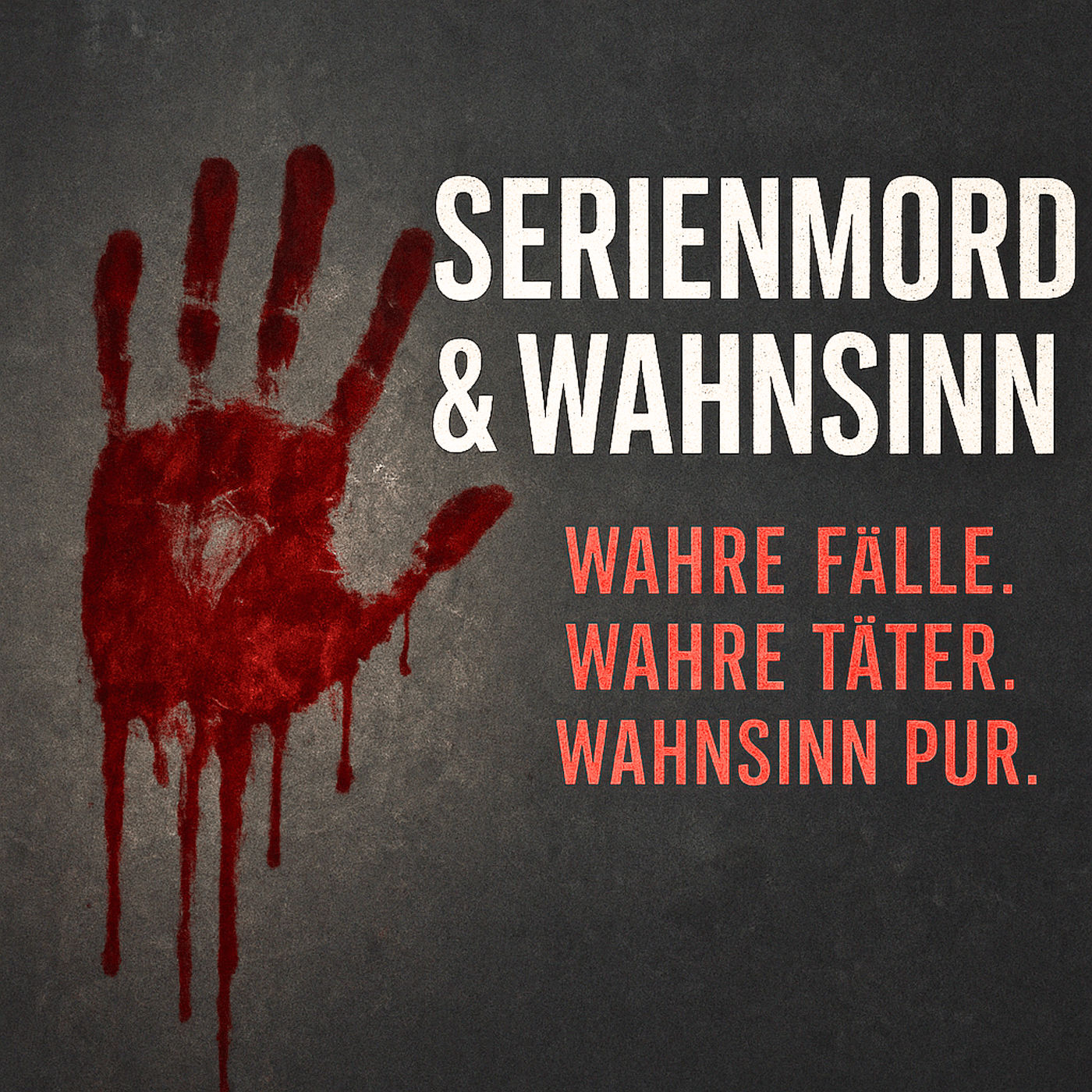---werbung---Schließe dich mir und 60 Millionen Nutzer*innen an, die Revolut lieben. Registriere dich mit dem Link unten: https://revolut.comMystery und Thriller auf Amazon Prime:https://amzn.to/4aeF1CE---werbung--- 1. Einstieg – Der verhängnisvolle Abend Am 27. Oktober 1990 war Graz in Nebel gehüllt. Die Straßen waren leer, nur das Brummen eines PKW durchbrach die Stille. Ein Mann stieg aus, zog seinen Mantel enger und ließ sein Blickfeld über die Fassade von Bordellhäusern und schmalen Wohnstraßen schweifen. Niemand ahnte, dass dies der Beginn einer neuen Mordserie sein würde. Der Mann war kein gewöhnlicher Straftäter: Er war gefeierter Autor, Talkshow-Gast und Symbol für Resozialisierung. Doch hinter dieser Fassade verbarg sich ein lange Zeit unentdeckter Serienmörder, dessen nächste Tat das öffentliche Bild eines „geläuterten Verbrechers“ zerstören sollte. 2. Hintergrund Täter & Opfer Johann „Jack“ Unterweger wurde am 16. August 1950 in Judenburg, Steiermark, geboren. Seine Kindheit war geprägt von Armut, Vernachlässigung und frühem Kontakt mit dem kriminellen Milieu. Die Mutter war mehrfach vorbestraft, der Großvater alkoholkrank. Schon als Jugendlicher geriet er regelmäßig mit dem Gesetz in Konflikt – Diebstähle, Einbrüche und sexuelle Übergriffe waren Teil seiner frühen Verfehlungen. 1974 wurde Unterweger erstmals wegen Mordes verurteilt: Er tötete die 18-jährige Margret Schäfer. Im Gefängnis begann er zu schreiben, verfasste Gedichte, Kurzgeschichten und eine Autobiografie. Seine Texte und öffentlichen Auftritte erzeugten ein neues Bild: der „geläuterte Straftäter“. Kulturschaffende feierten ihn als Beweis, dass Resozialisierung möglich sei. Nach 16 Jahren Haft wurde er 1990 auf Bewährung freigelassen. Medien und Intellektuelle nahmen seine Fassade unhinterfragt an – eine Entscheidung, die fatale Folgen haben sollte. Die Opfer seiner zweiten Mordserie waren überwiegend Frauen am Rande der Gesellschaft, oft Sexarbeiterinnen. Diese Auswahl reflektierte nicht nur seine eigenen Präferenzen, sondern auch gesellschaftliche Missachtung und Verletzlichkeit der Opfergruppe. 3. Tatserie / Tatablauf Nur wenige Monate nach seiner Entlassung begann Unterweger erneut zu töten. In Prag wurde die 30-jährige Blanka Bočková ermordet aufgefunden, erschlagen und stranguliert mit einem Unterwäschestück. Wochen später starb in Graz die 41-jährige Brunhilde Masser auf ähnliche Weise. Das Tatmuster war auffällig: Strangulation mit Kleidung, oft Unterwäsche, meist mit einem speziellen „Henkerknoten“. Die Ermittler registrierten die wiederkehrenden Elemente und versuchten, Bewegungsprofile zu erstellen, Kreditkarten- und Hotelrechnungen zu prüfen und Zeugen zu befragen. Unterweger führte ein Doppelleben: öffentlich als Journalist über Prostitution tätig, privat als Mörder unterwegs. Die Kombination aus medialer Präsenz, Intellekt und Charisma verschaffte ihm Freiheiten, die für die Fortsetzung der Mordserie entscheidend waren. Erst durch internationale Kooperationen konnte seine Spur verfolgt und seine Festnahme vorbereitet werden. 4. Ermittlungen Die Ermittlungen gestalteten sich schwierig. Unterweger reiste zwischen Österreich, Prag und den USA, was die Verknüpfung der Taten erschwerte. Indizien waren Hotelquittungen, Mietwagenbelege, Zeugenaussagen und forensische Spuren. 1992 wurde Unterweger in Miami von US-Marshals festgenommen und nach Österreich zurückgeführt. Dort begann ein umfassendes Ermittlungsverfahren, das sich über mehrere Jahre erstreckte. Das Ziel der Polizei war, die Verbindungen zwischen den Tatorten zu belegen und das Tatmuster zu analysieren, um eine lückenlose Beweiskette zu schaffen. 5. Prozess & Urteil Der Prozess begann am 20. April 1994 am Landesgericht Graz. Angeklagt waren neun Morde in Österreich, einer in Prag sowie weitere Morde in den USA. Die Beweisführung basierte auf Zeugenaussagen, Indizien, Bewegungsprofilen und dem erkennbaren Tatmuster. Unterweger präsentierte sich vor Gericht charismatisch und selbstbewusst. Doch das Urteil war eindeutig: neun Morde, lebenslange Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung. Nur wenige Stunden nach dem Urteil erhängte sich Unterweger in seiner Zelle – mit demselben „Henkerknoten“, den er bei mehreren Opfern verwendet hatte. 6. Rückwirkungen / Reflexion Der Fall Unterweger löste breite gesellschaftliche Diskussionen aus. Wie konnte ein medial gefeierter „geläuterter Autor“ unbemerkt weitermorden? Die Medienlandschaft hatte seine Rehabilitation zu früh gefeiert. Gleichzeitig zeigt der Fall die Anfälligkeit gesellschaftlicher Systeme, die Symbolik über kritische Prüfung stellen. Für die Kriminalistik wurde Unterweger zu einem Lehrstück: Tatmusteranalyse, Profiling, internationale Zusammenarbeit, und die Bedeutung der Medieninszenierung eines Täters. Die Opfer waren meist marginalisiert, ihre Stimmen und Leben wurden lange übersehen. Die Geschichte lehrt: Vertrauen in Resozialisierung muss kritisch überprüft werden, und öffentliche Fassade kann tödlich trügen.