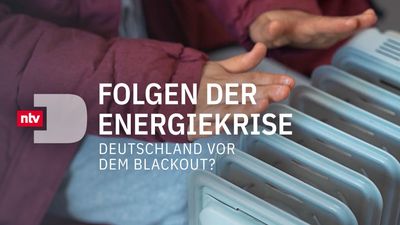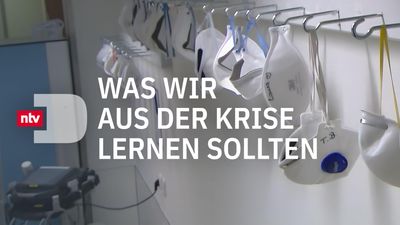Alles klar!? Wasser in der Krise
Was bedeuten steigende Temperaturen, Starkregen und extreme Trockenheit einer fortschreitenden Klimakrise für das Leben der Menschen? Welche Herausforderungen stellen sich für die Umwelt, aber auch für die Wirtschaft? Wie wirkt sich die Klimakrise auf den natürlichen Wasserhaushalt vor Ort aus? Wird es künftig noch genügend Wasser für alle Bedarfe geben und wie wird sich unser Leben verändern? Welche politischen Weichenstellungen sind jetzt regional und global nötig, um die immer weiter an Dynamik gewinnende Klima- und Wasserkrise abzubremsen? Welche Anpassungen werden nötig sein, um in Zeiten massiver Wetterextreme zu (über)leben? Diese und viele weitere Fragen rund ums Wasser stellen wir Expert*innen! Der Podcast ist neben der Ausstellung "Alles im Fluss!? Wasser in der Krise" und einem umfangreichen Online-Dossier Bestandteil eines umfassenden Informationsangebots rund um das Thema Wasser. Sie finden es hier: www.weiterdenken.de/de/wasserausstellung
Alle Folgen
Elbe: Zwischen Flusslandschaft und Schifffahrtsstraße
Die Elbe in Mitteleuropa ist eine der letzten naturnahen Flusslandschaften: Auf rund 600 Kilometern - zwischen der letzten Staustufe in Tschechien und der Staustufe in Geesthacht bei Hamburg - kann sie frei fließen. Hoch- und Niedrigwasser formten hier vielfältige Lebensräume für teils bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Doch in Zeiten einer fortschreitenden Klimakrise und des rasanten Artensterbens steht die Elbe unter enormem Druck, der durch die menschliche Nutzung des Flusses noch verstärkt wird. So werden für die kaum noch existente Schifffahrt weiter intensive Baumaßnahmen an der Elbe durchgeführt, die der Flusslandschaft schaden und viel Geld verschlingen. Wir sprachen mit Iris Brunar, langjähriger BUND-Elbeexpertin, wie es anders ginge. Der Podcast ist neben der Ausstellung "Alles im Fluss!? Wasser in der Krise" und einer umfangreichen Online-Themensammlung Bestandteil eines umfassenden Informationsangebots rund um das Thema Wasser. Sie finden es hier: https://www.weiterdenken.de/de/wasserausstellung
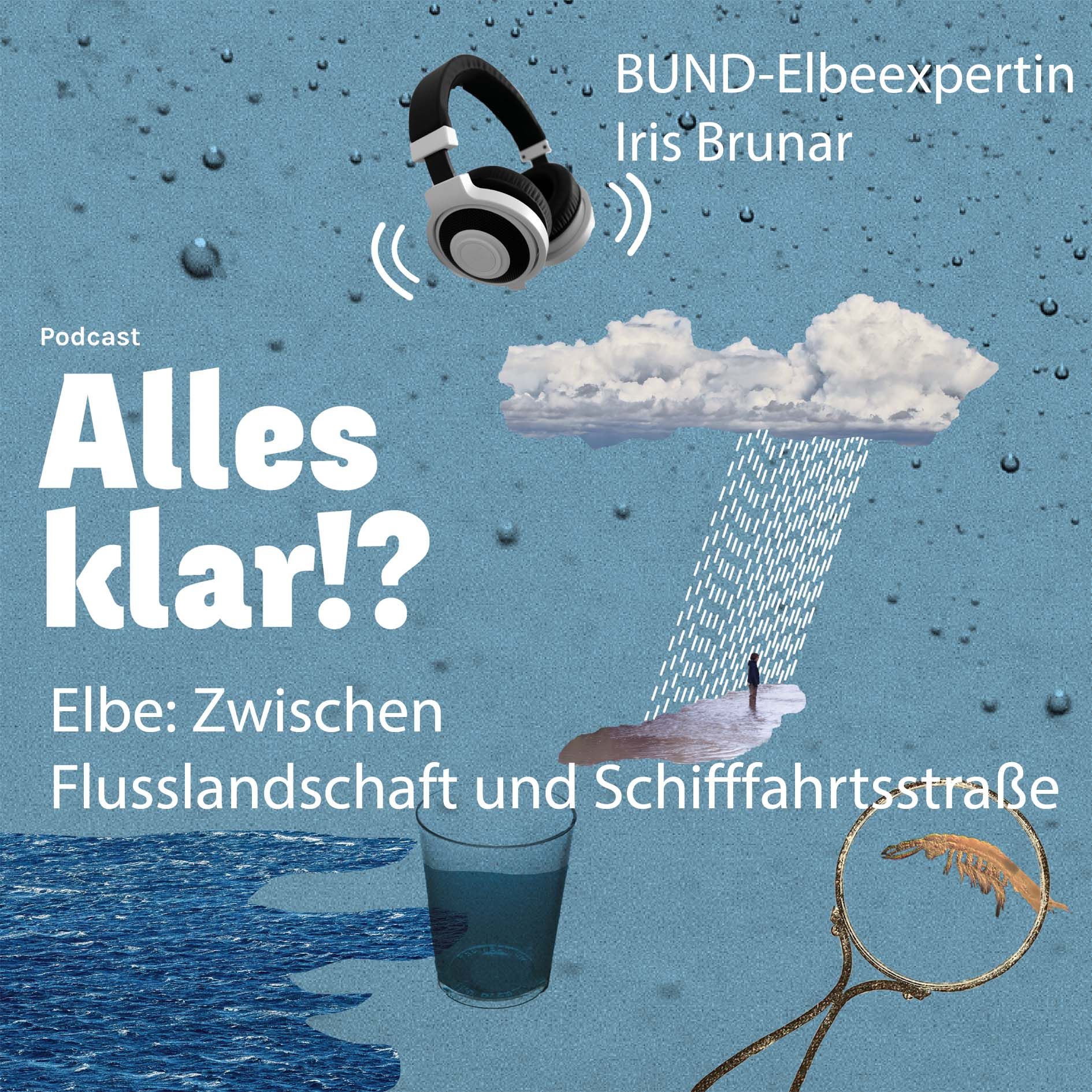
Im Umbruch: Seen, Tümpel, Talsperren in der Klimakrise
Steigende Temperaturen, ausbleibende oder extreme Niederschläge in Folge der fortschreitenden Klimakrise führen in unseren Seen, Teichen und Talsperren zu sichtbaren Veränderungen. Sie kommen zu den Belastungen etwa durch Dünger, Pestizide und Schadstoffe sowie menschliche Nutzung noch hinzu. Von A wie Arteninventare über E wie energetische Nutzung bis Z wie Zuflüsse: Mit Prof. Karsten Rinke, Leiter des Departments Seenforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg, sprachen wir über Gewässer in der Klimakrise. Shownotes: Department Seenforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magedeburg: www.ufz.de/index.php?de=34221 weiterführende Infos zu Seen in der Klimakrise: www.weiterdenken.de/de/seen-und-teiche-not Brandenburger Seenreport 2024 des BUND: https://www.bund-brandenburg.de/service/presse/pressemitteilungen/news/bund-seen-in-brandenburg-akut-gefaehrdet/ verschriftlichtes Interview und Infos zu Prof. Karsten Rinke: https://www.weiterdenken.de/de/2024/08/09/im-umbruch-seen-tuempel-talsperren-der-klimakrise Der Podcast ist neben der Ausstellung "Alles im Fluss!? Wasser in der Krise" und einem umfangreichen Online-Dossier Bestandteil eines umfassenden Informationsangebots rund um das Thema Wasser. Sie finden es hier: www.weiterdenken.de/de/wasserausstellung

Wasser und Wirtschaft: Abrücken vom Green Deal wäre falsch
Durch Verbrauch und Nutzung von Wasser beeinflussen Unternehmen sowohl die Menge des zur Verfügung stehenden Wassers, als auch dessen Qualität. Darüber hinaus werden bei Anbau, Herstellung, Transport und Entsorgung von Gütern Treibhausgase ausgestoßen. Diese befeuern die Klima- und damit auch die Wasserkrise zusätzlich. Wir sprachen mit Uwe Ritzer, Autor des Buches "Zwischen Dürre und Flut", Wirtschaftskorrespondent der Süddeutschen Zeitung und Investigativ-Journalist über neue Wege im Umgang mit der Ressource Wasser und über die Bedeutung der anstehenden Europawahl für nachhaltiges Wirtschaften.

Dresden: Stadt der "durstigen" Industrie
Dürre und Flut lagen in den vergangenen 20 Jahren in Dresden dicht beieinander und sind bis heute eine große Herausforderung für die Stadt. Auf die Fluten 2002, 2006 und 2013 folgten extrem wenig Elbewasser, absinkende Grundwasserstände und ausgetrocknete Bäche in den Jahren 2018, 2019, 2020 und 2022. Mit Dresdens Umweltbürgermeisterin, Eva Jähnigen, sprachen wir über wassersensible Stadtplanung in einer fortschreitenden Klimakrise. Wie wird Dresden konkret vorbereitet auf Starkregen, Dürre und extreme Temperaturen mit Rekorden von über 39 Grad? Was können Bürger*innen selbst tun? Warum wird Dresden ein neues Flusswasserwerk bauen und was hat das mit dem steigenden Wasserbedarf der Industrie zu tun?

Probleme für die Ewigkeit: Kohleabbau und Wasser
Die negativen Auswirkungen des Kohleabbaus sind breit diskutiert. Doch neben dem Verlust von fruchtbarem Land, der Zerstörung intakter Ökosysteme sowie menschlicher Siedlungen und der globalen Erwärmung gibt es einen Aspekt des Kohletagebaus, der häufig weniger beleuchtet wird: Die weitreichenden Beeinträchtigungen des Wasserhaushalts! Durch den Kohleabbau wurde und wird massiv in den Wasserhaushalt eingegriffen: Flüsse werden verlegt, enorme Mengen an Grundwasser aus dem Boden gepumpt. Doch auch nach dem Kohleaus müssen wir uns mit Wasserfragen weiter beschäftigen: Wie wird aus einem Tagebaurestloch eigentlich eine Bergbaufolgelandschaft? Was sind die Vor- und Nachteile einer Flutung von Löchern und wie können diese komplexen Prozesse möglichst nachhaltig und gerecht gestaltet werden? Über all das sprechen wir mit Dr. Mareike Pampus. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin sowohl am Institut für Strukturwandel und Nachhaltigkeit sowie an der Martin-Luther-Universität in Halle. Sie beschäftigt sich in ihrer Forschung insbesondere mit Bergbaufolglandschaften, Rekultivierungen und den zugrunde liegenden Naturverständnissen.
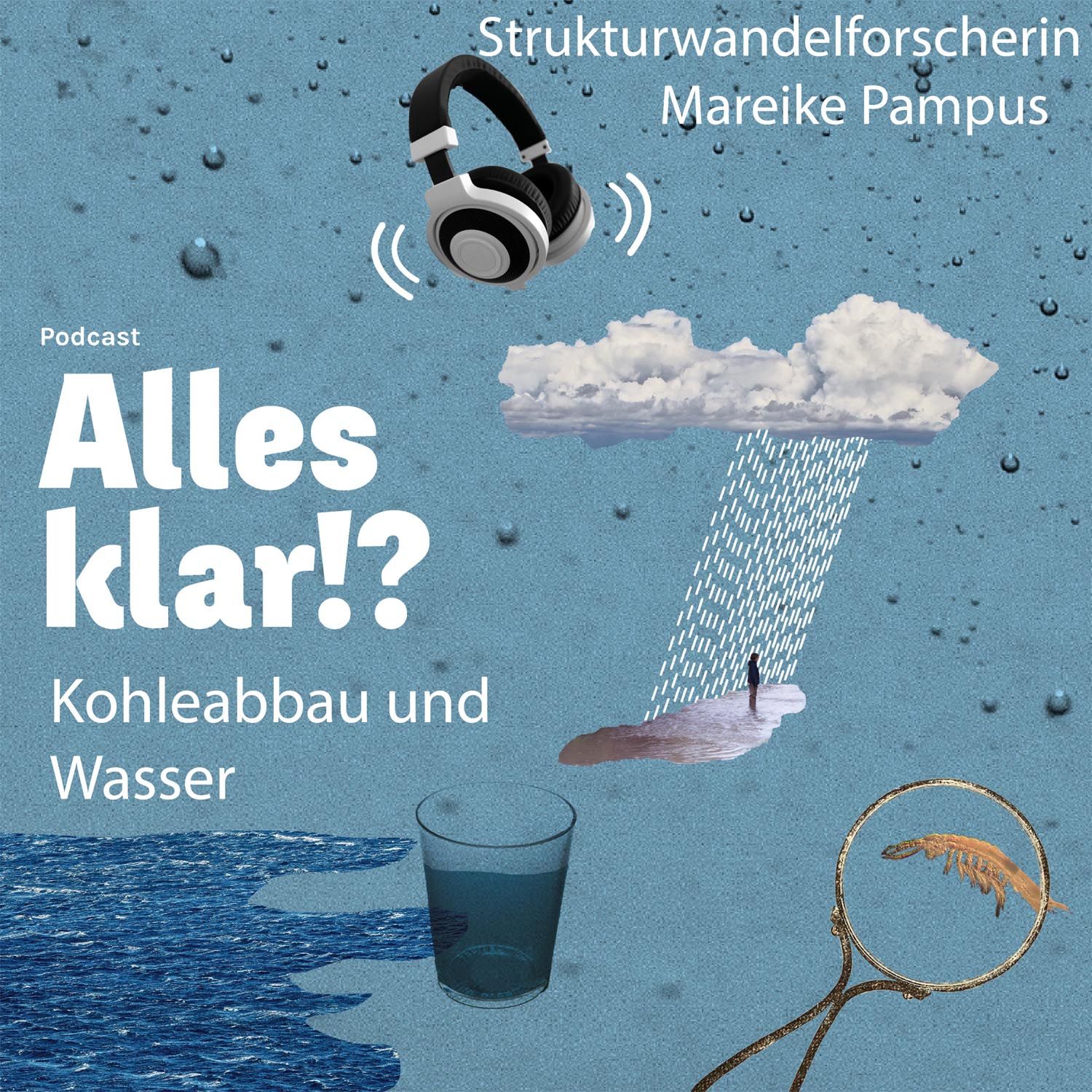
Plastik: Gefahr für unser Wasser
Im Gespräch mit der Meeresbiologin Dr. Rosanna Schöneich-Argent besprechen wir, was das Tempolimit mit Mikroplastik zu tun hat. Wir erfahren mehr über die Verschmutzung unserer Gewässer und was wir dagegen tun können.

Wasser und Landwirtschaft: Brunnen lösen das Problem nicht
Nachhaltig landwirtschaftlich produzieren in einem sich ändernden Klima? Das funktioniert! Wir sprachen mit Claudia Gerster vom Hof Sonnengut in Sachsen-Anhalt über den Umgang mit zunehmender Trockenheit, Starkregen und Wind.
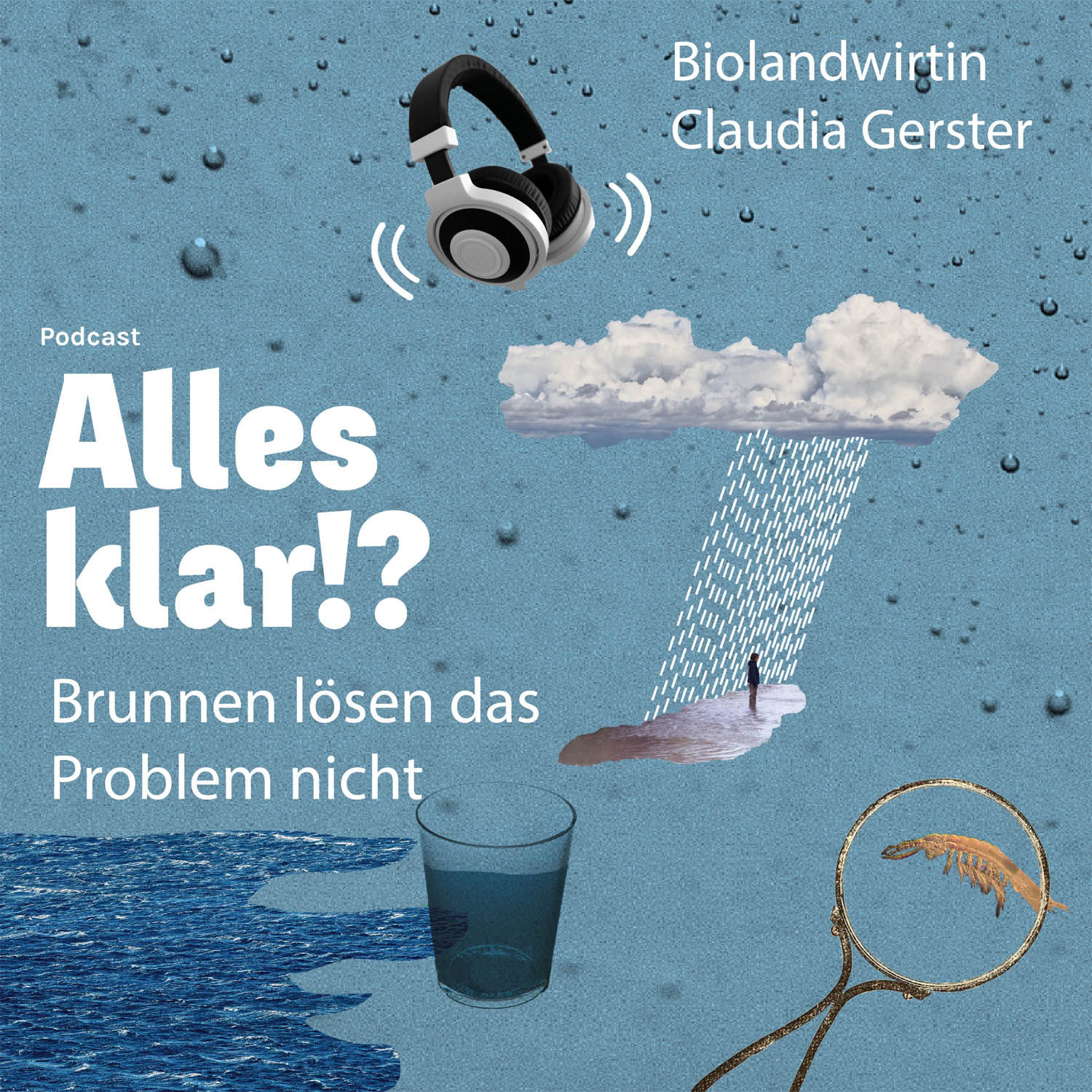
Wasser in der Stadt: Das Pilotprojekt Leipziger BlauGrün
In der Leipziger Innenstadt entsteht ein wasser- und energieeffizientes Viertel mit über 2.000 Wohnungen. Ein Ziel ist, das Regenwasser im Quartier zu speichern. Es versorgt das Grün mit Wasser und hilft so, ein angenehmes Klima für die Bewohner*innen zu schaffen. Die Kanalisation wird entlastet. Wir sprachen mit dem Projektleiter Prof. Roland Arno Müller vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) Leipzig und erfahren mehr über blaugrüne Quartiers- und Stadtplanung anhand des konkreten Pilotprojekts.

The North Drift: Plastikmüll aus Deutschland in der Arktis
Steffen Krones ist Filmemacher. Eine Reise weit in den Norden von Norwegen hat den gebürtigen Dresdner zu seinem Dokumentarfilm „The North Drift“ angeregt. Fasziniert von der Natur der Lofoten stieß er in dem arktischen Paradies immer wieder auf Plastikmüll, auch aus Deutschland. Kann es wirklich sein, dass unser Müll in der Arktis angespült wird? Mit sogenannten Driftern vollzieht er die Reise von Plastik aus Dresden bis nördlich des Polarkreises nach. Entstanden ist dabei nicht nur ein für die Wissenschaft interessantes Werk, sondern auch ein unterhaltsames Lehrstück für uns alle! Wir sprachen mit ihm über Plastik, seine Recherchen und Erlebnisse sowie seinen Film.

Für unser Wasser: Von der Nadelkultur zum Mischwald
Im Juli 2022 trafen wir die Waldökologin Dr. Tanja Sanders auf einer Forschungsfläche im brandenburgischen Britz. Wir sprachen mit ihr, wie ihre Erkenntnisse für die gezielte Neubildung von Grundwasser als auch für die Prävention von Waldbränden nutzbar gemacht werden können. Tanja Sanders arbeitet beim Thünen-Institut auf und mit einer Forschungsfläche in Britz. Hier wachsen unterschiedliche Baumarten, nach Arten getrennt bzw. gemischt. Weit unter den Wurzeln der Bäume wird das versickernde Wasser von so genannten Lysimetern aufgefangen und gemessen. So lässt sich feststellen, welche Bäume wie viel Wasser versickern lassen und damit zur Neubildung von Grundwasser beitragen: In Zeiten zunehmender Dürre und sinkender Grundwasserstände ein extrem wichtiger Faktor, wenn es um die Gestaltung heutiger und künftiger Wälder und Forste geht. Aber auch für die Prävention von Waldbränden lassen sich ihre Erkenntnisse nutzen.

Grundwasser: lebenswichtig
Weiterdenken 161 Follower161 318 Tracks318 Über 70 Prozent unseres Trinkwassers gewinnen wir aus Grundwasser in Deutschland. Doch Grundwasser ist nicht nur für uns lebenswichtig! Mit Wasser in oberen Bodenschichten versorgen sich Pflanzen. Grundwasser hält Lebensräume in Oberflächengewässern am Leben. Aber auch das Grundwasser selbst bietet zahlreichen Tieren und Mikroorganismen einen - wenn auch kargen - Lebensraum. Doch ausbleibende Niederschläge und ein hoher Wasserbedarf lassen Grundwasserspiegel absinken. Einträge aus der Landwirtschaft - etwa Dünger und Pestizide -, Industrie und Verkehr verschmutzen das Grundwasser. Durch Klimakrise und menschliche Nutzung verändern sich die Temperaturen in dem sensiblen Lebensraum. Wir sprachen mit dem Gewässerökologen Hans Jürgen Hahn über die aktuellen Gefahren für unser Grundwasser und Wege, das lebenswichtige Wasser wirksam zu schützen.