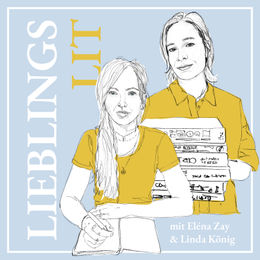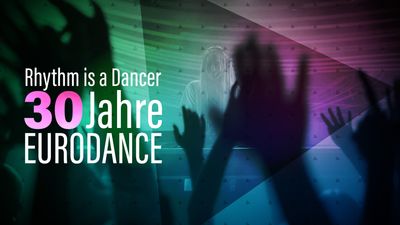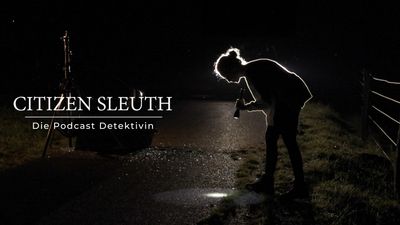Musiker:innen, die plötzlich gute Romane veröffentlichen. Autor:innen, deren Bücher wie guter Rap klingen. Aufregende Bücher, die ein größeres Publikum verdient hätten. Neuerscheinungen, an denen kein Weg vorbei führt. Interviews zwischen Bookstagram-Nerdtum und Deep-Talk. All das gibt es jede Woche neu im „Buch zur Woche“ vom Popkultur-Magazin DIFFUS. Moderation: Daniel Koch und Celine Leonora
Alle Folgen
Die (vorerst) letzte Folge!
Im April 2021, inmitten der Pandemie, startete unser Redakteur Daniel Koch den DIFFUS-Podcast „Buch zur Woche“ und stellte ab da bis heute wirklich fast jede Woche ein neues Buch vor. Es dauerte nicht lange, da gab es auch die ersten Interviewfolgen. Es kamen spannenden Autor:innen aus Deutschland, der Schweiz, England, Japan und Mexiko und natürlich viele Buch schreibende Musiker:innen. Vor gut zwei Jahren ergänzte dann BookTokerin Celine Leonora das Team und brachte im Wechsel mit Daniel ebenfalls spannende Interviewpartner:innen mit – und nochmal einen neue Literaturfarbe hinein. Mit dieser gemeinsam moderierten Folge, in der sich die beiden noch einmal ihre Lieblingsbücher an den Kopf werfen und einen kleinen Ausblick auf 2025 geben, endet der Podcast „Buch zur Woche“ fürs Erste in seiner gewohnten Form. Warum, das erfahrt ihr im Gespräch. Aber: Buchtipps wird es in naher Zukunft bei DIFFUS weiterhin auf der Website, bei Insta und bei TikTok geben – und vielleicht wird Daniel hin und wieder auch noch ausgewählte Interviewfolgen bringen. So ganz geht das Buch zur Woche also noch nicht … In diesem Sinne: Vielen Dank fürs Zuhören über die Jahre – und vielleicht bis bald an anderer Stelle!

„Deutschrap war ein kommerzielles Produkt“ – die Autoren von „Remix Almanya“ im Interview
In dieser Interviewfolge spricht unser Host Daniel mit den Autoren Murat Güngör und Hannes Loh, die im Herbst das Buch „Remix Almanya – Eine postmigrantische HipHop-Geschichte“ im Hannibal Verlag veröffentlicht haben. Es ist bereits ihr zweites gemeinsames Buch. Schon vor gut 20 Jahren schrieben sie „Fear Of A Kanak Planet“ – was im Titel natürlich eine Referenz an „Fear of a Black Planet“ von Public Enemy ist. Das Buch sorgte durchaus für Diskussionen. Murat und Hannes wurden damals „als linke Nestbeschmutzer“ gesehen, wie sie uns erzählten, weil sie inmitten des Rap-Booms in Deutschland die wunden Punkte ansprachen: Zum Beispiel, dass der so genannte „Deutschrap“ seine postmigrantischen Wurzeln verleugnete, die Industrie das Genre weißwaschen wollte und einige Rap-Acts nationalistische Strömungen aufgriffen. Hannes Loh und Murat Güngör waren aber nicht nur Rap-Forschende und über Rap schreibende, sie waren selbst in der Szene aktiv. Hannes war zum Beispiel Rapper der linken Crew Anarchist Academy. Murat Güngör wiederum war Ende der 90er Teil des Netzwerks Kanak Attack, dessen Allstar-Single „Dieser Song gehört uns“ ein wichtiger Meilenstein des postmigrantischen Raps in Deutschland ist. Heute sind die beiden übrigens Lehrer – und sie touren seit Jahren immer wieder durch die Lande, um über ihre Rap-Forschung und ihre persönliche Geschichte zu referieren. In ihrem neuen Buch „Remix Almanja“ werfen Murat und Hannes wieder einen sehr interessanten und abwechslungsreichen Blick auf postmigrantischen Rap in Deutschland. In kurzen Essays und sehr spannenden Interviews zeichnen sie ein Bild von Rap-Deutschland, das man in dieser Komplexität selten zu lesen bekommt. Dass sie damit perfekt zu DIFFUS und in diesen Podcast passen, merkt man schon daran, dass im Buch viele Menschen auftauchen, die auch wir regelmäßig featuren. Miriam Davoudvandi sagt zum Beispiel sehr schlaue Dinge, Apsilon ebenso und Megaloh gibt ein geradezu herzzerreißendes Interview. Wenn ihr nach diesem Interview neugierig geworden seid: zwei Live-Termine von Murat und Hannes stehen in naher Zukunft an. Am 1. Februar sind sind im Bürgerzentrum Ehrenfeld in Köln und dann 27. April im SO36 hier in Berlin-Kreuzberg.
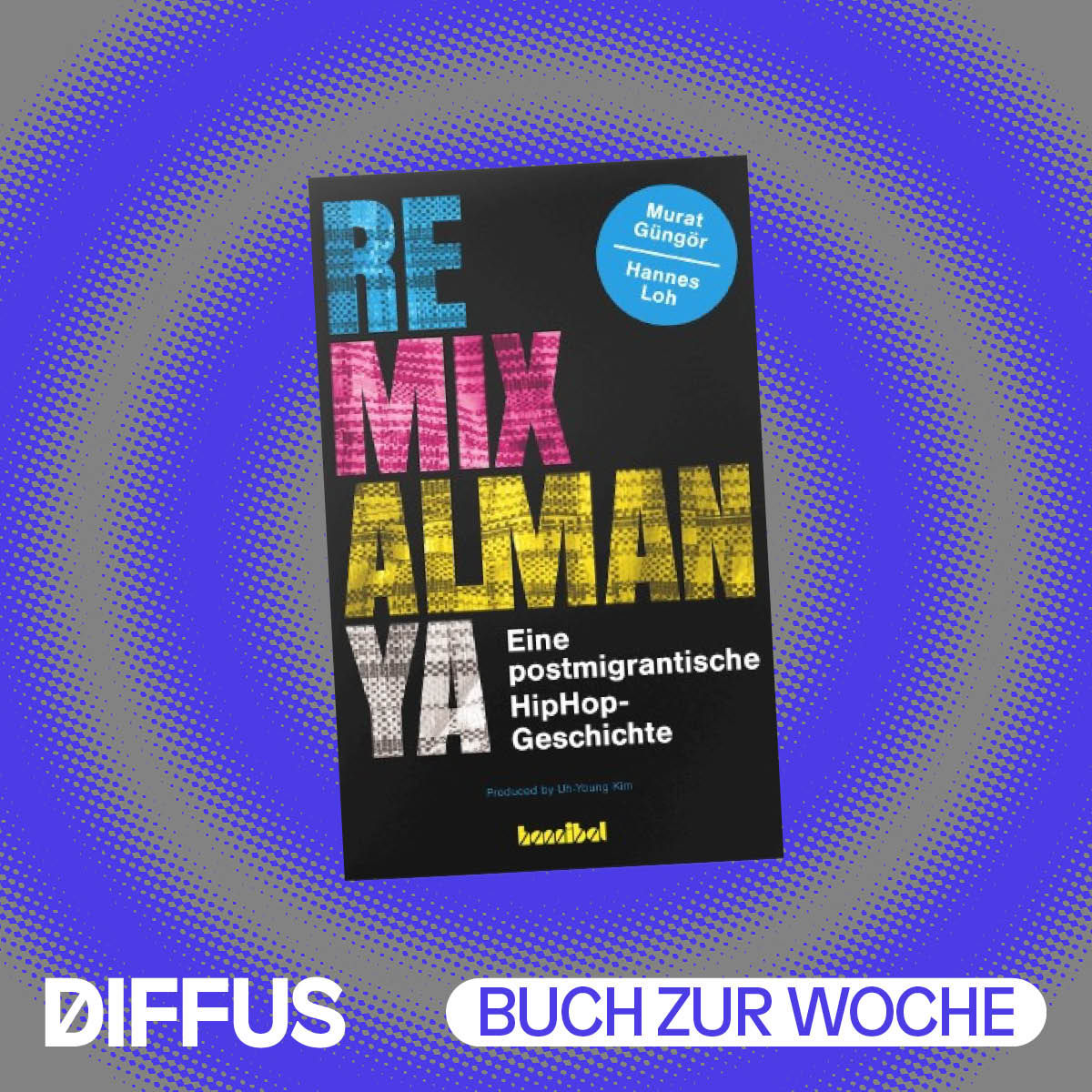
Lea Ruckpaul sagt „Bye Bye Lolita“ und gibt ihr eine starke Stimme
Trigger-Warnung: In dieser Folge geht es auch um den Roman „Lolita“ von Vladimir Nabokov – und das bedeutet eben nicht, dass es um eine Liebesgeschichte geht, sondern um Pädophilie und sexuelle Gewalt. Hört ihn also nur, wenn ihr euch diesen Themen gewappnet fühlt. Die Schauspielerin und Autorin Lea Ruckpaul erzählt die Geschichte der Dolores Haze, die viele aus dem Skandalroman „Lolita“ von Vladimir Nabokov aus dem Jahr 1955 kennen. Im originalen Roman wird man gezwungen, den wohl formulierten und verdrehten Erinnerungen des pädophilen Vergewaltigers Humbert Humbert zu lauschen, der uns weis machen will, dass wir da einer Liebesgeschichte lauschen. Dabei ist er ein Täter – und zerstört das Leben der 12jährigen Dolores Haze, die er „Lolita“ nennt. Die Dolores in „Bye Bye Lolita“ schreibt nun ihre eigene Sicht auf die Geschehnisse auf – und sie hat Humbert Humberts Tagebuch in ihrem Besitz, dem sie ihren Text entgegensetzen will. Lange Zeit traut sie sich jedoch nicht, Humberts Worte zu lesen. Erst im letzten Drittel des Buches wagt sie diesen Schritt. Und fragt sich unter anderem: „Suchte er all diese manierierten Worte, die duftigen Ausdrücke, um vor sich selbst zu verbergen, dass er Gewalt ausübte? Wie passt die schmonzettige Verehrung von ‚Lolita‘ zusammen mit der Respektlosigkeit, mit der er mich behandelte?“ Für Ruckpauls Dolores – die Ende dreißig ist, als sie mit dem Schreiben beginnt – ist das Schreiben eine Trauma-Therapie und eine Selbstermächtigung. Sie will kein Opfer sein. „Beim Schreiben kann ich die Dosis des Schmerzes regeln“, heißt es in Ruckpauls Roman.

Lieblingsbuch: Warum nicht „Rubinrot“ von Kerstin Gier rereaden?
Juhu, endlich wieder eine Lieblingsbuchfolge! Und dieses Mal hat Celine für euch ein echtes „Juwel“ ihrer Jugend: „Rubinrot“ von Kerstin Gier. Dieses Buch gehört zur „Edelsteintrilogie“ und wurde sogar schon verfilmt. Es geht um die junge Gwendolyn, die zu ihrem Entsetzen feststellen muss, dass sie das Zeitreise-Gen in ihrer Familie geerbt hat und nicht ihre Cousine Charlotte. Um zu verhindern, dass sie wahllos durch die Zeit springt und dabei eventuell verletzt wird, muss sie sich einer Geheimloge anschließen, die jedoch einen fanatischen Plan verfolgt.
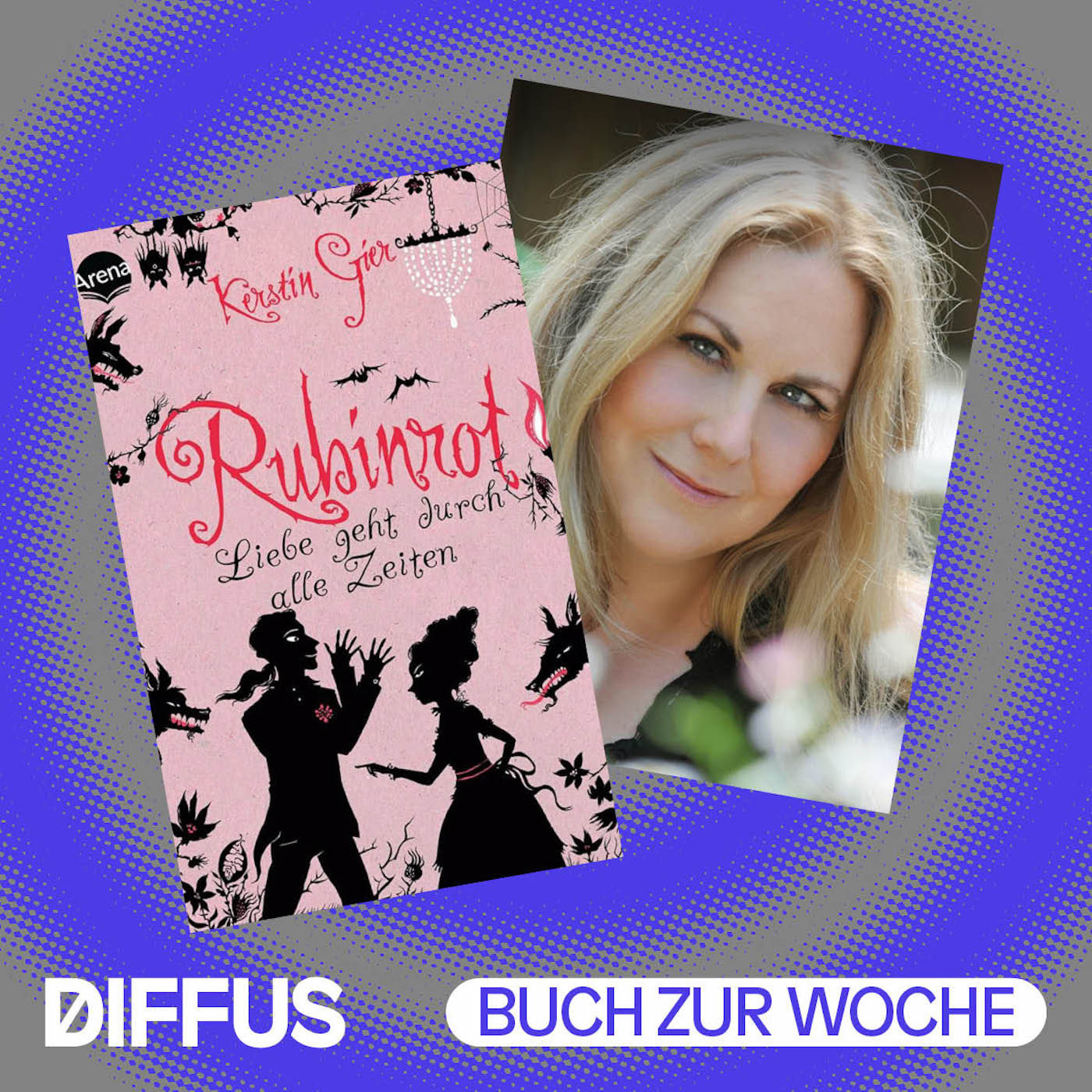
„Pleasure“ von Jovana Reisinger ist das Buch, das man Ikkimel zum Geburstag schenken kann
Daniel stellt euch heute „Pleasure“ von der Autorin, Filmemacherin und bildenden Künstlerin Jovana Reisinger vor. Kein klassischer Roman, sondern ein Essay, der allen gefallen dürfte, die den „Barbie“-Film gefeiert haben haben, Ikkimel hören, Karl Marx‘ „Das Kapital“ im Regal stehen haben und Paris Hilton als die clevere Geschäftsfrau erkennen, die sie ist. In dem 320-seitigen Essay geht es um Klasse, Arbeit, Luxus, Paris Hilton, gutes Essen, Carrie Bradshaw, Tussies und eben ihr „Pleasure“. Das Reisinger so definiert: „Pleasure steht für Genuss und Bedürfnisbefriedigung: eine Praline, das gute Obst, der Edelschmuck, die Freibadpommes, die Designerhandtasche, der Kuss, die geilen Heels, der Sonnenuntergang, die Umarmung, ein Käsebrot, die Postkarte aus dem Urlaub, der Urlaub, die Berührung, das ausgeschlafene, erholte Aufwachen, der richtige Satz, das merkwürdige Ereignis, die ergreifende Kunst, der alles verschlingende Sex.“ Das wollen wir doch auch!
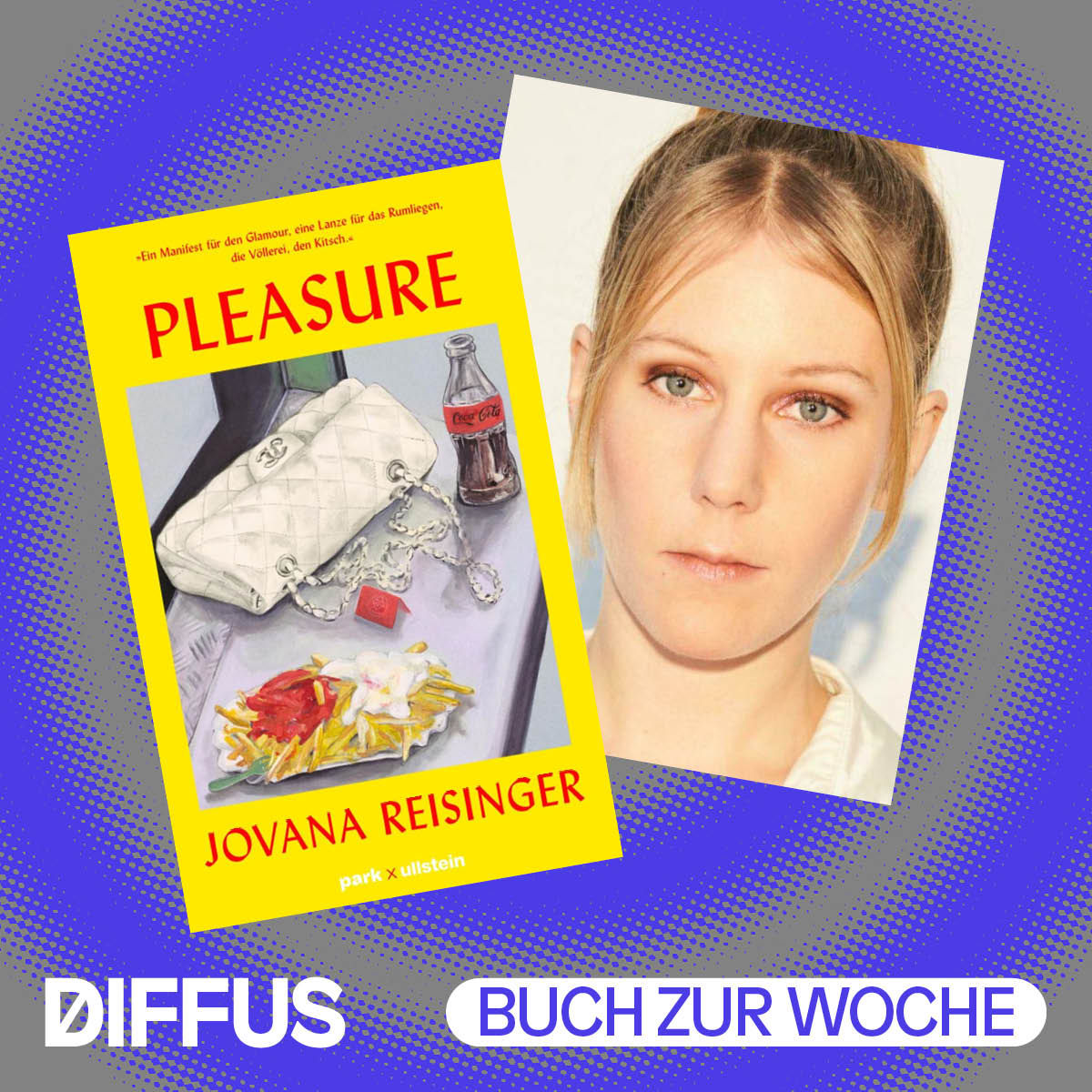
Winterliche Leseliste: Spannung, Grusel und Fantasy
Eine neue Folge von Celine Leonora und diesmal hat sie sogar gleich drei Bücher dabei, die sie für die Winterzeit empfiehlt. Da ist alles dabei von Romantasy, über Fitzek hin zu einem Sammelband mit schaurigen Wintergeschichten. Perfekt, um mit einer Decke auf's Sofa zu kuscheln und die dunkle Welt außerhalb der eigenen vier Wände zu vergessen. Schaffen die Bücher es auch auf eure Leseliste?

„Nachtlichter“ von Amy Liptrot kommt bald als „The Outrun“ ins Kino
„Nachtlichter“ von Amy Liptrot, die Buchvorlage zum kommenden Kinofilm „The Outrun“, ist ein fantastisches Buch. Poetisch. Schmerzhaft. Wunderschön. Traurig. Niederschmetternd. Erhebend. Amy Liptrot erzählt darin von ihrer wilden Zeit als Studentin und Musikjournalistin in London, die schnell vom Euphorischen ins Suchtkranke kippt. Als sie merkt, dass sie die Kontrolle über ihr Leben verliert, beschließt sie, in ihre alte Heimat zu reisen – auf die schottischen Orkney-Inseln. Eine karge, von Fischerei, Landwirtschaft, Naturschutzgebieten, örtlichen Mythen, Landflucht und Seefahrt geprägte Inselgruppe. Dort trifft Amy auf ihre Mutter, die vor einigen Jahren zu Gott gefunden hat, und auf ihren charismatischen, psychisch kranken Vater. „Systemsprenger“-Regisseurin Nora Fingscheidt hat aus der Geschichte in enger Zusammenarbeit mit der Autorin den Film „The Outrun“ gemacht – mit Saoirse Ronan in der Hauptrolle, die damit schon jetzt als Oskar-Kandidatin gilt. Der Film startet am 5. Dezember 2024 in den deutschen Kinos – vorher oder nachher solltet ihr unbedingt auch das Buch lesen, das im btb-Verlag erschienen ist und zum Kinostart noch mal neu aufgelegt wurde.
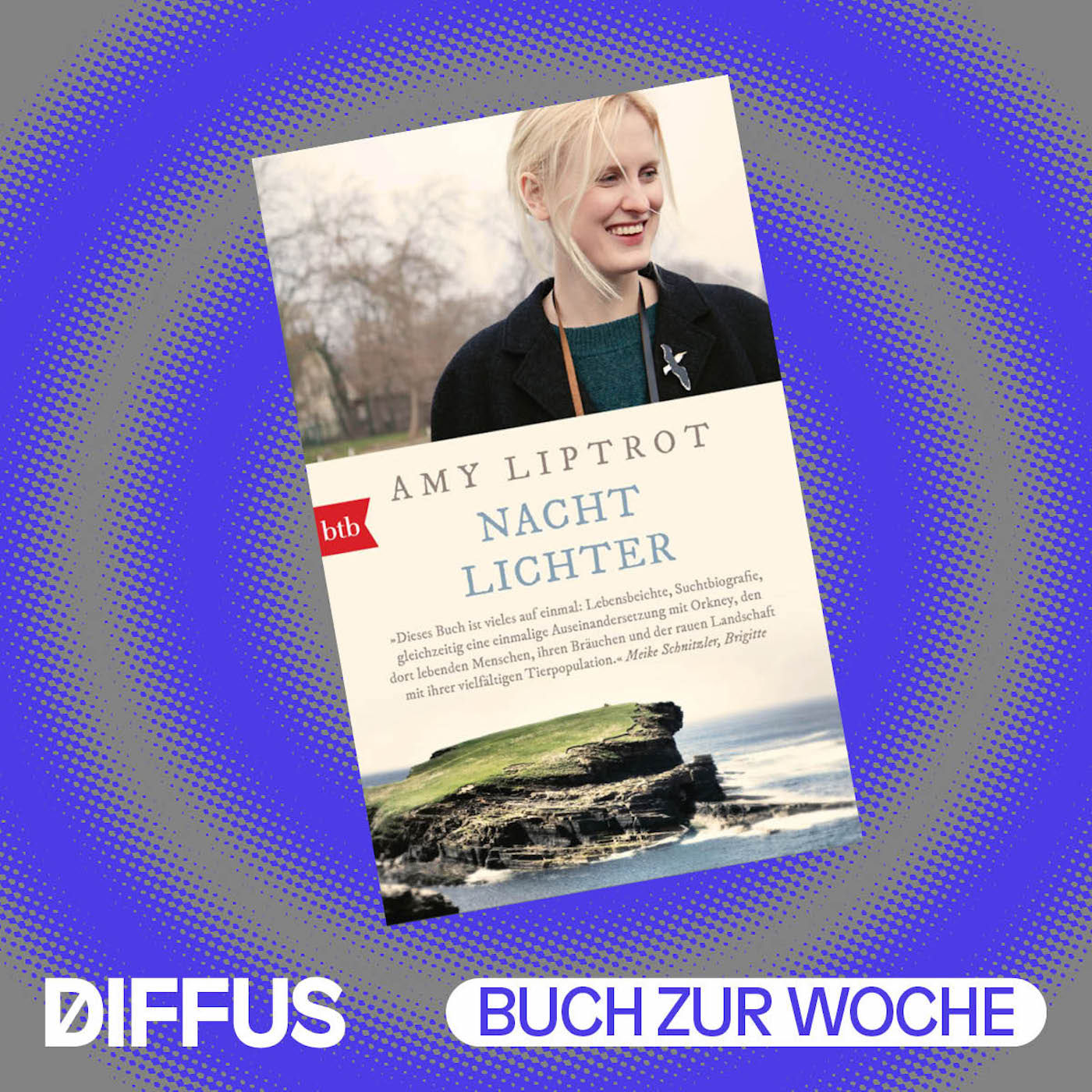
Lieblingsbücher: „Die roten Stellen“ von Maggie Nelson
Daniel stellt heut eines seiner Lieblingsbücher vor und findet: Wer sich für „True Crime“ interessiert, sollte „Die roten Stellen – Autobiographie eines Prozesses“ gelesen haben. Gerade weil die US-Autorin Maggie Nelson in ihrem autofiktionalen Text mit dem seltsamen Interesse hadert, das vor allem Verbrechen gegen Frauen entgegengebracht wird. Die Geschichte ist vor allem so bewegend, weil es hier um den Mord an Nelsons Tante geht. Jane Mixer wurde 1969 im Alter von 23 Jahren ermordet, lange bevor Maggie Nelson geboren wurde. Mixer wollte eines Abends per Anhalter fahren und wurde vermutlich von ihrem Mörder mitgenommen. Sie wurde mit zwei Kopfschüssen und einer Nylonstrumpfhose, die um ihren Hals gewickelt war, in Michigan gefunden. Vom Täter gab es jahrelang keine Spur. Der Mord wurde zum Cold Case. Maggie Nelson entdeckte als junge Frau die Tagebücher von Jane und fand sich in der selbstbestimmten, attraktiven, studierenden Frau ein Stückweit wieder. Sie spürte dem Trauma innerhalb ihrer Familie nach und verarbeitete diese Eindrücke in ihrem Gedichtband „Jane – A Murder“. Als sie den gerade veröffentlicht hatte, erfuhr ihre Familie, dass – mehr als 20 Jahre nach der Tat – ein vermeintlicher Mörder gefunden und zur Anklage gebracht wurde. Neue DNS-Analyse-Techniken machten das möglich. In „Die roten Stellen“ nimmt uns Maggie Rogers nun mit in diesen Prozess und erzählt anhand dieses privaten Schicksals, was sie am Umgang mit Frauenmorden und an der Faszination für True Crime verstört.
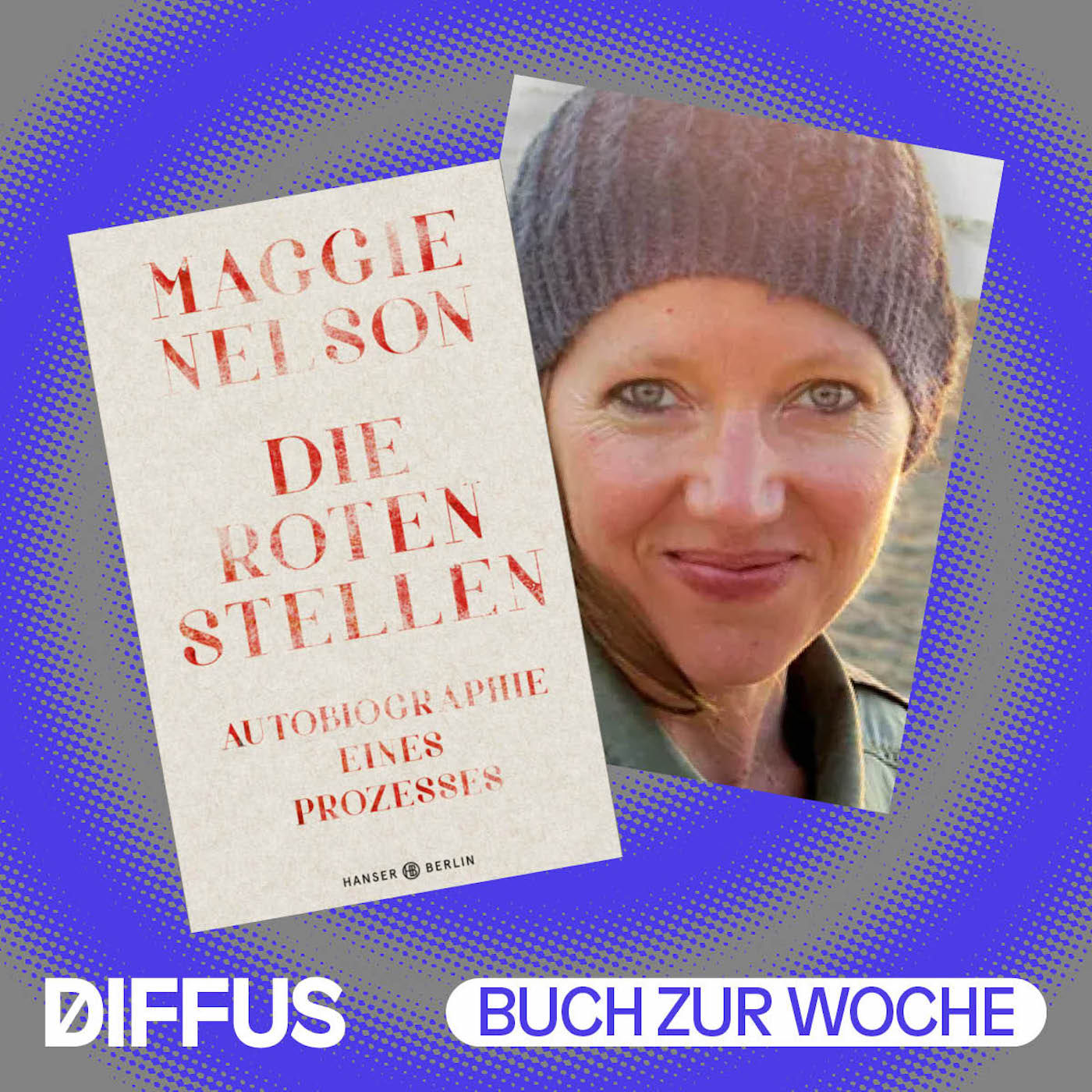
Lidia Yuknavitch hat ihr wildes Leben „In Wasser geschrieben“
In dieser Folge geht es um das Memoire „In Wasser geschrieben“ (btb Verlag, übersetzt von Claudia Max) von Lidia Yuknavitch, das im Original bereits 2010 veröffentlicht wurde und gerade unter der Regie von Kristen Stewart verfilmt wird. Im Englischen heißt es „The Chronology Of Water“. Das Buch taucht immer wieder mal auf, wenn man im feministischen Teil von Booktok unterwegs ist. Dort feiert man zurecht Yuknavitchs roughe, schonungslose Schreibe – und ist ebenfalls zurecht erstaunt über das Leben dieser Frau. Ein Leben, das von Missbrauch, Sucht, Selbstzerstörung und dem vernichtenden Verlust einer Fehlgeburt geprägt wurde. Trotz dieser Schicksalsschläge ist „In Wasser geschrieben“ aber eben kein Klagelied – im Gegenteil. Lidia Yuknavitch erzählt zwar mit aller Härte von diesen Erfahrungen, aber sie erzählt eben auch, wie sie durch das Schreiben und das Schwimmen ihren eigenen Weg fand, damit umzugehen. Dabei stilisiert sie sich aber nicht als Kämpferin, die alle Traumata niederringt, sondern erzählt ebenso offen von ihren Irrwegen, von dem Gefühl, Außenseiterin zu sein, von ihrer teilweise rücksichtslosen Suche nach einer erfüllenden Sexualität, die sie mal bei Männern, mal bei Frauen, mal bei trans Personen findet.
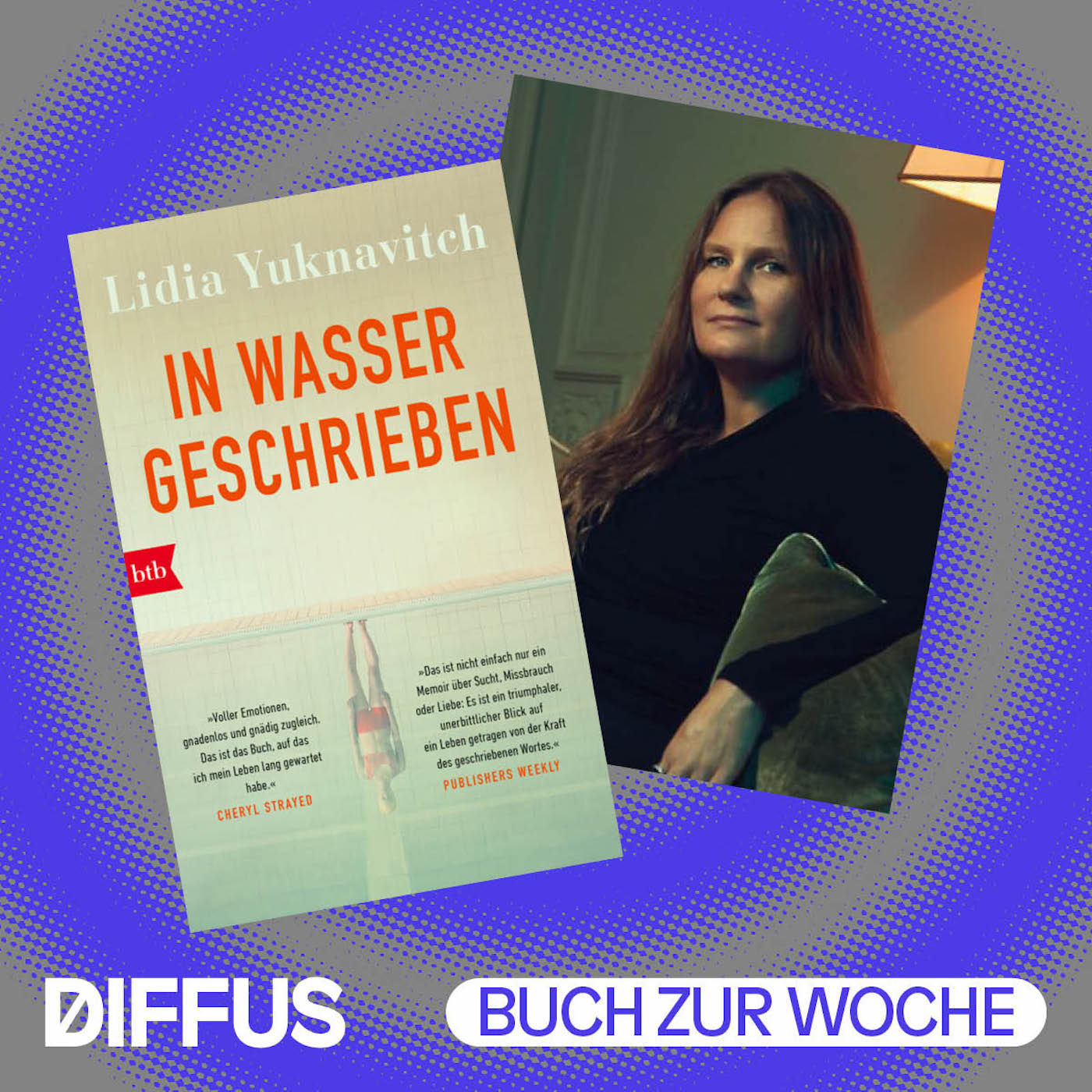
Tex Brasket und Christian Schlodder im Gespräch über „Dreck und Glitzer“
Host Daniel hat in dieser Folge mit Tex Brasket und Christian Schlodder gesprochen. Die haben gerade – zusammen, mit wechselnden Erzählperspektiven – das autobiografische „Dreck und Glitzer“ geschrieben, das letzten Freitag bei KiWi erschienen ist. Der Untertitel des Buches erklärt vielleicht etwas besser, worum es da geht: „Eine Geschichte von der Straße und vom Licht an dunklen Orten.“ Die beiden erzählen das Leben von Tex – und das war lange Zeit von einigen Härten geprägt. Er kämpfte mit der Drogensucht, lebte eine Weile auf der Straße – und musizierte oft an einer Fußgängerbrücke am S-Bahnhof Storkower Straße in Berlin. Diese Brücke hat den leidlich liebevollen Spitznamen „Der lange Jammer“. Dazu muss man wissen: Inzwischen ist Tex Brasket ein etablierter Musiker. Vor gut zwei Jahren kam die Punk-Instanz Slime auf die Idee, ihn als neuen Sänger an Bord zu holen und auch, wenn das den Die-Hard-Fans nicht gefällt: Seitdem sind Slime wieder spannender geworden. Und spielen weitaus größere Konzerte. Vor kurzem startete Tex mit Lucas Uecker von Liedfett das Projekt Teluxe. Die besondere Note des sehr vertrauten Gesprächs: Die erste Reportage über Tex schrieb Christian damals für das Magazin „Intro“, bei dem Daniel zu der Zeit Chefredakteur war. Im Talk geht es um die Herausforderung der Autofiktion, Tex‘ Rolle bei Slime, das Leben am Langen Jammer, die „Empathie der Straße, Tex‘ Verhältnis zum Ex-Sänger Dirk Jora alias Diggen, die lange und auch mal hitzige Freundschaft zwischen Christian und Tex und seine Pläne für die nahe Zukunft.

Thorsten Nagelschmidt im Gespräch über seinen neuen Roman „Soledad“
Unser Host Daniel spricht in dieser Folge mit Thorsten Nagelschmidt über seinen neuen Roman „Soledad“. Dieses Wort hat viele Bedeutungen: Es ist ein sehr konkreter Ort im Norden Kolumbiens und im Spanischen bedeutet es „Einsamkeit“. Der Roman ist gerade bei S. Fischer erschienen und der Nachfolger zum zu Recht gefeierte Episodenroman „Arbeit“. Thorsten Nagelschmidt könntet ihr auch aus einem anderen Kontext kennen: Er ist Sänger, Texter und Gitarrist bei Muff Potter, wo ihn viele noch als Nagel kennen. Im Mittelpunkt von „Soledad“ stehen zwei auf den ersten Blick sehr unterschiedliche Personen. Zum einen die queere Fotografin Alena, die in einer Lodge im kolumbianischen Soledad strandet. Eigentlich wollte sie dort nach einem Reportage-Job mit ihrer Freundin Sonja Urlaub machen, aber die beiden zerstreiten sich dermaßen, dass Sonja früher abreist und Alena beschließt, eine Weile allein in der „Tortuga Lodge“ zu bleiben. Dort ballert sie sich mit Benzos zu und lässt sich vom Hotelbesitzer Rainer aus seinem Leben erzählen. Das Buch mischt nun diese Kammerspiel-artigen Szenen, die Sonja als Ich-Erzählerin vermittelt, mit der schillernden Biografie des fast siebzigjährigen Rainers. Im diesem gut einstündigen Interview geht es um den Ort, der Thorsten zu dieser Geschichte inspirierte und wir erfahren, wie Alena und Rainer in sein Leben kamen, wie der Klassen-Aspekt in die Geschichte spielt und warum Thorsten ein BRD-Leben wie das von Rainer erzählen wollte. Thorsten Nagelschmidt ist außerdem ab Sonntag auf großer Lesetour. Und zwar hier: 13.10.2024 Mainz, 3sein 14.10.2024 Darmstadt, Centralstation 15.10.2024 Essen, VERLEGT von der Zeche Carl in den LeseRaum Akazineallee (Tickets behalten ihre Gültigkeit) 16.10.2024 Düsseldorf, zakk 17.10.2024 Hamburg, Centralkomitee 18.10.2024 Frankfurt, Kunstverein (OpenBooks, Buchmesse) 19.10.2024 Osnabrück, Lagerhalle 20.10.2024 Münster, Pension Schmidt 22.10.2024 Bielefeld, Bunker Ulmenwall 23.10.2024 Lemwerder, Begu 24.10.2024 Kiel, Studio 28.10.2024 Dresden, Schauburg 29.10.2024 Jena, Kassablanca 30.10.2024 Wiesbaden, Schlachthof 31.10.2024 Enkirch, Weingut Immich Anker 09.11.2024 Erlangen (book:ed Literaturfestival) 10.11.2024 Karlsruhe, P8 14.11.2024 Lübeck, Burgtor 16.11.2024 Weissenhäuser Strand (Rolling Stone Beach) 17.11.2024 Rostock, Peter Weiss Haus 18.11.2024 Erfurt, Buchbar 19.11.2024 Leipzig, Werk 2 20.11.2024 Göttingen, Musa 21.11.2024 Köln, Agnes Buchhandlung 22.11.2024 Stuttgart, Merlin 23.11.2024 Zürich, Kapitel 10 24.11.2024 München, Bellevue di Monaco
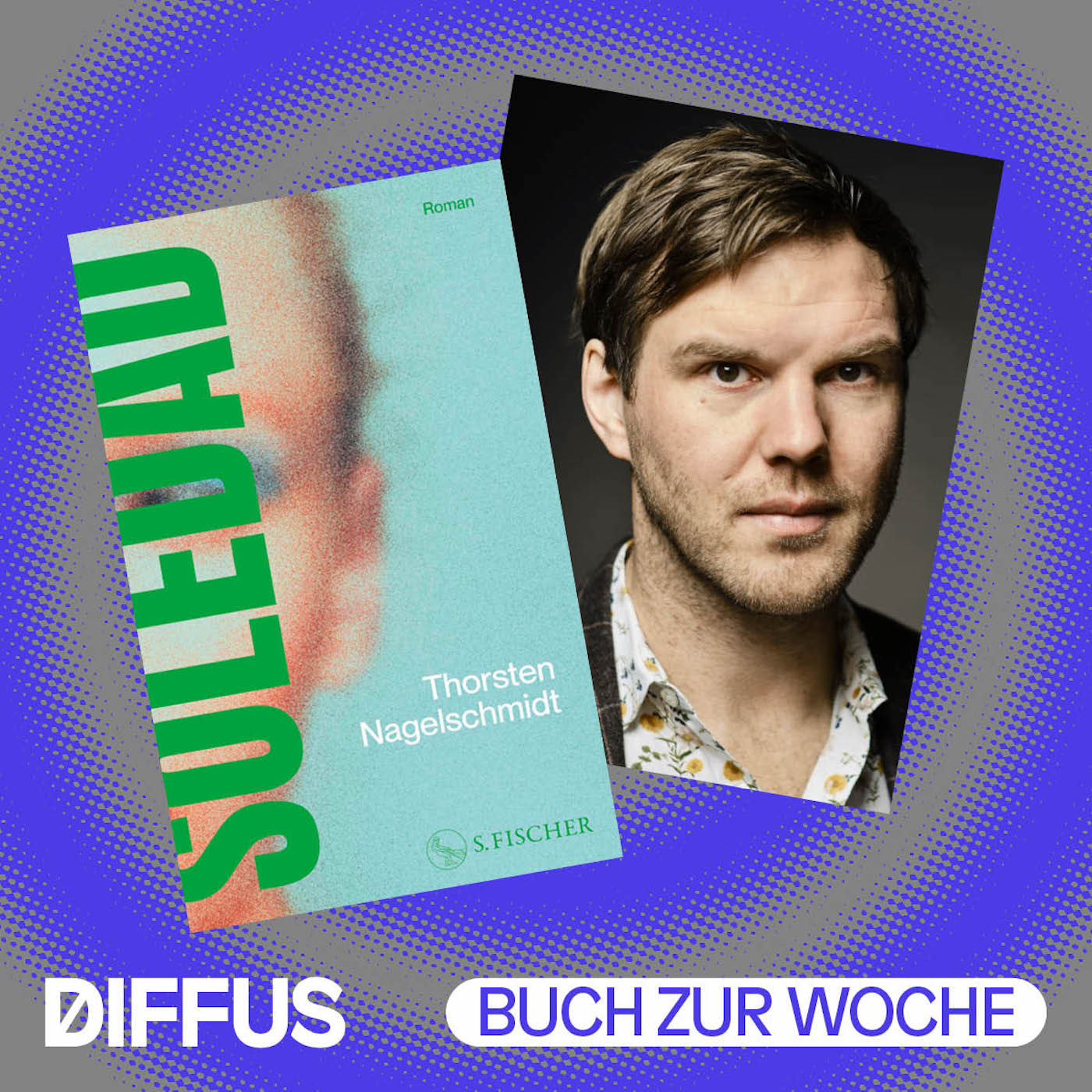
Buchclub | Das Rooney-Intermezzo
Die Hosts Celine Leonora und Daniel Koch sprechen heute über das Buch, das am letzten Wochenende wohl (fast) alle Bücher lesenden Menschen gelesen haben werden: „Intermezzo“ von Salley Rooney. Der vierte Roman der Irin ist letzte Woche zeitgleich mit der englischen Ausgabe auf Deutsch bei Claasen erschienen – in der sehr flüssigen Übersetzung von Zoë Beck. Sally Rooeny, die spätestens seit ihrem Roman „Normal People“ geradezu kultisch verehrt wird, erzählt in „Intermezzo“ von den Brüdern Peter und Ivan. Peter ist Mitte 30, Anwalt und verstrickt in einer Art Dreiecksbeziehung: Er fühlt sich noch immer zu seiner Ex-Freundin und ersten Liebe Sylvia hingezogen – eine Literaturprofessorin, die sich nach einem schweren Unfall von Peter getrennt hat, u. a. weil sie nicht wollte, dass er sie pflegen muss. Trotzdem verbringen beide noch viel Zeit miteinander. Peter ist aber auch mit Naomi zusammen – eine schöne, junge Studentin, die auch bei Only-Fans hin und wieder ihr Geld verdient. Klingt nach einem Klischee, hat aber mehr Gefühl und Tiefe, als man erwartet – wie eigentlich immer bei Rooney. Peters Bruder Ivan ist zehn Jahre jünger als er, ein passionierter Schachspieler, der lange Zeit Schwierigkeiten hatte Anschluss zu finden. Er lernt bei einem Turnier die 14 Jahre ältere Margaret kennen – neben Ivan und Peter die dritte Person, aus deren Perspektive die Geschichte erzählt wird. Peter und Ivan lieben und/oder hassen sich und müssen bei all dem auch noch den Tod ihres Vaters überwinden.

Rückkehr mit Folgen in „The Reappearance of Rachel Price“ von Holly Jackson
In dieser Folge spricht Celine über ihr Jahreshighlight „The Reappearance of Rachel Price" von Holly Jackson. In dem Buch geht es um die 18-jährige Bel, die in einem echten True Crime Fall aufwächst. Denn ihre Mutter ist seitdem sie zwei Jahre alt ist, spurlos verschwunden. Rätsel und Mythen ranken sich seitdem um den Fal – schon in solchem Ausmaße, dass ein Filmteam den Fall aufrollen will. Doch dann taucht plötzlich Bels verschollene Mutter wieder auf und stellt alles auf den Kopf. Was ist wirklich vor 16 Jahren passiert und kann Bel dieser Fremden wirklich trauen?
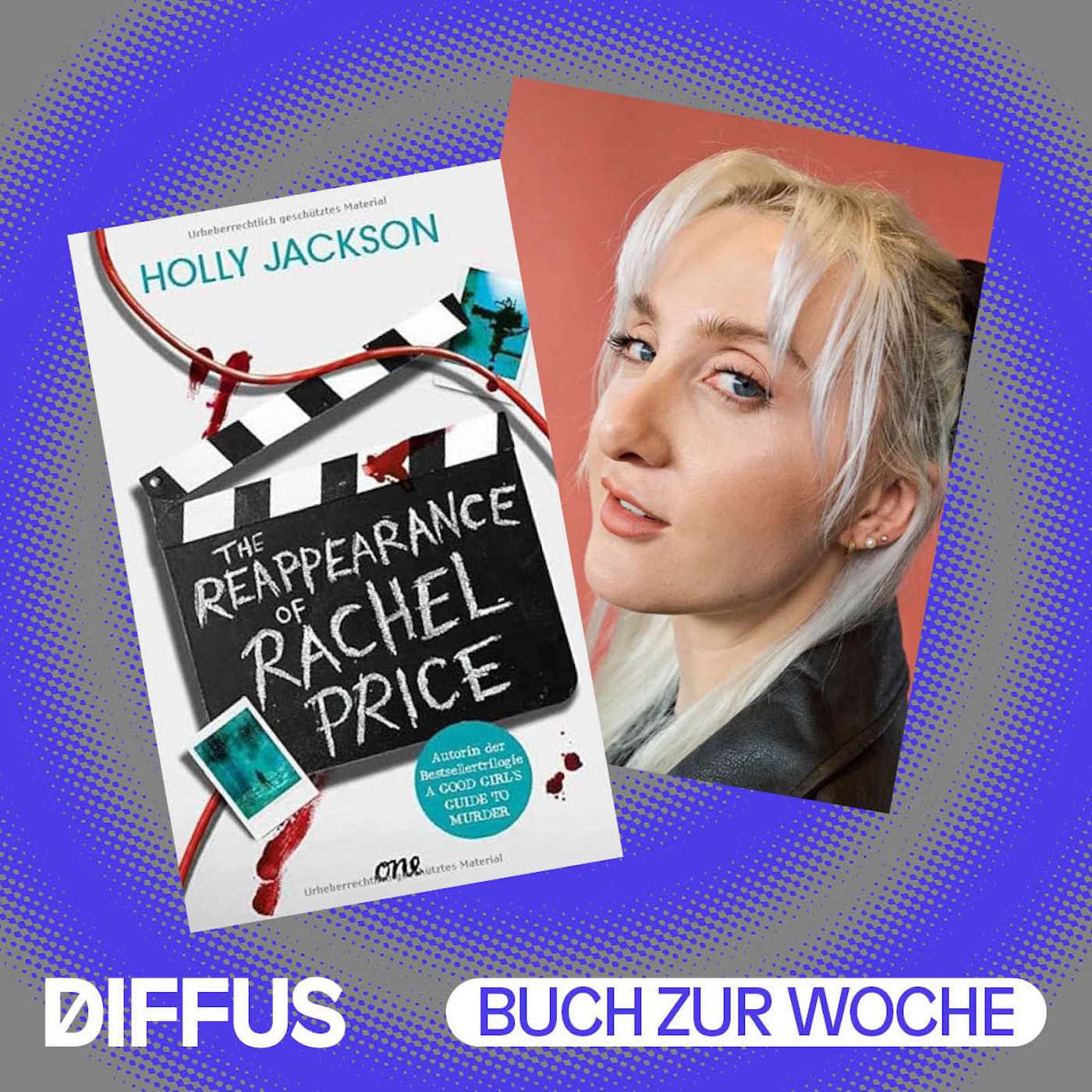
Sina Scherzant im Interview über ihren neuen Roman „Taumeln“
Daniel spricht heute mit der Autorin Sina Scherzant über ihren zweiten Roman „Taumeln“, der gerade bei Park x Ullstein erschienen ist. Darin geht es um das Verschwinden einer jungen Frau namens Hannah in einer Kleinstadt – oder vielmehr: Es geht um eine Gruppe von Menschen, die sich zwei Jahre später jeden Samstag trifft, um nach Spuren von ihr zu suchen. Sina Scherzant kennen viel vom Meme-Acount „Allman Memes 2.0“ – wo sie bis vor gut einem Jahr mit an Bord war. Mit Marius Notter, dem Gründer der „Allman Memes 2.0“, hat sie auch ihre ersten Bücher geschrieben – satirische Sachbücher über die Deutschen. Das bekannteste trägt den schönen Titel „Randale, Randale Treckingsandale“. Sinas erster Roman heißt „Am Tag des Weltuntergangs verschlang der Wolf die Sonne“ und kam letztes Jahr im August. Warum sie gut ein Jahr später schon wieder „Taumeln“ veröffentlicht, wie das True-Crime-Genre ihre Story beeinflusst hat, wie sich ihre eigenen Kleinstadtbeobachtungen in der Geschichte wiederfinden – das alles erzählt Sina Scherzant in diesem ausführlichen Interview.

Basma Hallak im Interview: Lachen und weinen zugleich mit „Between My Worlds“
Ob man in dieser Folge merkt, dass Autorin Basma Hallak und Celine Leonora befreundet sind? Basma erzählt von ihrem Debütroman „Between My Worlds“, in dem die gebrochene Fotografin Kalima nach Island flieht und dort nicht nur versucht herauszufinden, wer sie eigentlich ist, sondern obendrein auch noch Nói begegnet. Eine wandelnde Greenflag, der auch seine Päckchen zu tragen hat. Herzzerreißend schön mit einer Prise Humor verfeinert, so kann man den Own-Voice-Roman beschreiben. Warum in diesem Podcast der Baumarkt OBI, Culcha Candela und Sternzeichen eine Rolle spielen, könnt ihr nur herausfinden, wenn ihr reinhört.
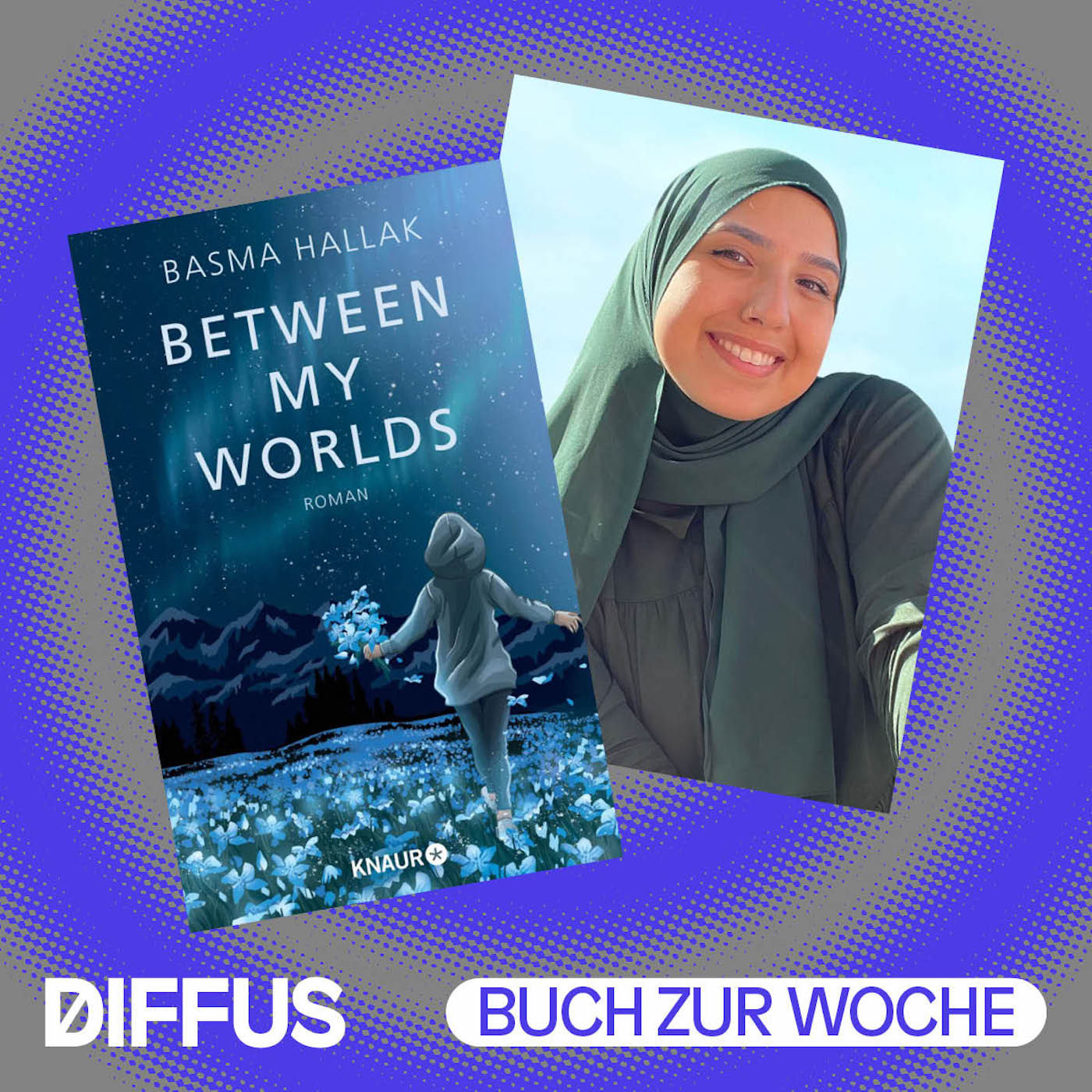
Buchclub | Über Boxkämpfe am Pool, zur Seite gelegte Bücher und Colleen Hoover
Die Hosts Celine Leonora und Daniel Koch treffen sich wieder für eine gemeinsame Buchclubfolge. Es geht um Romane, die ihnen am Pool gute Gesellschaft leisteten, um Bücher, die man mal eine Weile an die Seite legen muss, um Colleen Hoovers „It Ends With Us“-Verfilmung und um zwei Bücher, auf die sich die beiden schon jetzt freuen.

Verfluchte Liebe in „Psyche und Eros" von Luna McNamara
Endlich wieder ein feministisches Retelling einer der besten griechischen Sagen! In „Psyche und Eros“ verfolgen wir einen Gott, der sich aus Versehen mit einem seiner eigenen Pfeile verletzt und sich unsterblich in das Menschenmädchen Psyche verliebt. Doch ein Fluch liegt über dieser Liebe und Feinde versuchen die beiden zu trennen. Ein absolutes Must-Read für jeden Mythologie Fan, aber auch ein tolles Werk, um in dieses Thema einzusteigen, denn das Buch vereint Liebe, Spannung und Intrigen. Braucht man mehr?
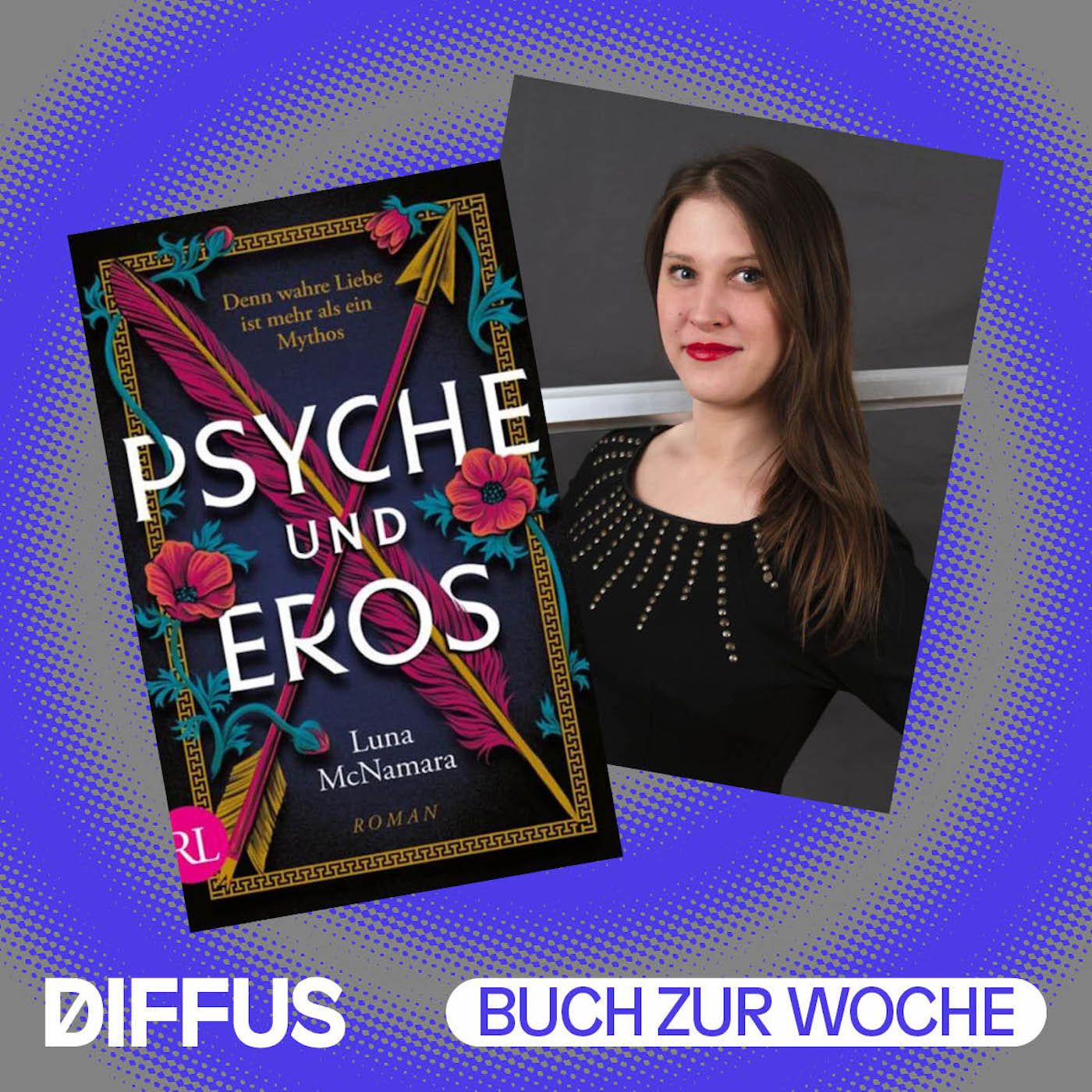
„Verlorene Sterne“ von Tommy Orange: Familienroman trifft „The Wire“ für Native Americans
Tommy Orange ist nicht weniger als ein Shooting Star der Literaturwelt. Sein Debütroman „Dort Dort“ aus dem Jahr 2018 war ein Bestseller eines der besten Bücher der letzten Jahre. Das Ding wurde über eine Million Mal verkauft – was für ein Debüt geradezu sensationell ist. Tommy Orange stammt aus Oakland und genau dort spielen auch großer Teile seiner Bücher. Er ist Native American, Mitglied des Cheyenne und des Arapaho Stammes und vielleicht gerade die präsenteste Native-Stimme in der Literatur. „Dort Dort“, dessen Titel im Englischen ein bisschen besser über die Lippen geht, erzählte aus dem Leben von 12 Native Americans. Sie alle strugglen, kämpfen mit Traumata, Süchten, Rassismus-Erfahrungen, Familien-Dramen, Geldsorgen. Orange sprang mit jedem Kapitel zu einem anderen Character und führte ihre Leben in einem dramatischen Finale zusammen. Die Kulisse dabei: Ein Powwow – also ein Treffen der Native Americans, die auf dieser Kulturveranstaltung ihre alten Bräuche zelebrieren. „Dort Dort“ hatte den Punch eines Actionfilms, die Tiefe großer Literatur und den genauen Blick einer Sozialstudie. Tommy Oranges zweiter Roman „Verlorene Sterne“ erfüllt nun den Herzenswunsch seiner Leser:innen, mehr Zeit mit diesen Charakteren verbringen zu können. Das Buch ist zugleich Prequel und Sequel von „Dort Dort“ und beginnt als poetischer, tragischer Familienroman und wird in der zweiten Hälfte zu einer Art „The Wire“ der Native Community.

Ein etwas anderes Sommerbuch: „Family of Liars“ von E. Lockhart
Vorsicht! Das ist kein leichter Sommer-Read! Eine abgelegene Privatinsel, gutaussehende Besucher und ein furchtbares Geheimnis - das und vieles mehr erwartet uns in „Family of Liars“ von E. Lockhart. Hier geht es um Carrie, die älteste von den drei Sinclair Schwestern, die nur einen Sommer wie jeden anderen auf der Privatinsel ihrer Familie erleben will. Doch dann taucht plötzlich Pfeff auf und bringt alles durcheinander. Was zuerst wie eine süße Romanze wirkt, wird schnell zu einem Albtraum, also checkt auf jeden Fall vorher die Triggerwarnings.
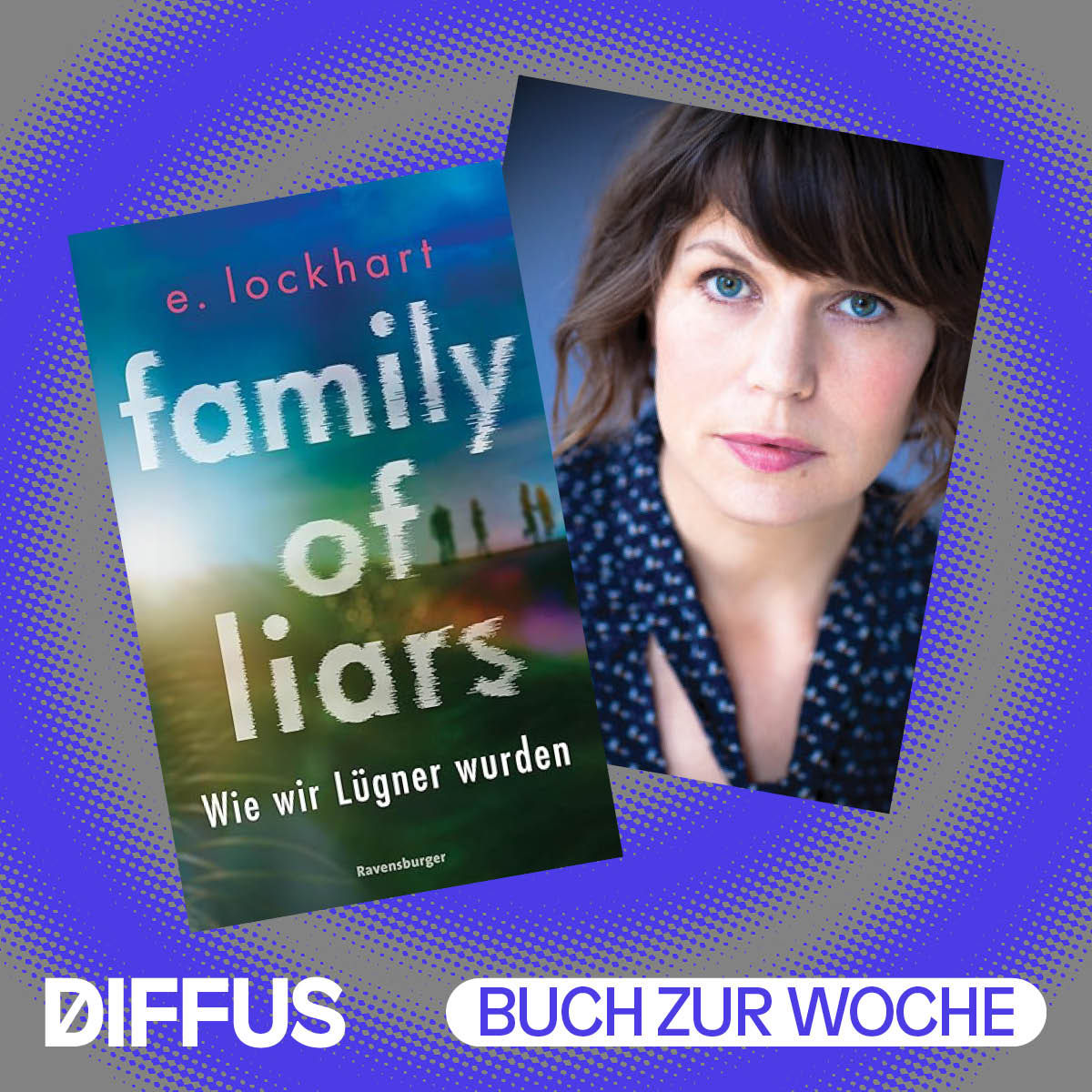
Josi Wismar will euch mit „Wandering Hearts" leiden sehen
Happy Book-Birthday!!! Genau heute, am 10. Juli erscheint der neue New Adult Roman von Josi Wismar und wir haben sie im Interview. Sie erzählt, wie sie mit dem Schreiben begonnen hat, wie ihr die Idee zu ihrem Buch gekommen ist und was wir noch von ihr erwarten dürfen. Zusätzlich bekommen wir einen Einblick in die Buchvermarktung über Social Media, denn auf BookTok kennt sie mittlerweile jeder Buchliebhaber. Viel Spaß!
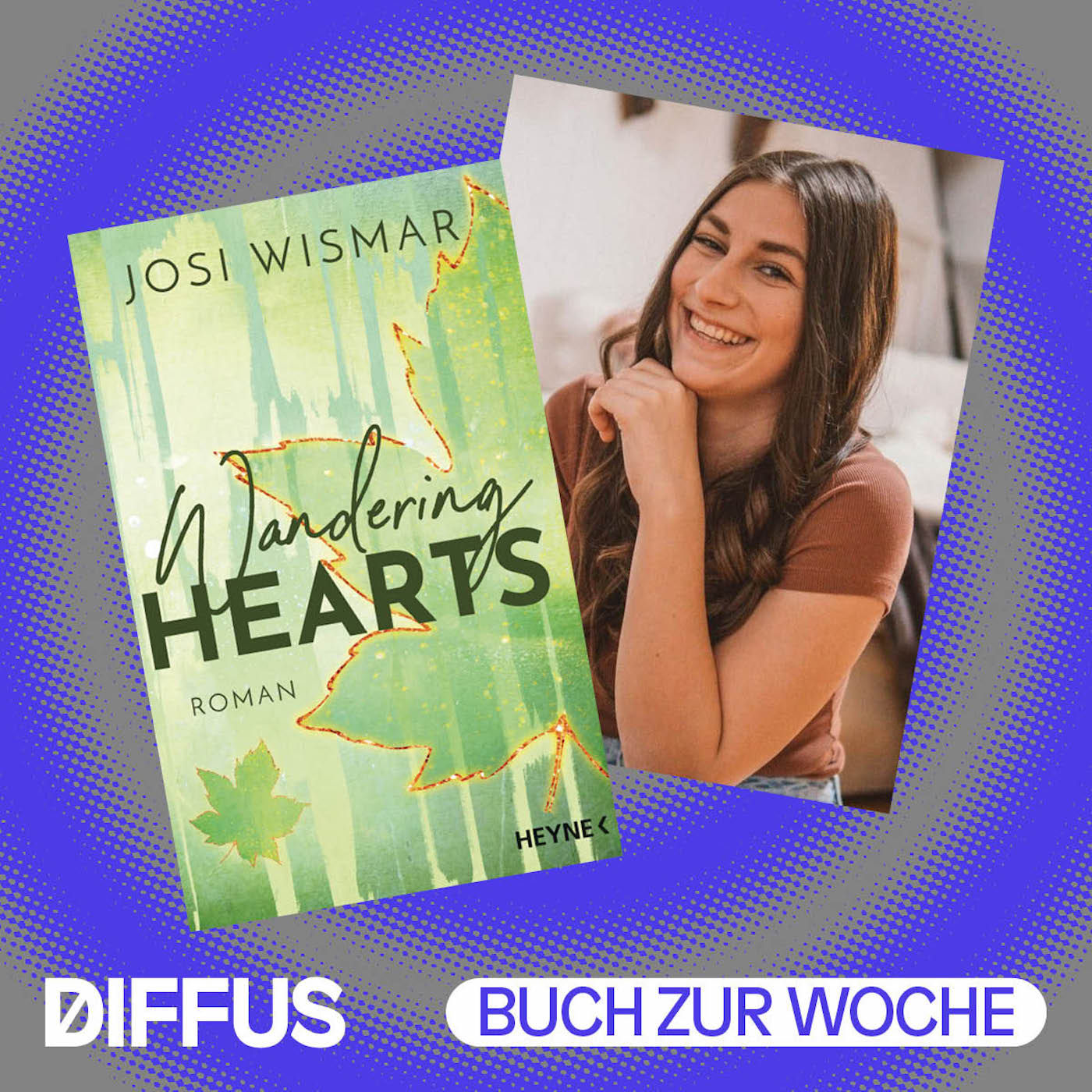
Wie kann man „Better Than the Movies" von Lynn Painter nicht lieben?
Vor einem Jahr hat Celine „Better than the Movies" von Lynn Painter auf Englisch gelesen und sich eine deutsche Übersetzung gewünscht. Jetzt ist sie endlich da! Liz träumt vom perfekten Prom-Date, doch dafür braucht sie die Hilfe von Wes, dem beliebten Bad Boy. Michael, ihr Kindheits-Crush, sieht in ihr nämlich immer noch die kleine Liz von früher. Wes hilft Liz und Michael zusammenzufinden, doch dabei kommen auch Wes und Liz sich näher. Lynn Painter hat einen einzigartig lockeren und humorvollen Schreibstil, den Celine sehr schätzt. Vor kurzem durfte sie die Autorin bei einer Lesung im Dussmann treffen, wo sie viele interessante Fragen zu ihren Büchern beantwortete, die ihr in dieser Folge hören könnt.
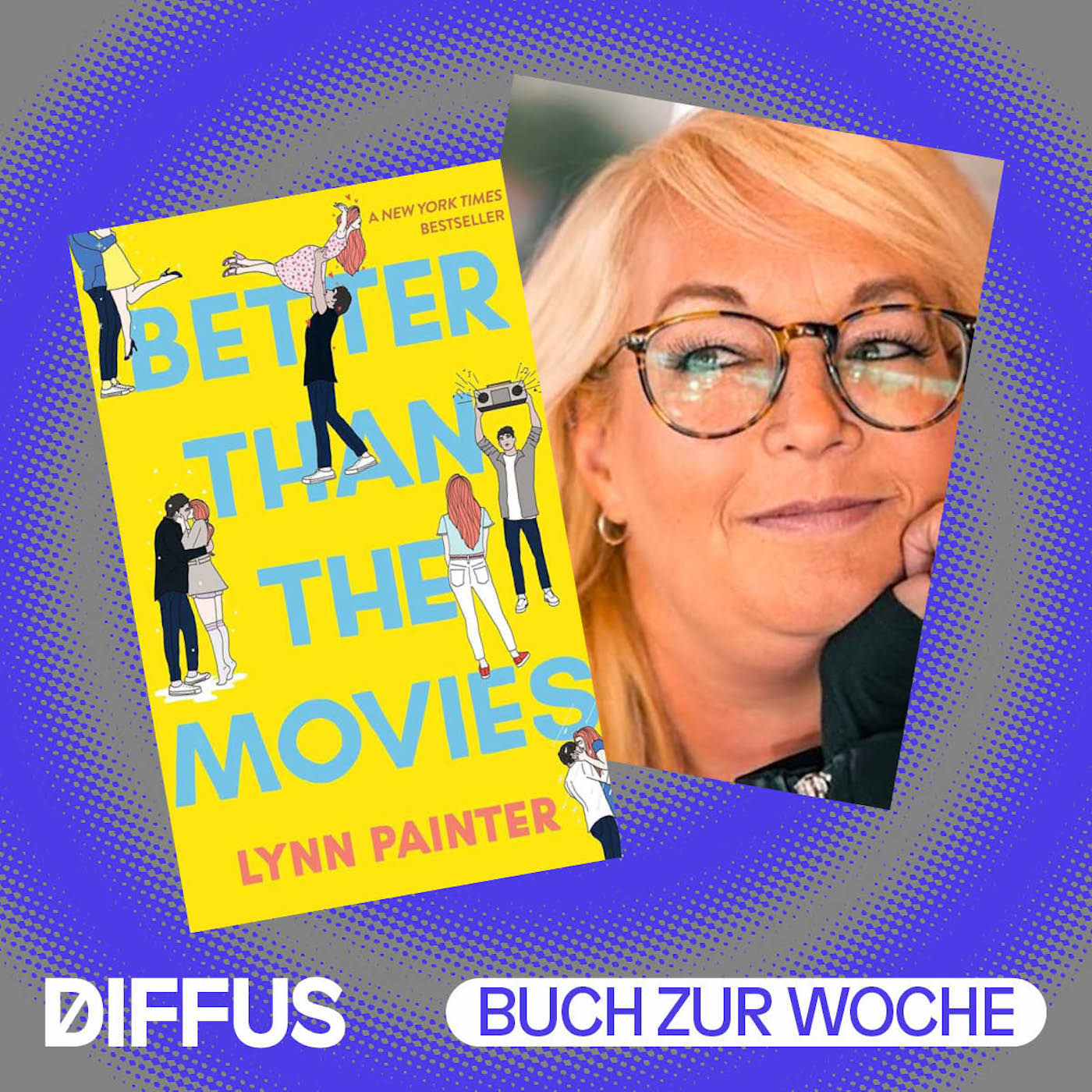
Buchclub | Über furchtbare Smut-Bücher, musikalischen Kaniballismus und Summer Reads
Das Bücherjahr feiert Halbzeit, die Sommer-Lektüre wartet und die Verlage verkünden bereits, was im Herbst und Winter so alles geht. Eine gute Gelegenheit für einen gemeinsamen Talk beider „Buch zur Woche“-Hosts. Celine Leonoara und Daniel Koch sprechen über aktuelle Lieblingsbücher, Summer Reads, Leseflauten, Lese-Enttäuschungen und Neuerscheinungen, auf die man sich schon jetzt freuen kann.

Liebe, Verrat und eine gefährliche KI in „Ophelia Scale“ von Lena Kiefer
Jede:r Leser:in, der oder die gerade zwischen 20 bis 30 Jahren alt ist, hat bestimmt in den 2010er Jahren diese eine Liebe zur Dystopie gefunden. Sei es durch „The Hunger Games", „Divergent" oder „Maze Runner". Und ich sage euch, „Ophelia Scale - Die Welt wird brennen" hätte sich prima bei diesen Büchern eingereiht. Uns erwartet hier eine Widerstandskämpferin, die feststellen muss, dass es keine ausschließlich gute oder böse Seite gibt, vor allem nicht, wenn es zusätzlich um romantische Gefühle geht. Aber worum geht es in dieser Trilogie überhaupt und warum ist es eine Dystopie? Das und viel mehr wird in der neuesten Folge besprochen. Viel Spaß!

Lena Kampf im Interview über In dieser Interviewfolge geht es um das Buch „Row Zero - Gewalt und Machtmissbrauch in der
In dieser Interviewfolge geht es um das Buch In dieser Interviewfolge geht es um das Buch „Row Zero - Gewalt und Machtmissbrauch in der Musikindustrie“ von Lena Kampf und Daniel Drepper. Da Daniel Drepper am Tag der Aufnahme erkrankt ist, stellt sich Lena Kampf gute eine Stunde lang den Fragen unseres Daniels. von Lena Kampf und Daniel Drepper. Das ist in der letzten Woche im Eichborn Verlag erschienen und sorgt bereits in der Musikbranche für wichtige Diskussionen. Da Daniel Drepper am Tag der Aufnahme erkrankt ist, stellt sich Lena Kampf gute eine Stunde lang den Fragen unseres Daniels. „Row Zero“ liefert genau das, was der Titel verspricht: Das Buch nimmt das „Groupie-Casting“-System von Rammstein und die Berichterstattung darüber als Ausgangspunkt, um kritisch auf das System hinter der Musikindustrie zu schauen. Das eben an vielen Stellen von Gewalt und Missbrauch geprägt ist – die teilweise sogar als „Sex, Drugs & Rock’n’Roll“ zelebriert oder zumindest verklärt werden. Lena Kampf und Daniel Drepper waren Teil der Berichterstattung über die Vorwürfe gegen Rammstein und Till Lindemann – unter anderem für die Süddeutsche Zeitung. Vor allem die Art und Weise, wie die Musikindustrie und das Publikum darauf reagierten, weckte ihr journalistisches Interesse. Für „Row Zero - Gewalt und Machtmissbrauch in der Musikindustrie“ sprachen die beiden mit über 200 Menschen und näherten sich dieser Branche mit den Mitteln des Investigativ-Journalismus. Als Lesender stellt man dabei schnell fest: Diese Branche, von der auch wir als DIFFUS Teil sind, hat viele Problemfelder. Deshalb hoffen wir, dass viele Kolleginnen und Kollegen das Buch lesen oder dieses Interview hören werden. Auch, wenn ihr unbedingt in dieser Branche arbeiten wollt, ist dieses Buch unserer Meinung nach Pflichtlektüre.
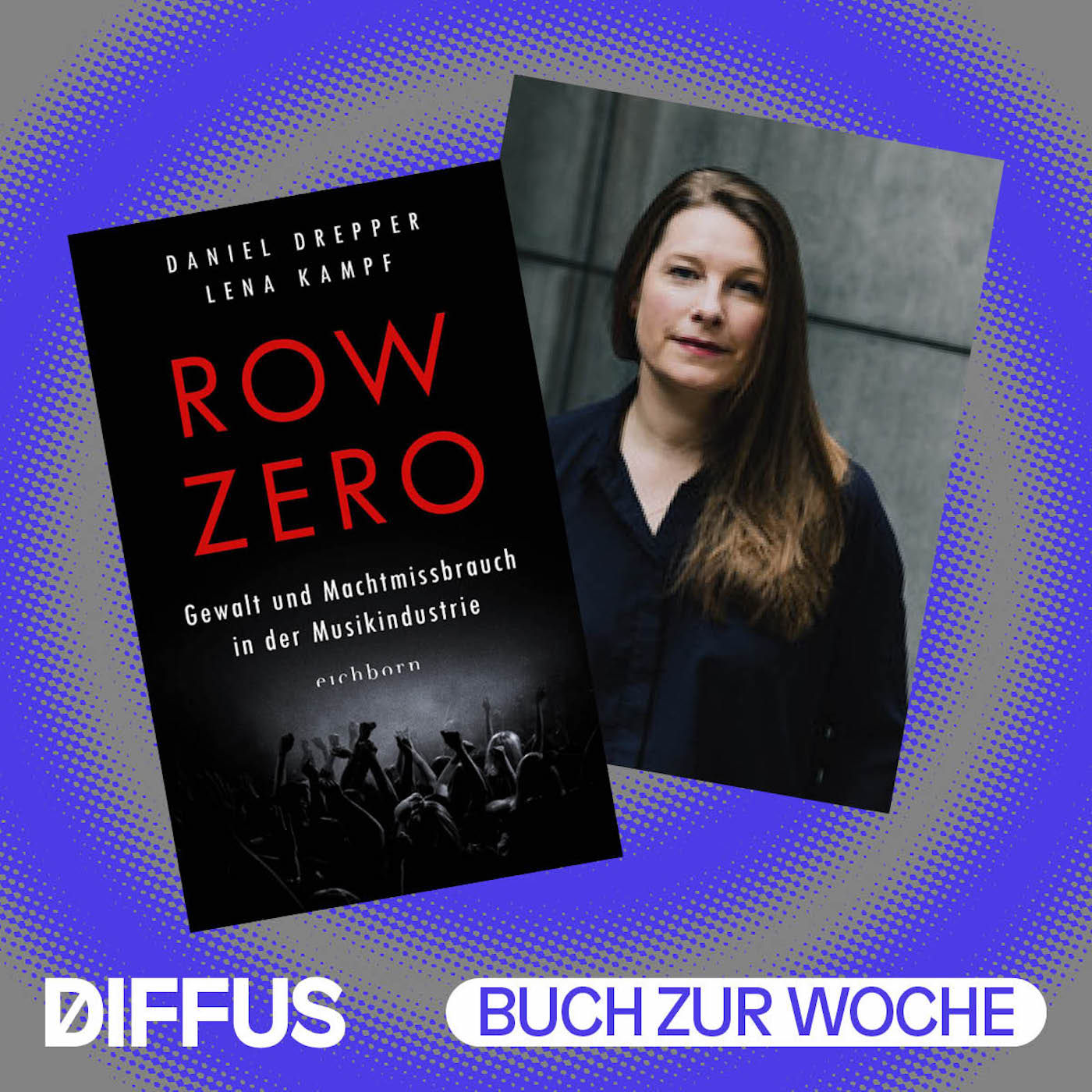
Michelle Steinbeck im Interview über ihren wilden Roman „Favorita“
In dieser Folge spricht Daniel mit der Schweizer Autorin und Lyrikerin Michelle Steinbeck. Sie ist 1990 in Lenzburg geboren, wuchs in Zürich auf, studierte am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel und wohnt mittlerweile in Basel. Schon ihr Debütroman schlug 2016 gehörig ein – und bescherte ihr Nominierungen für den Deutschen und den Schweizer Literaturpreis. Das Buch trug den griffigen Titel: „Mein Vater war ein Mann an Land und im Wasser ein Walfisch.“ Eine surreale, wilde Geschichte, die Elke Heidenreich im Schweizer Fernsehen damals dermaßen in Wallung brachte, dass die vermeintlich große Literaturkritikerin sämtliche Contenance verlor. Michelles zweiter Roman „Favorita“ (gerade bei Park x Ullstein veröffentlicht) ist nun ein mitreißender Roadtrip von der Schweiz nach Italien. Oder etwas griffiger formuliert: Wer schon immer mal eine Mischung aus „Meine geniale Freundin“ von Elena Ferrante, „Die Roten Stellen“ von Maggie Nelson, einem feministischen Actionfilm und einer Bibel-Lektüre auf Pilzen lesen wollte – dem sei „Favorita“ wärmstens empfohlen. Wir folgen im Buch der Ich-Erzählerin Fila, die gleich am Anfang des Buches erfährt, dass ihre abwesende Mutter in Italien gestorben sei. Offiziell heißt es, sie habe sich zu Tode gesoffen und sei an einer Leberzirrhose verendet. Der Anruf einer Ärztin bei Fila weckt aber deutliche Zweifel an dieser Darstellung. Also macht sich Fila, die bei ihrer Großmutter in der Schweiz aufwuchs, auf den Weg nach Italien – trifft Kommunistinnen, Faschisten, revolutionäre Sex-Workerinnen und den Geist einer jungen Frau namens Sisina. Die wurde Opfer eines Femizids in der Nachkriegszeit – und hat sogar ein reales Vorbild. Im Interview geht es um diesen Femizid, die Möglichkeit von Geistern, Irmgard Keun, Elena Ferrante, das Zusammenspiel von Lyrik und Prosa und die Frage, wie es sich eigentlich anfühlt, wenn man schon nach dem Debütroman als „wilde Skandalautorin“ geframet wird.

Paula Irmschler im Gespräch über ihren neuen Roman „Alles immer wegen damals“
Paula Irmschler, die 1989 in Dresden geboren wurde, ist vor allem als Autorin, Satirikerin und Journalistin bekannt. Sie schreibt und schrieb für Intro, den Musikexpress, für das Missy Magazin und für Neues Deutschland. Sie war Redakteurin bei der Titanic und schreibt gerade für das ZDF Magazin Royale von Jan Böhmermann. Sie stand mit Christiane Rösinger, Stefanie Sargnagel und anderen auf der Bühne bei dem Theaterstück „Die große Klassenrevue“. Aber Paula ist vor allem „Spiegel Bestseller-Autorin“: Ihr Roman „Superbusen“ ist einer der besten deutschen Musik-Romane der letzten Jahre und war ein großer Erfolg. Nun ist also ihr zweiter Roman draußen – und geht in eine etwas andere Richtung: „Alles Immer wegen damals“ (gerade erschienen im DTV-Verlag) ist ein moderner, lustiger, bisweilen sehr zärtlicher Familienroman. Im Mittelpunkt stehen die 30jährige Karla und ihre Mutter Gerda, die sie und drei weitere Geschwister allein in den letzten Jahren der DDR und um die Wende herum großgezogen hat. Karla wohnt in Köln, Gerda in Leipzig – und die beiden haben aus Gründen ein paar Jahre nicht mehr miteinander geredet. Das will Karlas Schwester Mascha ändern: Sie überredet die beiden, gemeinsam nach Hamburg zu reisen. Zwei Nächte inklusive „König der Löwen“-Besuch und ein Gang ins Beatles-Museum. Wir sprechen mit Paula Irmschler über ihren Roman, Familiendynamiken, Parallelen in die eigene Kindheit, das Leben der „DDR-Mütter“, stabile Sachsen und Sächsinnen, das Schreiben und Verkneifen von Pointen und Klassenunterschiede, die es zu überwinden gilt. Paula Irmschler muss man aber vor allem live erleben. Deshalb ist sie auch mit ihrem zweiten Roman auf einer langen Lesetour. Hier sind die noch ausstehenden Daten: 23.05.24 Bremen - Schlachthof 01.06.24 Neustrelitz - Immergut Festival 02.06.24 Mannheim - Maifeld Derby Festival 06.06.24 Moers - Bollwerk 107 07.06.24 Mainz - Schon Schön 08.06.24 Stuttgart - Merlin 13.06.24 Leipzig - Moritzbastei (Outdoor) 14.06.24 Dresden - Schauburg 15.06.24 Meißen - Literaturfest 20.06.24 Mülheim an der Ruhr - Ringlokschuppen 21.06.24 Köln - King Georg 26.06.24 Hamburg - Schanzenzelt 29.08.24 Oberhausen - Druckluft 11.10.24 Frankfurt - Mousontum 16.10.24 Soest - Alter Schlachthof 17.10.24 Kiel - Hansa 48 18.10.24 Lüneburg - Spätcafé im Glockenhof 05.11.24 Karlsruhe - NUN Kulturraum
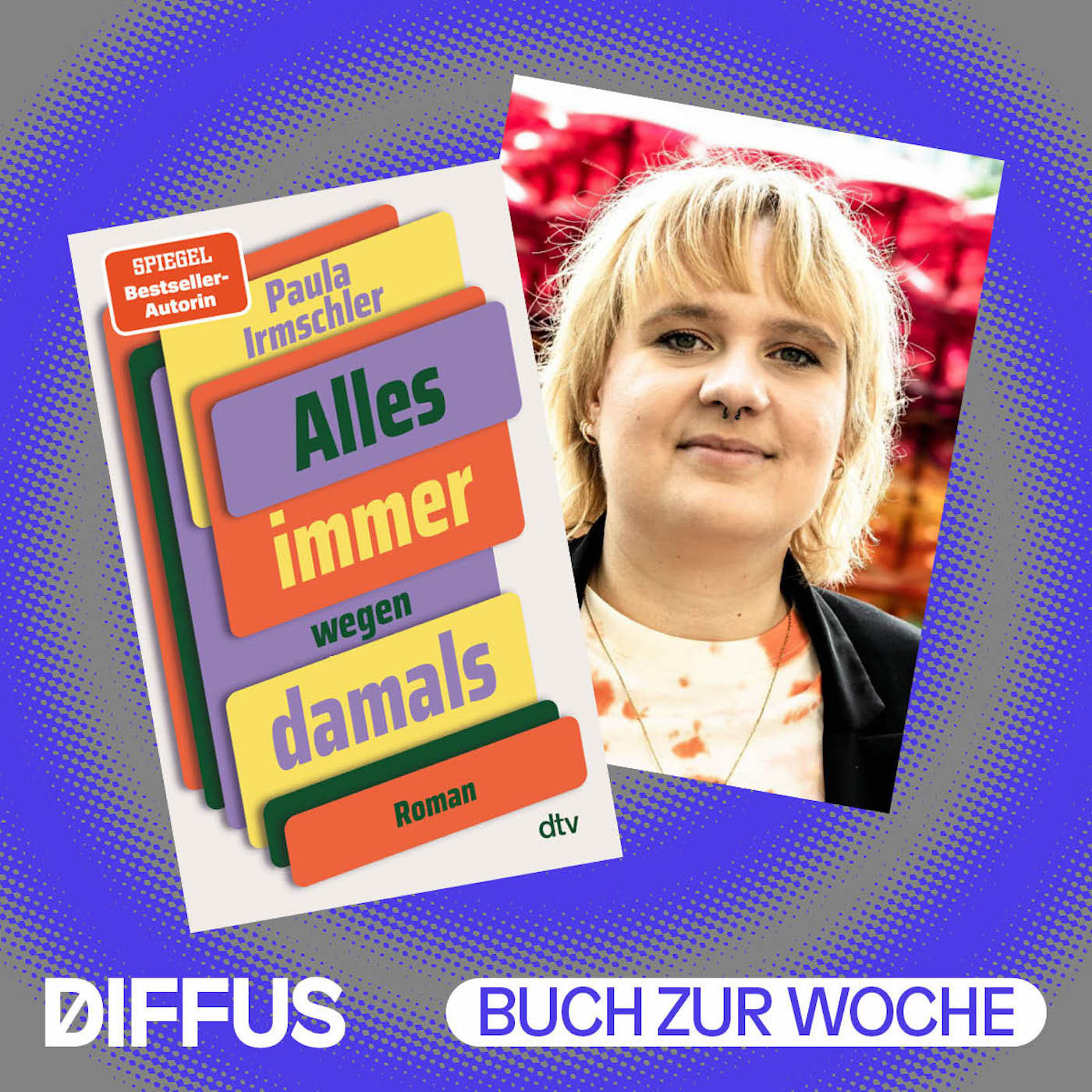
„Auf allen vieren“ findet Miranda July neue Wege
„Auf allen vieren“ (KiWi Verlag) ist der zweite Roman der Künstlerin, Schauspielerin, Autorin und Regisseurin Miranda July. Sie war vor einigen Jahren auf irgendwie unangenehme Weise der Star eines jeden mittelalten Feuilletonisten. Ihre Filme „Me and You and Everyone We Know“ aus dem Jahr 2005 und „The Future“ aus dem Jahr 2011 machten sie in den Augen vieler Kultur-Männer zu einer Art intellektuellem „Manic Pixie Dream Girl“ und das war, nun ja, weird und unangenehm. Neben ihren Arbeiten als bildende Künstlerin, schrieb Miranda July danach den tollen Kurzgeschichtenband „Es findet dich“, bevor dann 2015 ihr Romandebüt „Der erste fiese Typ“ folgte. Sehr empfehlenswert ist auch ihr letzter Film „Kajillionaire“, bei dem sie Regie führte und das Drehbuch schrieb: Evan Rachel Wood spielt darin die kleptomanische Tochter einer Familie voller Kreinkrimineller. Miranda Julys neuer Roman ist nach eigener Aussage sehr autobiografisch gefärbt und sei „close to the bone“, wie sie in einem Interview sagte. Die Ich-Erzählerin will eigentlich einen Roadtrip von Kalifornien nach New York machen und ihr nonbinäres Kind und ihren Mann für zwei Wochen allein lassen. Sie schafft es dann aber nur einen Ort weiter, wo sie einen jungen Mann namens Davey kennenlernt, der ungeahnte Gelüste in ihr weckt. „Auf allen Vieren“ ist aber nicht bloß die Geschichte einer Affäre zwischen einer Frau kurz vor den Wechseljahren und einem jungen schönen Mann, der gerne tanzt. Dieses Buch ist viel mehr als das: Miranda July geht darin auf der ihr eigenen Weise Gefühlen und Erlebnissen nach, die ihr eigenes Leben prägen. Das Buch ist bei aller Tiefe aber auch höllisch witzig. Man ist dieser suchenden, zweifelnden, liebenden, masturbierenden Erzählerin dermaßen ausgeliefert, dass man das Buch einfach nicht weglegen kann …
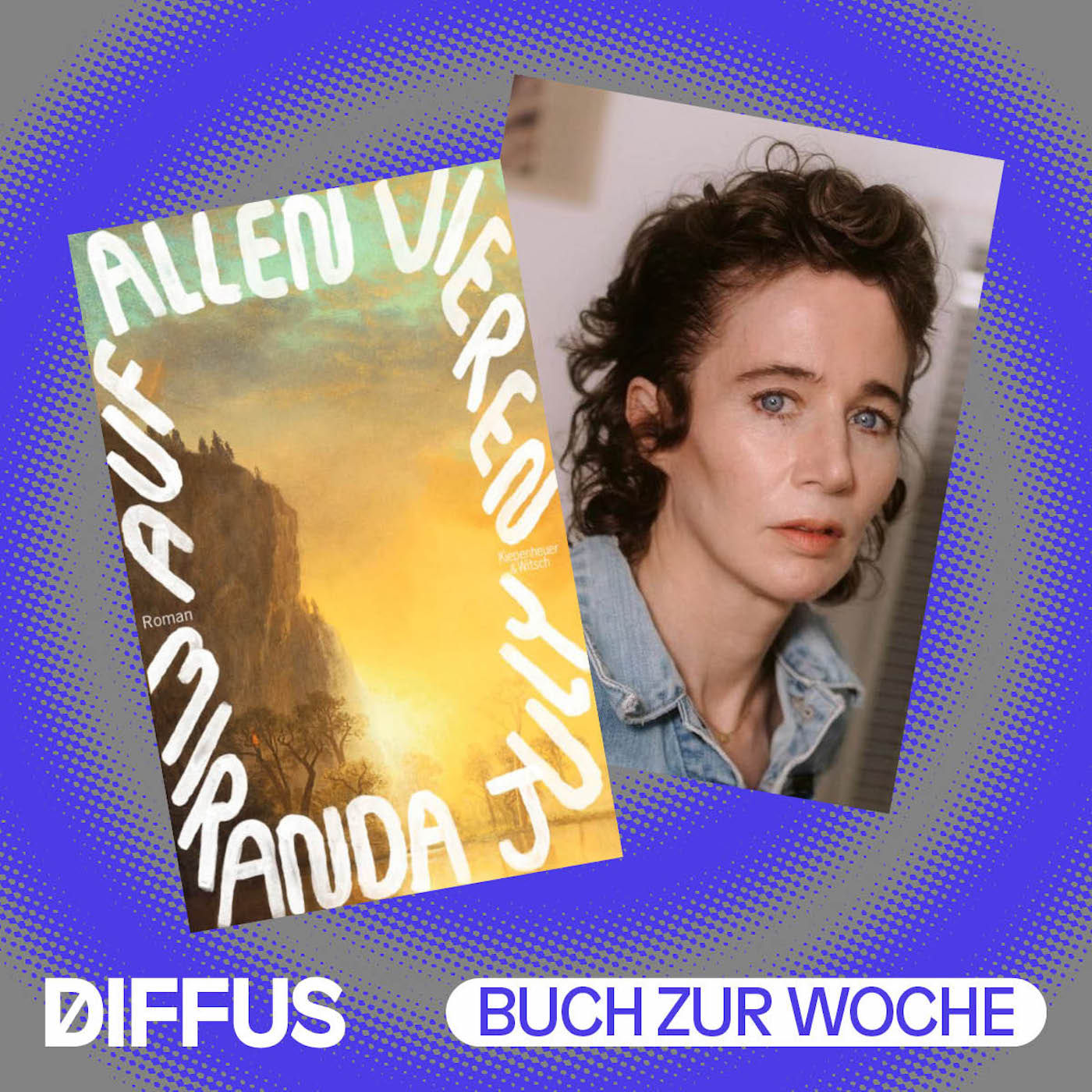
Neue Musikbücher von Eric Pfeil, Françoise Cactus und Michel Faber
Endlich mal wieder ein kleiner Ritt durch aktuelle Musikbücher. Eric Pfeil findet in „Ciao Amore, Ciao“ (KiWi Verlag) noch mehr Geschichten aus der bunten Welt des Italo-Pop – die hier bisweilen sehr melancholisch wirkt. „Oh Oh Mythomanie – Erlebtes, Erinnertes & Erlogenes“ von Françoise Cactus aus dem Ventil Verlag lässt uns die Stereo-Total-Sängerin noch viel mehr vermissen und „Listen: On Music, Sound and Us“ (Hanover Press) von „Under The Skin“-Autor Michel Faber hält nicht ganz, was er im Vorwort verspricht, aber hat ein paar geniale Momente.
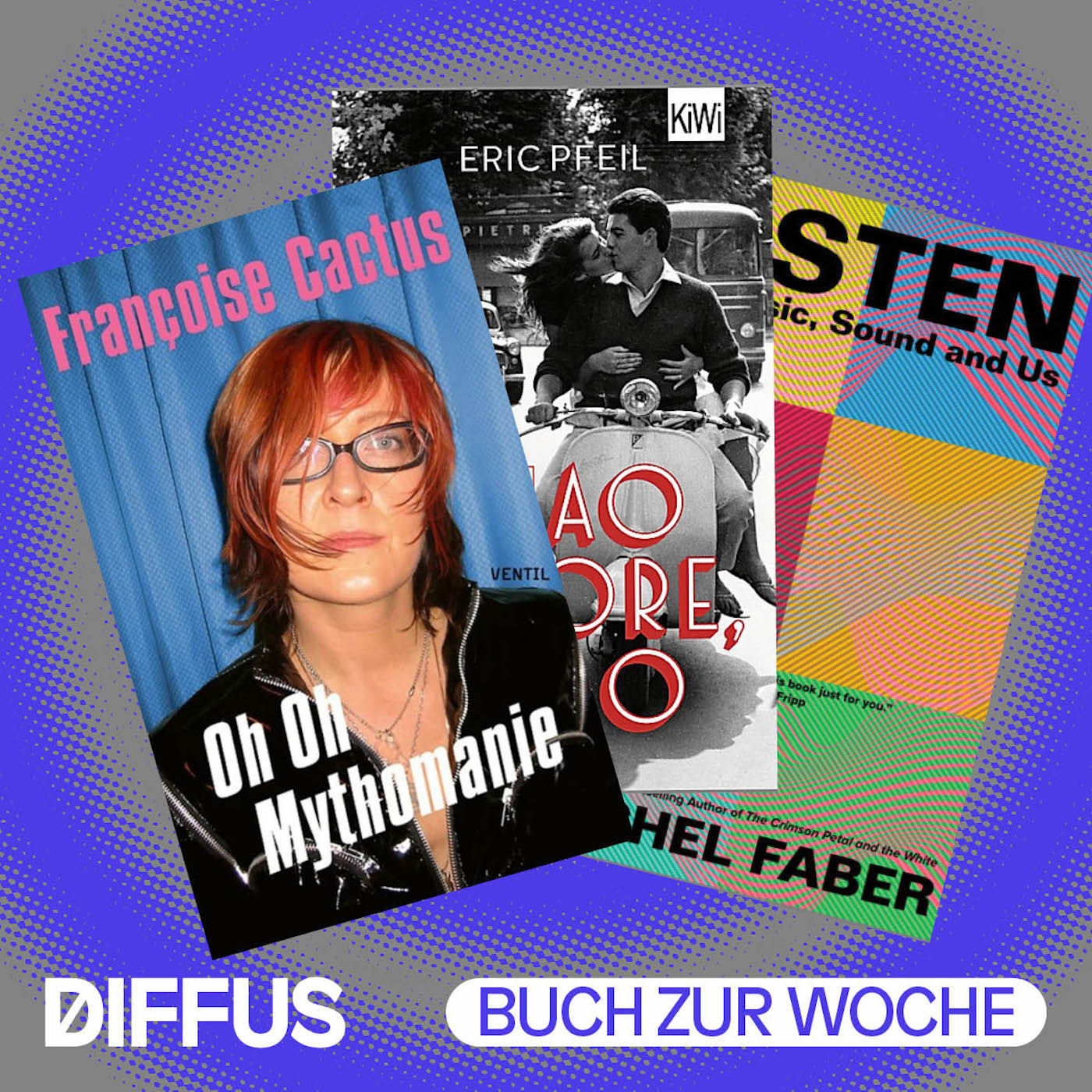
Es ist nicht so, wie es scheint in „Wenn sie wüsste" von Freida McFadden
Ein Thriller, der euch aus der Leseflaute holt und mit viel Spannung überzeugt. In „Wenn sie wüsste" auf Englisch bekannt als „The Housemaid" geht es um Millie, die sich als Haushälterin bei einer wohlhabenden Familie auf Long Island bewirbt. Doch auf den zweiten Blick wirkt die Familie, die aus Andrew und Nina Winchester und deren Tochter Cecilia besteht, doch nicht mehr so perfekt. Schon bald sieht sich Millie einem nervenaufreibenden Job gegenüber, der von den Anwandlungen einer Verrückten erschwert wird. Etwas scheint mit der Familie nicht zu stimmen, vom gruseligen Schlafplatz im Dachgeschoss bis hin zu den Warnungen des Gärtners hat Millie ein seltsames Gefühl. Aber was auf sie zukommt, damit hätte keiner gerechnet. Lasst euch von dem Bestseller packen und viel Spaß beim Hören!
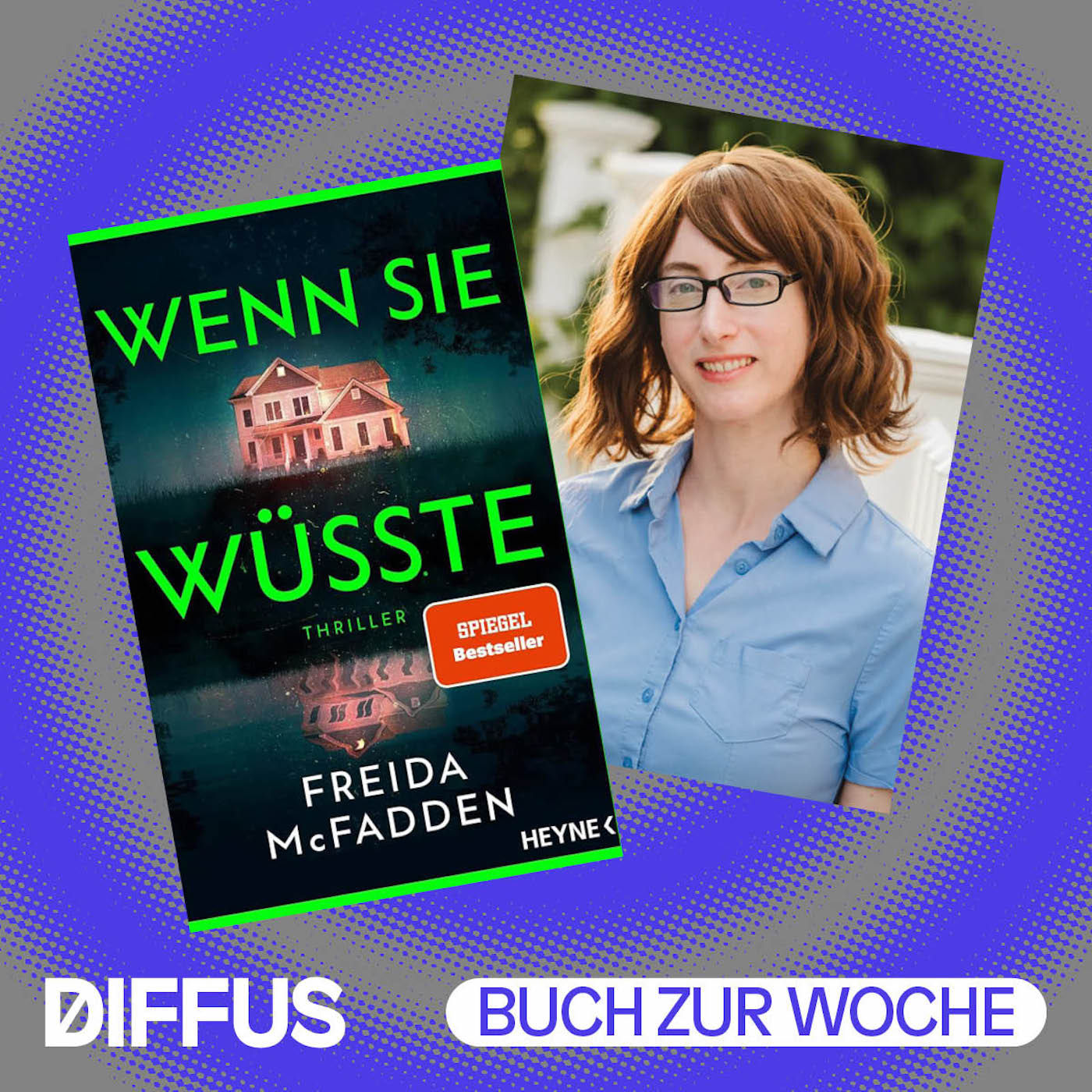
„Der letzte Wolf“ und der erste schwarze Sheriff von S.A. Cosby
Krimis kommen in Bücher-Podcasts und im Feuilleton irgendwie immer ein wenig zu kurz. Das mag daran liegen, dass es in diesem Genre wirkliche dutzende Veröffentlichungen gibt und einige davon eher, nun ja, funktionaler Natur sind. Aber es gibt eben auch einige Autorinnen und Autoren, die das Genre sehr literarisch angehen und außerhalb der Krimibestenlisten einen Platz haben sollten. Ein solcher Autor ist der Amerikaner S. A. Cosby, der 2023 mit „All The Sinners Bleed“ einen der besten Krimis des Jahres veröffentlicht hat – das findet zum Beispiel auch der große Stephen King und schrieb das ungefähr so im New York Times Book Review. In deutscher Übersetzung heißt das Buch nun eben „Der letzte Wolf“ (erschienen bei Ars Vivendi), was ein irgendwie lamer Titel ist. Vor allem, weil ihm die alttestamentarische Wucht abgeht, die dieses „All The Sinners Bleed“ in sich trägt. Die wirklich düsteren Parts der Bibel spielen nämlich auch eine Rolle in dieser Geschichte um den ersten schwarzen Sheriff in einem Südstaatenkaff und den brutalen, rassistischen Morden, die er aufklären muss.

Auf der Suche nach des „Pudels Kern“ mit Rocko Schamoni
Wenn man einen Buchpodcast bei einem Musikmagazin macht, dann muss man in dieser Woche natürlich über „Pudels Kern“ von Rocko Schamoni sprechen. Ein autobiografischer Roman, der gerade bei Hanser Blau erschienen ist. Er ist die Fortsetzung des Bestsellers „Dorfpunks“, in dem Rocko 2004 von seiner Jugend als junger Punk in Schleswig-Holstein erzählte. Diesmal begleiten wir den Hamburger Songwriter, Sänger, Entertainer und Mitbegründer des „Golden Pudel Club“ durch seine ersten Hamburg-Jahre und treffen auf dem Weg die Goldenen Zitronen, die Einstürzenden Neubauten, die Toten Hosen und noch ein paar andere illustre Gesellen und Gesellinnen. Dank des Verlags Hanser Blau haben wir die Möglichkeit, 3 Exemplare von „Pudels Kern“ von Rocko Schamoni zu verlosen: Schickt uns einfach eine Mail mit eurer Postadresse an verlosung@diffusmag.de und beantwortet folgende Frage: Wie hieß die Hamburger Kneipe, an dessen Theke man in den 80ern als Punk einfach stehen musste?
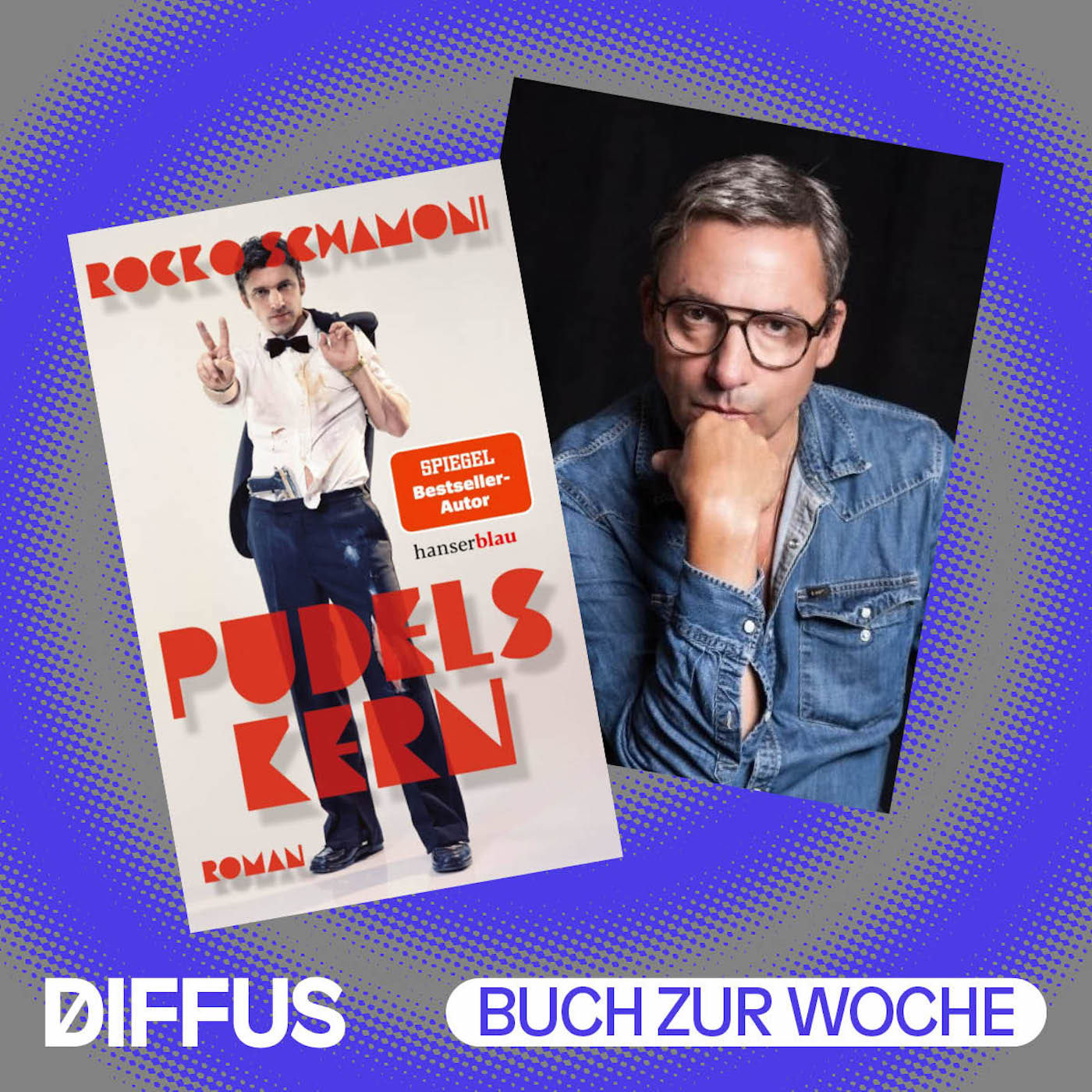
Ruby Braun im Interview über ihren düsteren Romantasy-Hit „Vengeance“
In dieser Folge spricht Celine mit der Autorin Ruby Braun über ihr neues Buch „Vengeance". Es ist der erste Band einer Dilogie und handelt von einer dunklen Traumakademie und der Protagonistin, die Rache für ihren toten Bruder will. Nur ihr Herz darf ihr dabei nicht im Wege stehen. Ruby erzählt im Gespräch, wie sie auf die Idee gekommen ist und verrät uns, ob sie selbst luzide träumen kann. Diesen Romantasy-Hit solltet ihr nicht verpassen!
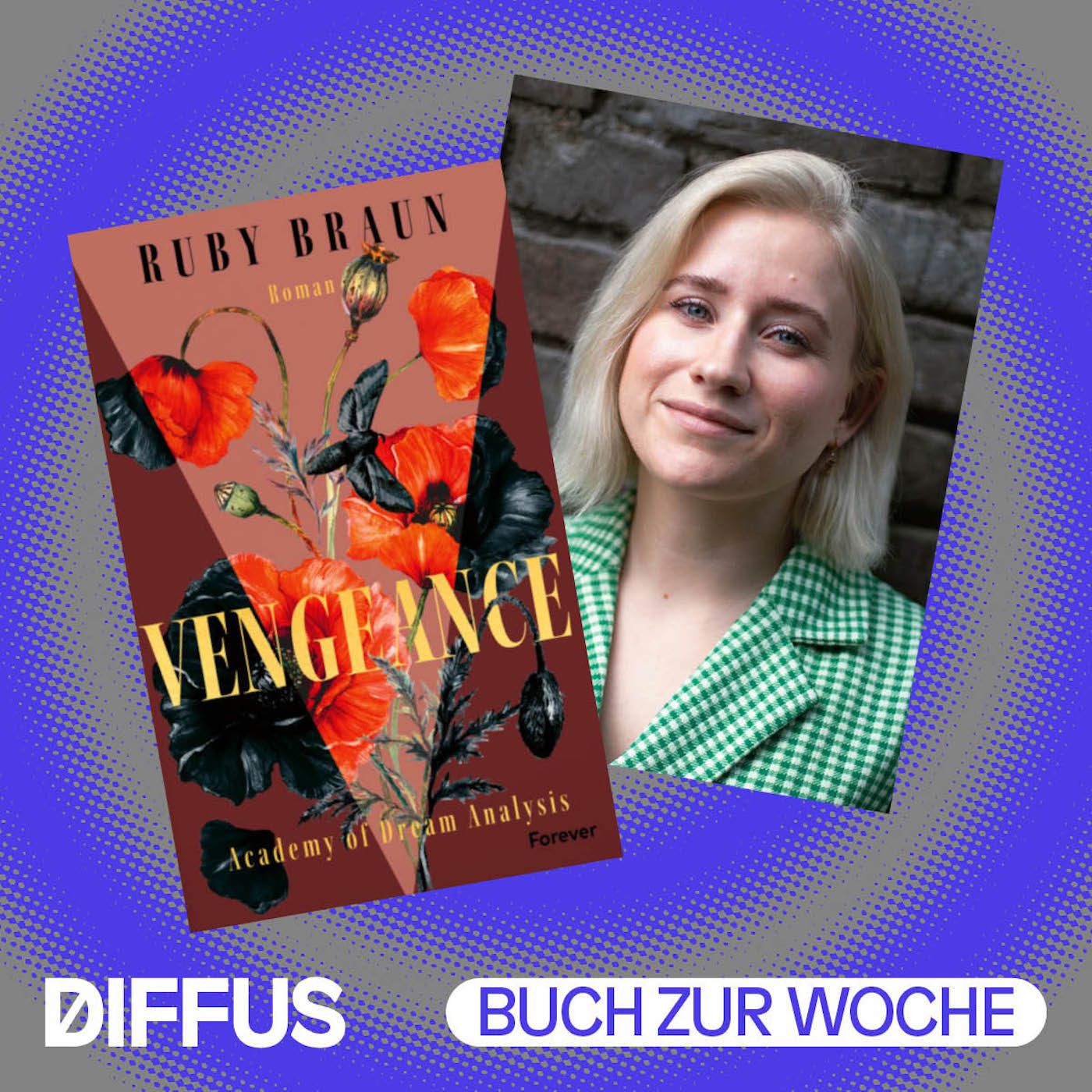
Rasiermesserscharfe Satire mit „Yellowface“ von Rebecca F. Kuang
Juhu, der neue Roman Yellowface von Bestseller Autorin Rebecca F. Kuang wurde endlich ins deutsche übersetzt und es gibt uns einen schockierenden Einblick in die Verlagswelt und den allgegenwärtigen Alltagsrassismus. Aber worum geht es in Yellowface überhaupt? Wir verfolgen hier die Schriftstellerin June, die mit ihrer Arbeit im Schatten von ihrer „quasi" Freundin Athena Liu steht. Sie hat alles, was June sich nur wünschen kann. Erfolg, Geld, Relevanz in der Autorenwelt und obendrein ist sie attraktiv und wird von jedem vergöttert. In Junes Augen liegt das vor allem daran, dass Athena mit ihren chinesischen Wurzeln in der Verlagswelt besser ankommt. Als während eines abendlichen Trinkgeldes ein unvorhersehbarer Unfall passiert und Athena vor Junes Augen stirbt, wird die Story verzwickter. Denn June verschafft sich Zugang zu Athenas gerade vollendeten Manuskript, das sie bis dato noch niemanden außer June gezeigt hat. Kurzerhand entscheidet sich June dazu, Athenas Werk „Die letzte Front“ zu vervollständigen und dieses als ihres auszugeben. Der Roman handelt von den Heldentaten chinesischer Arbeiter während des Ersten Weltkriegs. Und in Junes Augen verdient es diese Geschichte erzählt zu werden, egal ob weiß oder nicht weiß. Aber nun muss June ihr Geheimnis hüten. Und herausfinden, wie weit sie dafür gehen will.

Down and out in Madrid: „Die schlechte Gewohnheit“ von Alana S. Portero
In der heutigen Folge geht es um den autobiografisch gefärbten Roman „Die schlechte Gewohnheit“ von der spanischen Autorin Alana S. Portero. Gerade erschienen im Claassen Verlag – in der Übersetzung von Christiane Quandt. Die 1978 geborene Autorin Alana S. Portero ist in ihrer Heimat eine wichtige Stimme der Trans-Community. Sie gründete die Theatergruppe STRIGA, schrieb aus der Perspektive einer Transfrau Theaterstücke, Gedichtbände, Essays und Artikel über Feminismus und LGTB-Aktivismus. Aufgewachsen ist Portero in Madrid – genauer gesagt im Stadtteil San Blas. In ihrer Jugend war das eine roughe Working-Class-Gegend, die noch heute in Tourie-Listen auftaucht, die Titel tragen wie „4 Areas To Avoid in Madrid if you want to live here“. In den 80ern wird San Blas ein Drogenumschlagplatz, ein Straßenstrich, aber auch ein Zentrum der queeren Szene. Porteros Romandebüt „Die schlechte Gewohnheit“ spielt ebenfalls in San Blas. Die Ich-Erzählerin wächst im Körper eines Jungen auf – in einem Umfeld das von konservativen Geschlechterrollen geprägt wird. Portero führt uns in diesem Roman durch die Kindheit und Jugend dieser Ich-Erzählerin. Wir lernen, was es bedeutet, im falschen Körper geboren zu sein. Wir sehen das Elend in den Straßen von San Blas – die Junkies, die gewalttätigen Väter, die oft noch jugendlichen Stricher, die transsexuellen Prostituierten, die betrunkenen Machos erst einen blasen müssen und dann manchmal von ihnen verdroschen werden, weil sich diese ach so männlichen Mann-Männer nach dem Akt dann doch dafür schämen, ihr Kunde gewesen zu sein.

„Die Ungelebten“ von Caroline Rosales: Täter, Väter, Töchter und #MeToo im deutschen Schlager
Carolin Rosales ist Journalistin sowie Drehbuch- und Roman-Autorin. 2019 hat sie mit ihrem feministischen Memoire „Sexuell Verfügbar“ für Aufsehen gesorgt. Darin beschreibt sie anhand ihrer eigenen Erfahrungen wie bereits kleine Mädchen darauf konditioniert werden, lieb und höflich zu sein und dem Onkel doch ein Küsschen zu geben. Und wie aus diesen Mädchen Frauen werden, die mehr auf das Gegenüber achten als auf sich selber. Aus diesem Buch ist übrigens die gerade angelaufene ARD-Serie gleichen Namens entstanden, die Rosales mit dem Autor Timon Karl Kaleyta geschrieben hat – der übrigens schon mal bei uns im Podcast zu Gast war (https://diffusmag.de/p/podcasts/das-buch-gespraech-zur-woche-timon-karl-kaleyta-ueber-die-geschichte-eines-einfachen-mannes/) Viele Motive aus „Sexuell Verfügbar“ stehen auch im Mittelpunkt von „Die Ungelebten“. Es ist ein Roman über das Schlager-Business, #MeToo, Mutterschaft, Väter, die Täter sind – und das alles dominierende Patriarchat. Im Mittelpunkt steht die dreifache Mutter Jennifer Boyard. Ihr Vater, Bernd Boyard, führt eines der größten Schlager-Labels Deutschland. Er ist down mit den ganz großen: Howard Carpendale, Udo Jürgens, Helene Fischer – er kennt oder kannte sie alle. Bernd Boyard war dabei immer der Mann für die neuen Talente: In einer Szene des Buches zählt er stolz auf, dass er über die Jahre 345 Schlagersängerinnen groß gemacht hätte. Gendern muss man an dieser Stelle nicht: Bernd Boyard nahm vor allem junge Frauen unter Vertrag, die unbedingt ins Schlager-Game wollten. Eine davon, die Sängerin Lorelei, beschuldigt Bernd nun, sie vergewaltigt zu haben …

Jeff VanderMeer, Killerbären, Erinnerungspilze und ein Wesen namens „Borne“
Den amerikanischen Science-Fiction-Autor Jeff VanderMeer kennen viele durch „Auslöschung“. So heißt der erste Roman seiner sogenannten „Southern Reach Trilogie“, der 2018 für Netflix von Alex Garland verfilmt wurde – mit Natalie Portman in der Hauptrolle. In dieser Folge soll es aber um den Roman „Borne“ gehen. In einigen Punkten ist dieser ein „classic VanderMeer“. Der Autor erzählt gerne Geschichten, die man vielleicht als Öko-Science-Fiction bezeichnen könnte. Während andere im Genre sehr Technik-verliebt sind und ins All streben, gibt es aber in VanDerMeer-Romanen irdische Umweltkatastrophen, ausgestorbene Tierarten, Bio-Tech-Auswüchse oder eine Flora und Fauna, die plötzlich nach Regeln funktioniert, die der Mensch nicht mehr versteht. „Borne“ spielt in einer dystopischen Zukunft. Schon die Inhaltsangabe klingt etwas irre. Oft kann man sich die Buchrücken-Texte ja eh sparen, aber hier lohnt es sich, den mal zu zitieren: „Ein riesiger Bär, der eine zerstörte Stadt terrorisiert. Eine junge Frau, die in den Ruinen nach biotechnologischem Abfall sucht. Ein Drogendealer, der daraus psychoaktive Drogen herstellt. Ein undefinierbares Wesen, das diese Welt für immer verändern wird …“. Alles klar? Da will man doch reinlesen … Warum sich hinter dieser weirden Prämisse eine sehr deepe Story verbirgt, erklärt Daniel Koch in dieser Folge.
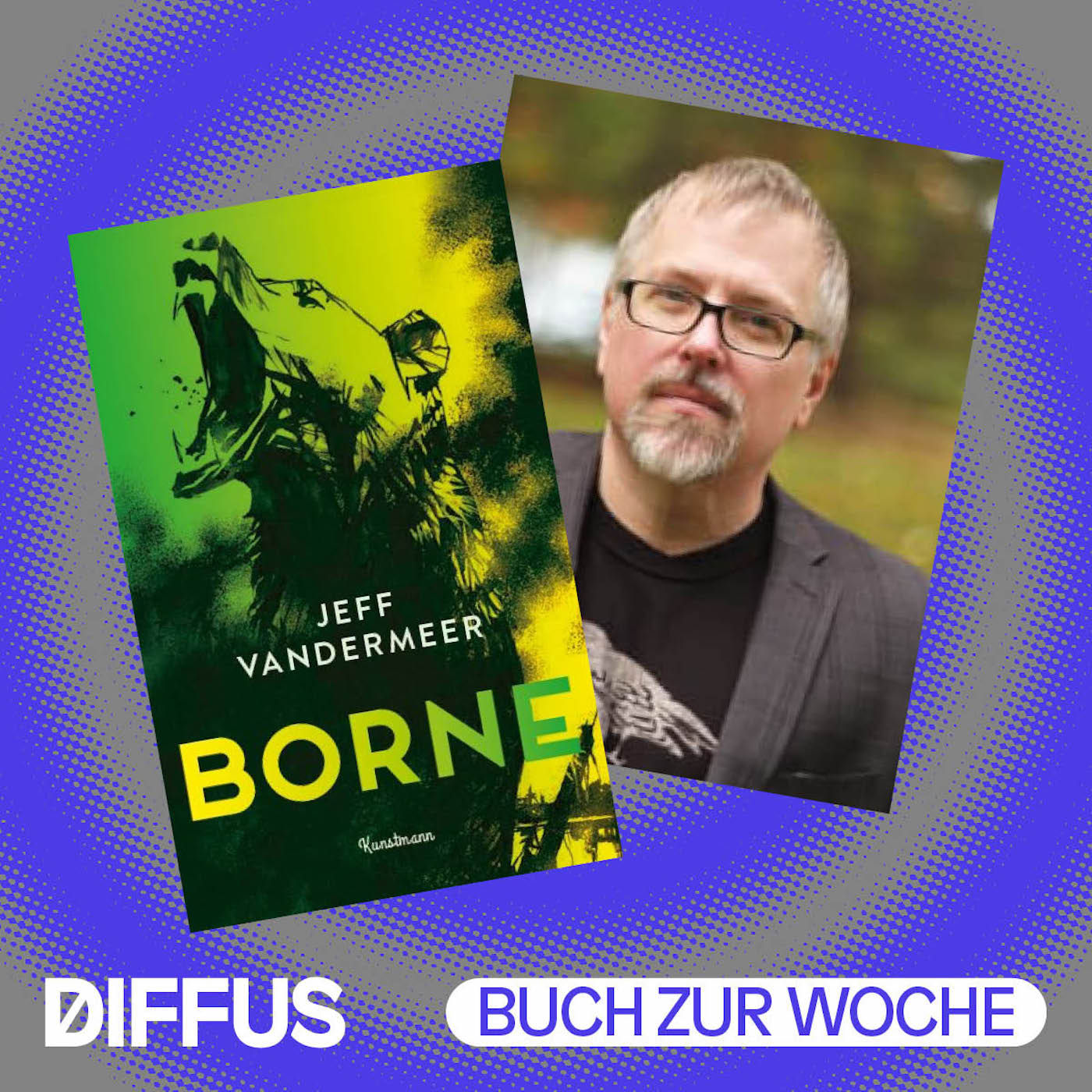
„Jeder kennt einen Felix“: Rabia Doğan im Interview über „Trusting Was The Hardest Part“
In dieser Folge spricht Celine mit der Autorin Rabia Doğan über ihr neues Buch. Es ist das zweite in einer Reihe, bei der jeder Teil von einer anderen Person aus einer Berliner WG handelt. In „Trusting Was The Hardest Part“ verfolgen wir Zelal, die an der FU studiert und dort für ihren neuen Dozenten arbeitet. Die Arbeitsbeziehung gerät ins Wanken, als sich beiderseitig Gefühle entwickeln, die zu vielen Schwierigkeiten führen. Doch dieses Buch ist noch so viel mehr wie eine Liebesgeschichte. Das Buch thematisiert außerdem toxische Beziehungen, Grooming und die Übergriffigkeit von Männern gegenüber Frauen. Rabia erzählt obendrein im Gespräch, mit welchem Charakter sie sich identifizieren kann und von Situationen, die jede Frau wohl schon erlebt hat. Freut euch außerdem auf eine Szene aus dem Hörbuch, dass euch sofort ins Buch saugen wird. Viel Spaß!

„Latente Grundpanik“: Kaleb Erdmann im Interview über „Wir sind Pioniere“
In der neuen Folge ist der Autor und Poetry-Slammer Kaleb Erdmann beim hörbar Baumblütenpollen-Allergie-geplagten Host Daniel zu Gast. Kaleb hat gerade bei Park x Ullstein seinen Debütroman „Wir sind Pioniere“ veröffentlicht. In dem sehr schnellen und lustigen Buch geht es um Bruckner und Vero. Die beiden sind ein Pärchen, kennen sich seit den Studientagen in Mannheim und haben eine offene Beziehung. Als sie erfahren, dass sie Eltern werden, wollen sie ihre Beziehung eigentlich „schließen“ und erwachsen werden. Aber ganz so weit sind sie anscheinend noch nicht. Im Kern also eine klassische, moderne Beziehungs-Story – aber auf sehr besondere Weise geschrieben. Kaleb verzichtet zum Beispiel auf Groß- und Kleinschreibung und Interpunktion. Warum er das getan hat, erfahrt ihr im Interview. Außerdem geht es um das Image der Poetry-Slam-Szene, das Studium an einer Schreibschule, das Prekariat, in dem Medienmenschen oft leben müssen – und um das Erwachsenwerden.
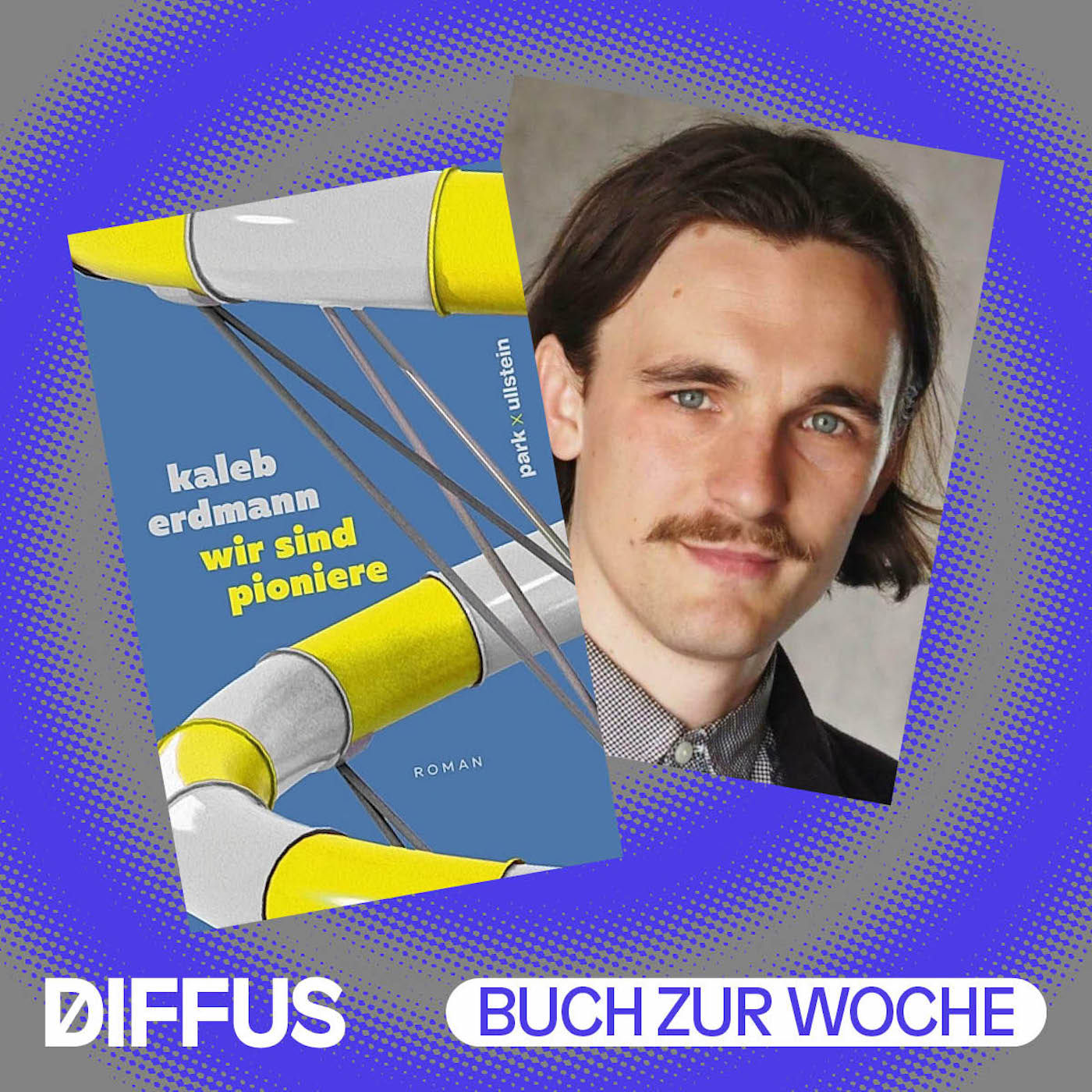
„Chaing Gang All-Stars“: Als hätte Kendrick Lamar „Squid Game“ geschrieben
Nana Kwame Adjei-Brenyah hatten wir schon mit seinem Short-Story-Band „Friday Black“ in unserem Podcast. Nun erscheint sein Romandebüt auf Deutsch bei Hoffmann & Campe. „Chaing Gang All-Stars“ heißt es und ist ein satirischer, politischer Thriller, der allen Fans von Kendrick Lamar, „Mad Max“, „1984“, „Atlanta“, „Gladiator“, „Squid Game“, „Running Man“ und der „Hunger Games“-Reihe gefallen dürfte. Schon der Titel knallt gewaltig. Die Worte „Chain Gang“ erinnern zugleich an die Zeit der Sklaverei in den Südstaaten und an das amerikanische Gefängnis- System. Damals wurden Sklaven und Gefangene oft als „Chain Gangs“ in Gruppen aneinandergekettet, um harte Arbeiten auf den Feldern und in den Städten zu verrichten. Die Worte „All-Stars“ wiederum erinnern an die bunte Welt des Profisports – an All-Star-Basketball-Teams oder Football-Duelle. Beide Welten bringt Nana Kwame Adjei-Brenyah zusammen: In seiner nahen Zukunft kämpfen Häftlinge in „Death Matches“ gegeneinander, wer lange überlebt, kann am Ende die Freiheit gewinnen. Aber die beiden Kämpferinnen Loretta Thurwar und Hamar Stacker, namens „Hurricane Staxxx“, versuchen das zynische Spiel zu sprengen …
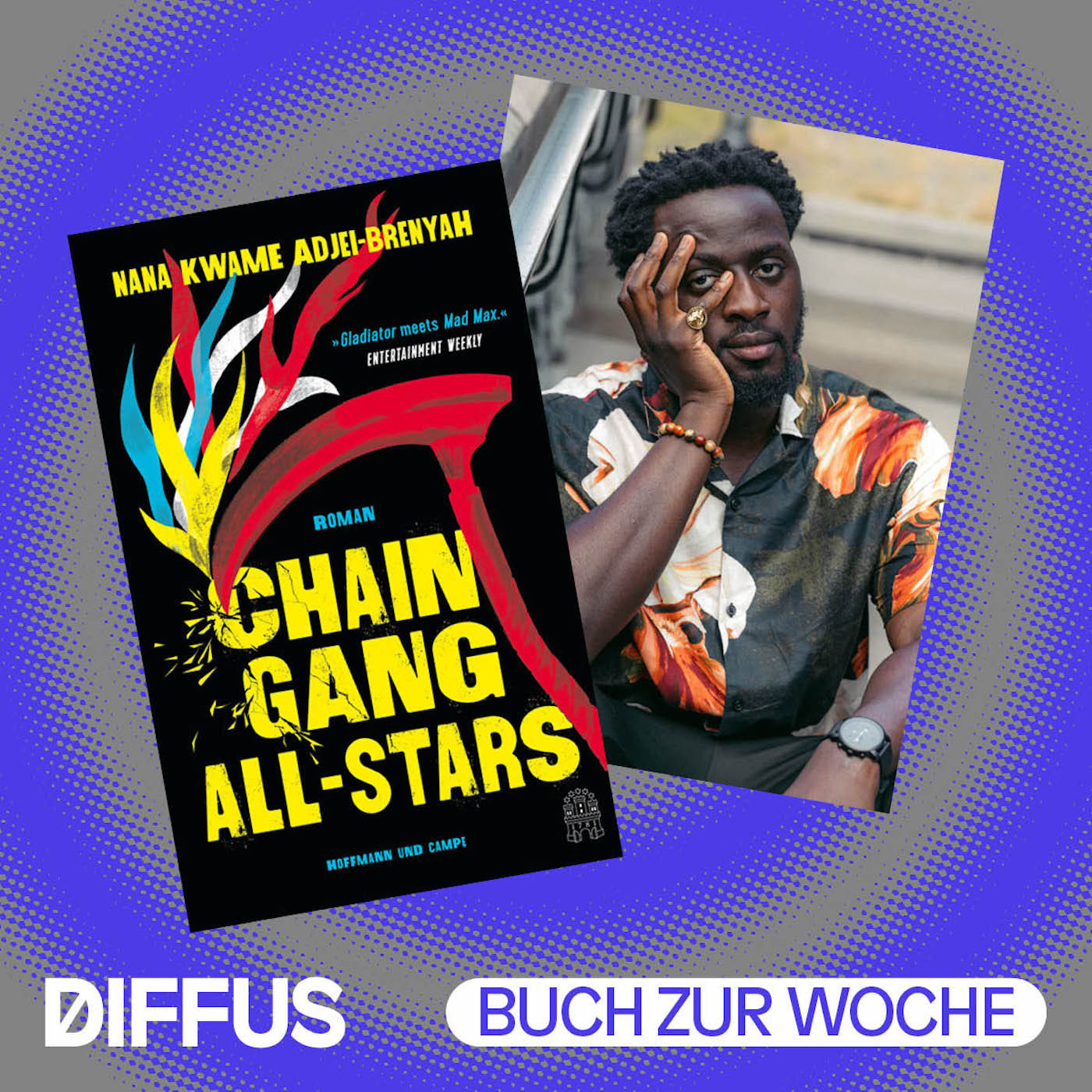
„Dieses Buch hat mich zerstört!“ Im Interview mit okaychiara über „Babel“ von R. F. Kuang
In dieser Folge ist die Buchbloggerin @okaychiara bei uns zu Gast und erzählt über ihr Lieblingsbuch "Babel" von R.F. Kuang. Denn sie hat wohl erst mit ihren Videos auf TikTok die deutsche Buch-Community auf dieses Meisterwerk aufmerksam gemacht. Zudem wissen ihre Follower sicherlich von ihren 11 verschiedenen Ausgaben, die sie sammelt. Aber warum hat sie dieses Buch so gecatcht? In Babel verfolgen wir den chinesischen Waisenjungen Robin, der von dem britischen Professor Lovell nach England gebracht wird. Dort wird er mit dem Lernen von Latein, Altgriechisch, Englisch und Chinesisch darauf vorbereitet, eines Tages in Babel zu studieren. Dies ist das in Oxford ansässige königliche Institut für Übersetzung. Oxford ist das Zentrum allen Wissens und Fortschritts in der Welt. Und ein Traum wird wahr, als Robin dort wirklich studieren kann. Denn in Babel wird nicht nur Übersetzung gelehrt, sondern auch Magie. Das Silberwerken in Verbindung mit Sprache bringt das britische Imperium zu großer Macht, dadurch wurden jedoch auch große Teile der Welt kolonisiert. Während er in Babel studiert, lernt Robin außerdem Freunde kennen, die zum Teil das gleiche Schicksal wie er erleiden müssen und von Rassismus nicht verschont bleiben. Im Laufe seines Studiums gerät Robin zwischen Babel und dem zwielichtigen Hermes-Bund, einer Organisation, die die imperiale Expansion stoppen will. Als Großbritannien einen ungerechten Krieg mit China um Silber und Opium führt, muss Robin sich für eine Seite entscheiden … Aber wird er gegen ein Imperium bestehen? Eins lässt sich jedoch von vorneherein sagen: R.F. Kuang ist eine Meisterin!

Nino Haratischwili und „Das mangelnde Licht“ einer Jugend in Georgien
Wer Bücher über Freundschaften liebt – wie zum Beispiel Stephen Kings „Es“ oder „Meine geniale Freundin“ von Elena Ferrante –, sollte auch dieses Buch lesen. Die in Deutschland lebende, aus Georgien stammende Autorin Nino Haratischwili erzählt in „Das mangelnde Licht“ von vier Freundinnen, die Ende der 80er/Anfang der 90er in Tbilissi aufwachsen. Das ist die georgische Hauptstadt, die fälschlicherweise in Deutschland oft noch Tiflis genannt wird. Die sensible Ich-Erzählerin Keto, die abenteuerhungrige Dina, die schlaue Eigenbrötlerin Ira und die romantische Nene, Nichte des mächtigsten Kriminellen der Stadt, geraten im Roman nicht nur in die Irrungen und Wirrungen der Pubertät – sondern auch in eine Zeit der politischen Unruhe und der Gewalt. Georgien war eines nämlich eines der ersten Länder, das sich 1991 von der kollabierenden Sowjetunion lossagte und die Unabhängigkeit erklärte. Nichts kann die Vier in all dem Chaos trennen – bis ein tragischer Tod und ein Verrat die Clique schließlich auseinandertreibt …

Buchclub | Über Krieg, pinke Schachbücher und koreanische Horrorhasen
Juhu, endlich wieder eine Special-Folge! In der neuesten Buchclub-Folge stellen Celine und Daniel euch Bücher in folgenden Kategorien vor: Current Reads, Lieblingsbücher & Bücher, auf die man sich 2024 freuen darf. Schnell stellen sich hier folgende Fragen: Wie pink darf ein romantisches Buch über Schach sein? Wie ist es, mitten im Krieg groß zu werden? Und wieso kommt es nicht häufiger vor, dass man Milliarden-Erbin wird?

Maximilian Hecker über „Lottewelt“, „Neverheart“ und die grelle Welt des K-Pop
Der in Berlin lebende und aus Bünde stammende Sänger und Songwriter Maximilian Hecker hat eine recht seltsame und faszinierende Karriere: In den Nullerjahren war er der smarte Schmerzensmann der Berlin-Mitte-Indie-Szene und veröffentlichte großartige Alben wie „Infinite Love Songs“ (2001), „Lady Sleep“ (2005) und „I’ll Be A Virgin, I’ll Be A Mountain“ (2010). Über das Berliner Label Kitty-Yo, das international als recht geschmackssicher galt, gelangten seine Alben auch auf den asiatischen Markt. Dort trafen seine intensiven Balladen einen Nerv – was in den Folgejahren dazu führte, dass seine größten Märkte China, Japan und Südkorea wurden. Dort nannte man ihn in den Landesprachen: „der melancholische Prinz“. Heckers Musik lief in K-Dramas und wurde von vielen koreanischen Idols gehört. Selbst die heutigen Superstars BTS empfahlen einmal via Twitter sein 2010er-Album „I’ll Be A Virgin, I’ll Be A Mountain“. https://open.spotify.com/intl-de/album/3opzhZggQUcwCMu5oFmAER?si=treot_QkRl-dLb79nvP-uw Maximilian Hecker hat nie aufgehört, traurig-schöne Musik zu veröffentlichen. Gerade kam das Album „Neverheart“ raus, das den Sound voll auf Heckers Stärken reduziert: Stimme, Klavier und perfekt abgeschmeckte Arrangements irgendwo zwischen Neo-Klassik, Ambient und Pop. Ende letzten Jahres erschien außerdem sein Romandebüt „Lottewelt“. In einer soghaften, lyrischen Prosa erzählt er darin aus dem Leben seines Protagonisten Maximilian Hecker. Dieser hadert mit einem Kindheitstrauma nach dem Tod seiner Schwester Liselotte. Er sucht in den grellen Neonlichtern des Vergnügungsparks „Lotte World“ in Seoul nach der Liebe, ringt mit seinen Projektionen, Abgründen und Gelüsten – und findet am Ende schließlich so etwas wie den eigenen Frieden. Die Parallelen zu seinem realen Leben sind dabei ebenso offensichtlich wie gewollt. Wir sprachen mit Maximilian Hecker über das Buch und das Album – und damit immer wieder auch über das seltsame Karriere-Leben zwischen zwei Kontinenten und die südkoreanische Popwelt, in der Glanz und Schmerz oft nah beieinander liegen.
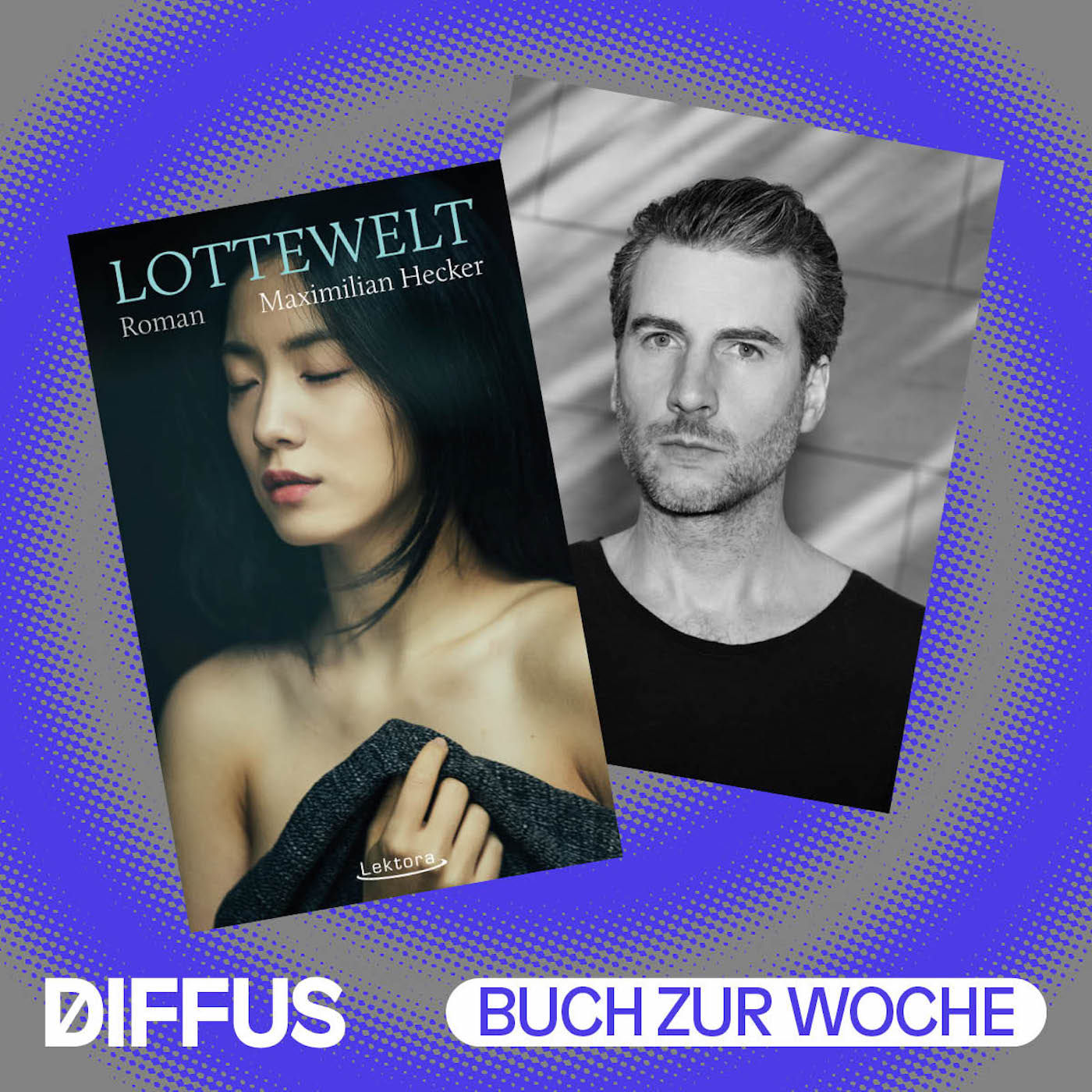
Die Unsterbliche und der Tod bei "Belladonna" von Adalyn Grace
Ein fantastisches und gleichzeitig düsteres Murder Mystery erwartet euch in der neuesten Folge. Was wäre, wenn du nicht sterben könntest, doch alle um dich herum es tun? Und was wäre, wenn du den leibhaftigen Tod sehen könntest, ja sogar mit ihm sprichst? Signa führt ein seltsames Leben und es droht sogar noch verhängnisvoller zu werden, als sie zu ihrer entfernten Familie nach Thorn Grove geschickt wird. Dort geht etwas nicht mit rechten Dingen zu und schonbald muss Signa einen Giftanschlag und einen Mord aufklären und dabei hilft ihr niemand geringeres als der Tod selbst. Ein wundervoll poetisch geschriebenes Werk, das endlich auch auf Deutsch übersetzt wurde. Eines unserer absoluten Highlights im Jahre 2023.

„Wo ich wohne, ist der Mond ganz nah“ von Koreas Literatur-Star Cho Nam-Joo
Cho Nam-Joo ist nicht weniger als ein feministischer Literatur-Star. Ihr Roman „Kim Jiyoung, geboren 1982“ aus dem Jahr 2016 wurde auf der ganzen Welt über zwei Millionen Mal verkauft. Er war in Südkorea nicht nur ein Bestseller, sondern auch Motor der dort ebenfalls längst überfälligen #MeToo-Bewegung. Nach einer Kurzgeschichten-Sammlung namens „Miss Kim weiß Bescheid“ hat Cho Nam-Joo nun wieder einen Roman draußen. Und man kann durchaus sagen: In „Wo ich wohne, ist der Mond ganz nah“ (KiWi Verlag) bleibt sie ihren Themen treu. Das Buch ist nicht nur eine feministische Geschichte, sondern auch ein Roman über Armut und Klasse. Und über den Druck einer Leistungsgesellschaft auf jene, denen der Alltag schon jegliche Kraft raubt, weil er ein einziges Rattenrennen ist. Im Kern der Geschichte steht die Ich-Erzählerin Mani – eine Frau Mitte 30, kinderlos, unverheiratet, noch immer bei den Eltern lebend. Ihr Vater und ihre Mutter haben nicht viel Geld, er führt seit Jahren alleine ein Geschäft, dass mal Kiosk, mal Trödelladen, mal Imbiss ist – und nie so richtig gut läuft. Ihre Mutter ist Hausfrau, und Mani muss mit dem Geld ihres Bürojobs einen Großteil der Familienversorgung stellen. Nach ihrer betriebsbedingten Kündigung wird die Lage noch komplizierter…
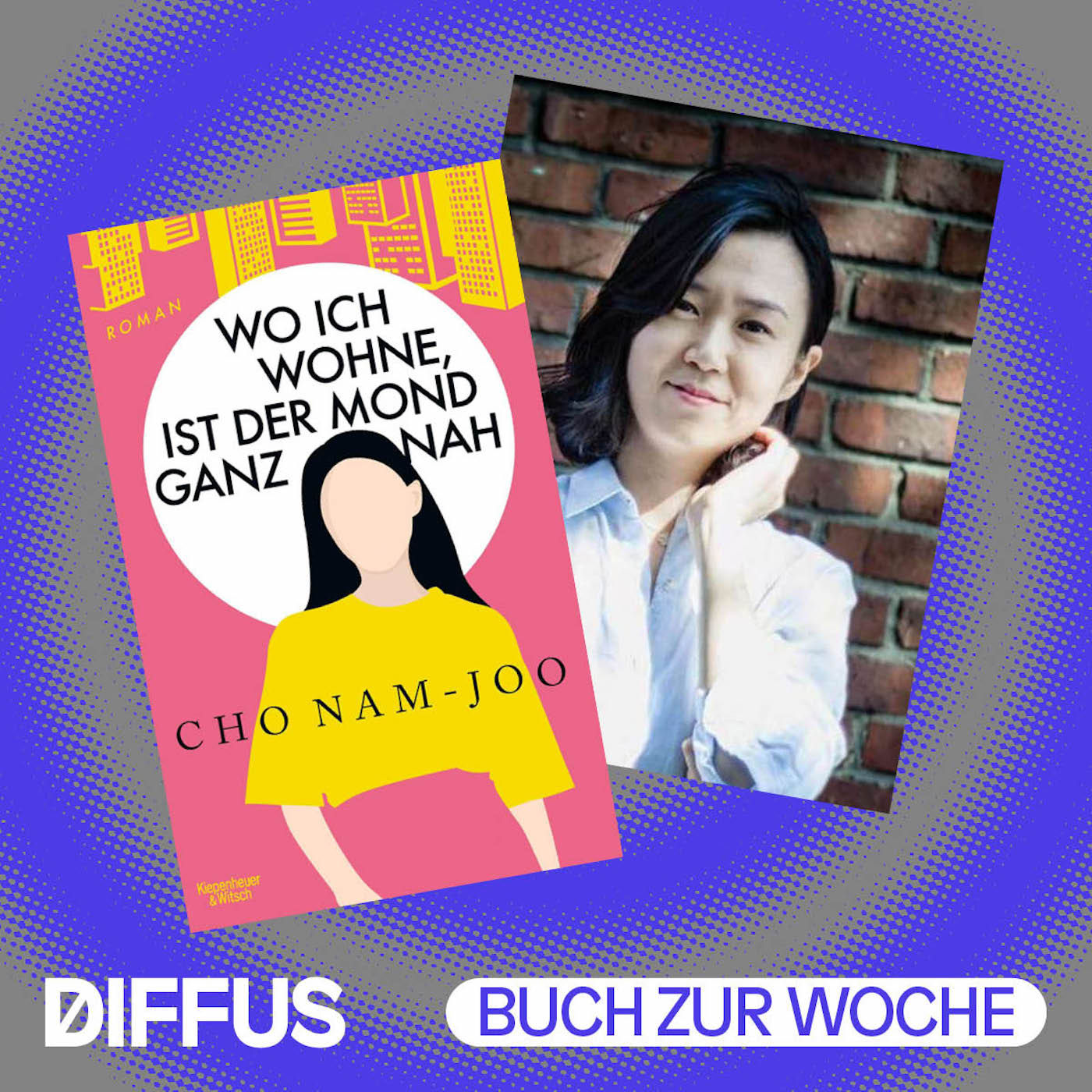
Tödliches Rätselraten bei „Und dann gab's keines mehr" von Agatha Christie
Einen guten Rutsch ins neue Jahr und viele gute Bücher wünscht euch euer Buchpodcast des Vertrauens! Und wir starten ins Jahr mit einem Kriminalklassiker von der „Queen of Crime" herself. Agatha Christie schrieb nämlich 1939 ihr meistverkauftes Werk, was wir euch in dieser Folge näher vorstellen wollen. Es handelt von zehn Menschen, die unter mysteriösen Vorwänden auf eine Privatinsel eingeladen werden. Aber wer hätte ahnen können, dass dieser Besuch auch ihr letzter sein könnte? Denn jeder von ihnen hat sich in der Vergangenheit etwas zu schulden kommen lassen und der mysteriöse Gastgeber hat es sich zur Aufgabe gesetzt, Gerechtigkeit walten zu lassen. Aber mit wem haben sie es hier zu tun? Und ist er vielleicht sogar unter ihnen? Absolut spannend und das perfekte Buch für den „Thrill" zum Jahresbeginn.

Unser Lesejahr 2023: Mordfälle, Anti-Nazi-Klassiker, der charmante Tod und enttäuschende Hexen
Die letzte Folge des Jahres wird beim „Buch zur Woche“ noch einmal besonders: Zum ersten Mal moderieren unsere Hosts Celine Leonora und Daniel Koch gemeinsam und schauen zurück auf ihr persönliches Lesejahr. Wer war der Underdog? Was war das beste Buch des Jahres? Welcher Geheimtipp könnte mehr Aufmerksamkeit gebrauchen? Was war das schlimmste Buch des Jahres? Auf welches Buch freut man sich 2024? Was liest sich am besten zwischen den Jahren? Warum ist der Tod in vielen Büchern eigentlich ganz nett? Kann man Podcasts als Roman erzählen? Was hilft gegen Leseflaute? Wie groß ist der Stapel der ungelesenen Bücher? Warum werden schlecht geschriebene Romane zu Bestsellern? Diese Fragen klären die beiden in diesem Podcast. Die nächste Folge vom „Buch zur Woche“ gibt’s dann bereits am 03. Januar mit Celine Leonora.

„Oppenheimer“ war lame, lest lieber „MANIAC“ von Benjamín Labatut
Der chilenische Autor Benjamin Labatut hatte uns schon mit seinem ersten Buch überzeugt. „Das Blinde Licht“ kam 2020 auf Deutsch raus und erzählte von vier Wissenschaftlern, die entweder wegen ihrer Arbeit dem Wahn verfielen, oder aber der Menschheit Gutes tun wollten – und am Ende großes Unglück anrichteten. Zum Beispiel Fritz Haber, dessen physikalische Verfahren zwar eine Hungerkrise vermeiden konnten, aber auch das diabolischste Werkzeug der Nationalsozialisten hervorbrachten. Mit seinem zweiten Roman „MANIAC“ (Suhrkamp Verlag, in der Übersetzung von Thomas Brovot) hat Labatut schon wieder so ein „fiktives Werk, das auf Tatsachen beruht“ geschrieben, wie er es nennt. Und wenn ihr bei dem Titel jetzt an Verrückte denkt, liegt ihr nur so halb richtig. Zwar geht es in diesem Roman um intelligente Menschen, die manchmal dem Wahnsinn recht nahe sind. Aber auch um einen Computer namens „Mathematical Analyzer Numerical Integrator And Computer Model“. Kurz: MANIAC. Labatuts Roman ist in seiner Form schwer zu beschreiben. Er umkreist in einzelnen Kapiteln immer wieder den Mathematiker John von Neumann. Labatut geht dabei zunächst chronologisch vor und erzählt einzelne Abschnitte aus von Neumanns Leben aus der Sicht von Weggefährtinnen oder Kollegen. Er tut das aber vor allem, um die Geschichte jener Wissenschaft zu erzählen, die uns die Atombombe, die Wasserstoffbombe, den Kalten Krieg – und die Künstliche Intelligenz brachte. Ein Wissenschafts-Thriller, der die moralischen Fragen stellt, die Christopher Nolan in seinem etwas blasierten und verlaberten Blockbuster nur andeuten wollte.
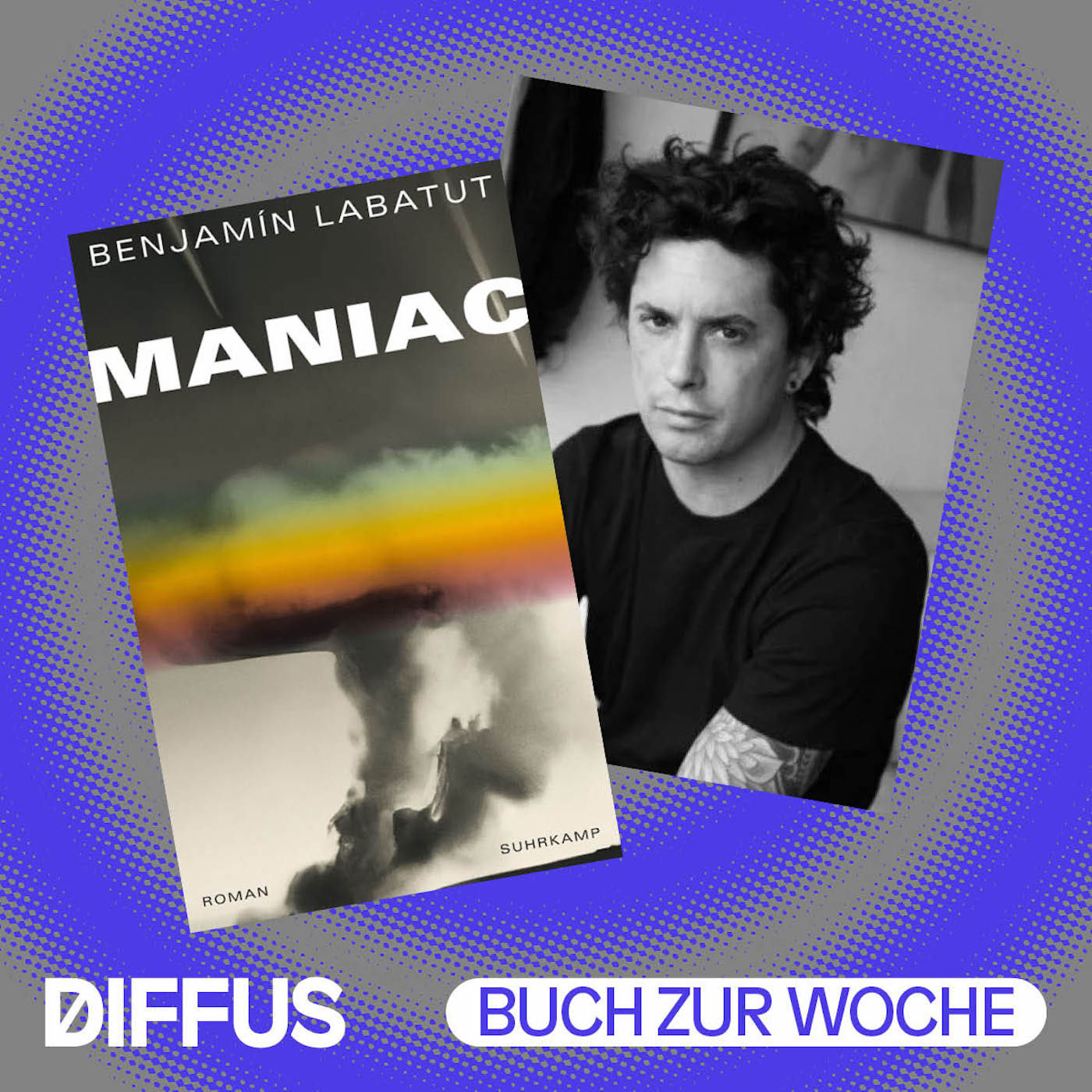
Fantastischer Herzschmerz bei „Once Upon A Broken Heart" von Stephanie Garber
Fantasy, Herzschmerz und viele Geheimnisse erwarten euch bei „Once Upon A Broken Heart" von Stephanie Garber. Eines von Celine Leonoras absoluten Lieblingsbüchern. Sie hat sich sehr gefreut, als sie erfahren hat, dass dieses Buch nun auch auf Deutsch übersetzt wurde. Also gibt es keine Ausreden mehr für alle Romantasy-Liebhaber, dieses Buch nicht zu lesen! Es geht um Evangeline Fox, die von Liebeskummer getrieben einen enormen Fehler macht, denn sie geht einen Deal mit einer Schicksalsmacht ein. Aber Evangeline sucht nicht nur irgendeine Schicksalsmacht auf, nein, sie geht einen Pakt mit Jacks, dem Prinz der Herzen, ein. Dieser hat nicht nur gute Absichten Evangeline gegenüber. Aber ist sie wirklich dazu bereit, den vollen Preis zu zahlen? Es geht um Verrat, Geheimnisse, Mord und vieles mehr. Also lasst euch von dieser fantastischen Welt verzaubern.
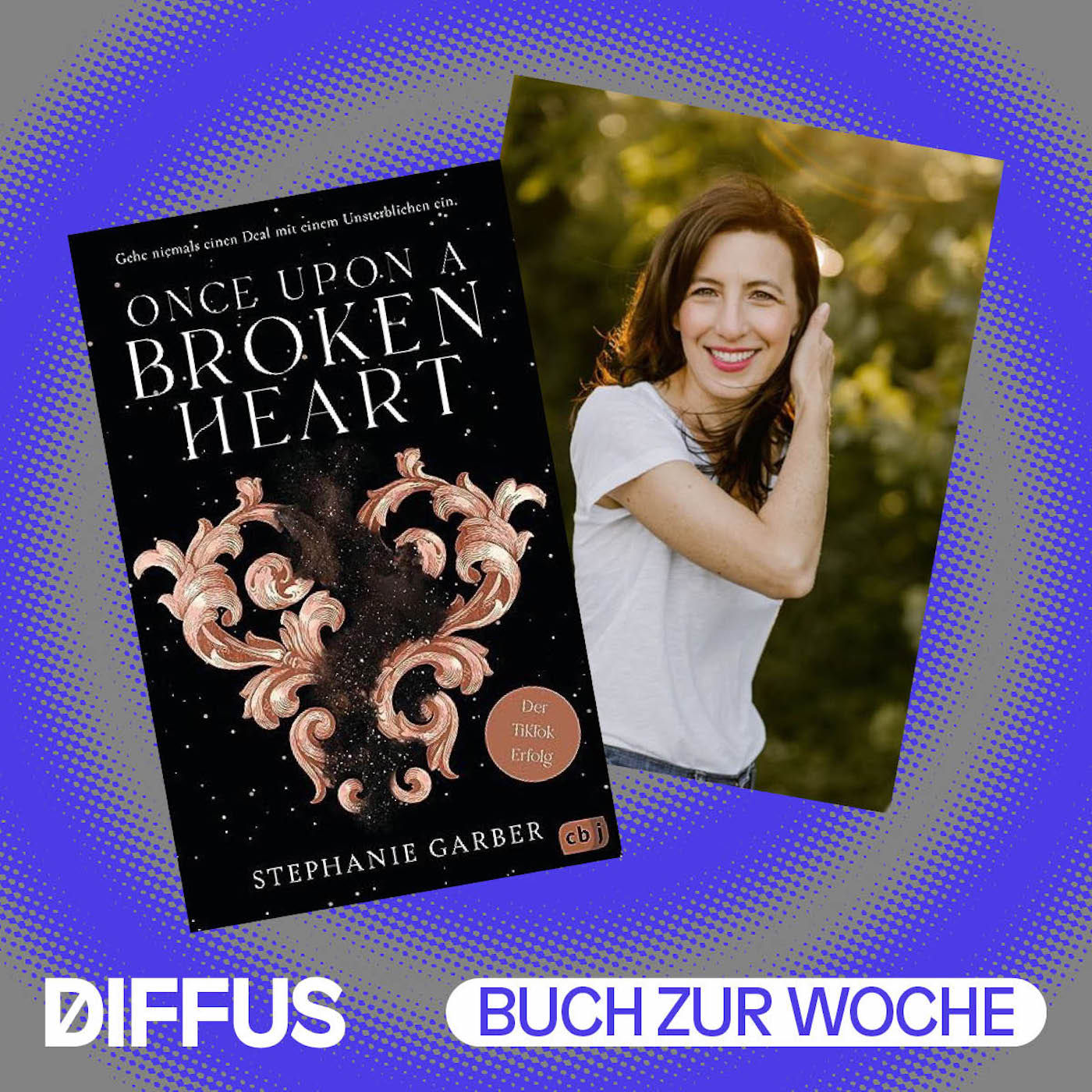
Mögen wir Snow? "Die Tribute von Panem X" von Suzanne Collins
Endlich können wir mit dem neu erschienenen Kinofilm wieder in die Welt von Tribute von Panem eintauchen. Ein toller Zeitpunkt vorher mal in das Buch "Tribute von Panem X - Das Lied von Vogel und Schlange" reinzulesen, oder? Denn dieses Buch hat es in sich! Oder hättet ihr euch vorstellen können mal Sympathie für Präsident Snow zu empfinden? Denn genau aus dessen Sicht lesen wir dieses Buch, das 65 Jahre früher spielt, als die Haupttrilogie. Aber warum sollte man bitte mit diesem unmoralischen Charakter sympathisieren? Hört doch gerne in unsere Podcast Folge rein und findet es heraus.
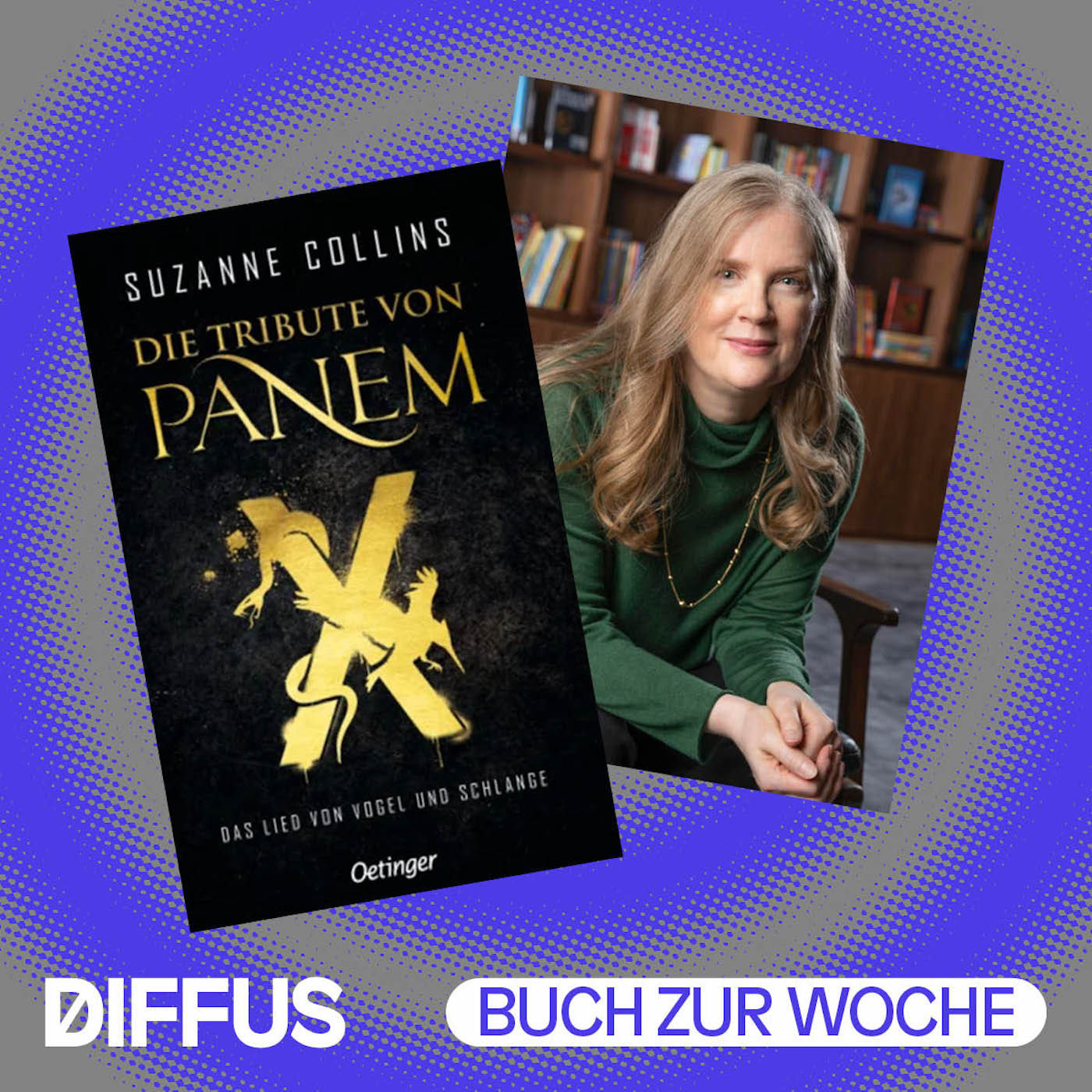
Claire Dederer fragt: Ist mein Lieblingskünstler „Genie oder Monster“ oder beides?
Triggerwarnung: In dem hier vorgestellten Buch und deshalb auch in dieser Folge geht es um sexuelle und sexualisierte Gewalt sowie Beispiele zu diesen Themen. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Claire Dederer widmete sich dem Thema ihres Buches „Genie oder Monster – Von der Schwierigkeit, Künstler und Werk zu trennen“ zum ersten Mal in einem Essay im Jahr 2017. Darin stellte sie sich und ihren Leser:innen die Frage: „Was machen wir mit der Kunst monströser Männer?“ Es war das Jahr, in dem das übergriffige Verhalten von Hollywood-Mogul Harvey Weinstein publik wurde und die #MeToo-Bewegung ihre volle Wucht entfaltete. Im Buch erzählt Dederer, wie sie danach vor allem von junge Menschen immer wieder gefragt wurde, ob man zum Beispiel die Musik von David Bowie noch hören dürfe. Bowie hat einige Kapitel in seiner Biografie, die unter heutigen Gesichtspunkten mindestens problematisch, vielleicht sogar justitiabel waren – zum Beispiel „teilte“ er sich in seinen Berlin-Jahren mit Iggy Pop eine minderjährige Geliebte. Dederer musste jedoch die Fragenden enttäuschen: Ein simples „Ja“ oder „Nein“ konnte sie ihnen nicht liefern. Sie schreibt auch in diesem Buch, ein guter Autor oder eine gute Autorin solle den Lesenden nicht vorschreiben, was sie mit ihrem eigenen Leben machen will. Dederer interessiere die klare Lösung also weniger, als eine genaue Analyse des Problems. Die Kernfrage für sie sei: „Was geschieht, wenn wir diese Kunstwerke konsumieren?“ Diese Schlüsselzeile ist so etwas wie die Bedienungsanleitung von „Genie oder Monster“. Claire Dederer seziert in diesem Buch ihren eigenen Kampf mit der Problematik problematischer Künstler und deren Kunstwerken. Einfache Antworten findet sie dabei nicht – weder für sich noch für uns als Lesende. Aber ihre klugen (und bei aller Schwere des Themas oft erstaunlich unterhaltsamen) Analysen nehmen die richtigen Fragen ins Visier: Welches System ermöglicht monströses Verhalten? Wie wirkt sich das auf die Rezeption eines Kunstwerks aus? Wie reagiert die Kulturkritik auf diese Kunstwerke? Wer ist das überhaupt, der da diese Kritiken schreibt? Eines vergisst Claire Dederer dabei allerdings nie: das Leid der Opfer. Wenn man als Musik- und Filmfan allein auf dieses Jahr zurückblickt, spürt man schnell, dass man ein Buch wie dieses lesen sollte. Denn auch das dürfte allen klar sein: Wir alle werden in den nächsten Jahren noch das ein oder andere Mal mit Geschichten über geliebte Künstler (und manchmal vielleicht auch Künstlerinnen) konfrontiert werden, die uns verstören, enttäuschen und schockieren werden. Mit diesem ebenso klugen, wie mitreißenden Buch ist man dem nun ein wenig besser gewappnet. In unserer aktuellen, ersten Print-Ausgabe von DIFFUS könnt ihr ein komplettes Kapitel des Buches bereits lesen. „Genie oder Monster – Von der Schwierigkeit, Künstler und Werk zu trennen“ von Claire Dederer ist soeben im Piper Verlag in der deutschen Übersetzung von Violeta Topalova erschienen.
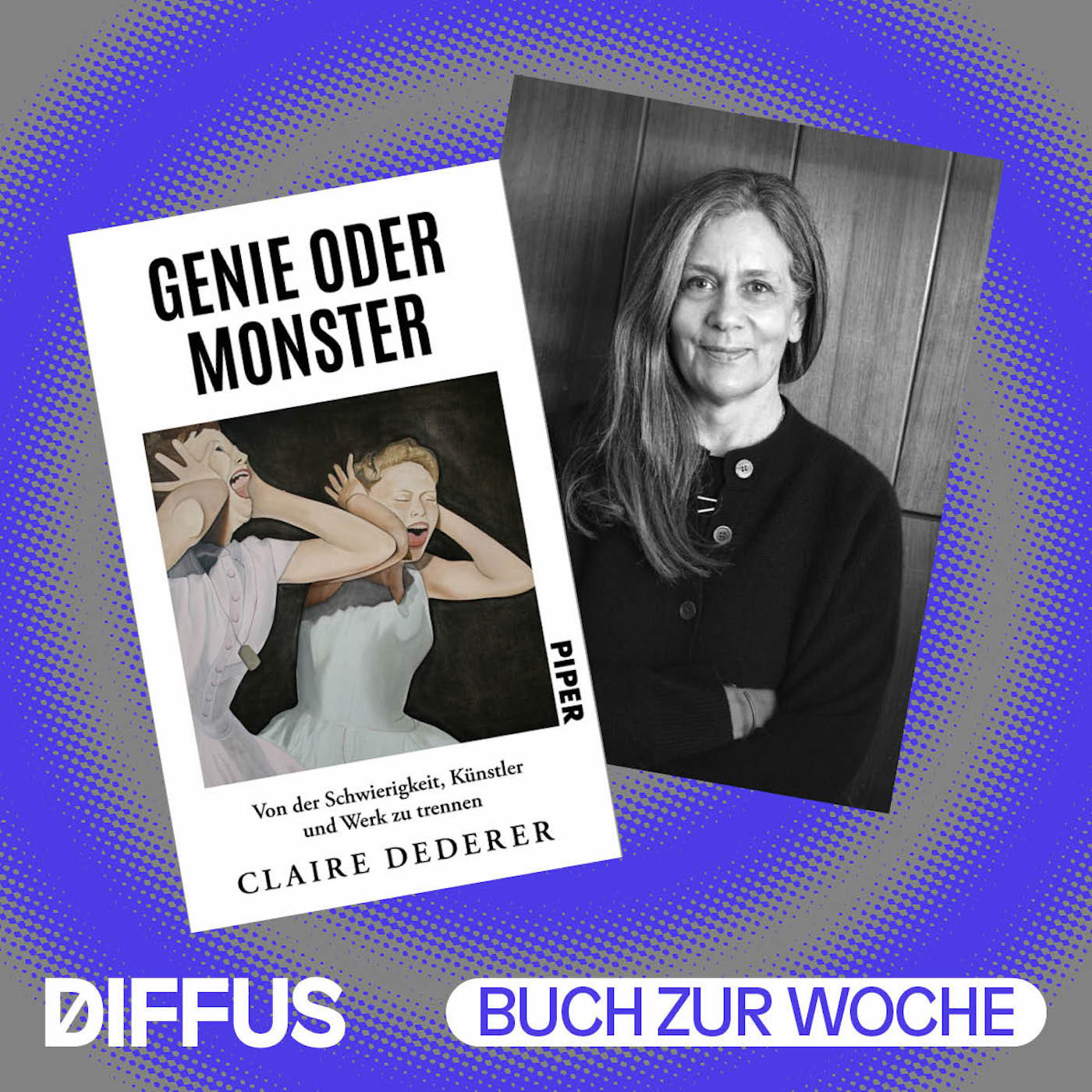
Dark Academia Vibes mit „If We Were Villains" von M.L. Rio
Passend zu den kalten, düsteren Tagen stellen wir euch ein absolutes Herbst-Highlight vor: „If We Were Villains". Und dieses Buch hat es in sich! Wir begleiten sieben Freunde auf ihrem Weg durch ihr Schauspielstudium am Dellecher College. Sie werden förmlich von den Shakespearestücken absorbiert, woraufhin es bald schwer wird zu unterscheiden, was Schauspiel und was die Realität ist. Sie legen die Rollen im echten Leben immer seltener ab und plötzlich treibt einer der sieben tot im College See. Aber war das wirklich ein Unfall? Was ist nur in dieser Nacht geschehen und wer von den übrigen sechs spielt seine Rolle etwas zu gut? Das Ende dieses Buches wird euch zerstören. Also ab auf eure Wunschliste damit!
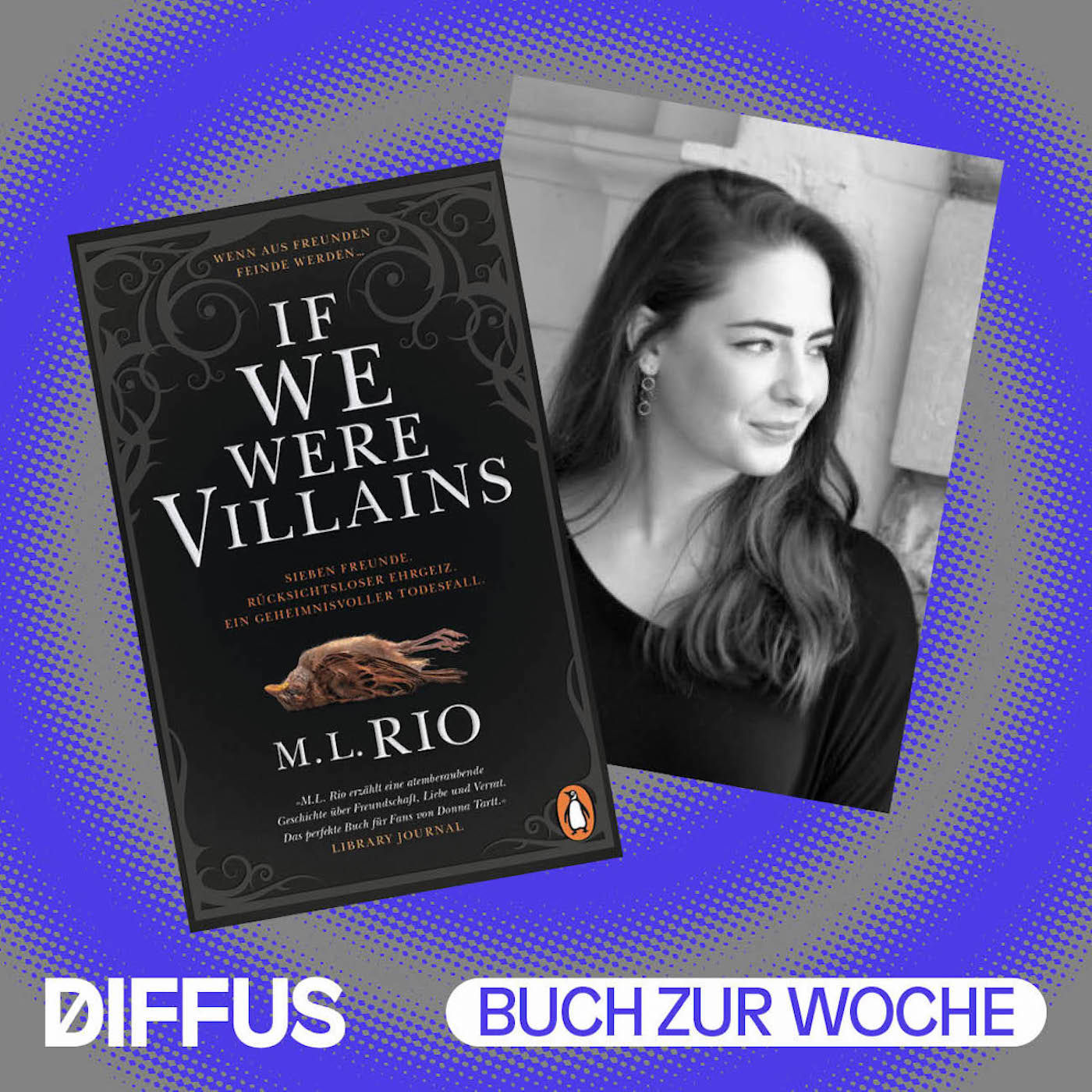
Wir sind hier nicht in Seattle: Dirk Gieselmann im Gespräch über Pearl Jam
Heute haben wir wieder eine Interview-Folge für euch. Daniel Koch spricht mit dem Journalisten und Autor Dirk Gieselmann über Grunge, das Aufwachsen in der Provinz und den richtigen Moment, in dem man seinen alten Held:innen „Goodbye“ sagen sollte. Dirk hat soeben einen neuen Band namens „Pearl Jam“ in der „KiWi Musikbibliothek“ veröffentlicht. In dieser feinen Buchreihe schreiben prominenten Autor:innen Essays oder manchmal auch Novellen über jeweils einen Musik-Act, der ihr Leben verändert hat. Dirk, der früher im Jahr sein sehr gutes Romandebüt „Der Inselmann“ veröffentlich hat, schreibt auf gut 100 Seiten von seiner frühen Liebe zu Pearl Jam. Dabei spricht er gar nicht so sehr über die Bandgeschichte und die Ursprünge des Grunge, sondern erzählt eine sehr schöne, autiobiografische Coming-of-Age-Geschichte aus der Provinz. „Pearl Jam“ von Dirk Gieselmann erscheint in dieser Woche und ihr könnt es ab Donnerstag in jedem Buchladen kaufen – oder aber: Bei uns gewinnen. Schreibt uns einfach eine Mail mit dem Stichwort „Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk“ und eurer Postadresse an verlosung@diffusmag.de. Und mit ein wenig Glück, gewinnt ihr eines von drei Exemplaren, die wir für euch bei KiWi klar gemacht haben. Viel Glück dabei – und jetzt viel Spaß beim Interview …
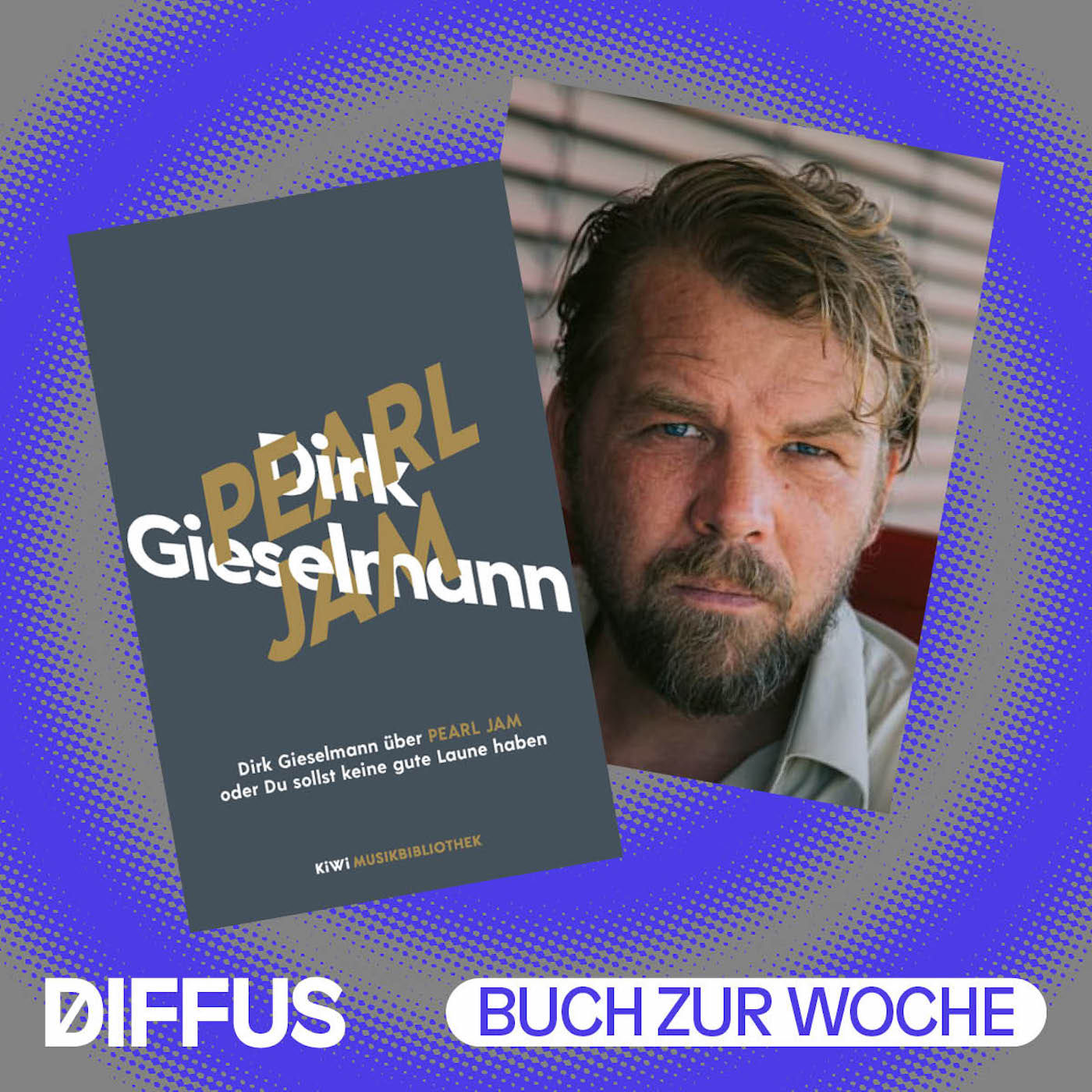
Unmoralische Helden mit "Vicious" von V. E. Schwab
X-Men trifft auf spannenden Rache-Thriller! Klingt interessant? Ist es auch! Wie wir V. E. Schwab dafür lieben, dass sie unsere Moralvorstellungen mit nur einem Buch völlig über Bord werfen kann. Denn in "Vicious" gibt es nur moralisch graue Charaktere und das Lustige ist, dass man den einen für das verachtet, was man an den anderen schätzt. Von der Kritik wurde Vicious außerdem als eine brillante Erkundung des Superheldenmythos und als ein fesselnder Rache-Thriller bezeichnet und gelobt. Ein perfektes Buch für die Halloweenzeit, denn manche Szenen sind nichts für schwache Nerven.

Gereon Klug zählt „Die Nachteile von Menschen“ auf und amüsiert sich über Böhse Onkelz
Diesmal geht es um das neue Buch von Gereon Klug. „Die Nachteile von Menschen – 132 Beschädigungen aus dem reflektierten Leben“ heißt es und ist soeben beim Ventil Verlag erschienen. Außerdem ist Gereon Klug jetzt und in den nächsten Monaten auf Lesetour unterwegs – präsentiert von DIFFUS. Das wäre schon ein guter Grund, dieses Buch hier vorzustellen, aber der bessere ist dieser: Es ist wirklich saulustig. Geron Klug ist der Gründer des Plattenladens Hanseplatte, war Tourmanager von Studio Braun, hatte mal ein Label namens Nobistor, war Werbetexter, schrieb an wichtigen Deichkind-Hits wie „Leider Geil“ oder „Wer sagt denn das?“ mit und tauchte über die Jahre mit Glossen und Artikeln immer mal wieder in Medien vom Handelsblatt bis zur Titanic auf. Ihr seht also schon: Gereon Klug ist ein umtriebiger Geselle. Und das merkt man auch seinem neuen Buch an. „Die Nachteile von Menschen – 132 Beschädigungen aus dem reflektierten Leben“ ist nämlich streng genommen das überall zusammengefegte Oeuvre dieses Mannes. Die 132 Texte setzen sich aus Romanfragmenten, seltsamen Listen, Glossen, die er für die Wochenzeitung Die Zeit geschrieben hat, Pressemitteilungen des Golden Pudel Clubs, Newslettertexten und Kurzprosastücken zusammen. Klingt chaotisch und ist es auch ein wenig. Trotzdem macht dieser Band eine große Freude, wenn man ihn so häppchenweise liest, wie er entstanden ist.
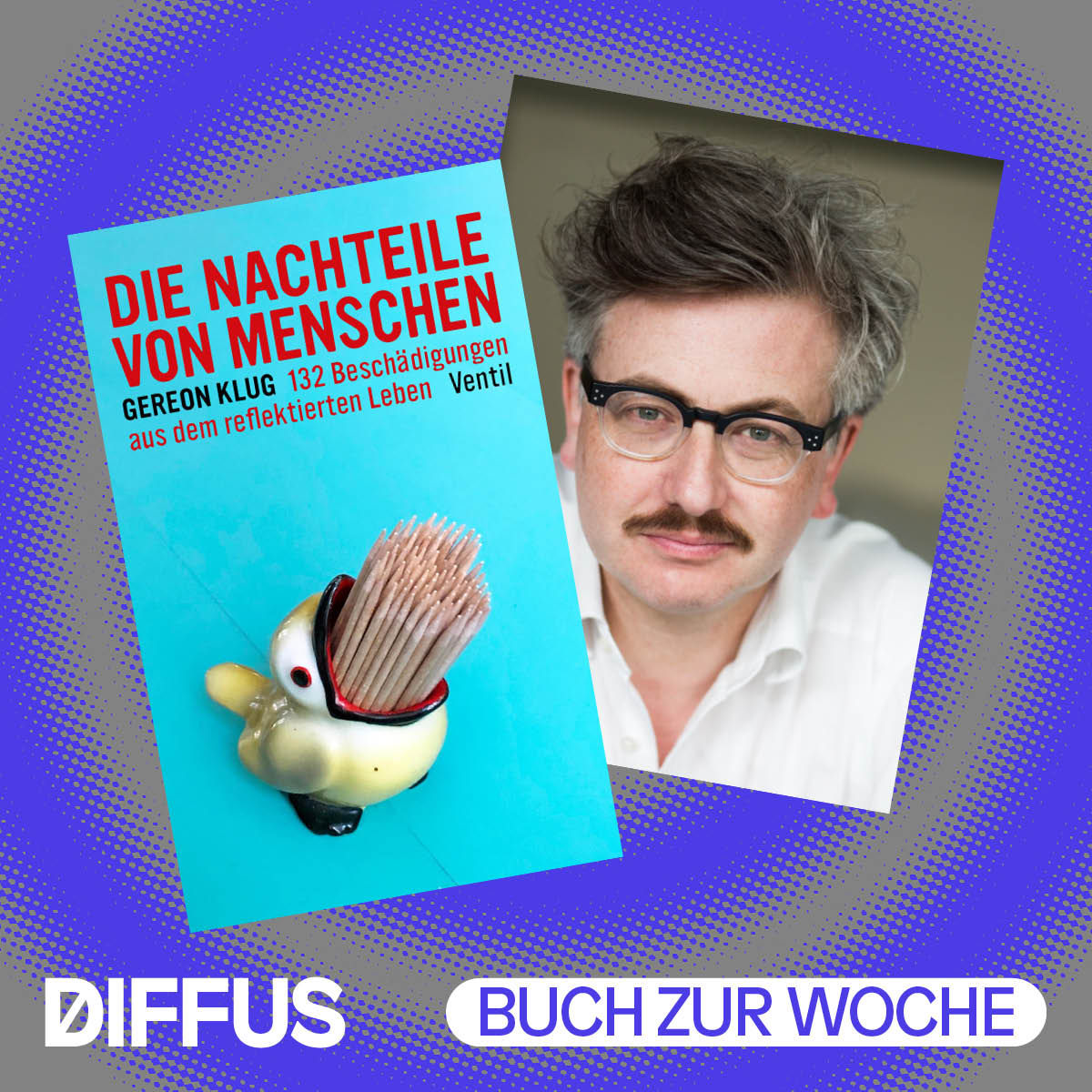
Rebellische Neuerzählung mit „Ich bin Circe" von Madeline Miller
Für alle, die sich bislang nicht so recht vom Sommer verabschieden wollen, haben wir hier einen Kompromiss in Buchform. Die griechische Nacherzählung „Ich bin Circe“ von Madeline Miller – und die ist unserer Meinung nach viel zu underhyped. Es ist eine feministische Neudeutung und behandelt das Leben der Göttin Circe in allen Facetten. Neben herzzerreißenden Themen wie: Isolation, Mutterschaft und die patriarchale Welt der Antike, treffen wir in der Geschichte auch viele bekannte Charaktere der Mythologie wieder. Ein Buch, was sich schnell zu euren absoluten Lieblingsbüchern gesellen wird, wenn ihr nicht aufpasst.
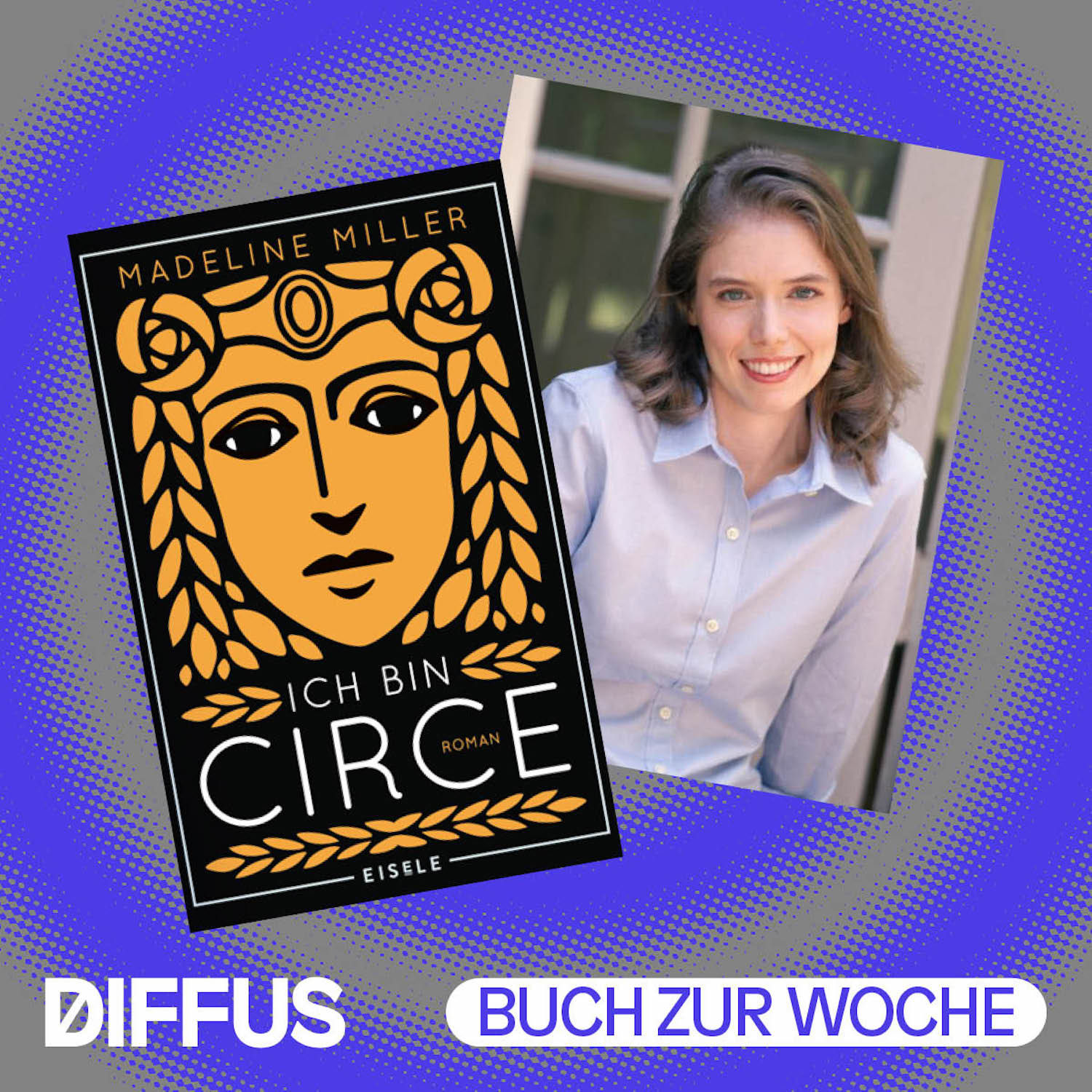
Olga Bach im Gespräch über ihr Romandebüt „Kinder der Stadt"
Olga Bach ist eigentlich schon eine recht namhafte Autorin – aber eher in der Theaterwelt. Mit Stücken wie „Die Vernichtung“, „Das Erbe“ oder „Kaspar Hauser und Söhne“ hat sie sich dort einen Namen gemacht. Sie schrieb all diese Stücke für den in der Türkei geborenen Regisseur Ersan Mondtag, der so etwas wie ein Shooting Star der Berliner Theaterwelt ist. Auch in ihrem Romandebüt „Kinder der Stadt“ gibt es so ein Dreamteam aus Autorin – die hier Irina heißt – und einem Regisseur namens Orhan. Die beiden sollen für einen zahlungskräftigen Mäzen und dessen Museum eine Theater-Performance produzieren. Gut bezahlt sei das, künstlerische Freiheit wäre gewährleistet – Win-Win für alle. So läuft es natürlich nicht. Aber dieser frustrierende Fail einer Zusammenarbeit ist nur so etwas wie der dramaturgische Auslöser für eine sehr politische Geschichte über Familie, Freundschaft, die Verletzungen der Vergangenheit und dem Leben in Berlin und Istanbul in den Nullerjahren und der Jetztzeit. Die Freundschaft von Irina zu Orhan und ihrer Jugendfreundin Maria, machen dabei das Herz des Buches aus. Von den dreien und ihren Familien erzählt Olga Bach in schnellen Kapiteln, die auf drei Zeit-Ebenen spielen – eine Struktur, die auf den ersten Seiten noch ein wenig herausfordernd ist, dann aber einen erstaunlichen Sog entwickelt. Vor allem die Kapitel, in denen Irina, Orhan und Maria in Berlin aufwachsen, wirken vom Flow ein wenig, als hätte sie einen Makko oder einen BHZ-Song in Literatur verwandelt. Wir sprechen ausführlich über das Buch, die Verbindungen in die Realität und die Brücken zwischen Literatur und Theater.

Ein tödlicher Roadtrip mit „Five Survive" von Holly Jackson
Aufgepasst, in der heutigen Folge wird es nervenaufreibend! „ACHT STUNDEN. SECHS FREUNDE. EIN TÖDLICHER ROADTRIP." So wird das neue Buch von Holly Jackson „Five Survive“ beschrieben. Besser als jede Koffeintablette kommt der Locked-Room-Thriller daher und erzählt von sechs Freund:innen, die auf dem Weg zum Springbreak mit ihrem Camper liegen bleiben. Kann ja mal passieren, oder? Falsch, denn die Panne haben wir nicht den spröden Reifen zu verdanken, sondern einem Scharfschützen, der sich in der dunklen Nacht versteckt und eine Forderung stellt. Er verlangt ein bestimmtes Geheimnis von einer der anwesenden Personen, aber was, wenn eigentlich jeder ein Geheimnis verbirgt? Hören auf eigene Gefahr!
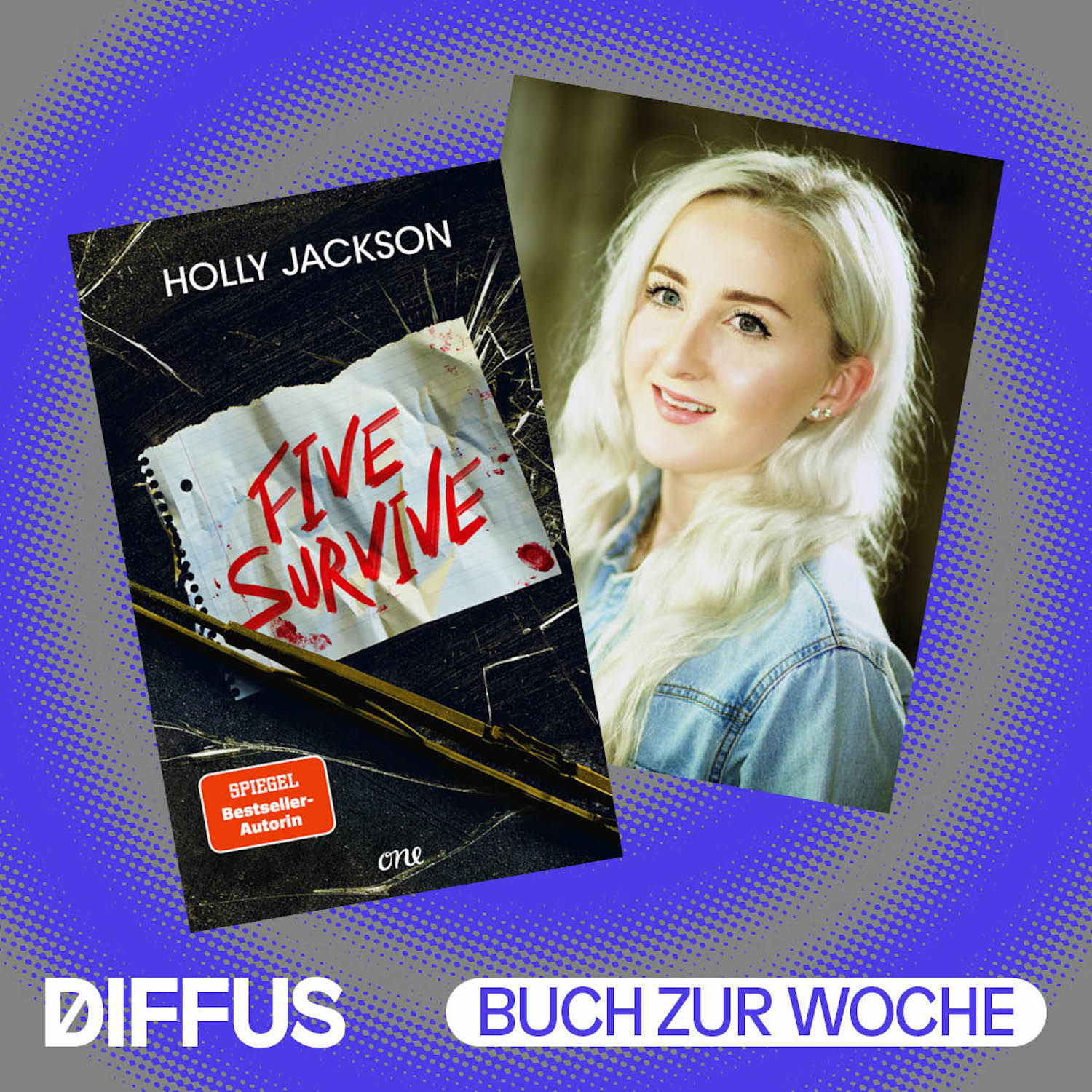
Lieblingsbücher: „Morgen, morgen und wieder morgen“ von Gabrielle Zevin
Heute möchten wir euch mal wieder ein Lieblingsbuch vorstellen. Wir haben nämlich gerade einen harten Crush auf den Roman „Morgen, morgen und wieder morgen“ von Gabrielle Zevin – und der ist gerade erst im Frühjahr bei Eichborn in der deutschen Übersetzung von Sonia Bonné erschienen. Wer seine Buchtipps bei Bookstagram holt, wird jetzt vermutlich nur müde lächeln. Denn Zevins Roman wird da schon seit 2022 gelobt und gepriesen, als er auf Englisch erschienen ist. Der größte und räuberischste Buchhändler Amazon hat den Roman sogar zum „Besten Buch des Jahres“ gekrönt. Diese Folge ist also ein kurzes: „Believe the Hype“. Vordergründig ist „Morgen, Morgen und wieder morgen“ ein Roman über die Gaming-Kultur der 90er und Nullerjahre. Im Mittelpunkt stehen Sam und Sadie, die sich schon im Kindesalter kennenlernen. Sie sind so um die 11 Jahre, als sie sich in einem Krankenhaus begegenen und über eine Party Super Mario Brothers bonden. Sam hat gerade einen schweren Unfall hinter sich und sein Fuß ist ganze 27. Mal gebrochen. Außerdem hat er einen ihm sehr wichtigen Menschen verloren – was auch der Grund ist, warum er wochenlang nicht gesprochen hat. Bis sich Sadie zu ihm setzt. Aus dieser Szene entwickelt sich eine langjährige Freundschaft, die nicht ganz unproblematisch ist …
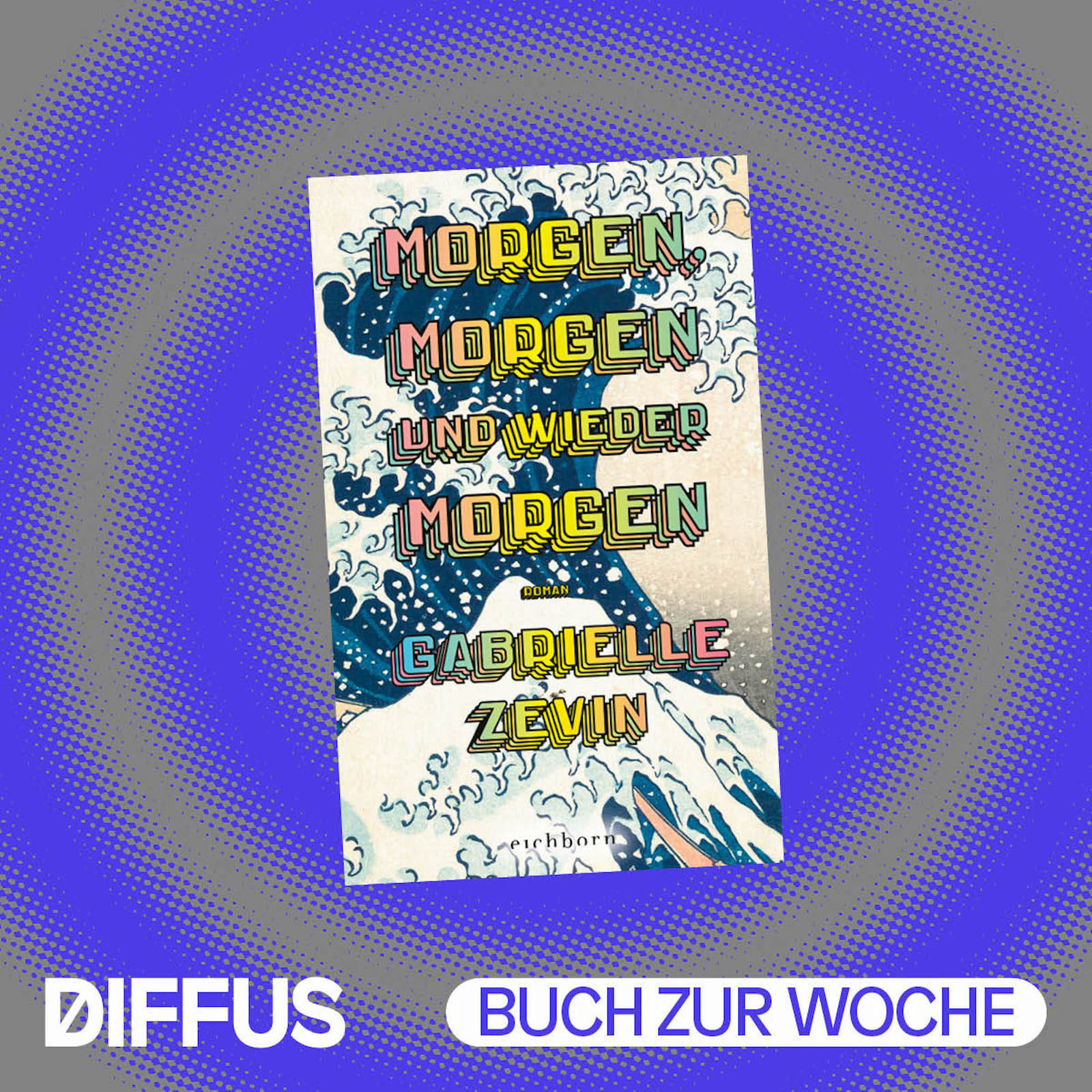
Dunkle Zukunftsvisionen mit „Scythe“ von Neal Shusterman
Was würde passieren, wenn wir alles wissen, was es zu wissen gibt? Wenn wir in einer Welt leben würden, in der wir den natürlichen Tod besiegt haben und eine KI besser regiert, als es Menschen jemals hätten schaffen können? Klingt zu schön, um wahr zu sein? Ist es auch. Denn in dieser Welt bestimmen die Scythe über den Tod. Ausgebildete Sensenmänner, die sich dem „Nachlesen" von Menschen verschworen haben und diese Macht nicht nur für die Zwecke des Gemeinwohls nutzen.Und mittendrin stecken Citra und Rowan, zwei Teenager, die die Chance erhalten, das Amt des Tötens zu erlernen. Doch was, wenn diese Ausbildung einen alles kosten könnte? Ein Buch, was einen zum Nachdenken anregt und gleichzeitig mitfiebern lässt, über eine Welt, in der der Schein trügen kann – vorgestellt von unserer neuen Podcast-Host Celine Leonora!

Sophie Passmann und die „Pick Me Girls“
In dieser Folge geht es um ein Buch, das ihr bald vermutlich in wirklich jeder Buchhandlung finden werdet. Diese Prognose darf man ruhigen Gewissens abgeben. Ebenso wie die folgenden: Das Buch wird ein „Spiegel"-Bestseller. Es wird mindestens einen Shitstorm gegen die Autorin auslösen (denn das war bei ihr leider irgendwie immer so). Und es wird einen Begriff salonfähig machen, den man bisher vor allem bei TikTok und im feministischen Popkulturdiskurs fand und verstand. Und damit wären wir bei „Pick Me Girls“ von Sophie Passmann, das soeben beim KiWi-Verlag erschienen ist. Die Autorin, Schauspielerin, X-Twitter-Prominenz, Moderatorin und Podcasterin verhandelt in diesem Buch vor allem ihre eigene Biografie. Sie sagt selbst, sie sei das größte Pick Me Girl gewesen, das sie kennt – und seziert, warum sie diese Rolle eingenommen hat. Warum man(n) das lesen sollte, erfahrt ihr in dieser Folge.
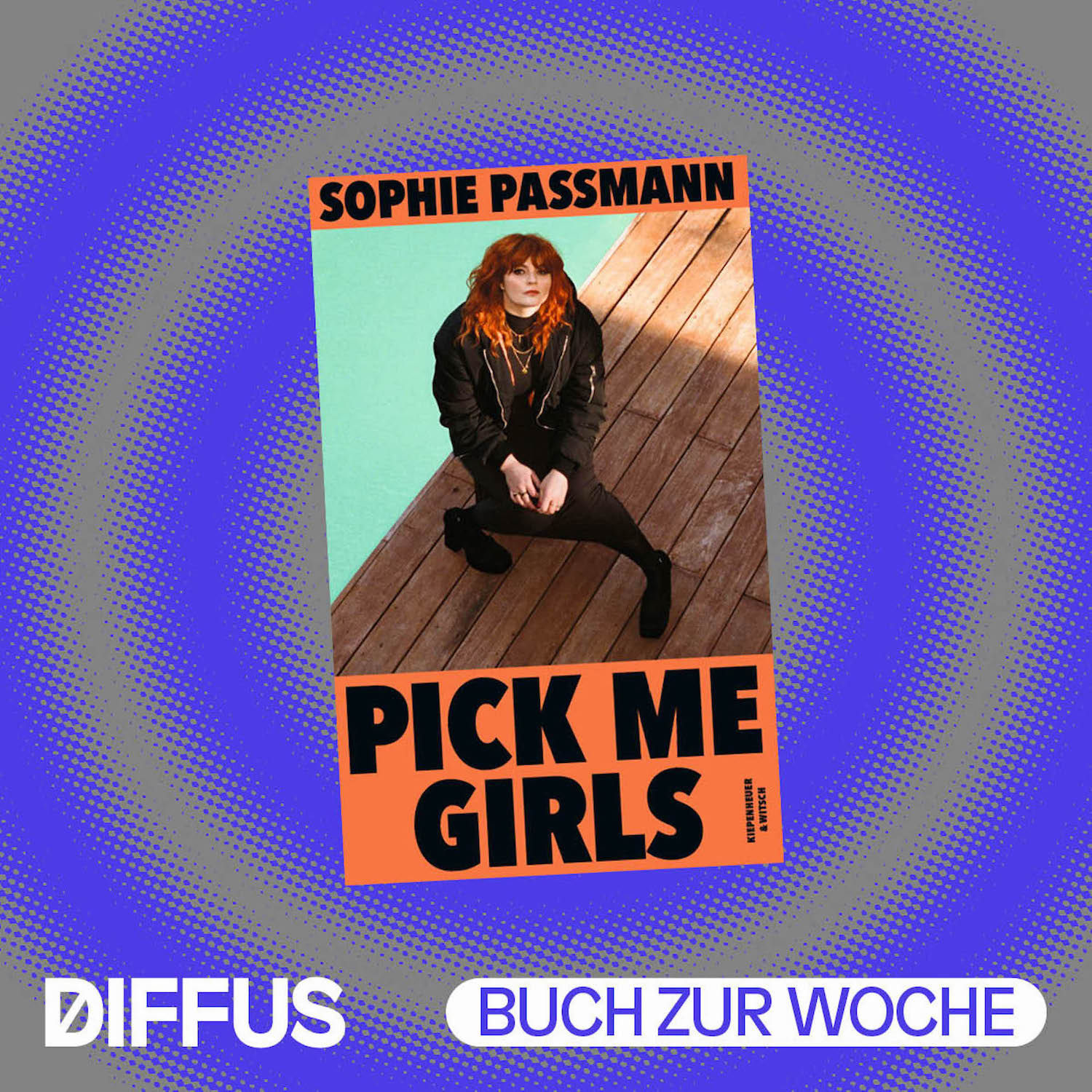
Im traurigen Teil von Hollywood mit Joan Didion und „Play It As It Lays“
Mit dieser Folge melden wir uns aus der Sommerpause zurück und haben ein Buch dabei, das sehr gut zu den letzten warmen Tagen passt, die da hoffentlich noch kommen mögen: „Play It As It Lays“ von Joan Didion. Im Original aus dem Jahr 1970, ist es soeben neu aufgelegt im Ullstein Verlag erschienen. In der Übersetzung von Antje Rávik Strubel. „Play it as it lays“ ist ein Roman – und das muss man bei Joan Didion durchaus hervorheben. Denn die im Dezember 2021 verstorbene amerikanische Autorin ist in erster Linie für ihre journalistischen, autobiografischen und essayistischen Texte bekannt. In Deutschland schätzt man vor allem ihr Buch „Das Jahr des magischen Denkens“, in dem sie 2005 den Tod ihres Ehemannes John Dunne und die lebensbedrohliche Krankheit ihrer Adoptivtochter verarbeitete. „Play It As It Lays“ erzählt vom Leben der Reichen und Schönen und Traurigen und Neurotischen im Hollywood der 60er Jahre – eine Welt, die Joan Didion sehr gut kannte. Die Hauptfigur ist Maria Wyeth Lang – eine charismatische, schöne Frau, deren Karriere als Schauspielerin aber nie so richtig in Fahrt kam. Sie erholt sich in einer Nervenklinik von einer Art emotionalem Zusammenbruch. Auch Marias vierjährige Tochter lebt in einer Klinik: Sie hat eine geistige Behinderung und braucht permanente Pflege. Maria will ein Leben führen, in dem auch Kate einen Platz, aber weder sie noch ihr Ehemann – der Regisseur Carter Lang – vermögen es, ihre Arbeit und ihr Leben so einzurichten, dass das möglich ist. „Play It As It Lays“ ist für ältere Lesende natürlich alles andere als ein Geheimtipp. Das Buch wurde in diversen Bestenlisten und in zahlreichen Nachrufen auf Joan Didion als die große amerikanische Literatur geehrt, die es nun mal ist. Warum also hier diese neue Übersetzung noch einmal vorstellen? Vielleicht weil es ein zeitlos gutes Buch ist und nichts von seiner Eleganz und seiner Wucht verloren hat. Und vielleicht auch, weil es gut zu einer jüngeren Leser:innenschaft passt, die vielleicht Freude an den Büchern von Emma Cline und Lisa Taddeo hatten, die mit ähnlichen Geschichten und in einer ähnlichen Sprache große Erfolge feierten.
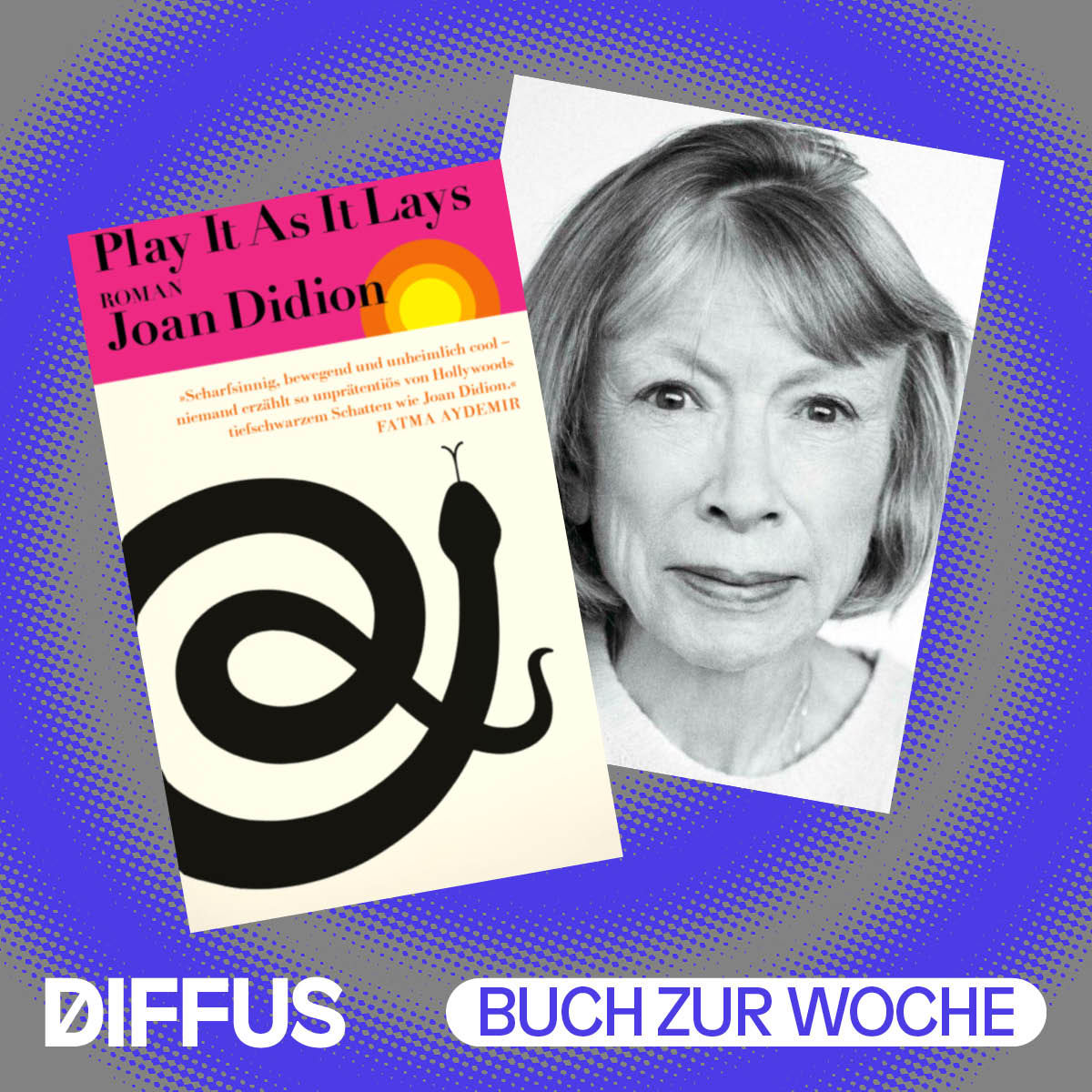
„Das Meer der endlosen Ruhe“ von Emily St. John Mandel – ein Tauchgang im Mondlicht
In der letzten Folge vor einer vierwöchigen Sommerpause geht es um den neuen Roman der kanadischen Autorin Emily St. John Mandel. Die ist alles andere als unbekannt – was vor allem an ihrem Roman „Station Eleven“ liegt. 2014 veröffentlicht, erzählt das Buch von einer postapokalyptischen Welt, in der 90 Prozent der Menschheit von einer Pandemie dahingerafft wurde. In der Corona-Zeit wurde „Station Eleven“ vor allem dank BookTok zu einem Bestseller und für viele gar zum Kultbuch. Aber auch Mandels „Das Glashotel“ fand sich in zahlreichen Bestenlisten. „Das Meer der endlosen Ruhe“ spielt teilweise in der Zukunft – auf den Mondkolonien, wo das mysteriöse „Zeitinstitut“ seine Zentrale hat. Und die einzige Zeitmaschine der Menschheit. Über Jahre ausgebildete Agentinnen und Agenten werden von dort durch die Zeit geschickt, um sogenannte Anomalien zu erforschen. Eine solche, besonders beunruhigende Anomalie steht nun im Zentrum dieser Geschichte. Emily St. John Mandel reist mit uns durch die Zeit, durch die Welt und zum Mond, um uns jene Menschen vorzustellen, die diese Anomalie erlebt und erforscht haben. Das mag alles nach einem lupenreinen Science-Fiction-Roman klingen, aber „Das Meer der endlosen Ruhe“ ist mehr als das. Warum, erfahrt ihr in dieser Folge

Eine Ausstellung und ein Lieblingsbuch: Mit Lee Miller im „Krieg“
Für diese Folgen haben wir uns von einer aktuellen Ausstellung in Hamburg inspirieren lassen. Lee Miller ist nämlich eigentlich eher als Fotografin bekannt – und einige ihrer besten Arbeiten werden gerade im Bucerius Kunst Forum (https://www.buceriuskunstforum.de/ausstellungen/lee-miller-fotografin-zwischen-krieg-und-glamour) in Hamburg ausgestellt. Da findet man auch das Foto, das sie weltberühmt machte. Darauf sitzt Miller in der Badewanne von Adolf Hitler in dessen Münchener Wohnung. Geschossen hat dieses Foto ihr Kollege David E. Scherman, den Miller wiederum danach ebenfalls in der Wanne fotografierte. Dieses inszenierte Bild ist natürlich ein Statement: Lee Miller hat kurz zuvor das befreite Konzentrationslager Buchenwald in Dachau besichtigt – und dieses Motiv war ein klares „Fuck you“ an Hitler und Nazi-Deutschland, das gerade endlich am Ende war. Das Foto findet sich auch in dem Buch „Krieg“ von Lee Miller – das es in einer kompakten Taschenbuchausgabe vom btb-Verlag gibt. Der Band versammelt Reportagen und Fotos aus der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Reportagen und Fotos im Buch „Krieg“ entstanden ab 1944. Lee Miller hatte sich um eine Akkreditierung als Militärkorrespondentin der Army beworben und war sozusagen als Embedded Journalist in entscheidenden Momenten des Krieges dabei. Sie machte allerdings nicht nur Fotos, sondern schrieb auch sehr persönlich gefärbte Reportagen für die Vogue. Sie war der Meinung, dass auch die Welt des Glamours und der Mode mit der Realität des Krieges konfrontiert werden musste.
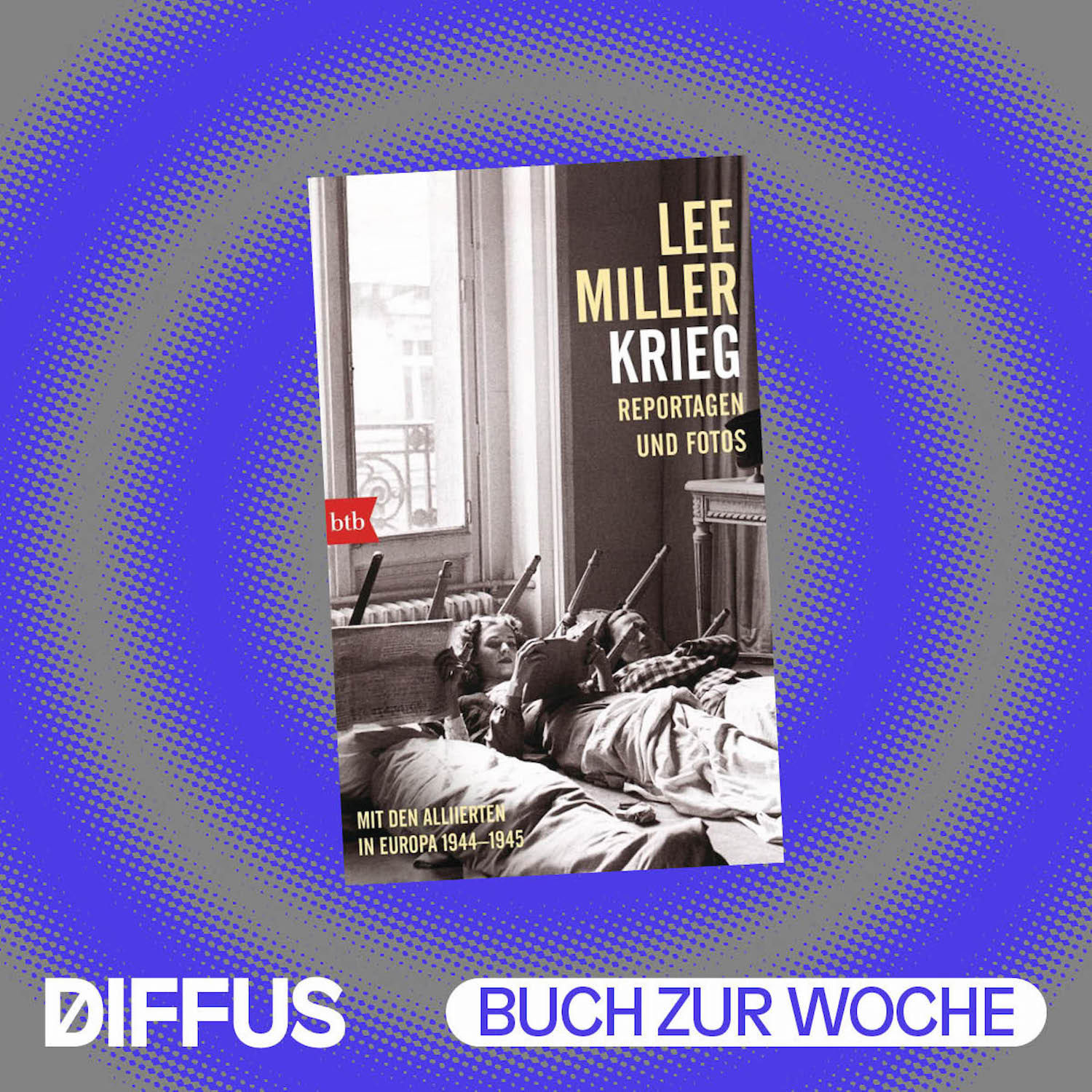
„Paradais“ von Fernanda Melchor ist der Roman, der euch bei diesem Wetter den Rest gibt
Als wir diesen Podcast aufnahmen, waren es draußen 35 Grad – und deshalb gibt’s diesmal ein Buch, das fast zu perfekt zu diesen irren Temperaturen passt. „Paradais“ von der mexikanischen Autorin Fernanda Melchor. Der Roman erschien schon 2021 in Deutschland im Verlag Klaus Wagenbach – und zwar in der Übersetzung von Angelica Ammar. Die 1982 in Veracrus geborene Melchor zählt zu den wichtigsten literarischen Stimmen Lateinamerikas – was vor allem an ihrem Roman „Saison der Wirbelstürme“ liegt. In „Paradais“ bereitet uns Fernanda Melchor ein Giftbad in toxischer Männlichkeit. Das kommt nicht von ungefähr. Sie hat viele Jahre als Journalistin in Mexiko gearbeitet – was einer der gefährlichsten Jobs der Welt sein dürfte. Ihre Portraits und Reportagen befassten sich mit Femiziden, mit der Gewalt des Drogenkriegs und mit stetig wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich. Die Gewalt, deren Folgen sie dokumentierte, kam dabei – immer von Männern. In einem Interview mit dem Deutschlandfunkt sagte sie dazu: „In Mexiko werden immer noch sehr viele Frauen ermordet, einfach nur, weil sie Frauen sind! Und es gibt immer noch keine klare Antwort auf die Frage: Wie können wir das stoppen?! Gleichzeitig spüre ich natürlich bei diesem Thema eine innere Unruhe, die sich beim Schreiben entlädt.“ Diese innere Unruhe hat Fernanda Melchor in „Paradais“ in furchteinflößende Literatur verwandelt.
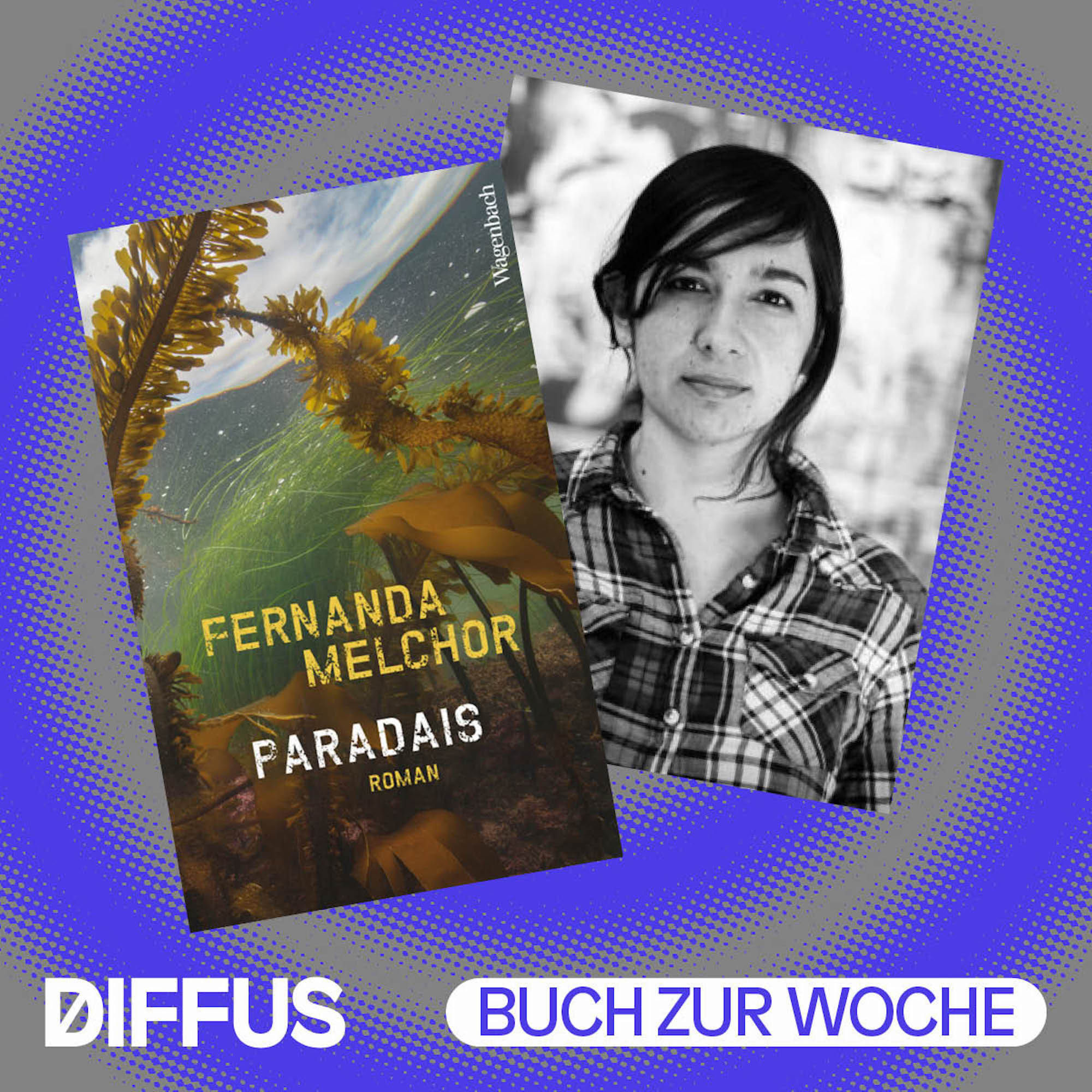
Eine Jugend in Berlin: Mascha Kaléko als Buch und Album
In dieser Folge geht es mal nicht um eine aktuelle Neuerscheinung. Zumindest nicht in Buchform. Wir sprechen nämlich heute über „Das lyrische Stenogrammheft“ von Mascha Kaléko. Und dieses Buch ist eigentlich schon ein Klassiker. Aber: Es ist gerade ein Album erschienen, das unter anderem Texte aus diesem tollen Buch in Liedform aufbereitet hat: Dota Kehrs „In der fernsten der Fernen“. Und deshalb gibt’s hier eine kleine Zeitreise ins Berlin zwischen den Weltkriegen – und zu einer Dichterin, die man auch lieben kann, wenn man es sonst nicht so Gedichtbänden hat. Mascha Kaléko war in den späten 20ern schon sehr aktiv in dem, was später die künstlerische Avantgarde Berlins werden sollte. Sie war Teil der Clique im Romanischen Café, lernte dort Else Lasker-Schüler und Joachim Ringelnatz kennen, zwei Namen, die ihr sicher auch aus dem Deutsch-Unterricht kennt. Und sie veröffentlichte bereits ihre Gedichte – zum Beispiel in der Kulturzeitschrift «Der Querschnitt». Was Kalékos Gedichte damals schon aus- und auch erfolgreich machte: Sie hatte eine sehr leicht zugängliche Sprache, eine zarte Melancholie und eine Art schnippischen Witz. Und sie erzählte aus ihrem Leben – und von einem Berliner Alltag, in dem sich viele wiederfanden. «Das lyrische Stenogrammheft» erschien 1933 – und dass es nicht im gleichen Jahr verbrannt wurde, lag nur daran, dass die Nazis noch nicht auf dem Schirm hatten, dass sie Jüdin war. Bevor Mascha nach New York emigrierte, wurde ihr Arbeit von den Nazis noch als «schädliche Literatur» eingestuft – seit jeher ein Qualitätsmerkmal für wichtige Literatur.
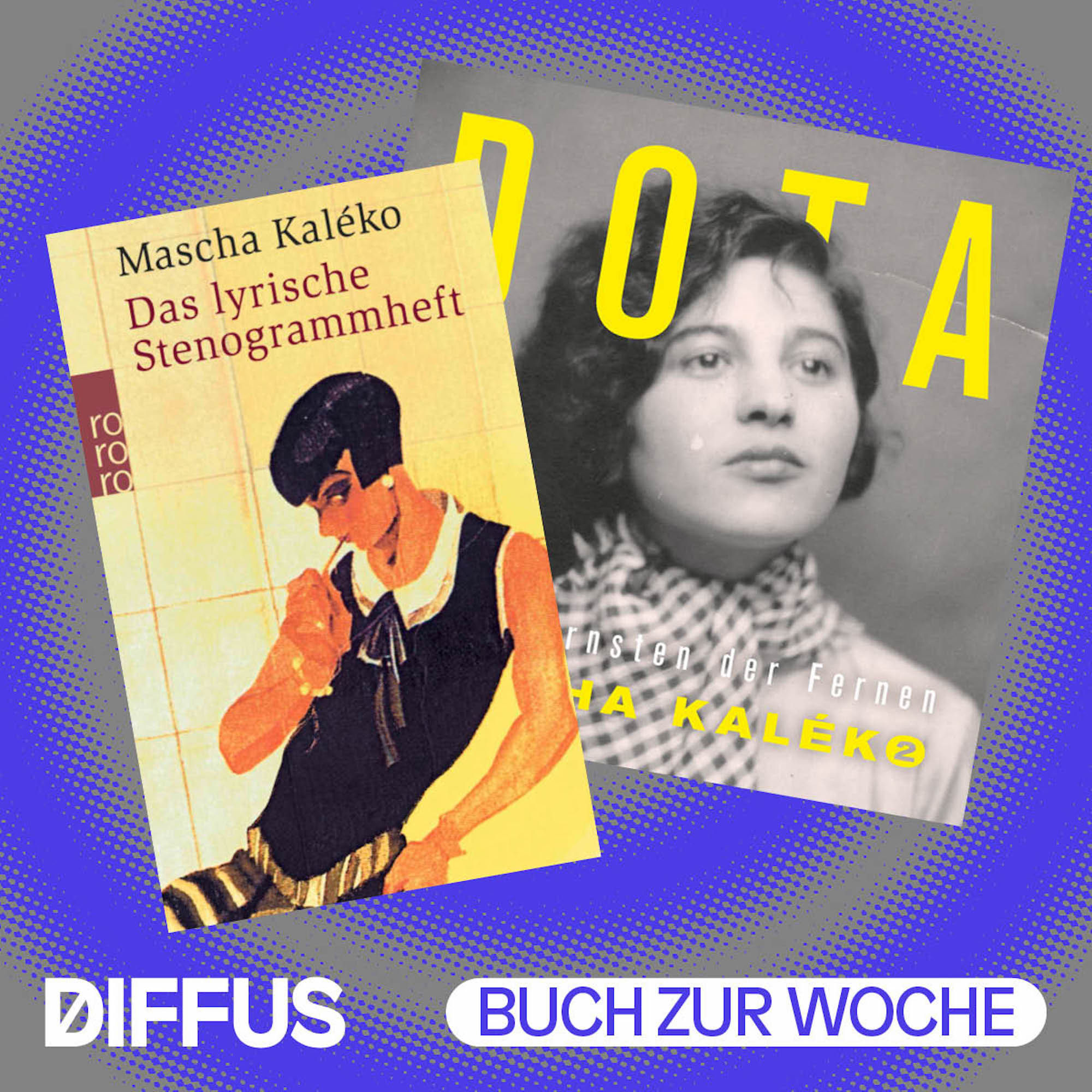
Mit Dorota Masłowska und „Bowie in Warschau“
Dorota Masłowska neuer, von Olaf Kühl übersetzter Roman hält erstmal was der Titel verspricht: „Bowie in Warschau“ beginnt im Zug von Moskau nach Berlin, der auch in Warschau stoppt. Es ist 1973. Frühling. David Bowie machte diese Reise tatsächlich – und er stieg wirklich in Warschau aus, obwohl er bis dahin nur wenig über Polen wusste. Das düstere, überwiegend instrumentale Stück „Warszwawa“ von seinem 1977 veröffentlichten Album „Low“ wurde von dieser Reise inspiriert. Und auch Dorota Maslowska wiederum wurde von diesem Stopp inspiriert: Sie erzählt um Bowies spontanen Warschau-Besuch herum von gescheiterten und sehr lustigen Existenzen im damals noch sozialistischen Polen. Dabei ist Bowie eher Spielball der Protagonisten als selbst einer – um ihn herum gibt es zahlreiche Irrungen, Wirrungen und Verwechslungen, denen man vor allem wegen des schwarzen Humors der Erzählung nur zu gerne folgt.
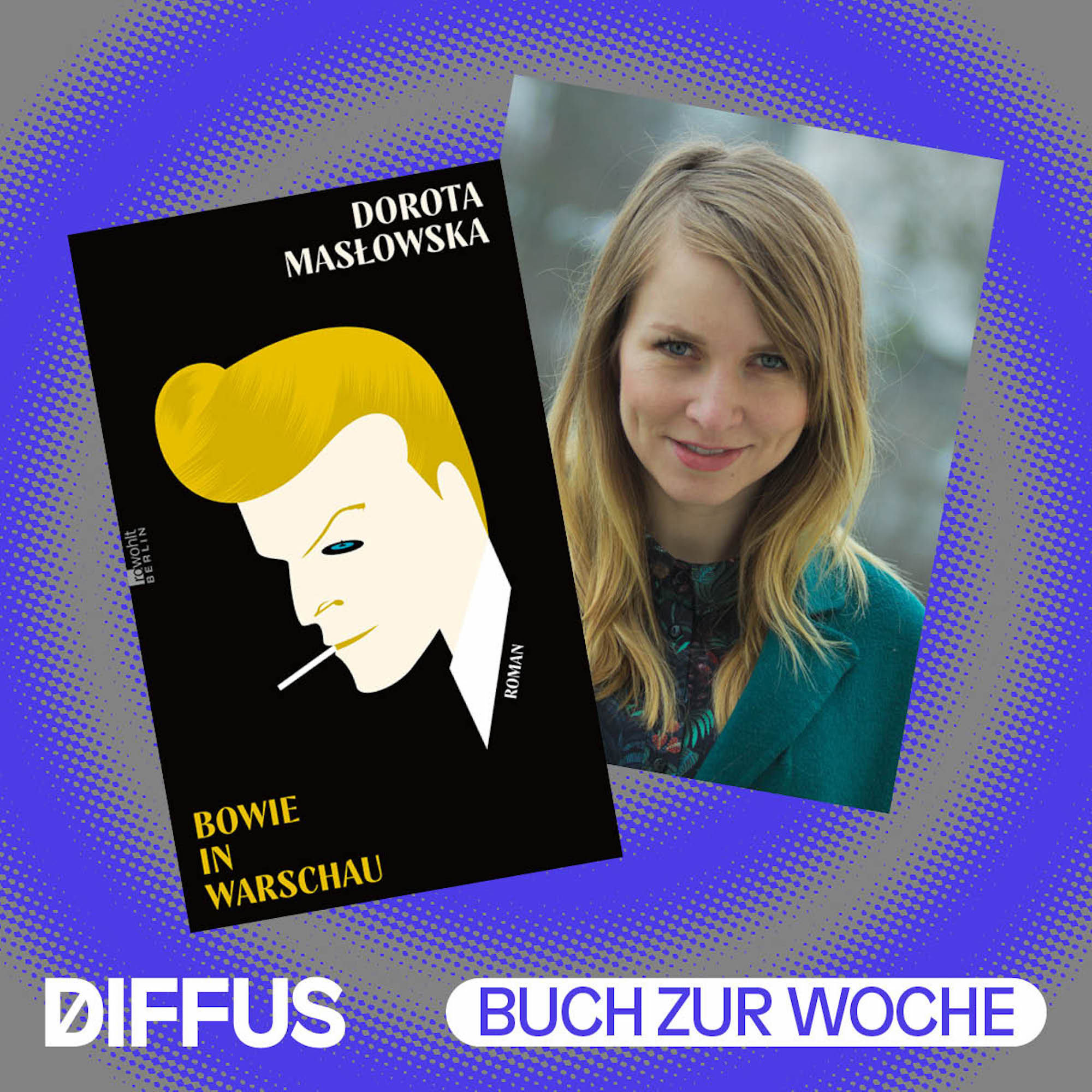
Nicola Lagioia seziert in seinem True-Crime-Roman „Die Stadt der Lebenden“
Rom, 2016. Ein grausamer Mord erschüttert die Stadt. Zwei Söhne aus gutem Hause bringen einen jungen Mann in ihrer Wohnung um. Mit einem Messer. Mit einem Hammer. Einer der Täter sagt später: „Wir wollten wissen, wie es sich anfühlt.“ Der italienische Krimiautor Nicola Lagioia berichtete für das Wochenmagazin „Venerdi“ über den Fall – und kommt auch Jahre später nicht so recht davon los. In diesem Buch erzählt er auf literarische Weise von dem Mord, seinem Hintergrund und seinen Folgen. „Die Stadt der Lebenden“ von Nicola Lagioia ist ein Buch, das einem einiges abverlangt. Aber eben nicht, weil es sich in der Gewalt suhlt oder auf Schockelemente setzt, sondern weil es diese grausame Tat als Ausgangspunkt für etwas Größeres nimmt. Lagioia stilisiert nicht die Täter zu satanischen Antihelden, wie es die zahllosen schlechten Bücher und Serien über Jeffrey Dahmer tun. Er hat Empathie für die Angehörigen des Opfers – aber auch die der Täter. Er zeigt uns, wie die Medienmaschine mit Blut und Wut gefüttert werden will. Er zeigt, was so eine Tat mit den Menschen macht, die in der Stadt leben, in der sie passiert ist. Und er zeigt, was diese Tat und die Berichterstattung darüber mit ihm macht: Lagoya fühlt sich manchmal selbst wie ein Bluthund, wenn er ein TV-Team begleitet, dass den Eltern der Täter auflauert. Er reflektiert seine eigene Faszination für den Mord – und die Bösartigkeit, die in dieser Tat zum Vorschein kam.
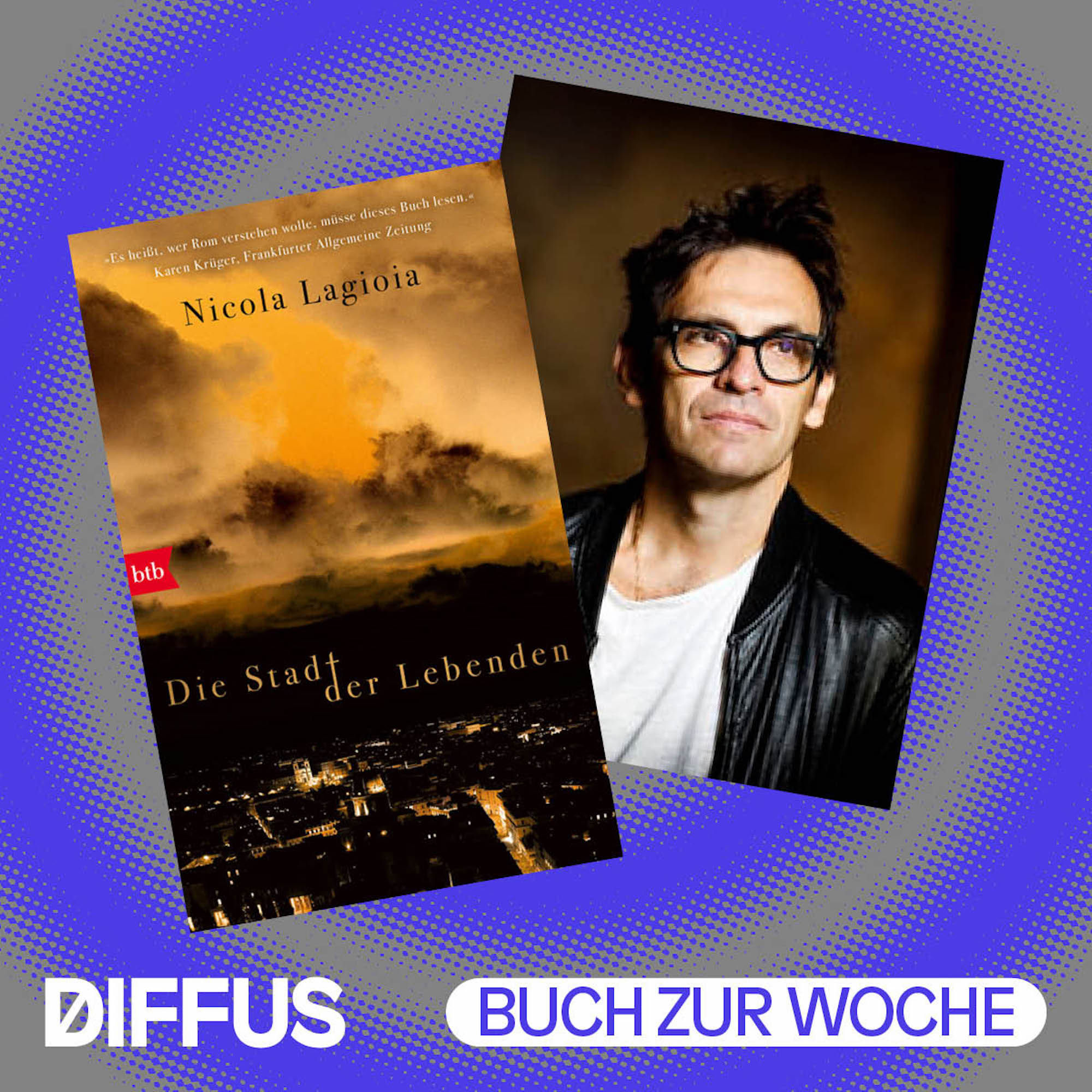
Henri Maximilian Jakobs im Gespräch über sein Romandebüt „Paradiesische Zustände“
Henri Maximilian Jakobs spricht heute mit uns über seinen Debütroman „Paradiesische Zustände“. Er ist Musiker, Schauspieler und Autor. Henri singt bei der Audiolith-Band Tubbe, spielt in Finnas Band und bei den Toten Crackhuren im Kofferraum und hat im vergangenen Jahr seine Solo-EP „Bizeps Bizeps“ veröffentlicht. Man kann Henri in der Schaubühne Berlin gerade im Stück „Das Leben des Vernon Subutex“ sehen – nach dem gleichnamigen Roman der großartigen Virginie Despentes. Henri war außerdem der Protagonist des sehr tollen Podcast „Transformer“ vom Bayrischen Rundfunk. Seine gute Freundin Christina Wolf hat ihn dafür bei seiner Transition begleitet und danach das Interviewbuch „All die brennenden Fragen: Ein Gespräch über trans Erfahrungen“ mit ihm geschrieben. Aber heute geht es um „Paradiesische Zustände“. Darin begleiten wir den Ich-Erzähler Johann auf seinem Weg zur Transition. Jedes Kapitel endet mit einem Countdown zu seiner Operation. Die Geschichte beginn im Alter von 19 Jahren und man lernt viel darüber, wie schmerzhaft es sein muss, wenn – so sagt es der Buchrücken – „der eigene Körper ein Zuhause ist, in dem man eigentlich keine Sekunde zu viel verbringen möchte“. Das ist ein verdammt harter Satz – der die Sache aber sehr gut trifft.

„Idol in Flammen“ von Rin Usami bleibt leider nur ein kühles Knistern
Die Ich-Erzählerin des Debütromans von Rin Usami heißt Akari und ist leidenschaftlicher Fan von Masaki – einem Mitglied der japanischen Pop-Band Band Maza Maza. Zu Beginn der Story erfährt Akari, dass Masaki eine junge Frau im Affekt ins Gesicht geschlagen haben soll. Ein Skandal, der zu einem Shitstorm führt – und seine Gunst bei den Fans zu recht sinken lässt. Akari, die noch zur Schule geht, führt einen Blog über Masaki, den sie akribisch pflegt – was man vom Rest ihres Lebens nicht sagen kann. In der Schule ist sie oft unaufmerksam, gibt sich Tagträumen oder ihren Sorgen um Masaki hin, isst zu wenig, fühlt sich schwach. Ihr Vater ist die meiste Zeit abwesend, ihre Mutter tadelt sie ständig und mag sie nicht so richtig und ihre ältere Schwester ist oft eifersüchtig, weil sie denkt, Akari lasse man viel mehr durchgehen als ihr. Rin Usami erzählt in „Idol in Flammen“ von der toxischen Liebe zwischen Fan und Idol und kommt dabei ein wenig vom Kurs ab. Obwohl die 1999 geborene Autorin unfassbar sicher schreibt und in ihrer Heimat als Shooting Star gilt, hat uns der kurze Roman ein wenig enttäuscht – warum, erklären wir in dieser Folge.
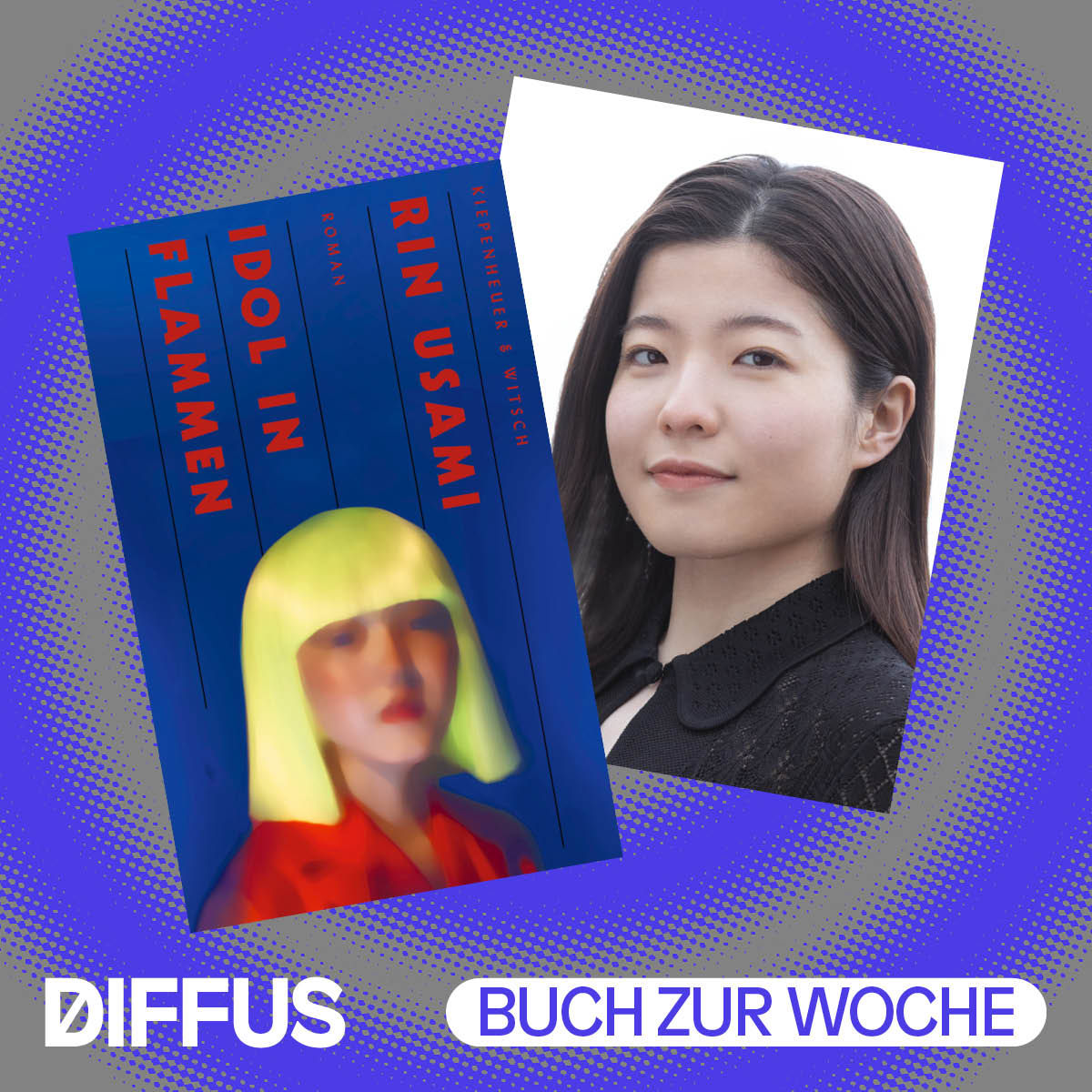
„Y/N“ von Esther Yi ist ein surrealer Trip in den K-Pop
Der Debütroman von Esther Yi, die in Los Angeles geboren ist und momentan in Leipzig lebt, ist im Englischen im Verlag Astra House erschienen. Wir hoffen wirklich sehr, dass schon ein deutscher Verlag die Rechte an der Übersetzung hat. Wenn nicht – schön blöd! Der Titel „Y/N“ spricht sich dabei übrigens wie „Your Name“. Diese Abkürzung verwendet man überwiegend in der Welt der Fan-Fiction – in Geschichten, in denen man als Lesende:r eingeladen ist an dieser Stelle den eigenen Namen zu lesen und zu denken. Die namenlose Ich-Erzählerin von „Y/N“ lebt zu Beginn in Berlin, hat einen Medienjob der ihr nicht wirklich gefällt und einen Boyfriend, der sie langweilt. Eines Abends lässt sie sich von einer Freundin überreden auf das Konzert der größten K-Pop-Band der Welt mitzukommen. Anfangs widerwillig und irritiert von den euphorischen Fans an der Arena hat sie während der Show eine Art Erweckungserlebnis. Als das jüngste Mitglied der Band – ein besonders schöner Mann namens Moon – tanzt und singt, verliebt sie sich auf eine Weise in ihn, die weit über Fanliebe hinaus geht. Wenn ihr jetzt aber denkt, Esther Yi hat bloß einen Roman über das Fantum im K-Pop geschrieben, der irrt gewaltig. Das Setting mag vertraut klingen und an Fans von BTS, Blackpink oder Stray Kids erinnern, aber sie dreht die Story von Anfang an ins Abgründige, Surreale und manchmal sehr komische. Esther Yi macht das jedoch nicht auf Kosten der K-Pop-Fans, sondern nutzt diese intensive Verbindung zwischen Fan und Idol als Spielwiese für ihre Fantasie. Denn auch das ist es, was K-Pop oder K-Pop-Fan-Fiction ausmacht: Sie wird von der Fantasie der Fans belebt, die bunt, queer, lustig, fanatisch, abgründig und manchmal ziemlich raunchy werden kann.
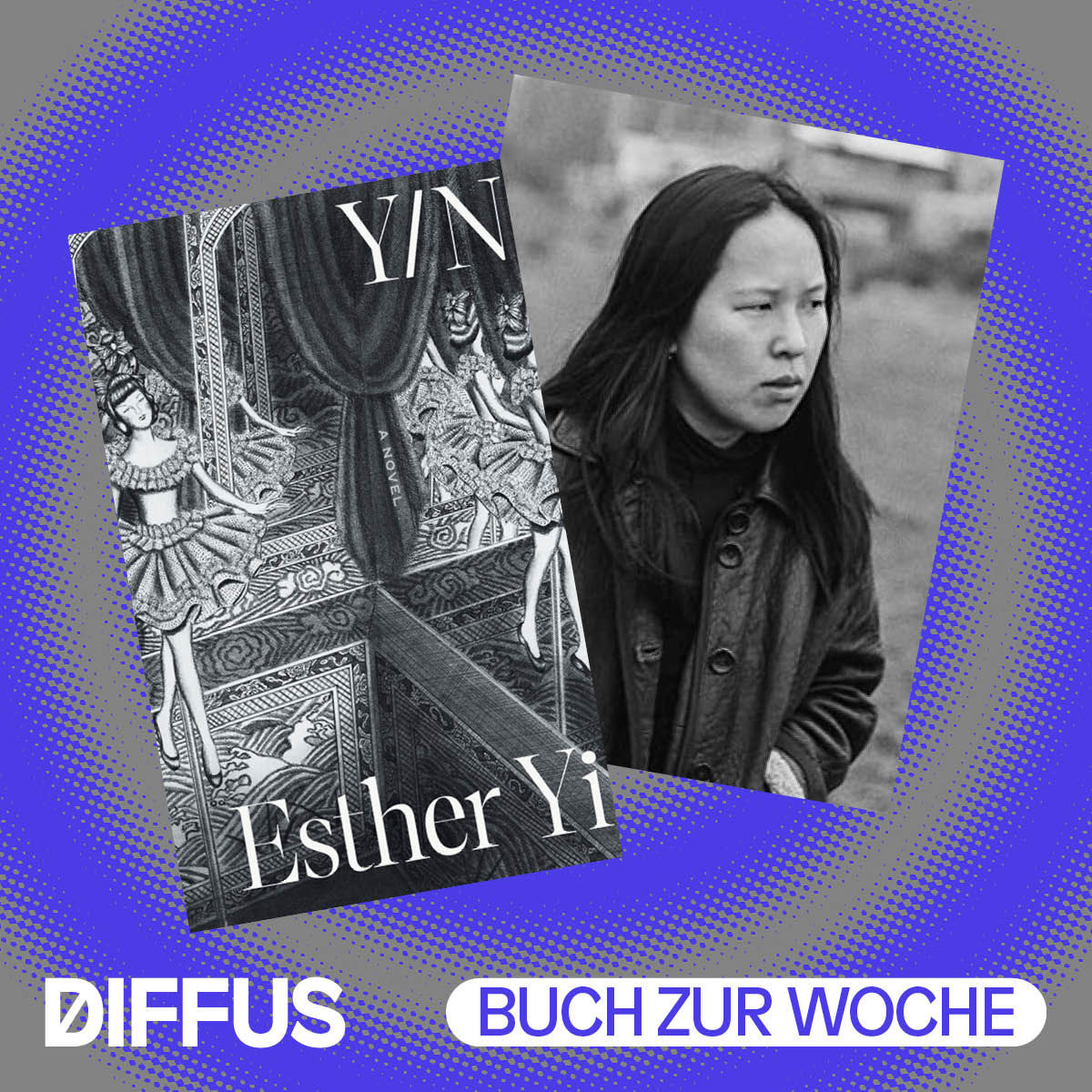
Ein Buch wie ein Hitzeschlag: „Der Stoff, aus dem die Tränen sind“ von Alexandra Kleeman
Diesmal geht es um den Roman „Der Stoff, aus dem die Tränen sind“ von Alexandra Kleeman – ins Deutsche übersetzt für den Kein & Aber Verlag wurde er von Christiane Sipeer und Anna-Christin Kramer. Es ist ein Buch, das euch trifft wie einen Hitzeschlag – und eine spannende Mischung aus Dystopie, Satire und Thriller. Im Mittelpunkt der Handlung steht der nur so halb erfolgreiche Schriftsteller Patrick. Er ist von der Ostküste, wo seine Familie wohnt, nach Los Angeles gereist, weil er die Verfilmung seines Buches leiten will. Die Hauptrolle soll das Hollywood Starlet Cassidy Parker spielen. Eine junge Frau, die mit der kessen Kinder-Serie „Kassi Keene – die kleine Detektivin“ berühmt wurde und nun eine etwas unberechenbare Influencerin und Schauspielerin geworden ist. Das L.A., das Patrick vorfindet, schwelt am Rande des Wahnsinns. Die Waldbrände – die in den letzten Jahren ein sehr reales Problem dort waren – reichen inzwischen bis in die City hinein. Ständig werden Straßen gesperrt, weil mal wieder die Palmen brennen. Außerdem macht sich eine mysteriöse Firma breit, die mit synthetischem Wasser namens WAT-R einen Verkaufsschlager gelandet hat – deren Produkt aber nicht nur Suchtpotential sondern auch ein paar Nebenwirkungen zu haben scheint.
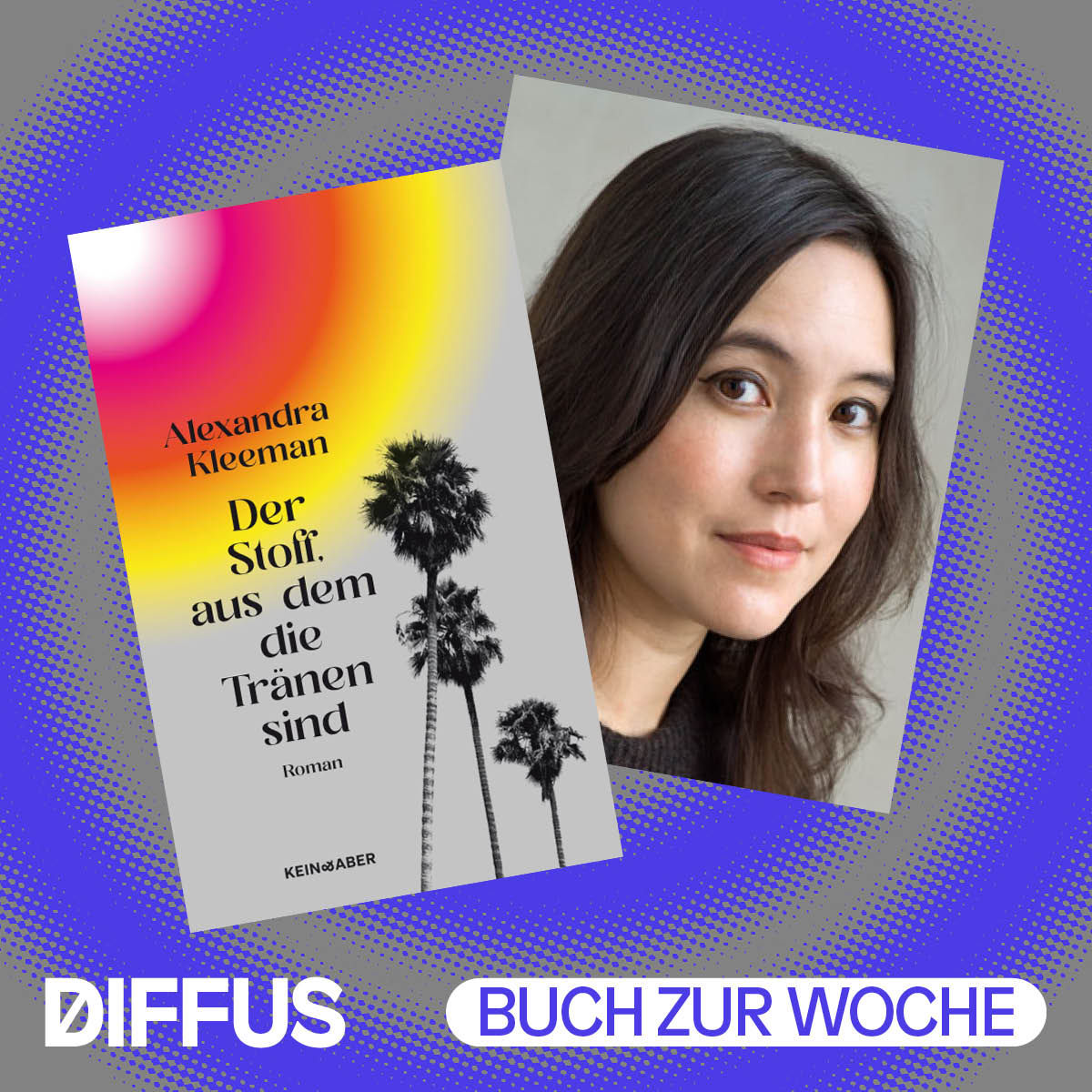
„Gott hassen“ von und mit Jenny Hval
Heute stellen wir bereits zum zweiten Mal in der Geschichte vom „Buch zur Woche“ einen Roman der norwegischen Musikerin und Autorin Jenny Hval vor. Im Mai letzten Jahres kam nämlich ihr Debüt-Roman „Perlenbrauerei“ auf deutsch raus und nun legt der März-Verlag den Roman „Gott Hassen“ nach. Aus dem Norwegischen übersetzt wurde er von Clara Sondermann. „Gott Hassen“ ist zuerst einmal ein toller Blickfang. Wenn man mit diesem Buch in der U-Bahn sitzt, fängt man sich todsicher ein paar missgünstige Blicke ein. Oder interessiertes Zwinkern vom Metal-Typen mit dem Morgoth-T-Shirt. Was dann schon dem Thema sehr nahe kommt: Denn „Gott Hassen“ ist Kreuzung aus Coming-of-Age-Story, norwegischer Kulturgeschichte, Rebellion gegen die vermeintliche Idylle Norwegens und Haten gegen die Kirche – all das in Form eines surrealistischen Romans, bei dem man nie weiß, ob man gerade im Kopf der Ich-Erzählerin ist oder doch in einem fast realen Vorort von Oslo.
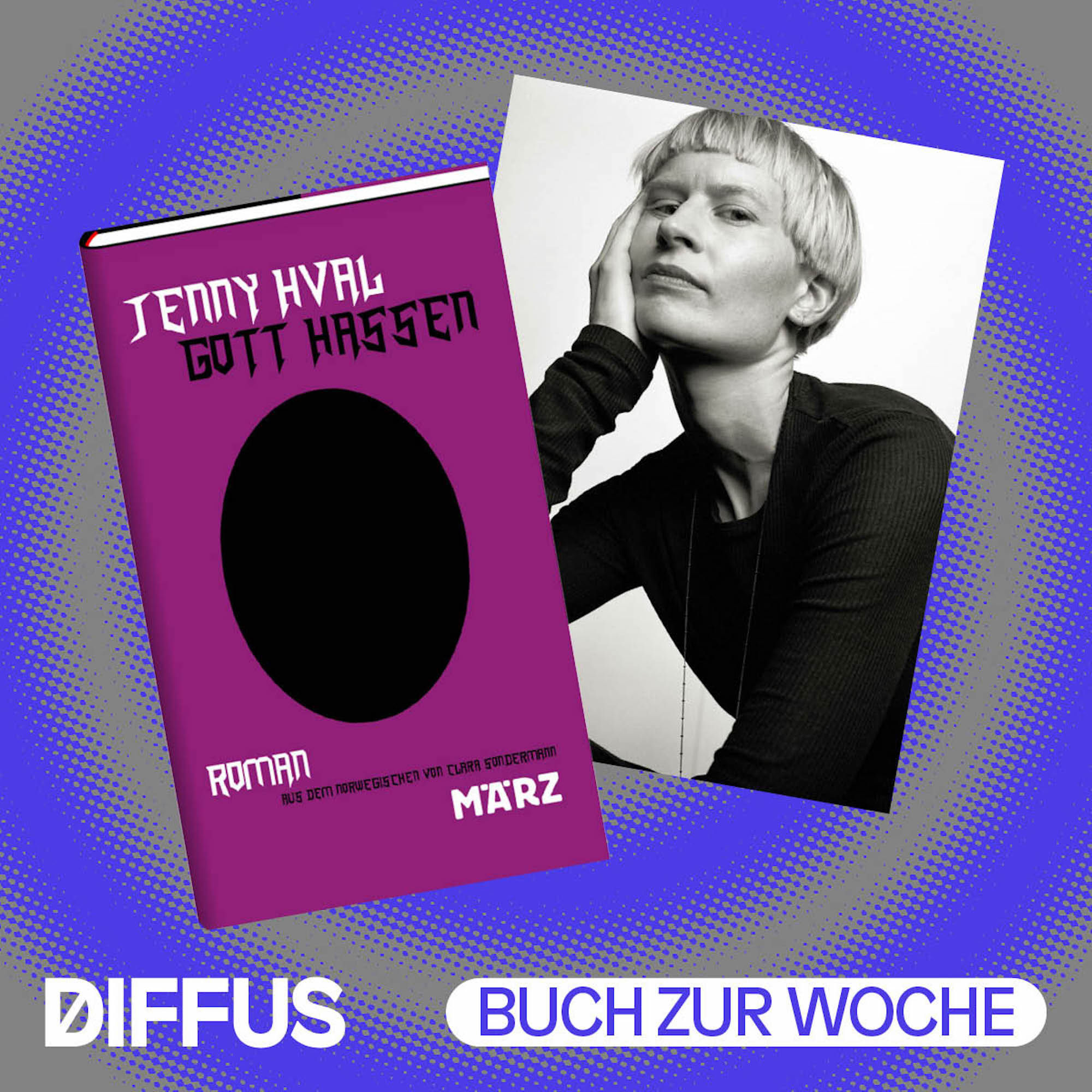
Lieblingsbücher: „Friday Black“ von Nana Kwame Adjei-Brenyah
Heute gibt’s mal wieder ein Lieblingsbuch des Hosts. Es geht um den Short-Story-Band „Friday Black“ des US-Autoren Nana Kwame Adjei-Brenyah, der 2018 im Englischen erschien und 2020 beim Penguin Verlag in der Übersetzung von Thomas Gunkel rauskam. Das Buch ist einerseits so etwas wie der literarische Soundtrack zu „Black Lives Matter“ und andererseits ein weiterer Beweis für die Kraft die Short Story. Denn Nana Kwame schafft es, sehr gegenwärtige politische Themen in Literatur zu verwandeln – und er tut das mit einem Punch, wie man ihn selten in einem Debüt findet. Es gibt ein Zitat von ihm, dass sehr genau beschreibt, wie „Black Friday“ funktioniert. Nana Kwame Adjei-Brenyah sagt über sein Buch: „Drei Personen sitzen auf einer Couch. Die erste sagt, ja, das ist sehr gemütlich, die zweite Person meint, ja, ich sitze echt gut und auch die dritte sagt, ich stimme euch vollkommen zu – aber ich glaube wir übersehen ein bisschen die Tatsache, dass die Couch aus Leichen besteht.“
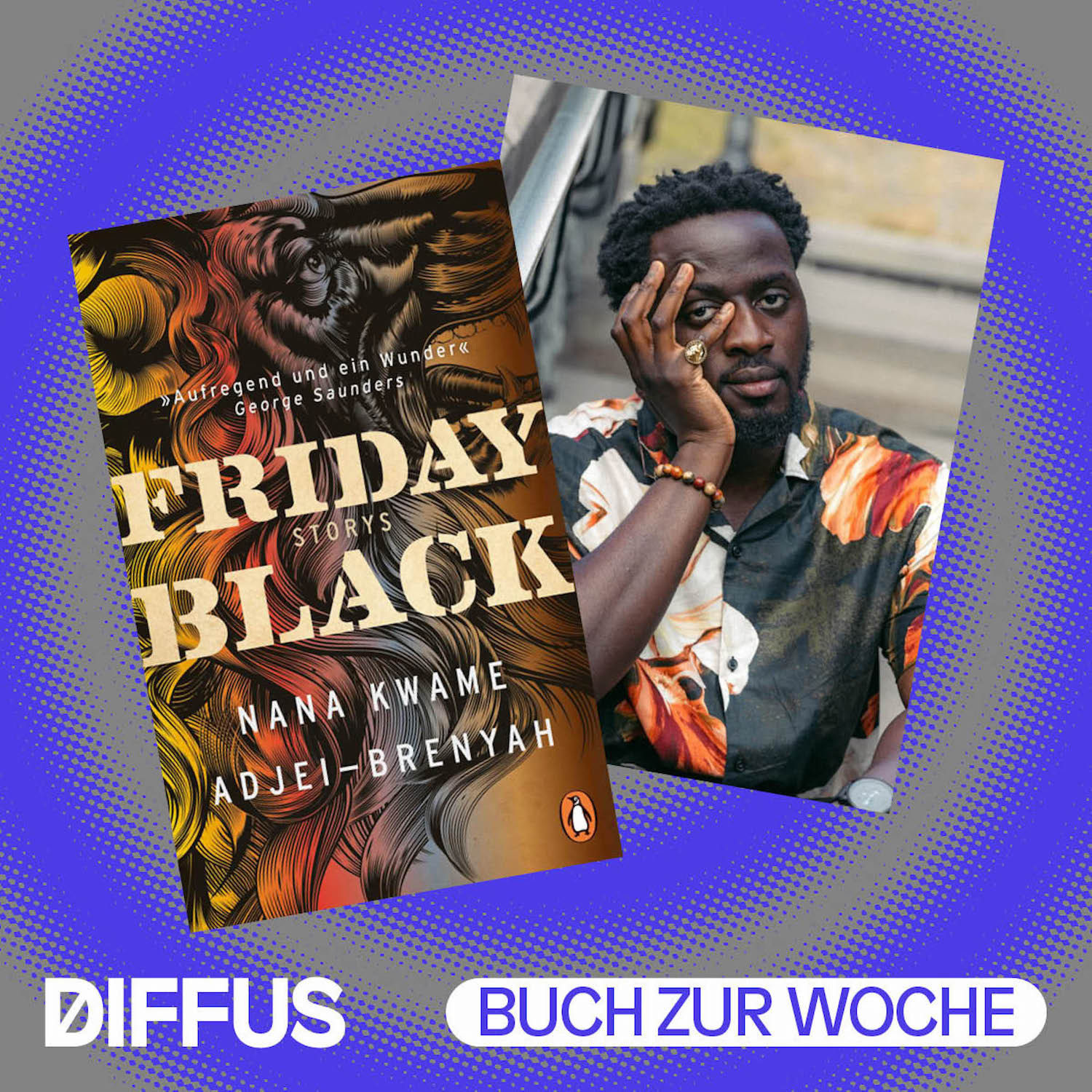
Neue Musikbücher von Schleimkeim bis UK Punk und Prince
Im „Buch zur Woche“ gibt es diesmal den obligatorischen Blick auf neue Musikbücher. DIFFUS ist und bleibt ja immer noch in erster Linie ein Musikmagazin – da macht das ja irgendwie Sinn. Mit dabei ist zum Beispiel der brandneue Essay von Mr. „High Fidelity“ Nick Hornby (Kiepenheuer & Witsch), der in „Dickens & Prince“ versucht den großen Literaten mit dem genialen Musiker zusammenzubringen. Außerdem gibt es einen journalistischen, soziologischen, angenehm linksgrünversifftgefärbten Blick auf „35 Jahre HipHop in Deutschland“, eine Oral History des Punks mit allen wichtigen Protagonist:innen (beide Hannibal Verlag), einen Comic über die DDR-Punkband Schleimkeim (Ventil Verlag), Tai Chi mit Lou Reed von The Velvet Undrground (btb Verlag) und das sehr amüsante „Mein Herz hat Sonnenbrand“, das die lyrischen Schwächen unser größten Musiker:innen schonungslos ins Visier nimmt (Reclam Verlag).

„Überforderung und Einsamkeit sind die großen Themen unserer Gegenwart“: David Schalko über „Was der Tag bringt“
„Was der Tag bringt“ von David Schalko (gerade erschienen bei KiWi) ist ein Roman, der – wie man so sagt – gut in die Zeit passt. Denn er handelt, mit viel Humor und sehr trockenen Pointen, von Existenzängsten und Vereinsamung. Und zwar bei Menschen, die nie im Leben gedacht hätten, dass sie jemals davon betroffen sein würden. Felix ist so einer. Er hat vor einigen Jahren ein Start-up für nachhaltiges Catering gegründet. Eine verdammt gute Idee eigentlich – in Zeiten, in denen viele Firmen ihr gutes Gewissen entdecken, oder es zumindest bei Veranstaltungen und Betriebsfeiern simulieren wollen. Aber dann kam das, was sicher viele von euch ebenfalls ein wenig zerrüttet hat – die Pandemie. Als die „vorbei“ ist, wollen Felix‘ Geschäfte allerdings nicht mehr so recht in Gang kommen. Also muss er sein Leben der aktuellen Situation anpassen. Er hat die Wohnung seiner Mutter geerbt – also zumindest Eigentum. Was schon mal mehr ist, als so manch anderer hat. Aber sich Essen kaufen oder den nächsten Kneipengang finanzieren, kann er damit ja auch nicht – es sei denn: Er vermietet sie. Genau das macht Felix: Er stellt seine Wohnung für ein paar Tage oder Wochen zur Verfügung und zieht in der Zwischenzeit von Sofa zu Sofa. Schläft bei alten Freunden, reist in seine Heimat zu den Eltern – erlebt viele seltsame, oft unangenehme Begegnungen. Das hätte auch langweilig und ermüdend sein könne, aber das passiert niemals, wenn der Österreicher David Schalko so eine Geschichte erzählt. Er ist Autor und Regisseur, schreibt Romane und Drehbücher und hat uns eine der bösesten und genialsten Serien der deutschsprachigen TV-Geschichte geschenkt: „Braunschlag“. Wir haben David Schalko in einem Sprachnachrichten-Ping-Pong ein paar Fragen zu seinem Roman „Was der Tag bringt“ geschickt und stellen den Roman ausführlich vor.

Ein dunkles Epos aus dem modernen Indien: „Zeit der Schuld“ - Deepti Kapoor
Heute geht es um den Thriller „Zeit der Schuld“ von der indischen Autorin Deepti Kapoor. Ein Buch, das wie die indische Antwort auf Gangs of London oder Der Pate daherkommt. Obwohl der Vergleich dann doch ein wenig hinkt, weil Kapoors Geschichte viel sozialkritischer und politisch aufgeladener ist. „Zeit der Schuld“ ist Anfang März im Blessing Verlag auf deutsch erschienen – übersetzt wurde der Roman aus dem englischen von Astrid Finke. Deepti Kapoor erzählt darin die Geschichte des reichen fiktiven Wadia-Clans, der von Dehli aus operiert und dank Korruption, organisierter Kriminalität und guten Verstrickungen in die indische Politik zu den reichsten und skrupellosesten Familien des Landes zählt. Was ihren epischen Roman so fesselnd macht, ist vor allem die Art, wie sie von diesem Clan erzählt. Und wie sie nicht dem Reiz verfällt, Verbrechen und Reichtum zu glorifizieren, sondern Charaktere gewählt hat, die auf verschiedene Weise mit diesem Clan verwachsen sind.
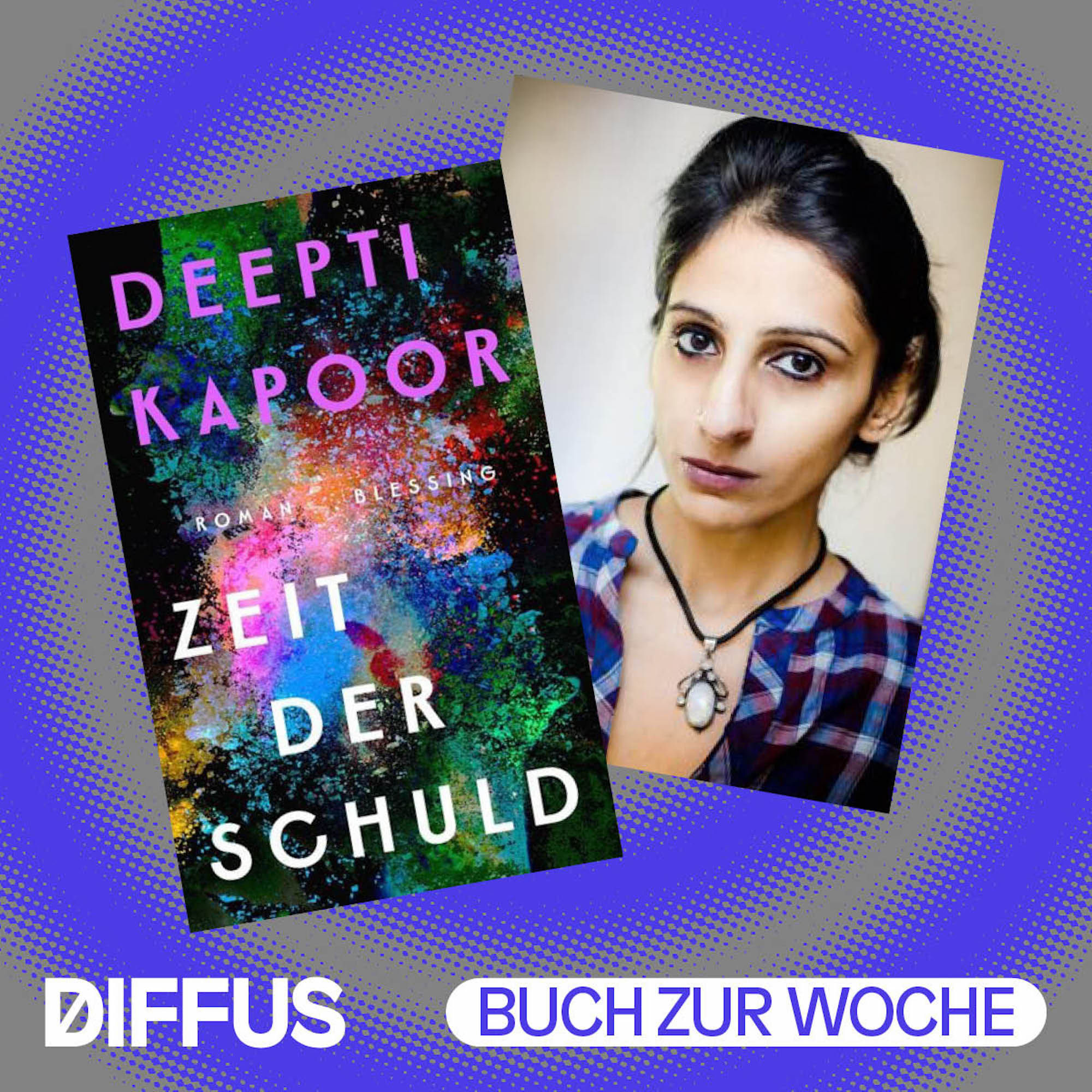
Wie der Schauspieler Samuel Finzi in „Samuels Buch“ über das Aufwachsen im sozialistischen Bulgarien erzählt
Das „Buch zur Woche“ ist zurück aus der kleinen Frühlingspause und kommt ab sofort wieder jeden Mittwoch. Heute geht es um „Samuels Buch“. Erschienen ist dieser autobiografische Roman im Ullstein Verlag, geschrieben wurde er von Samuel Finzi – und auch wenn es bei dem Namen vielleicht noch nicht klingelt: Googlet ihn einfach mal und ihr wisst sofort, wer das ist. Samuel Finzi stammt aus Bulgarien, wurde dort 1966 in Plowdiw geboren. Seit 1989 lebt und arbeitet er in Berlin – und zwar in erster Linie als TV-, Kino- und vor allem Theaterschauspieler. Man kennt ihn aber auch als Werbegesicht der Ergo Versicherungen – und er drehte sehr viele Film mit Til Schweiger, zum Beispiel „Honig im Kopf“, „Klassentreffen 1.0“, „Die Hochzeit“ und die „Kokowääh“-Filme. Es wäre aber fies, ihn daran festzumachen. Vielmehr ist Samuel Finzi einer der renommiertesten Theaterschauspieler, die in Deutschland arbeiten und in seiner Filmographie findet sich viel gutes Arthaus-Zeugs: Zuletzt sah man ihn zum Beispiel an der Seite von John Malkovic im Kinofilm „Seneca – Oder: Über die Geburt von Erdbeben“. „Samuels Buch“ erzählt die ersten Jahre aus dem Leben des Samuel Finzi – die Kindheit im sozialistischen Bulgarien, die rebellische Jugend, die späteren Reisen, die ihn schließlich 1989 nach Berlin führen, wo er bis heute geblieben ist. Dort, in seiner Küche, beginnen seine Erinnerungsreisen, die er meist in kurzen Kapiteln erzählt, die selten länger als zehn Seiten sind. Und gerade dieses Erzählen in pointierten Häppchen ist ihm ganz wundervoll gelungen – ganz nebenbei lernt man auch noch viel über dieses Land im Balkan, dass die ignoranten Deutschen immer noch viel zu oft mit Rumänien verwechseln …
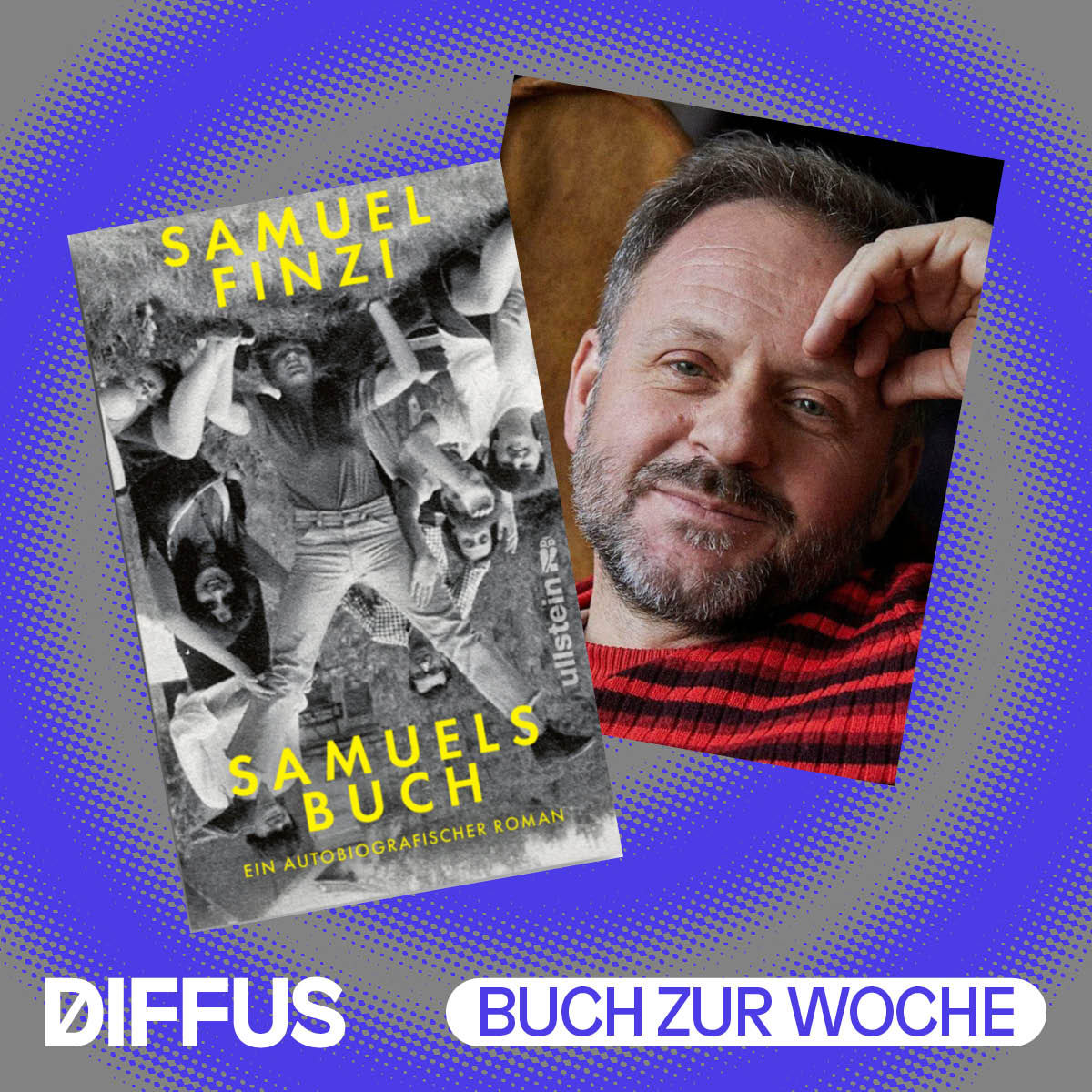
Gilda Sahebi liefert mit „Unser Schwert ist Liebe“ DAS Buch, das man zur Revolte im Iran lesen sollte
Diese Folge erscheint am 8. März – dem internationalen Frauentag, der bisher leider nur in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern ein gesetzlicher Feiertag ist. Der S. Fischer Verlag hat diesen Tag gewählt, um das Buch „Unser Schwert ist Liebe“ von Gilda Sahebi zu veröffentlichen. Der Untertitel dieses Sachbuchs lautet „Die feministische Revolte im Iran.“ Wenn ihr öfter bei Diffus vorbeischaut, dann wisst ihr vielleicht, dass wir uns dem Thema Iran regelmäßig in einer Kolumne widmen. Die Musikerin und geschätzte Kollegin Maryam.fyi schreibt darin für uns über die Entwicklung in diesem Land. Maryam hat iranische Wurzeln und erzählt deshalb – wie viele, die über die Aufstände der Bevölkerung gegen das Regime schreiben – aus einer sehr persönlichen Sicht. Die Autorin von „Unser Schwert ist Liebe“ Gilda Sahebi ist Journalistin, Autorin, Moderatorin, Ärztin und Expertin für die Region, die noch immer unter dem vom Westen geprägten Begriff „Naher Osten“ zusammengefasst wird. Der Iran ist dabei schon länger ein Schwerpunkt ihrer Arbeit – was nicht wundert, wenn man weiß, dass ihre familiären Wurzeln in diesem Land liegen. Wenn ihr Gilda Sahebi bei Twitter folgt, bekommt ihr einen sehr guten Überblick über ihr Schaffen und ihre Standpunkte. Ihr Twitter-Account sei außerdem ausdrücklich empfohlen, wenn man erfahren will, wie die Situation im Iran gerade ist. Gilda Sahebi hat es nun geschafft, innerhalb sehr kurzer Zeit ein Sachbuch über die Revolte im Iran zu schreiben, das erstaunlich aktuell ist – was bei dem Tempo des Buchmarktes ein ziemlicher Kraftakt gewesen sein dürfte. Sie erklärt in „Unser Schwert ist Liebe“ informativ und persönlich den Hintergrund für die Situation im Iran – wo die Zivilbevölkerung gegen das ultra-religiöse autoritäre Regime protestiert. Diese Proteste brauchen die Weltöffentlichkeit – und das ist eben schwierig, bei Herrschern, die weder vor Gewalt noch vor Zensur noch vor Mord zurückschrecken. Und man fühlt sich bei der Lektüre tatsächlich schnell ein wenig ertappt, denn man merkt ja selbst, dass man ebenso wie die großen Medien nicht mehr so oft auf dieses Land schaut, wie man sollte. Obwohl dieser Aufstand so wichtig, so voller Hoffnung, so gefährlich für die Revoltierenden und so essenziell für alle sein sollte, die sich eine demokratische und im Kern feministische Gesellschaft wünschen.
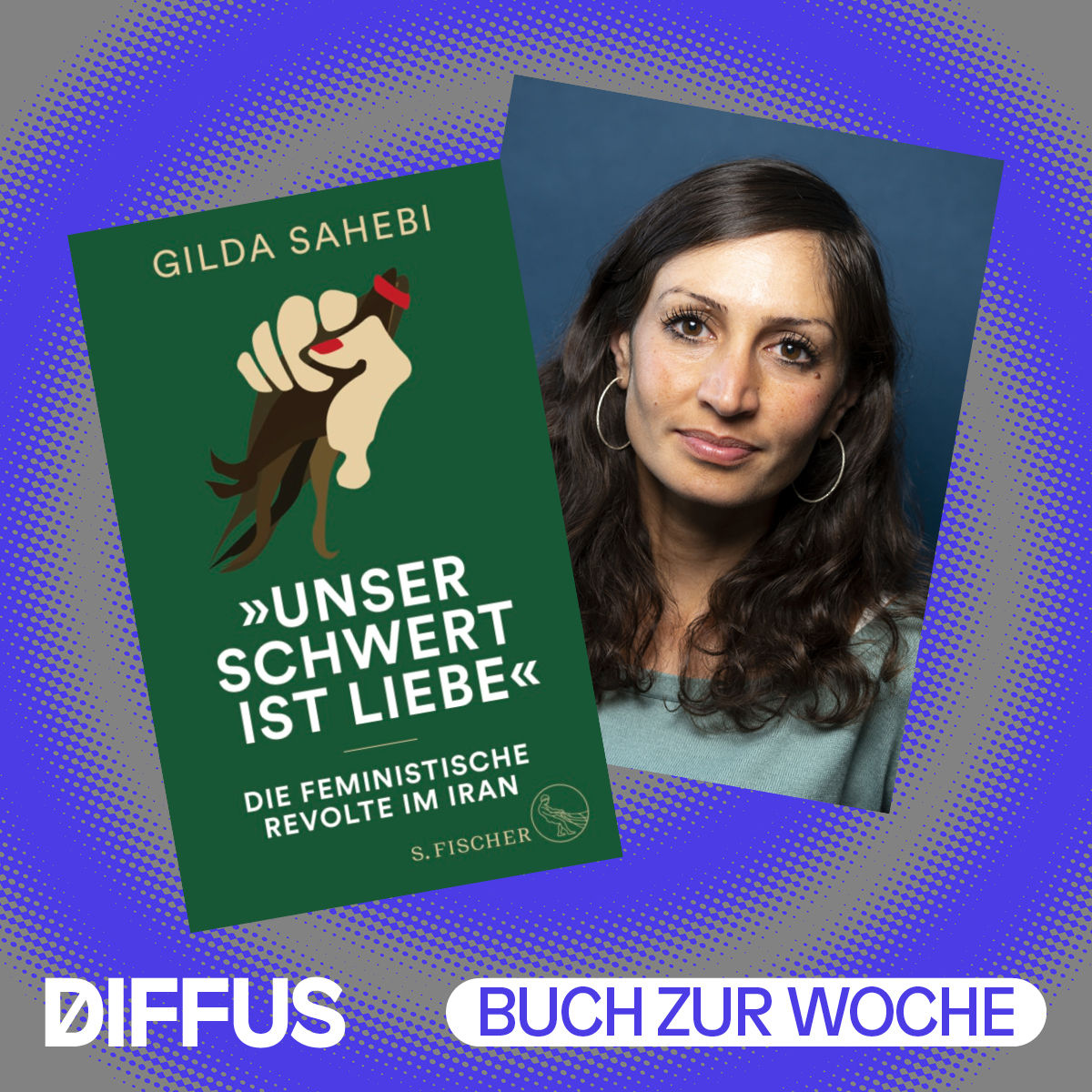
Antonia Baum, ihr Roman „Siegfried“ und Hilde und Alex und Johnny und Benjamin
Antonia Baum kennt man vielleicht aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, wo sie Kolumnistin und Autorin ist. In den letzten Jahren hat sie drei Romane veröffentlicht und das Memoire „Stilleben“ – wo sie sehr offen und intensiv über das Mutterwerden geschrieben hat, das sie nach eigener Aussage komplett aus der Bahn geworfen hat. In der KiWi-Musikbibliothek stammt von ihr der sehr tolle Band über Eminem. Außerdem hat einer von Antonias Romanen den besten Titel, den man sich ausdenken kann: „Ich wuchs auf einem Schrottplatz auf, wo ich lernte, mich von Radkappen und Stoßstangen zu ernähren.“ Ihr neuer Roman trägt hingegen den deutschesten Namen, den man haben kann. „Siegfried“. So heißt der Stiefvater der Ich-Erzählerin. Ein wohlhabender Geschäftsmann, immer perfekt gekleidet, immer mit der Aura eines kühlen Machers umgeben. Eine Autoritätsperson – geprägt von der Nachkriegszeit und den Geschichten seiner Mutter Hilde, die oft erzählt, wie sie vor „dem Russen“ flüchten musste. Antonia Baum ist eine fantastische Erzählerin. Während sie mich erst ein wenig mit Berlin-Mitte-Kultur-Prekariats-Alltag einlullte, legt sie schon die ersten Tretminen aus. Man merkt nämlich schnell, dass dieser vermeintliche Alltag gerade ganz langsam eskaliert und die Erzählerin kurz vor einem Nervenzusammenbruch steht. Sie hört eine Sirene, die niemand anders hört, sie steigert sich in Zwangshandlungen, sie sorgt sich auf irrationale Weise um ihren Stiefvater Siegfried – und ehe man sich versieht, verlässt sie barfuss mit lackierten Fußnägeln das Haus und fährt in eine Nervenheilanstalt. Erst im Wartezimmer kommt die Erzählerin und ich als Lesender dann mal kurz zur Ruhe. Allerdings nur, um langsam in den Strudel der Geschichte gezogen zu werden, die um ein verdrängtes Familientrauma kreist.

„Ich finde mein Buch stellenweise richtig gut“: Panik Panzer im Interview über „Der beste Mensch der Welt“
Tobias Pongratz alias Panik Panzer ist nicht nur Mitglied der Antilopen Gang, sondern auch ein Labelboss, „Antilopen Geldwäscher“, Mit-Manager seines Bruders Danger Dan, Solorapper mit der stattlichen Bilanz von einem Song namens „DIY CEO“ – und nun also auch Autor. Wir sprechen nämlich über seine Biografie „Der beste Mensch der Welt“, die soeben im Riva Verlag erschienen ist. Was ihn quasi zum Label- pardon Verlagskollegen von Kollegen wie Kollegah, Kool Savas, Xatar und Bushido. Die haben nämlich allesamt bei Riva ihre – meist von Ghostwritern verfassten – Bücher veröffentlicht. Panik Panzer mach kein Geheimnis draus, dass er das Buch mit dem befreundeten Autor und Journalisten Martin Seeliger geschrieben hat. Und er macht keinen Hehl daraus, das in diesem Buch alles fast ein klein bisschen wahr ist. Wer „Der beste Mensch der Welt“ liest, merkt nämlich schnell, dass man es hier nicht mit einer gewöhnlichen Rapper-Biografie zu tun hat. Im Interview geht es um diesen interessanten Spagat zwischen Satire und realer Karriere, um das erst nicht so begeisterte Feedback seiner Bandkollegin, um alternative Verwendungsmöglichkeiten, um den Stand seiner Solokarriere abseits des Buchregals und um seine Faszination für Rapper-Biografien. Wir haben außerdem zwei signierte Exemplare von „Der beste Mensch der Welt“ für euch zum Verlosen auftreiben können. Wenn ihr eines haben möchtet, schreibt doch bitte eine Mail mit dem Stichwort „Der beste Mensch der Welt“ an verlosung@diffusmag.de – und vergesst bitte nicht, eure Postadresse anzugeben.
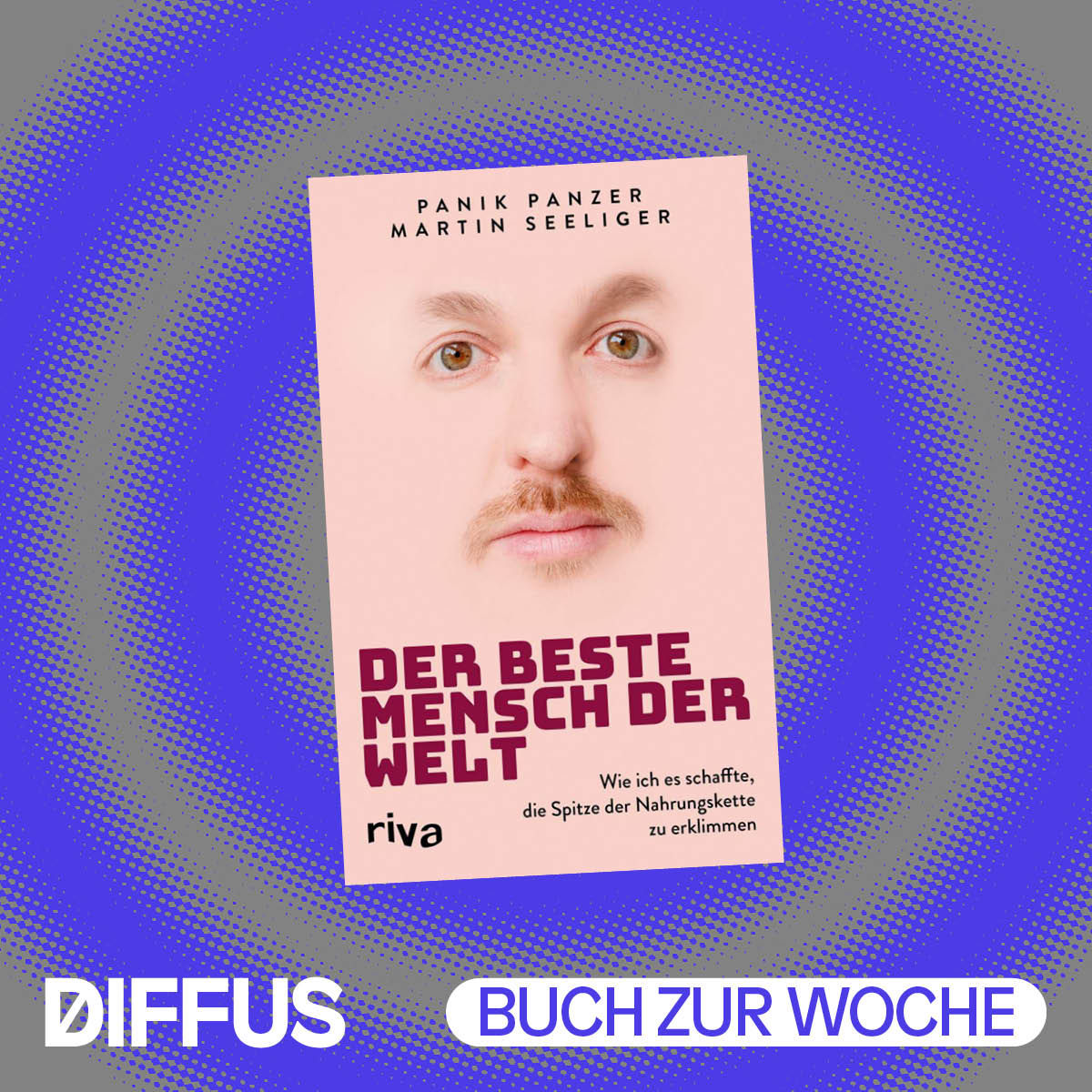
Andreas Dorau im Gespräch über „Die Frau mit dem Arm“ und andere Dinge
Diesmal geht es um das neue Buch von Sven Regener und Andreas Dorau: „Die Frau mit dem Arm“ heißt es und ist soeben im Galiani Verlag erschienen. Mit Andreas führen wir ein Interview über dieses sehr weise, lustige, kurzweilige, skurrile und zu fast 100 Prozent wahre Buch reden. Sven Regener kennt man natürlich als Sänger, Texter und Trompeter der Band Element of Crime. Und man kennt ihn als Bestseller-Autor. Romane wie „Herr Lehmann“, „Neue Vahr Süd“, „Der kleine Bruder“, „Magical Mystery Tour“ und zuletzt „Glitterschnitter“ haben bei vielen fast schon Kultstatus. Andreas Dorau wiederum ist eine der spannendsten Figuren der deutschen Pop-Historie. Seinen ersten Hit „Fred vom Jupiter“ landete er bereits 1981 – da war er 15 Jahre alt. In die NDW-Schublade, in die man ihn stopfen wollte, passte er allerdings schon da nicht. Seitdem liefert Andreas Dorau verlässlich gute, mal verschrobene, mal erstaunlich poppige Musik, ohne jemals auf der Stelle zu treten. Um in sein Ouevre einzutauchen, empfehlen wir, mal diese Songs zu hören: „Girls in Love“, „Stoned Faces Don’t Lie“, „Das Telefon sagt du“ und „Ossi mit Schwan“. Aber wie sieht es nun aus, wenn zwei Menschen ein Buch schreiben? In diesem Fall ist es so, dass Sven Regener die Geschichten aufschreibt, die Andreas Dorau ihm erzählt. Die beiden sind seit Jahrzehnten befreundet und Regener fand schon immer, dass Andreas Dorau Geschichten erlebt hat, die man sich nicht besser ausdenken kann. 2015 erschien bereits „Ärger mit der Unsterblichkeit“, wo Andreas aus seinem Leben bis zum Jahr 2000 erzählt. Nun geht es weiter in „Die Frau mit dem Arm“ und Andreas Dorau nimmt uns mit auf seinem sehr speziellen Weg durch die deutsche Musiklandschaft. Wir haben dank des Galiani Verlags ein paar Bücher bekommen, die wir hier verlosen dürfen. Wenn ihr jetzt also neugierig geworden seid und das Buch gewinnen und lesen wollt, dann schreibt uns eine Mail an verlosung@diffusmag.demit dem Stichwort „Die Frau mit dem Arm“. Bitte gebt dabei auch eure Postadresse an.
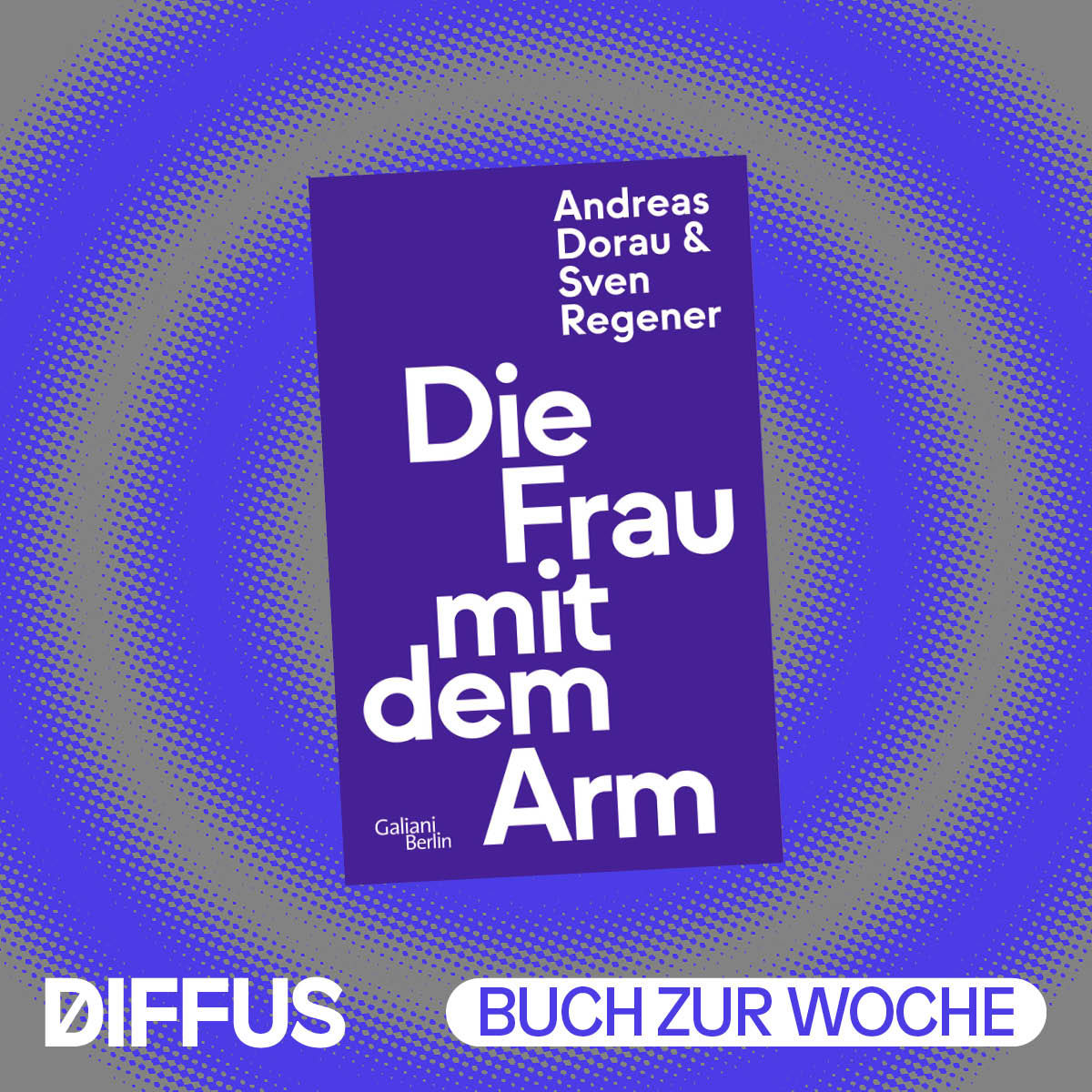
„Liebes Arschloch“ von Despentes ist für ihre Verhältnisse fast versöhnlich
Wer zum Beispiel Virginie Despentes Debütroman «Baise Moi – Fick mich» oder den Essay-Band «King Kong Theorie» gelesen hat, weiß dass diese Frau Bücher schreibt, wie andere Leute einen rechten Haken setzen. Oder einen Tritt in die Eier. In ihrem neuen Briefroman, der in ihrer Heimat Frankreich bereits gefeiert wird, zeigt sie allerdings: Milde, Verständnis, Empathie. Aber keine Panik: Das alles gibt’s nicht ohne Schmerzen. Und in verträglichen Dosen. Das war schon in ihrer extrem erfolgreichen Trilogie „Vernon Subutex“ teilweise zu spüren – über ihren neuen Roman sagte sie jedoch selbst: „Nach der Pandemie hatte ich wirklich überhaupt keine Lust darauf, etwas Depressives zu schreiben.“ Also gönnt sie sich eine schöne Utopie: Nämlich, dass sich misogyne Männer Mitte vierzig tatsächlich noch ändern können. Im Kern des Romans steht ein Mail- und Insta-DM-Wechsel zwischen dem Schriftsteller Oscar, der im Zentrum eines MeToo-Falles steht, und der Schauspielerin Rebecca, die einst Sexsymbol des französischen Films war und ihren angeblichen Bedeutungsverlust ganz gut wegsteckt. Als Kontrast zu diesem sehr unterhaltsamen „Boomer“-Talk gibt es zwischendurch Blogeinträge der jungen Feministin Zoé zu lesen: Sie war vor einigen Jahren die Pressereferentin von Oscar und wurde von ihm körperlich und emotional bedrängt. Ein moderner Brief-Roman, der drei Menschen zusammenbringt, die sich bei Twitter oder in einer Talkshow eher angeschrien hätten. Und genau darum ging es Despentes.
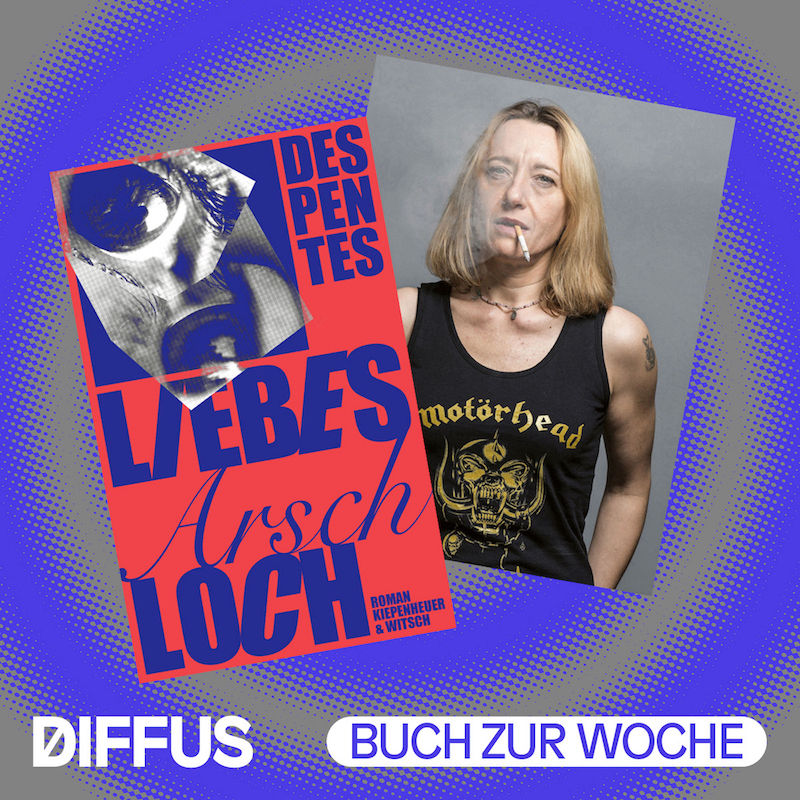
„Die Perfektionen“ ist der Berlin-Roman, der dein ach so cooles Stadtleben zerlegen wird
Heute haben wir einen sehr besonderen Berlin-Roman für euch. «Die Perfektionen» von Vincenzo Latronico. Aus dem italienischen übersetzt wurde das Buch von Verena von Koskull, erschienen ist es im Claassen Verlag. Der Roman handelt von Anna und Tom. Ein Expat-Pärchen, das nach Berlin zieht, was Kreatives mit Medien macht und eigentlich ein perfektes Leben führt. Oder vielmehr: Ein bei Instagram und Co. perfekt aussehendes Leben. Die beiden kennen sich seit der Studienzeit, ergänzen sich prächtig, sind beruflich als Soloselbstständige einigermaßen erfolgreich. Zu Beginn des Buches nimmt uns der Autor mit auf eine Tour durch die schicke Altbauwohnung der beiden. Und schon da merkt man, dass sein alles sehender Blick auch die Ecken ausleuchtet, die nur auf einem bearbeiteten Foto perfekt aussehen. Am Ende wirkt das bei Insta so cool aussehende Leben von Innen ziemlich hohl und unbefriedigend.
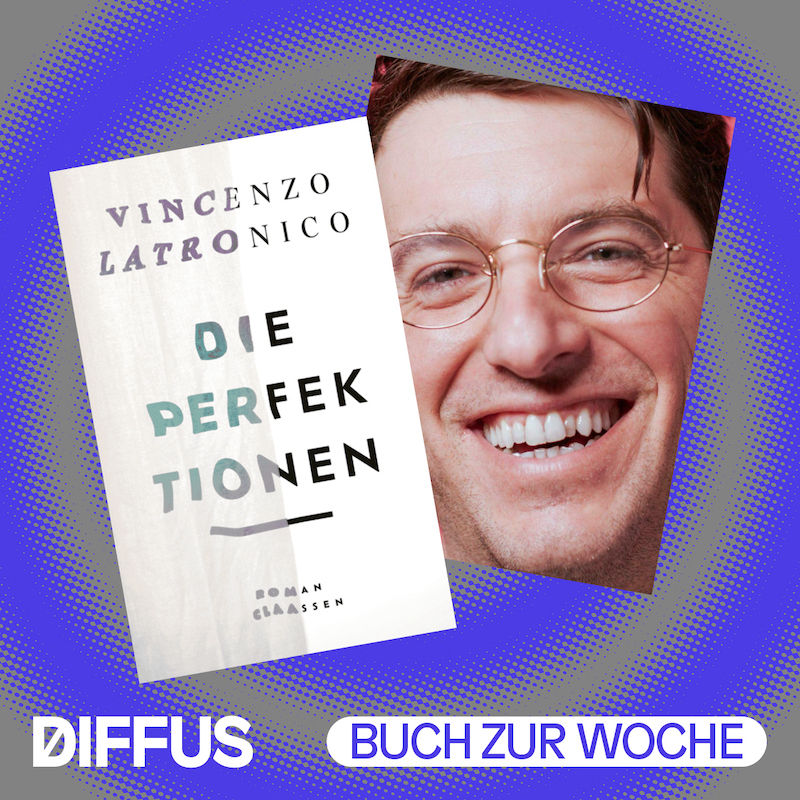
Härter als die Gebrüder Grimm: Ottessa Moshfegh und ihr Roman „Lapvona“
In dieser Folge haben wir schon wieder einen Blockbuster für euch, denn Ottessa Moshfegh ist nicht nur eine Lieblingsautorin von uns sondern auch eine Bestseller-Lieferantin. In der Pandemie entwickelte sich ihr Roman „Mein Jahr der Ruhe und Entspannung“ zum Book-TikTok-Hype, weil die Geschichte die Lockdown-Erfahrung schon Jahre zuvor sehr böse und gut getroffen hat. Bei Ottessa Moshfegh ging es allerdings nicht um einen Virus, der die Menschen zwingt, in der Wohnung zu bleiben, sondern um ein Model, das beschließt, auf Pillen ein Jahr lang durchzuschlafen, weil ihr die Menschheit außerhalb ihres Apartments ziemlich auf die Nerven geht. Das Werk von Ottessa Moshfegh ist eine wilde Reise. Ihr Debüt McGlue war eine Piratengeschichte, das Buch vor „Lapvona“, das „Der Tod in ihren Händen“ hieß, war eher dem Krimi nahe, und der aktuelle Roman ist eine Art Fabel, die in einem fiktiven Mittelalter spielt. Etwas überspitzt könnte man sagen, sie empfehle sich damit als Schwester der Gebrüder Grimm. Nur, dass es bei ihr noch etwas härter zugeht als bei den Grimms.
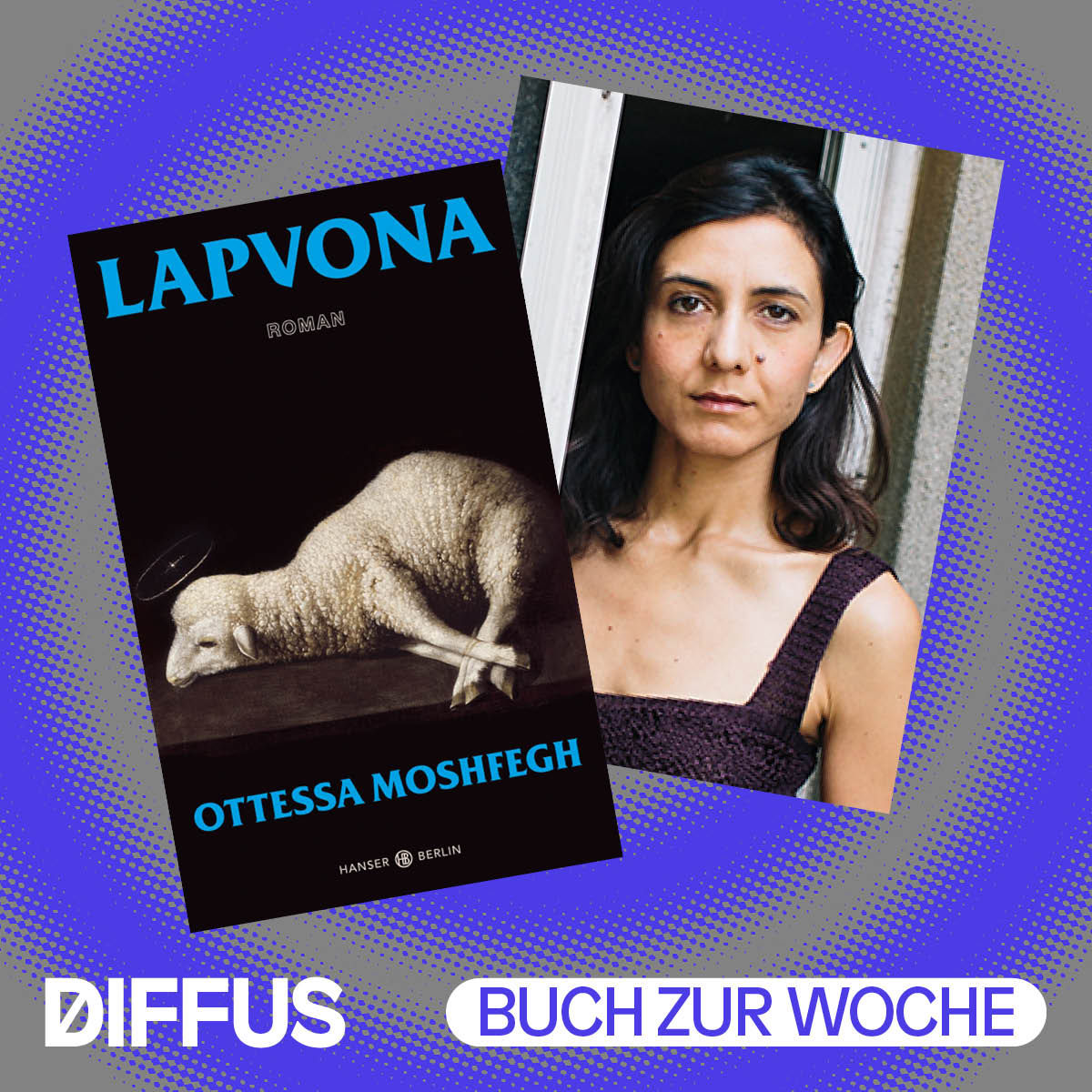
Muss man „The Shards“ von Bret Easton Ellis wirklich lesen, nur weil alle drüber reden?
Der Mann, der uns den „American Psycho“ Patrick Bateman „geschenkt“ hat, veröffentlicht seinen ersten Roman seit 13 Jahren. Bret Easton Ellis fiktionalisiert in „The Shards“ sein eigenes Leben und führt uns in das letzte Jahr seiner Schulzeit. Es ist 1981, Bret wächst reich und von den Eltern meistens alleine gelassen in Los Angeles auf, sammelt erste homosexuelle Erfahrungen und spürt diabolische Kräfte am Werk, die sein Leben und das seiner Schul-Clique verdunkeln werden. Gleichzeitig springt er kopfüber in die Pop-Kultur jener Zeit und verbindet fast jede Erfahrung mit einem ziemlich guten Song oder Film. Aber was führt eigentlich sein neuer Mitschüler im Schilde? Und ist er vielleicht gar dieser brutale Serienmörder, der „The Trawler“ genannt wird? Was hier nach einem Krimiplot klingt, ist zugleich mehr und auch weniger. Und Bret Easton Ellis, der eine durchaus streitbare Person ist, spielt gerne dieses Verwirrspiel zwischen Autobiografie und Fiktion. „The Sharks“ ist aber vor allem ein literarischer Blockbuster, der gerade in allen Kulturprogrammen besprochen und von vielen, meist männlichen, Kritikerin gefeiert oder gar als „dunkles Meisterwerk“ (Süddeutsche Zeitung) bezeichnet wird. Aber ist er das wirklich? Eine Antwort gibt’s in diesem Podcast, der wie auch das Buch selbst ein wenig Überlänge hat.
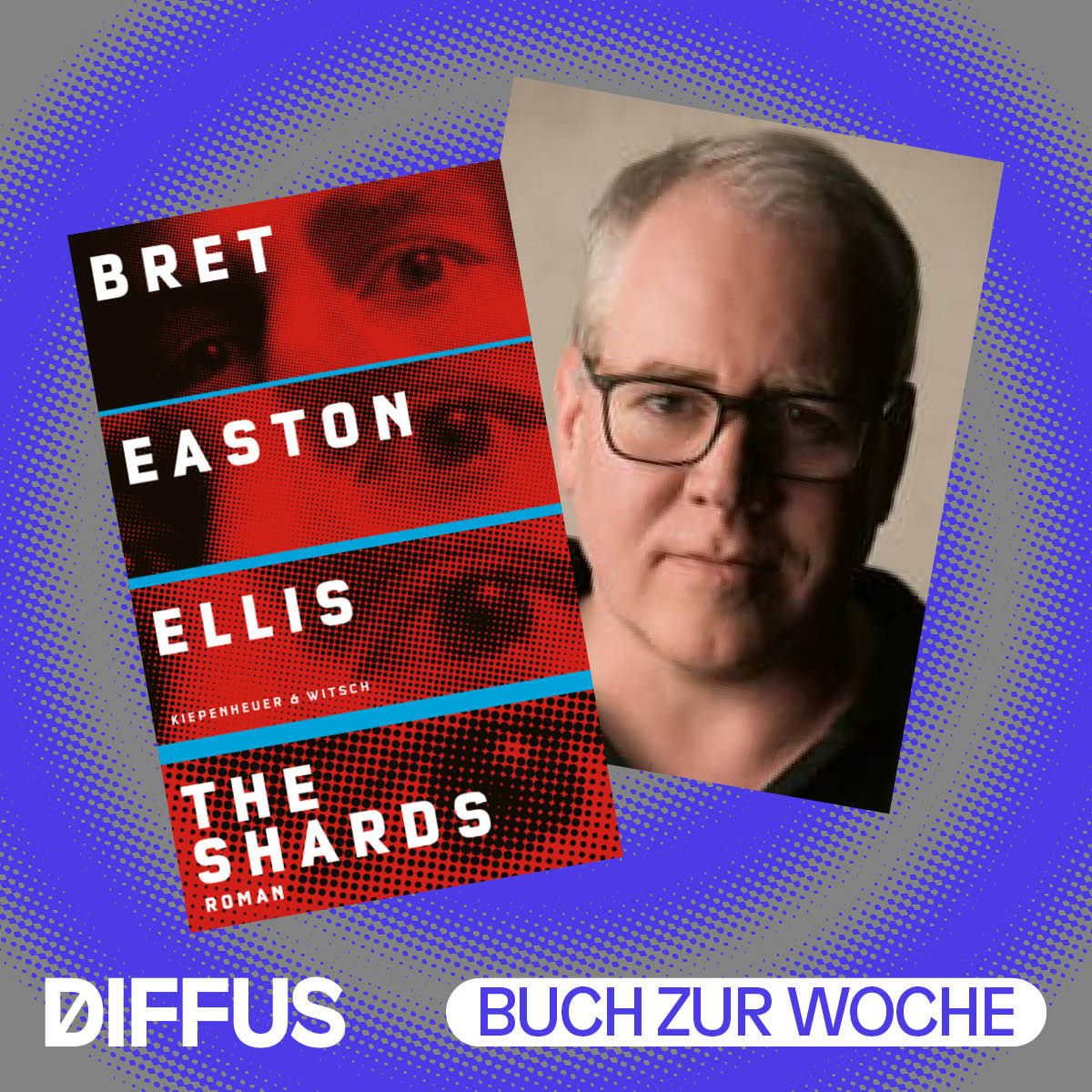
Die Freiheit, Freiheit mal freier zu denken: „Mein anarchistisches Album“ von Eva Demski
Dieses Buch von der Autorin und Fernseh-Journalistin Eva Demski kam gerade im Insel-Verlag raus und liefert genau das, was der Titel verspricht: Sie stellt eine Art Album zum Thema Anarchismus zusammen und erzählt in kompakten Kapiteln fast plaudernd von anarchistischen Denkerinnen und Denkern. Es ist aber nicht nur bloße Wissensvermittlung, die sie da betreibt – man spürt in jeder Zeile ihre persönliche Leidenschaft für das Thema Anarchismus. Ganz nebenbei ist dieses Buch auch noch ein kleines Fotoalbum, denn Demski und eine Freundin von ihr fotografieren seit Jahren Orte, an denen sie das „Anarchisten-A“ sehen – ein umkreistes A, dass diesen Kreis mit seine Enden zu zerschneiden scheint. Man kennt dieses Zeichen natürlich aus dem Straßenbild einer Stadt wie Berlin oder von bemalten Lederjacken, die man auf Punk-Konzerten manchmal sieht. Auch das Wort „Anarchie“ ist eigentlich im allgemeinen Sprachgebrauch verankert. Aber, und deshalb ist es so interessant dieses Buch zu lesen: Anarchie hat einen viel schlechteren Ruf, als diese Idee verdient hat. Viele Politiker oder konservative Medien verwenden gerne Formulierungen wie „Chaos und Anarchie“, wenn zum Beispiel mal wieder eine Demo oder ein Silvester ausartet. Oder sie benutzen das Wort im völlig falschen Wortsinn. Nämlich, um Gewaltherrschaft und Gesetzlosigkeit zu beschreiben, die immer dann vorkommt, wenn zum Beispiel in einem Bürgerkrieg die staatliche Ordnung zusammenbricht und quasi das Recht des Stärkeren etabliert wird. DAS nennt man aber eigentlich eine Anomie. Eva Demski räumt also mit gewissen Vorurteilen auf und zeigt auf oft amüsante Weise, dass ein wenig mehr Anarchie im Leben vielleicht gar keine schlechte Idee wäre …
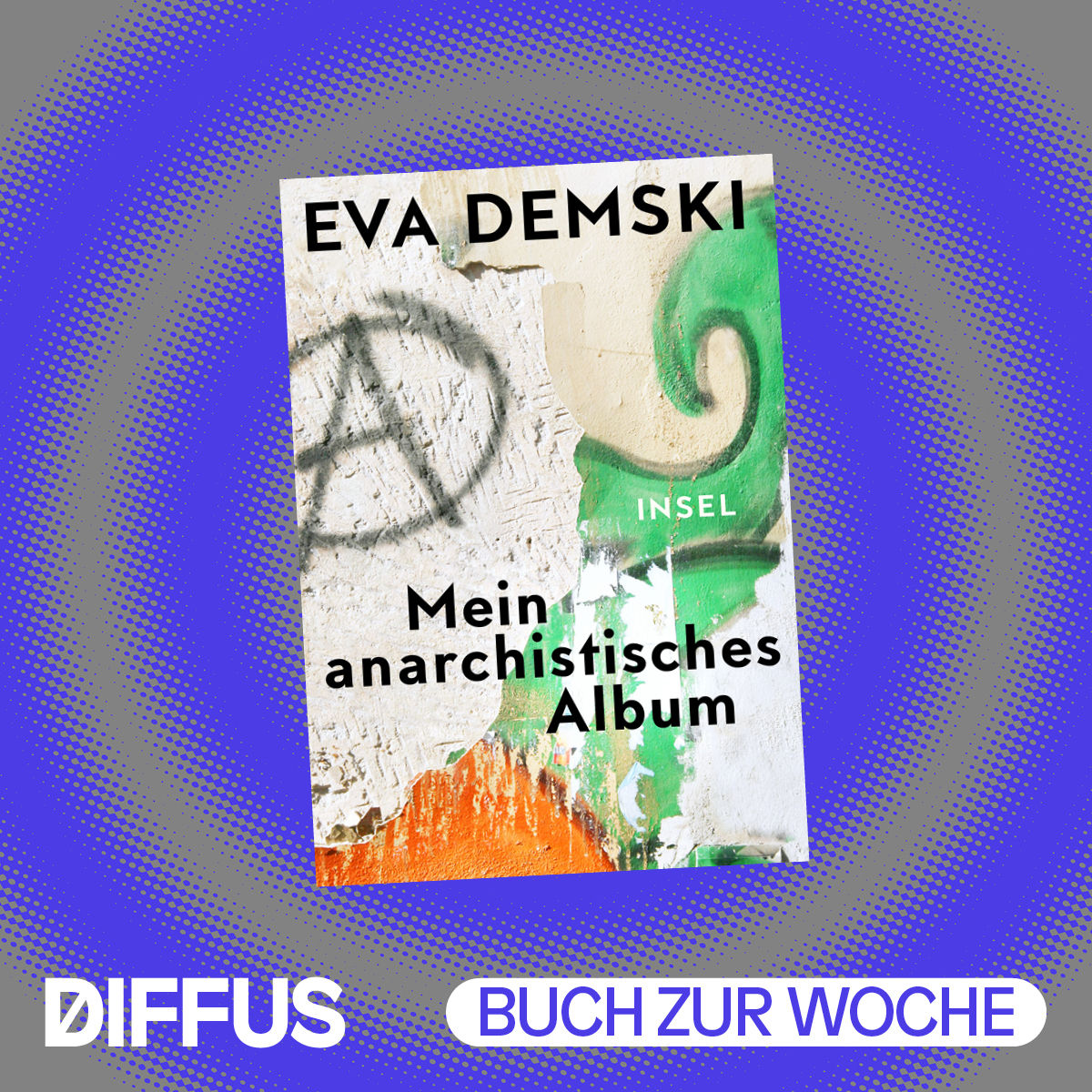
Das eine Buch, das man in diesem Jahr noch lesen sollte: „Himmel über Charkiw“ von Serhij Zhadan
Wir haben eine Weile überlegt, was wir in der letzten Folge des Jahres bringen sollten. Eigentlich hatten wir an so eine Art Bestenliste gedacht, aber das ist ja auch irgendwie doppelt gemoppelt, weil man dann bei Büchern landet, um die es hier schon einmal ausführlicher ging. Uns fiel dann aber in der letzten Woche ein Buch in die Hände, bei dem wir dachten: Stimmt, das sollte man in diesem Jahr unbedingt noch gelesen haben! Es heißt „Himmel über Charkiw – Nachrichten vom Überleben im Krieg“ und wurde geschrieben von Serhij Zhadan. Der Suhrkamp Verlag hat diese Kriegstagebuch des ukrainischen Musikers und Autors im Herbst veröffentlicht. Zhadan hat außerdem im Oktober den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels für seine Arbeit bekommen. Seri Jadan spricht selbst ziemlich gut deutsch, wie man in diversen Interviews hören kann, aber er schreibt dieses Tagebuch aus dem Krieg in seiner Heimat natürlich in seiner Muttersprache – und zwar zu allererst auf seinem Facebook-Account. Editiert und übersetzt wurden diese Texte von Sabine Stöhr, Juri Durkot und Claudia Dathe. Zwischen den sehr unmittelbaren, mal kurzen, mal tiefer gehenden Tagebucheinträgen und Überlegungen, finden sich außerdem viele Fotos von ihm, die sehr deutlich zeigen, was da ein paar Landesgrenzen weiter passiert.
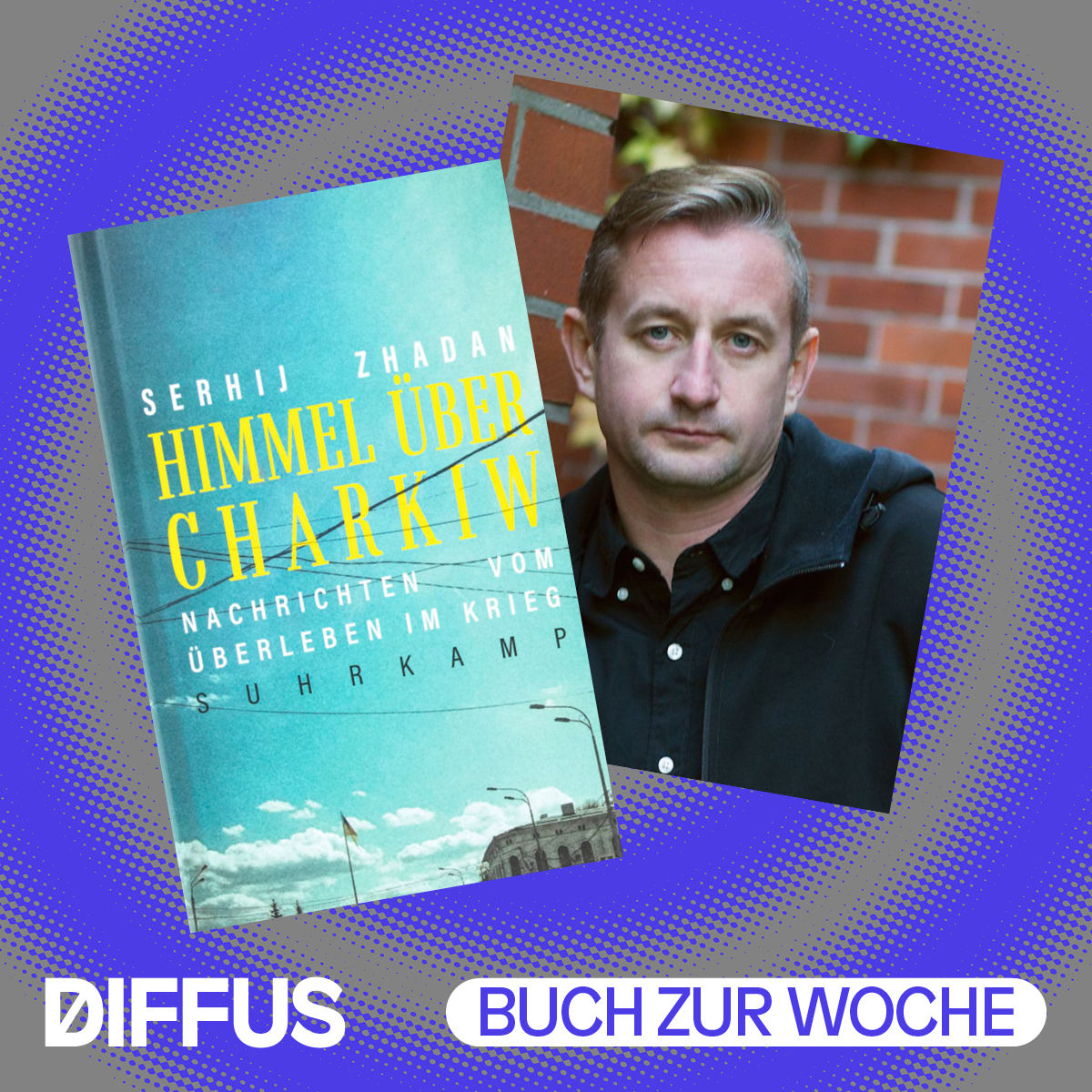
Lillian Fishman tut allen „Große Gefallen“, die Sally Rooney lieben
Heute möchten wir euch ein spannendes Roman-Debüt vorstellen. Und zwar „Große Gefallen“ von der amerikanischen Autorin Lillian Fishman – ein Buch, das allen gefallen dürfte, die in den letzten Jahre Sally Rooney erlegen sind. Wobei es bei Fishman noch etwas abgründiger zugeht. „Große Gefallen“ ist in diesem Jahr in der deutschen Übersetzung von Eva Bonné im Verlag Hofmann und Campe erschienen. Die Autorin Lillian Fishman hat damit in ihrer Heimat einen ziemlichen Wirbel verursacht. Das wundert sie vermutlich aber selbst gar nicht mal. Denn man spürt schon auf den ersten Seiten, wie gerne sie provoziert und Vorurteile in Sachen Liebe und Sexualität auf Links zieht. Für Diskussionen sorgte vor allem, dass Fishman, die sich schon während ihrer High School-Zeit als queer outete, in diesem Buch von einer lesbischen jungen Frau erzählt, die ihre eigentlich erfüllende Beziehung zu einer Kinderärztin gegen eine abgründige Dreiecks-Geschichte eintauscht, die um einen nicht gerade sympathischen heterosexuellen Mann mit toxischen Tendenzen kreist. Könnte auch ein schlechter Porno sein – wenn man nur auf den Plot schaut. Aber genau das ist „Große Gefallen“ eben nicht. Warum? Das erfahrt ihr im Podcast.
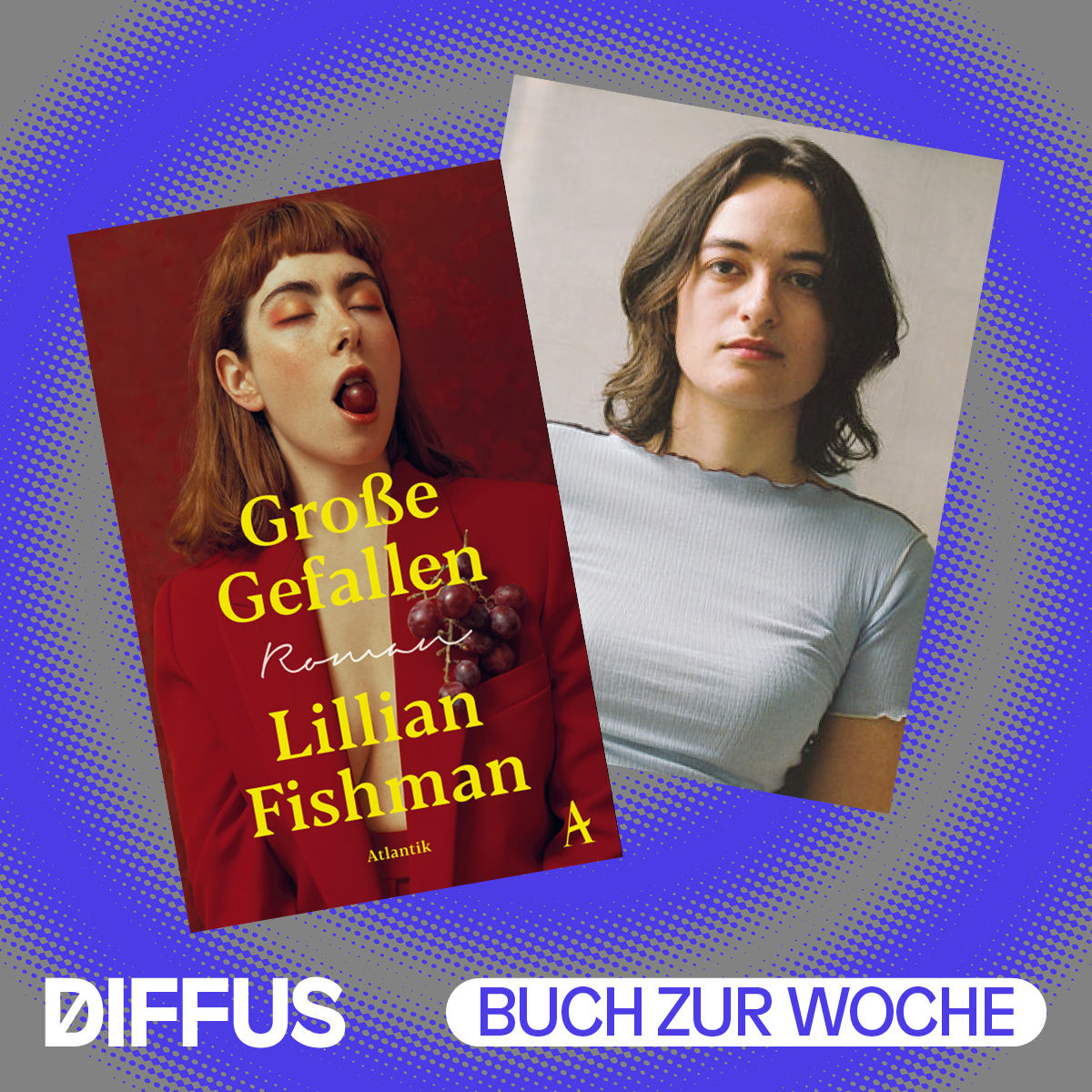
Lieblingsbücher: „Geek Love“ von Katherine Dunne ruft ein lautes „Hi Freaks“
Heute gibt’s mal wieder ein Lieblingsbuch vom Host: „Geek Love“ heißt es im Original und stammt von der leider 2016 verstorbenen Autorin Katherine Dunne. In Deutschland erschien das Buch vor gut acht Jahren in der Übersetzung von Monika Schmalz im Berlin Verlag. Da hat es den etwas sperrigen Titel „Binewskis: Verfall einer radioaktiven Familie.“ Die Amerikanerin Katherine Dunne genießt zumindest im Englischsprachigen Raum bei vielen Menschen mit gutem Buchgeschmack Kultstatus. Im Roman „Geek Love“, der 1989 veröffentlicht wurde, geht es um die sehr besondere Familie Binewski. Daher auch der Titel der deutschen Ausgabe: „Binewskis: Verfall einer radioaktiven Familie.“ Obwohl das Wortspiel nur so ha ha-lustig ist, trifft es den Kern der Story ganz gut. Dunne erzählt aus dem Leben einer besonderen Schaustellerfamilie, die auf amerikanischen Jahrmärkten ihre eigene „Freak Show“ unterhält – bzw. sie zeugt. Die Storyline von „Geek Love“ ist dabei zwar recht konventionell und im Kern ein schillerndes, böses Familiendrama – aber das Buch haut jede:n um, weil Katherine Dunne eine wahnsinnig gute Autorin ist. Der Humor ist bitterböse, die Beschreibungen dieser eigenen Welt und ihres freakigen Personals sind poetisch und hart zugleich – und das ganze Buch feiert einfach dermaßen schamlos und euphorisch das Anderssein, dass man bei einigen Parts sogar laut jubeln möchte.
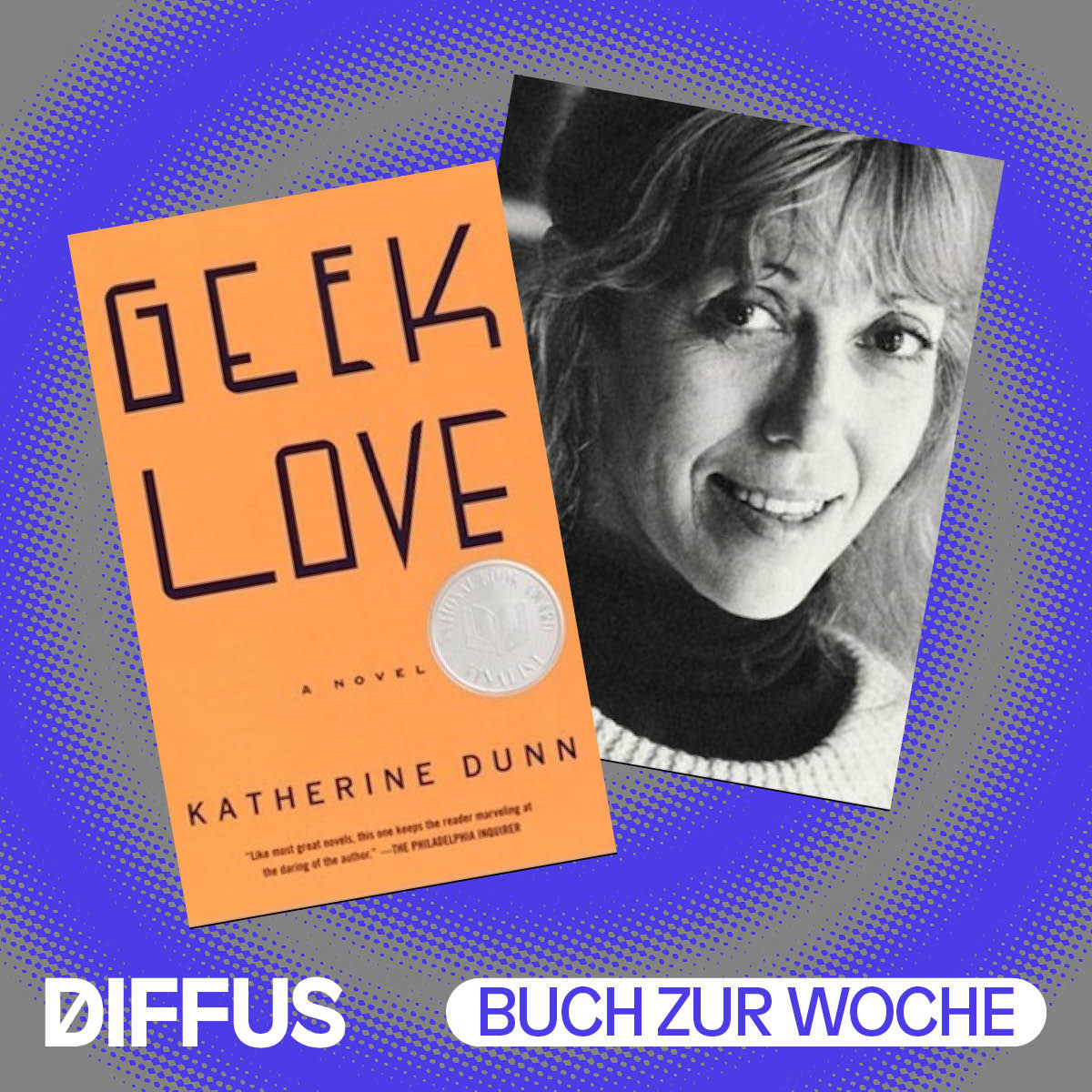
Die bizarre und poetische „Zeremonie des Lebens“ in den Storys von Sayaka Murata
In dieser Folge geht es um das neueste Buch der Japanerin Sayaka Murata. Das trägt den recht harmlos klingenden Titel „Zeremonie des Lebens“ und ist vor einigen Wochen im Aufbau Verlag erschienen. Murata hat darin zwölf Kurzgeschichten versammelt, die uns ebenso verstört wie begeistert haben. Übersetzt aus dem Japanischen wurden sie von Ursula Gräfe. Sayaka Murata gilt als eine der wichtigsten Stimmen der jüngeren japanischen Literatur. Ihre Romane „Die Ladenhüterin“ und „Das Seidenraupenzimmer“ erzählen brutal und poetisch von Außenseiter:innen in einer Gesellschaft, die eher auf Leistung und Konformität ausgelegt ist. Schon die erste Story in „Zeremonie des Lebens“ lässt einen nicht mehr los: Nicht mal 20 Seiten braucht sie, um unseren Blick auf das Leben und den Tod über den Haufen zu werfen und uns mit einer Mischung aus Faszination und Ekel zurückzulasesn. Zwar haben nicht alle Stories diesen philosophischen Schockeffekt. Dafür sind einige auf eine Weise romantisch, die man eben auch selten liest: Zum Beispiel, wenn Murata von einem Liebespaar erzählt, das aus einem Jungen, und einem im Wind wehenden Vorhang besteht. Aus der Titelstory „Zeremonie des Lebens“ wiederum könnte man einen Horrorfilm im Stile von „Midsommar“ machen. Was all diese Storys aber verbindet ist Muratas feministischer, rebellischer Blick auf die Welt.

„Das letzte Mahl“ mit Heyne Hardcore und Karla Zárate
Heute stellen wir euch ein Buch namens „Das letzte Mahl“ von der mexikanischen Autorin Karla Zárate vor. Darin geht es um diverse Henkersmahlzeiten – bzw. um den Koch, der diese zubereitet. Gleichzeitig ist dieses Buch einer der letzten Romane, der unter dem Banner „Heyne Hardcore“ erschienen ist. Der Verlag wird umstrukturiert und deshalb werden Romane dieser Art, die vorher das „Hardcore“ auf dem Cover hatten, in Zukunft ganz normal beim Heyne Verlag erscheinen. Das ist schade, denn diese Veröffentlichung ist noch einmal ein Roman, der das Wort „Hardcore“ zurecht trägt. In „Das letzte Mahl“ nimmt uns Ich-Erzähler John Guadalupe nimmt uns mit in sein Leben und auf seine Arbeit. Er ist Koch in einem texanischen Gefängnis, wo er u. a. die Henkersmahlzeiten zubereitet. Aber auch seinen Chef bekocht. Diesen Gefängnis-Direktor wird er gleich auf den ersten Seiten umbringen. Warum er das tut – ist ein Teil der Story. Zimperlich geht es bei Karla Zarate nicht gerade zu. Und wer das mag, hat mit „Das letzte Mahl“ einen guten, blutigen Snack für zwischendurch. Man hört John Guadelupe eben doch mit einer leicht angewiderten Empathie zu und gerade die Blicke in seinen Alltag und in sein frühes Leben sind bisweilen sehr interessant.
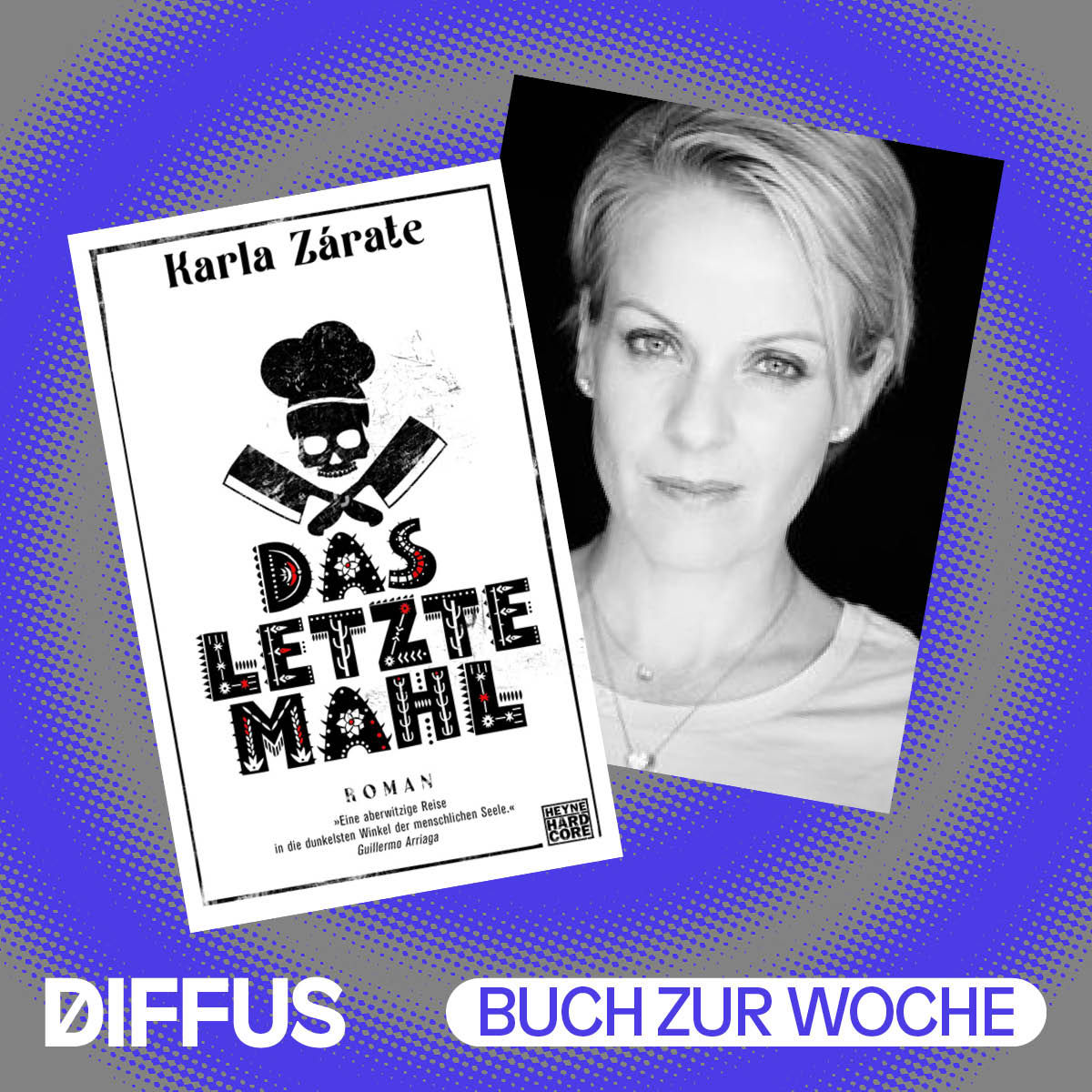
Romantik-Wrestling: Max Richard Leßmann über „Liebe in Zeiten der Follower“
Dinge, die wir Max Richard Leßmann immer schon mal sagen wollten: „Man merkt schon. Bei dir sitzen die Gedichte locker. Was mich wundert: Da kommt so gut wie nie scheiße bei raus. Woran liegt das?“ Diese und viele andere Fragen stellten wir dem Musiker, Songwriter, Dichter und Podcaster. Seine romantischen Gedichte, die er täglich bei Instagram mit rund 110.000 Follower:innen teilt, sind kleine, aber oft erstaunliche tiefe Lichtblicke im Doomscrolling der letzten Jahre. Nun hat Max Richard Leßmann seine persönlichen Favoriten in Buchform bei Kiepenheuer & Witsch veröffentlicht. Wir lesen uns gemeinsam durch eine kleine Auswahl und sprechen mit Max über Romantik, Wrestling, die Kitschfalle, das tägliche Gedankenspielen, dunkle Momente im Leben und den Sieg der Romantik über den Zynismus. Außerdem verlosen wir zwei Exemplare des Buches. Wenn ihr eines gewinnen wollt, dann schickt uns einfach eine Mail mit eurer Postadresse, einem kleinen romantischen Gedicht und dem Betreff „Romantik-Wrestling“ an verlosung@diffusmag.de. Viel Glüc

„Ich hasse meine Freunde“ schreibt Gerald Hoffmann – und meint das gar nicht so böse
Der Österreicher Gerald Hoffmann war uns vorher in erster Linie als Musiker bekannt. Unter dem Namen Gerard veröffentlichte er in den letzten Jahren atmosphärische Alben und Songs irgendwo zwischen Rap und Pop. Nun hat er bei Kiepenheuer & Witsch seinen Debütroman veröffentlicht und ihm diesen tollen Titel gegeben: „Ich hasse meine Freunde“. Wer das Buch liest, merkt jedoch schnell: Es ist maximal eine Hassliebe, die den Ich-Erzähler Julian Pichler da bewegt. Eigentlich hängt er nämlich sehr gerne mit seinen Freunden rum – und lässt sich nur zu gerne in eine amüsante Eskalation hineinziehen. Dabei spielen pflanzliche Drogen, verschwundene Bitcoins und ein Sehnsuchtsort namens Bad Gastein wichtige Rollen. Gerald erzählt diese Story in einem Tempo, dem man sich schwer erziehen kann. Dabei trifft gut abgehangene Mittzwanziger-Orientierungslosigkeit auf naiven Aktionismus, einen Humor, der die Pointen im Vorbeilaufen raushaut und auf Dialoge, die so anfangen, wie man es aus dem eigenen Leben mit seinen besten Freund:innen kennt – bis sie in abenteuerliche Gefilde aufbrechen. Wer Tino Hanekamps Romandebüt „So was von da“ geliebt hat, sollte „Ich hasse meine Freunde“ also unbedingt auch lesen. Wir haben dem Autor außerdem ein paar Fragen per Sprachnachricht geschickt, die Gerald Hoffmann uns nur zu gerne beantwortet hat.
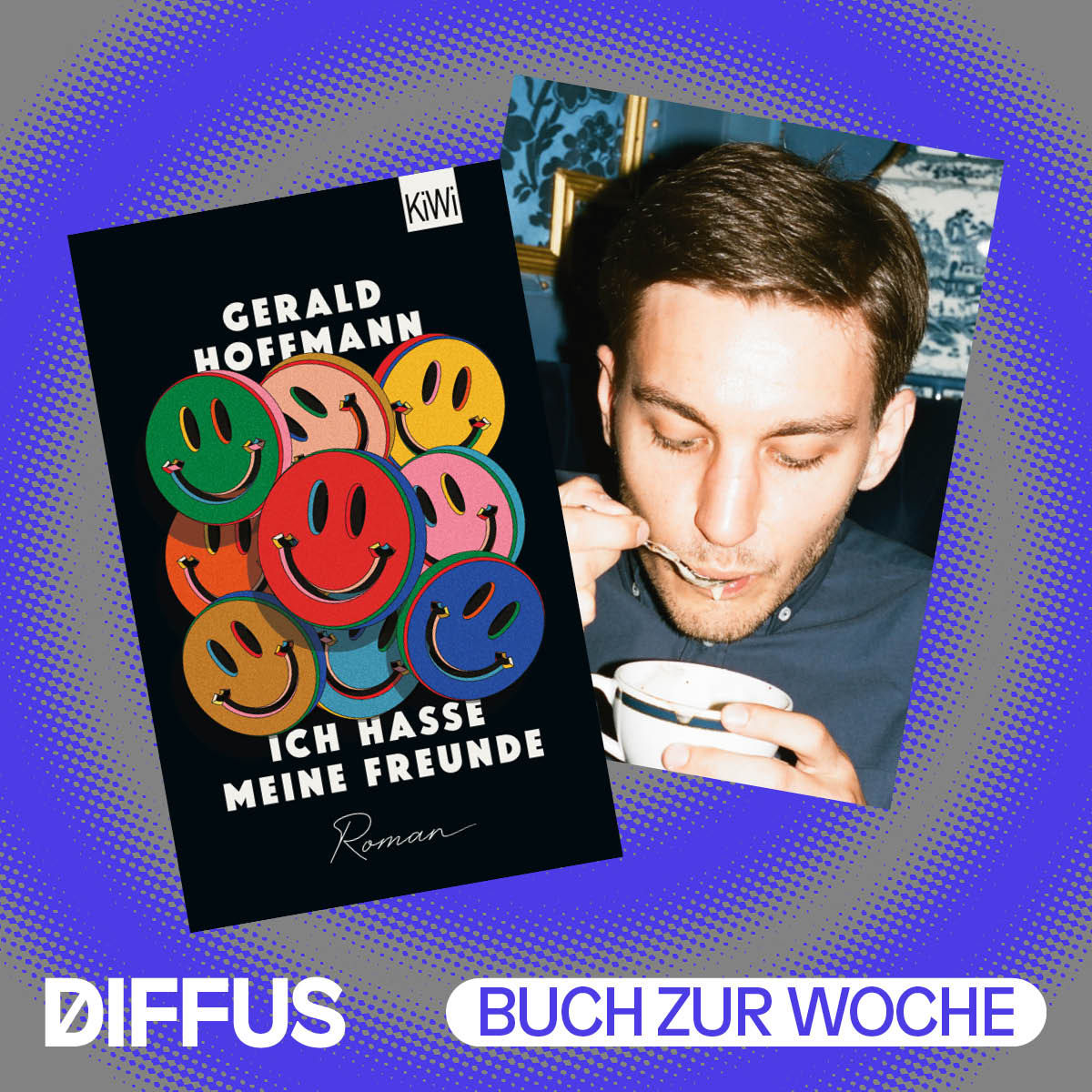
Lieblingsbücher: „Eisfuchs“ von Tanya Tagaq ist ein wilder Roman über eine Inuit-Jugend
Heute gibt’s mal wieder ein Lieblingsbuch des Hosts: „Eisfuchs“ von Tanya Tagaq. Die Sängerin, Künstlerin, Musikerin und Autorin erzählt in ihrem Debütroman „Eisfuchs“ von einer Kindheit und Jugend in der Arktis. Taqaq entstammt der indigenen Gruppe der Inuit und kommt somit aus Kanada, wo sie an der Südküste von Victoria Island lebt. Die Ich-Erzählerin erlebt ein Aufwachsen voller Armut und Gewalt, aber auch voller Mythen und Abenteuer, die sie mit ihrer Clique in der Tundra bestreitet. Sie wird immer wieder Opfer körperlicher und sexueller Gewalt – oft betrinken sich die Erwachsenen hemmungslos und steigen nachts in das Zimmer der Kinder. Die Teenager Kids des Romans entkommen der alltäglichen Gewalt mit Drogen und Alkohol, eigenen, selbst bestimmten sexuellen Erfahrungen und gemeinsamen Erkundungen ihres Dorfes und der Tundra drum rum. Taqaq erzählt im Grunde eine Coming-of-Age-Geschichte, mal in Prosa, mal in Versform. Und das in einer Sprache und mit einer Bildwucht, die man nie mehr vergessen wird. „Eisfuchs“ von Tanya Tagaq ist im Kunstmann Verlag erschienen. Hier gibt’s alle Infos und eine Leseprobe. https://www.kunstmann.de/buch/tanya_tagaq-eisfuchs-9783956143533/t-0/
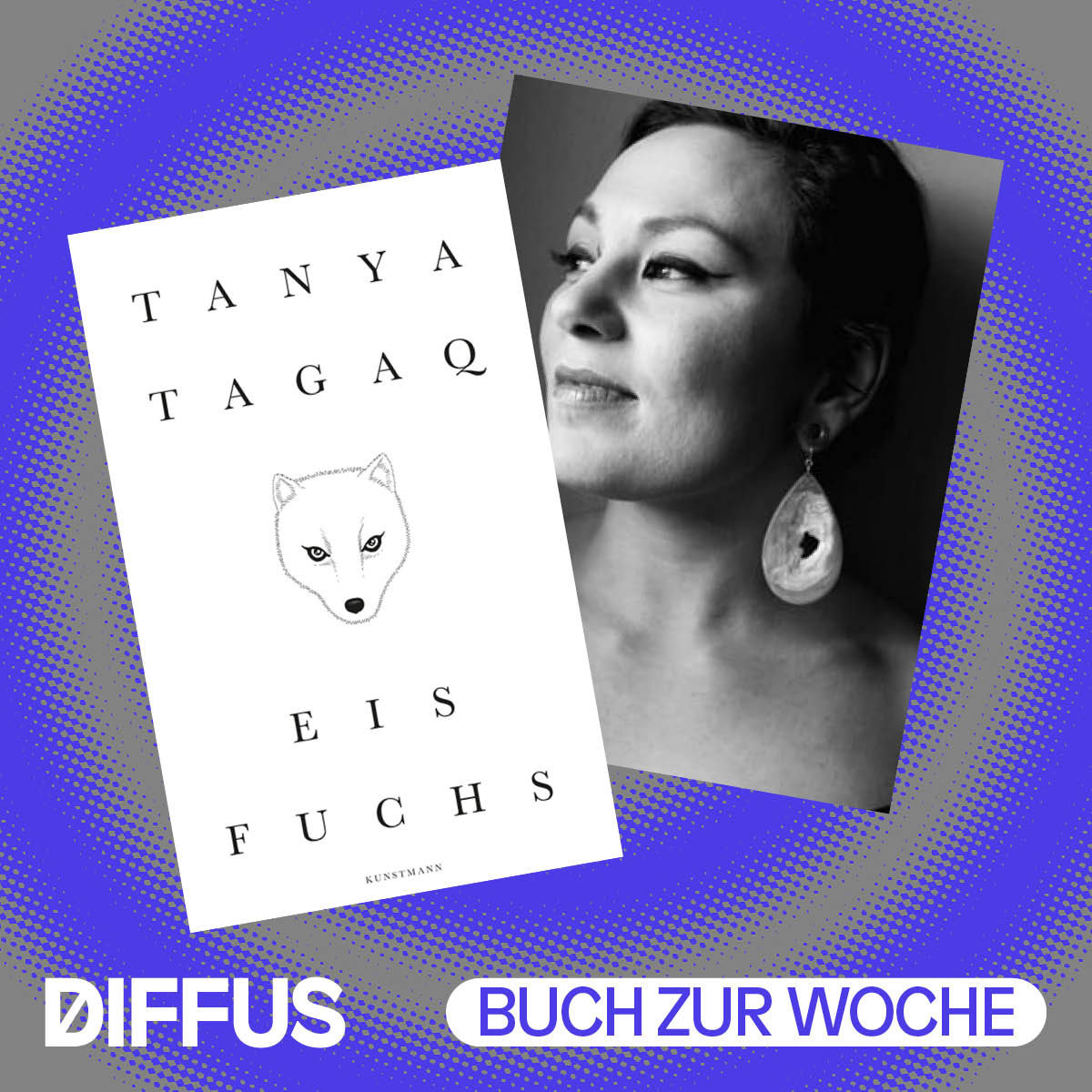
Julia Friese spricht über „MTTR“: „Wenn es eine Musik gibt, die zu dem Roman passt, dann wäre das Rammstein.“
Wenn man sich das Cover und den Titel von Julia Frieses Romandebüt „MTTR“ anschaut, denken viele sofort: „Ach ja, das heißt ‚Mutter‘, man lässt ja heute die Vokale weg, wenn es schick aussehen soll.“ Damit geht man der in Berlin lebenden Journalistin (Die Zeit, Musikexpress) aber schon auf den Leim. Die Abkürzung MTTR heißt nämlich „Mean Time To Recover“ und ist dem Ingenieurswegen entnommen. Was genau das bedeutet, und warum es sehr gut passt zu ihrer Geschichte, erfahrt ihr in dieser Interviewfolge. Im Buch geht es vordergründig um eine Frau der „Millenial“-Generation, die ungewollt Mutter wird. Teresa Borsig heißt sie – und ist sich eigentlich gar nicht sicher, ob sie das Kind will. Sie geht sogar mit dem Wunsch nach einer Abtreibung zur Ärztin. Obwohl Julia auch den Weg dieser Mutterwerdung erzählt, ist es nicht das einzige Kernthema: Eigentlich geht es nämlich generell um Erziehung und gesellschaftliche Zwänge. Ihre Generation wurde erzogen von Kindern der Kriegsgeneration, die wiederum das Nicht-über-Probleme-Reden, das Definieren über Arbeitskraft, den militärischen Drill und das harte Erziehen verinnerlicht hat. Julia nimmt sozusagen die Sätze, die ihre Erziehung geprägt haben als Ausgangspunkt für die Überlegungen: Was macht das mit mir? Mit den Menschen, die ich großziehen muss? Wo findet sich diese anerzogene Brutalität der Erziehung in meinem Leben und in der Gesellschaft? Das Buch ist vor allem so packend, weil es in einer klaren, knappen, brutalen Sprache geschrieben ist. Die wiederum inspiriert ist von den Sätzen, die man sich als Kind so anhören musste: „Gleich gibt’s was hinter die Ohren!“ „Stell dich nicht so an!“ „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen!“ Wenn es also, so sagt Julia mit einem Hauch von Ironie, „eine Musik gibt, die zu dem Roman passt, dann wäre das Rammstein.“ Wenn ihr nach dem Interview Interesse an dem Buch habt, könnt ihr bei uns zwei Exemplare von „MTTR“ gewinnen, das soeben im Wallstein Verlag erschienen ist. Schreibt uns einfach eine Mail mit eurer Postadresse an verlosung@diffusmag.de. Viel Glück!

Mord, Partys, Totschlag, viel Berlin und „Ruhm für eine Nacht“ gibt’s im Romandebüt von Calla Henkel
Heut gibt’s einen guten Thriller, der zugleich ein spannender Berlin-Roman ist - „Ruhm für eine Nacht“ von Calla Henkel. Die deutsche Ausgabe kam gerade im Kein & Aber Verlag heraus, in der Übersetzung von Verena Kilchling. Der Roman spielt im Berlin der Nullerjahre, im Kreise jener Menschen, die man wohl Expats nennt. Ich-Erzählerin Zoe kommt mit ihrer Uni-Bekannten Hailey nach Berlin, um dort für ein Jahr zu studieren. Beide gehen sonst in New York auf die Art School – wobei die Erzählerin Zoe nie so recht zu wissen scheint, warum sie das eigentlich tut und ob das wirklich alles Kunst ist, was man an den Universitäten als solche verkauft. Zoe hat außerdem noch ein paar Traumata im Reisegepäck: Ihre beste Freundin Ivy wurde brutal ermordet. Der Täter nie gefasst. Wir lernen bald aus Zoes Erzählung, dass die Grenze zwischen Liebe, Besessenheit und Freundschaft bei den beiden mitunter verschwommen ist. Zoe und Hailey ziehen schließlich in eine Wohnung in einem etwas abgehängten Teil der Stadt. Sie gehört einer bekannten Krimi-Bestseller-Autorin, die für eine Weile nach Wien gehen will, wo sie ein Schreibstipendium hat. Zoe und Hailey werfen sich nach und nach ins Berliner Nachtleben, schaffen es nicht ins Berghain, hängen in Arty Bars ab und stellen irgendwann fest, dass sie das alles nicht so richtig kickt. Vor allem Hailey redet ständig davon, ihr Leben zu einem Gesamtkunstwerk machen zu wollen – und dazu passt es eben nicht, ein Slacker-Dasein in Berlin zu fristen. Also veranstalten die beiden in ihrem Appartment rauschende Feste – und werden mit jeder Feier mehr zum Place To Be. Bis Haileys Leben ein blutiges Ende findet.
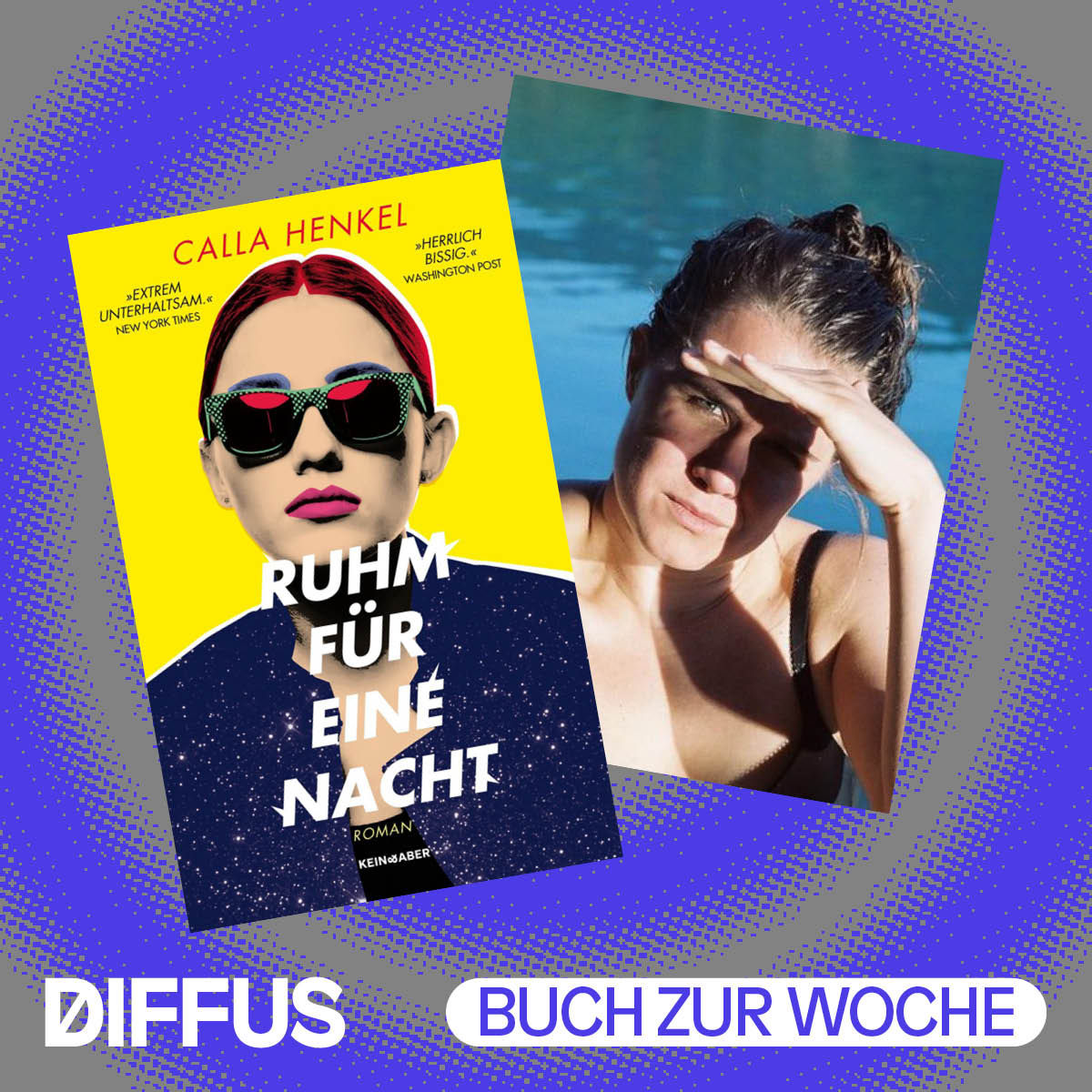
Über Bierdosenringe, Krach, Pulp und „Good Pop Bad Pop“ von Jarvis Cocker
Für die Jüngeren unter euch: Jarvis Cocker war Sänger der britischen Band Pulp. Die kennt man vielleicht durch die Songs „Disco 2000“ und „Common People“. Sie waren Teil des Britpop-Hypes und da eher nicht so die Lad- und Proll-Abteilung, sondern witzig und auf smarte Weise sozialkritisch. In „Common People“ geht es zum Beispiel um eine reiche Kunststudentin, die mit Jarvis abhängen will, weil der ja so arm und so real sei. Pulp haben schon lange keine neue Musik mehr veröffentlicht, aber sie haben vor einigen Jahren schon mal Reunion-Shows gespielt und werden das auch im nächsten Jahr wieder tun. Jarvis Cocker war aber alles andere als untätig: Er hat 2017 mit Gonzales ein sehr weirdes, sehr schönes Pianoalbum aufgenommen, hat als JARV IS 2020 die Platte „Beyond The Pale“ veröffentlicht und für den Wes Anderson Film „The French Dispatch“ ein Soundtrack-Album eingespielt. Auf „Chansons D’Ennui“ covert er französische Pop-Hits. Und jetzt kommt also sein Buch „Good Pop Bad Pop“ bei Kiepenheuer & Witsch. Der Untertitel lautet „Die Dinge meines Lebens“ und gibt sozusagen das Konzept des Buches vor. Denn: „Good Pop Bad Pop“ ist keine schnöde Autobiografie. Jarvis Cocker räumt sozusagen seinen Dachboden auf und nimmt sich wirklich die Gegenstände vor, die er dabei findet. Warum das sehr amüsant und erhellend ist, erfahrt ihr in dieser Folge.
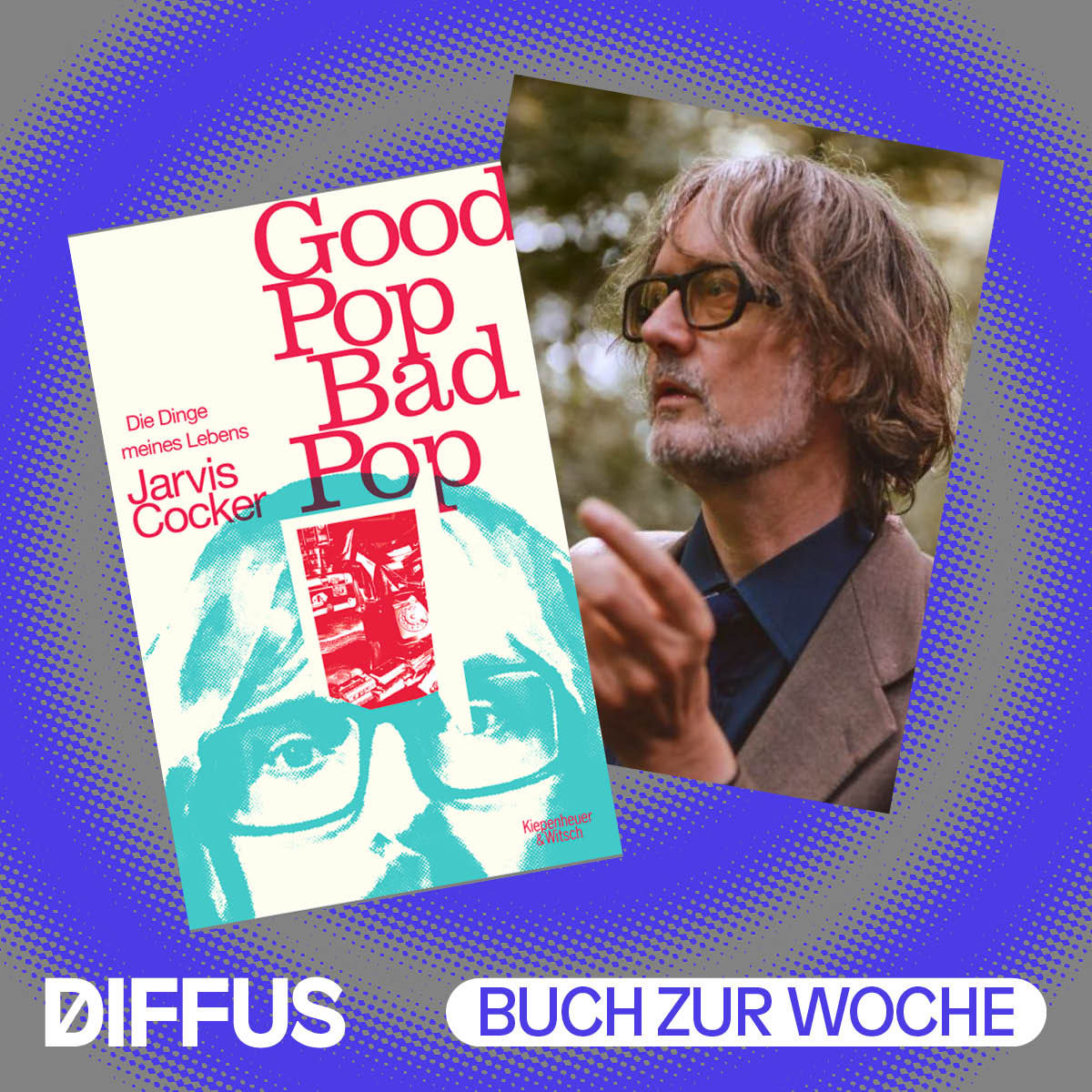
„So forsch, so furchtlos“ von Andrea Abreu ist eine buchgewordene Riot-Grrl-Platte
Diesmal geht es um das Buch „So Forsch, So Furchtlos“ von Andrea Abreu, das vor einigen Wochen bei KiWi im Hardcover erschienen ist. Andrea Abreu ist 1995 auf Tenneriffa geboren und dort aufgewachsen. Ihr Leben hat aber wenig mit dem zu tun, was eure Eltern euch vom letzten Tenerrifa-Urlaub berichtet haben. „So forsch, so furchtlos“ erzählt von einer besonderen Mädchenfreundschaft. Die namenlose Ich-Erzählerin lebt in einem kleinen Dorf am Rande eines Vulkans und zieht mit ihrer wilden, besten Freundin Isora umher. Die beiden stehen kurz vor bzw. so gerade in der Pubertät und befassen sich immer wieder mit ihren Körpern. Essen und Verdauen und Sich-Anfassen sind große Themen für die beiden, die sich – völlig alleine gelassen – ihren eigenen Reim auf das Leben und ihre Körper machen. Dass Andrea Abreu für diese rotzige, trotzige, grenzenüberschreitende Lebensphase die richtige Sprache gefunden hat, macht dieses Buch zu Recht zum Hype.

Neue Musikbücher über Primal Scream, Cäthe und Flintas, die „Punk as F*ck“ sind
Diesmal gibt es ein kompaktes Round-up zu neuen Musikbüchern: Die Autobiografie von Bobby Gillespie, das Buch über den Musik- und Lebensweg von Cäthe und „Punk as F*ck“ von Diana Ringelsiep und Ronja Schwikowski. „Tenement Kid“, die Autobiografie von Bobby Gillespie, ist gerade bei Heyne Hardcore auf Deutsch erschienen. Bobby ist und war der Sänger und Gründer und Cheftexter bei Primal Scream und erzählt hier von seiner Kindheit und Jugend in Glasgow – und natürlich von seiner Musikerkarriere. Das war es dann mit den Rock-Kerlen in dieser Folge. Kommen wir zu starken Musikerinnen aus Deutschland: Nämlich zur Sängerin und Songwriterin Cäthe. Die hat früher im Jahr das sehr gute Album „Chillout Punk“ veröffentlicht und sich in der Zeit viel mit Alexandra Helena Becht gesprochen: Sie ist Journalistin, Promoterin und Beraterin und kam auf die Idee ein Buch über Cäthe zu schreiben, das zugleich gute Einblicke gibt in das Haifischbecken Musikindustrie. „Lügen ist scheiße“ heißt das Buch und ist wieder einmal Pflichtlektüre für junge Musikerinnen und Musiker. Last but not least dabei: „Punk as F*ck“ – herausgegeben von zwei sehr geschätzten Kolleginnen, nämlich Diana Ringelsiep und Ronja Schwikowski. Diana ist Musikjournalistin und war vor allem eine treibende Kraft hinter #punktoo und Ronja ist Chefredakteurin des besten Punkmagazins der Welt „Plastic Bomb“. 50 Texte über die Punk-Szene aus Flinta-Perspektive, erschienen im Ventil Verlag.
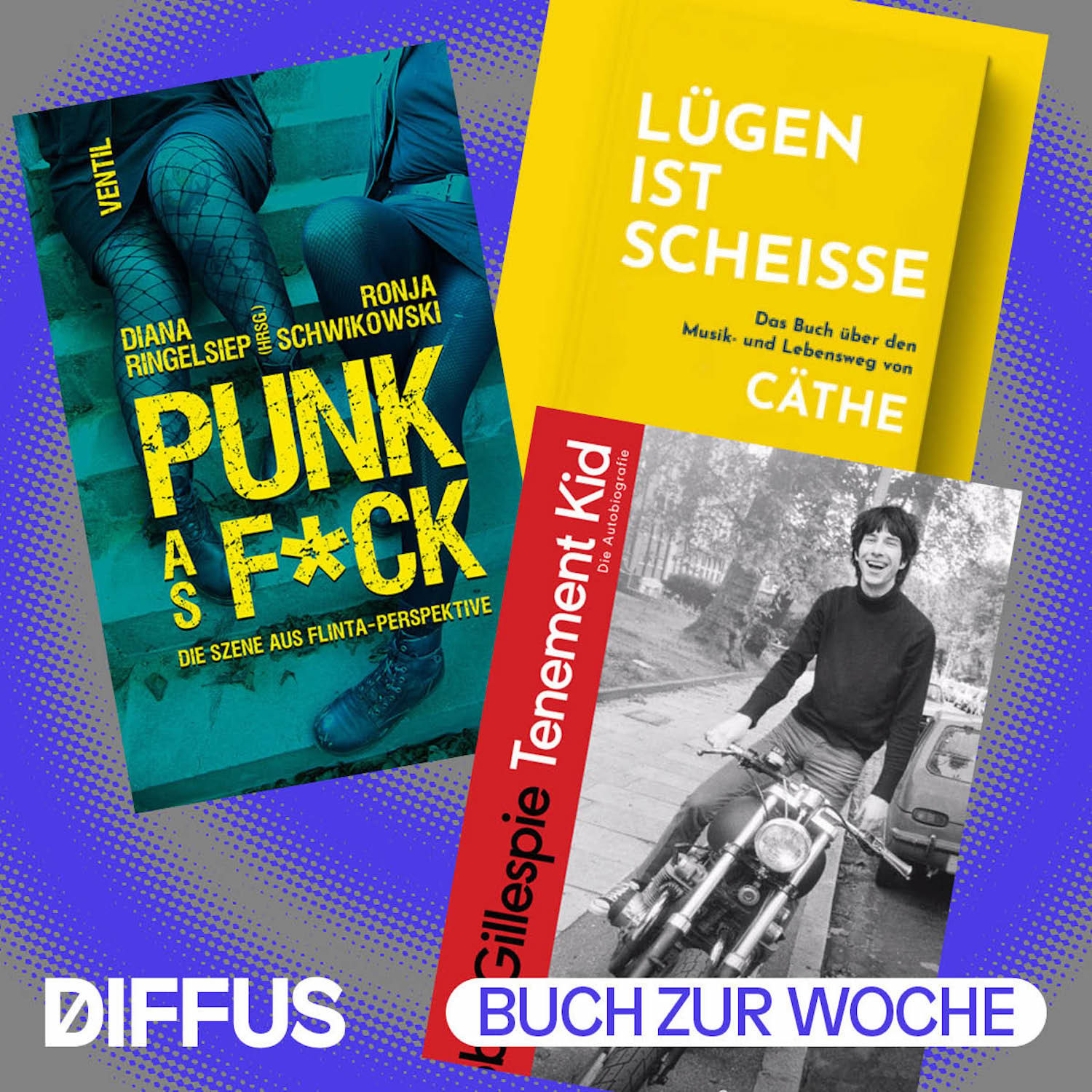
Das Buch zur Woche (Trailer)
Musiker:innen, die plötzlich gute Romane veröffentlichen. Autor:innen, deren Bücher wie guter Rap klingen. Aufregende Bücher, die ein größeres Publikum verdient hätten. Neuerscheinungen, an denen kein Weg vorbei führt. Interviews zwischen Bookstagram-Nerdtum und Deep-Talk. All das gibt es jede Woche neu im „Buch zur Woche“ vom Popkultur-Magazin DIFFUS. Moderation: Daniel Koch.