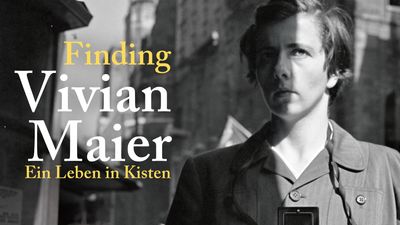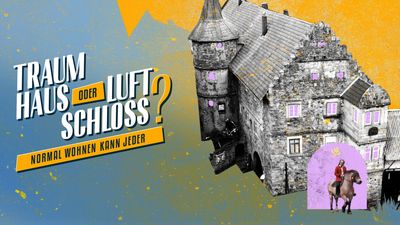Von Januar 2023 bis Dezember 2025 probieren das Ethnologische Museum und das Museum für Asiatische Kunst Berlin im Projekt „Das Kollaborative Museum“, kurz CoMuse, neue Formen der internationalen Zusammenarbeit aus: beim Kuratieren von Ausstellungen, beim Erforschen der Sammlungen, in Vermittlungsformaten, in künstlerischen Interventionen und in der Restaurierung. Dafür stellen Anna Schäfers als Mitarbeiterin im Projekt und Katharina Erben als freiberufliche Kulturredakteurin verschiedene Projekte innerhalb von CoMuse vor. Sie sprechen mit Vertreter*innen Indigener Gesellschaften, internationalen Partner*innen und Fellows, Leuten aus der pluralen Berliner Stadtgesellschaft und den Menschen aus dem Museum, die mit ihnen kooperieren, z. B. Kurator*innen, Vermittler*innen, Restaurator*innen. „Gegen die Gewohnheit – Der Podcast zu neuen Formen der Zusammenarbeit im Ethnologischen Museum und im Museum für Asiatische Kunst, Berlin“ wird produziert von speak low im Auftrag der Staatlichen Museen zu Berlin
Alle Folgen
Kollaboration zu den Mapuche-Sammlungen im Ethnologischen Museum
Kollaboration zu den Mapuche-Sammlungen im Ethnologischen Museum Das Volk der Mapuche kämpft gegenüber Chile und Argentinien um seine Anerkennung. Die Staaten hatten die Mapuche im 19. Jahrhundert gewaltsam von seinen angestammten Territorien vertrieben. In dieser Zeit gelangten auf verschiedenen Wegen viele Fotos und Tonaufnahmen, Schmuck- und Alltagsgegenstände der Mapuche in die Sammlungen des Ethnologischen Museums Berlin. Sie erzählen von Gewalt und Enteignung, aber auch von Mapuche-Identität. Eine Delegation der Mapuche besuchte 2025 Berlin, um die Gegenstände zusammen mit den Mitarbeitenden des Museums zu sichten, sie spirituell zu pflegen und das Wissen, das damals nicht erfasst wurde, zu ergänzen. Dabei kam es zu wichtigen, aber schmerzhaften Begegnungen. Collaboration on the Mapuche collections in the Ethnologisches Museum The Mapuche people are fighting for recognition from Chile and Argentina. These states forcibly displaced them from their traditional territories in the 19th century. During this period, many photographs, audio recordings, jewellery and everyday objects belonging to the Mapuche people were brought into the collections of the Ethnologisches Museum Berlin. These pieces are a testimony of violence and dispossession, but also of Mapuche identity. In 2025, a delegation of Mapuche people visited Berlin in order to view the collection together with the museum staff, to care for the objects spiritually, and to supplement the knowledge that was not recorded at the time. This lead to important but painful encounters.

Musik und Haare
Musik und Haare Im Herbst 2024 hat das Kollaborative Museum einen Open Call veröffentlicht, um Fellowships zu vergeben. Zwei der drei ausgewählten Fellows waren im Sommer 2025 in Berlin, beide beforschen die Sammlungen des Ethnologischen Museums, beide arbeiten mit Diaspora Communitys in Berlin, also mit Gruppen von Menschen, die ihre Migrationsgeschichte verbindet. Die Details waren dann allerdings schon unterschiedlich. Bei Samuel Baah Kortey aus Ghana ging es um die Schwarze Diaspora und Kämme in den Sammlungen des Ethnologischen Museums. Nhi Duong forschte über die vietnamesischen Diasporas in Berlin, wie sich ihre Musik unterscheidet und sie zusammenbringt. Gesprächspartner*innen in der Reihenfolge ihres Auftritts: Duong Doan Tuyet Nhi (Nhi Duong) arbeitet als Kulturmanagerin in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam, und interessiert sich besonders für die Schnittstellen von Anthropologie, Indigenem Wissen, Öffentlichkeitsarbeit und Kunst. In ihrer Arbeit kombiniert sie Ethnografie mit unkonventionelleren Herangehensweisen wie Kunstführungen oder Exkursionen, bei denen die Teilnehmer nicht nur als Betrachter*innen, sondern als Mitgestaltende agieren. Samuel Baah Kortey ist ein multidisziplinärer Künstler aus Ghana, dessen Werk sich mit den sichtbaren Ausprägungen befasst, die Städte, historische Artefakte und globale Begegnungen charakterisieren. Er ist Absolvent der Hochschule für Bildende Künste–Städelschule in Frankfurt am Main und der KNUST – Kwame Nkrumah University of Science and Technology in Kumasi, Ghana (Malerei und Bildhauerei). 2023 war er Stipendiat der Villa Romana. Music and Hair In autumn 2024, the Collaborative Museum published an open call for fellowships. Two of the three selected fellows were in Berlin in summer 2025, both researching the collections of the Ethnological Museum, both working with diaspora communities in Berlin, i. e. with groups of people connected by their migration history. However, the details differed. Samuel Baah Kortey from Ghana focused on the Black diaspora and combs in the collections of the Ethnologisches Museum. Nhi Duong researched the Vietnamese diasporas in Berlin, how their music differs and how it brings them together. Interviewees in the order of their appearance: Duong Doan Tuyet Nhi (Nhi Duong) is a cultural worker and organiser based in Ho Chi Minh City, Vietnam, interested in the intersections between anthropology, Indigenous knowledge, outreach and art. Her practice combines ethnography with unconventional approaches, such as art tours or field trips that position participants as co-creators rather than observers. Samuel Baah Kortey is a multidisciplinary artist from Ghana whose work traverses the visible expressions that characterise cities, historical findings, and global encounters. Samuel Baah Kortey is a graduate of Hochschule für Bildende Künste–Städelschule in Frankfurt am Main and KNUST – Kwame Nkrumah University of Science and Technology in Kumasi, Ghana (Dept. of Painting & Sculpture). He was a 2023 Villa Romana Fellow.

Noch einmal: Die Global Cultural Assembly – Entwicklungen 2025
Noch einmal: Die Global Cultural Assembly – Entwicklungen 2025 In der ersten Folge von „Gegen die Gewohnheit“ haben wir Euch von den Plänen für eine Global Cultural Assembly berichtet: Mehr als 80 Internationale Partner*innen des Ethnologischen Museums, des Museums für Asiatische Kunst und des Humboldt Forums waren 2022 und in kleinerer Besetzung 2023 in Berlin und haben mit den Museumsmenschen diskutiert, wie die Institutionen gerechtere Räume für Menschen aus den Herkunftsgesellschaften der Cultural Belongings und der Diaspora werden können. Nun hat im Juni 2025 die geplante Global Cultural Assembly im Humboldt Forum stattgefunden und die Weichen gestellt für eine dauerhafte, nachhaltige und echte Zusammenarbeit der internationalen Expert*innen mit den Akteuren im Humboldt Forum. Geplant wurde diese Neuauflage der GCA von der sogenannten Preparatory Group. Zur Mitte der Konferenzwoche haben uns vier ihrer Mitglieder einige Fragen zu ihrer Arbeit beantwortet und Ausblick gegeben auf das, was sie sich für die nächsten Jahre erhoffen. Gesprächspartner*innen in der Reihenfolge ihres Auftritts: ● Augustine Moukodi ist Autorin, Regisseurin und Produzentin aus Kamerun. Sie forscht zur Kolonialgeschichte und ist General Secretary des kamerunischen Arms der Worlds Association of Cultural Actresses zur Stärkung der Rolle von Frauen in der Kulturwelt. ● Feride Funda Gençaslan ist Vorsitzende des Sufi-Zentrum Rabbaniyya, Europäisches Zentrum für Sufismus und interreligiöse Begegnungen e. V. und Co-Kuratorin im Modul „Mystische Dimensionen des Islam“ im 3.OG der Ethnologischen Sammlungen im Humboldt Forum. ● Fabiano Kueva ist ein ecuadorianischer Künstler und Kurator, der für seine kritische und dekoloniale Dekonstruktion von Alexander von Humboldt bekannt ist. ● Achiles Bufure ist Direktor des National Museum & House of Culture in Dar Es Salaam, Tansania. The Global Cultural Assembly revisited – 2025 developments In the first instalment of “Going against the grain”, we told you about the plans for a Global Cultural Assembly: more than 80 international partners of the Ethnologisches Museum, the Museum für Asiatische Kunst and the Humboldt Forum had been in Berlin in 2022 and in smaller numbers in 2023 to discuss with museum people how the institutions can become more equitable spaces for people from the societies of origin of the Cultural Belongings and the diaspora. The planned Global Cultural Assembly took place at the Humboldt Forum in June 2025 and set the course for a lasting, sustainable, and genuine collaboration between international experts and the Humboldt Forum's players. This new edition of the GCA was planned by the so-called Preparatory Group. In the middle of the conference week, four of its members answered some questions about their work and gave us an outlook on what they hope to achieve in the coming years. Interview partners in the order of their appearance: ● Augustine Moukodi is an author, director and producer from Cameroon. She researches colonial history is General Secretary of the Cameroonian branch of the der Worlds Association of Cultural Actresses for the empowerment of women in the cultural world. ● Feride Funda Gençaslan is chairwoman of the Sufi centre Rabbaniyya, European Centre for Sufism and Interreligious Encounters e. V. and co-curator of the section “Mystic dimensions of Islam” on the 3rd floor of the ethnological collections in the Humboldt Forum. ● Fabiano Kueva is an Ecuadorian artist and curator known for his critical and decolonial deconstruction of Alexander von Humboldt. ● Achiles Bufure is director of the National Museum & House of Culture in Dar Es Salaam, Tanzania.

Kollaborative Projekte mit Indigenen Gruppen an der Nordwestküste Amerikas
Kollaborative Projekte mit Indigenen Gruppen an der Nordwestküste Amerikas Die weltgrößte Sammlung von Cultural Belongings der Eyak, einer Gruppe an der zentralen südlichen Küste Alaskas, befindet sich heute im Ethnologischen Museum Berlin. Grund dafür ist, dass von 1881 bis 1883 der norwegische Seemann Johan Adrian Jacobsen im Auftrag des Museums für Völkerkunde an der Nordwestküste Nordamerikas unterwegs war, um Cultural Belongings verschiedener Indigener Gruppen „ethisch zu erwerben“ – wobei nicht all seine Erwerbungen ethisch waren, auch wenn er er eine Vielzahl erhandelt oder gekauft hat. Nachdem es 2018 erste Rückgaben von aus Gräbern geraubten Gegenständen an die in der Region verortete Chugach Alaska Corporation gab, folgte das kollaborative Projekt „Getting our Stories Back“, in dem angesehen Vertreter*innen aller Gemeinschaften der Chugach-Region, unter anderem der Eyak, gemeinsam mit Museumsmenschen aus Berlin die Sammlungen erkundeten und sie digital mit ihren Communities teilten – um Verbindung aufzunehmen zu den Belongings ihrer Vorfahren und eben ihre Geschichten zurückzubekommen. Für diese Folge von „Gegen die Gewohnheit“ haben wir mit Vertreter*innen verschiedener Indigener Gruppen in Alaska und zwei Menschen, die von Berlin aus am Projekt beteiligt waren, gesprochen. Dazu geben wir einen kleinen Einblick, wie die Gruppen in Zukunft mit den Cultural Belongings umgehen wollen. Collaborative projects with Indigenous groups on the northwest coast of America The world’s largest collection of cultural belongings from the Eyak, a group on the southcentral coast of Alaska, is now housed in the Ethnologisches Museum Berlin. The reason for this is that from 1881 to 1883, the Norwegian sailor Johan Adrian Jacobsen travelled along the Northwest Coast of North America on behalf of the Museum für Völkerkunde to “ethically acquire” cultural belongings from various Indigenous groups – although not all his acquisitions were ethical, even if many were traded for or purchased. After the first objects robbed from graves were returned to the region’s Chugach Alaska Corporation in 2018, the collaborative project “Getting our Stories Back” followed, in which elder representatives from every community in the Chugach region, including Eyak, explored the collections together with museum people from Berlin and shared them digitally with their communities – in order to reconnect with their ancestral belongings and get their stories back. For this episode of “Going against the grain”, we spoke to representatives of various Indigenous groups in Alaska and two people who were involved in the project from Berlin. We also give a little insight into how the groups want to deal with cultural belongings in the future.

Manatunga. Künstlerische Interventionen von George Nuku
Manatunga – Künstlerische Interventionen von George Nuku Auf Einladung des Ethnologischen Museums hat der Bildhauer George Nuku drei Interventionen für die Ozeanien-Ausstellungsflächen im Humboldt Forum entwickelt. Er nimmt die Thematik der Ausstellungsräume und die dort gezeigten Ausstellungsstücke auf und setzt die historischen Werke aus den Sammlungen des Ethnologischen Museums durch seine zeitgenössischen Kunstwerke aus Plexiglas und Plastik in eine neue Perspektive. Gemeinsam mit Dorothea Deterts, der Kuratorin für die Sammlungen aus Ozeanien, hat George mit uns im Studio über seine Arbeit für die Interventionen gesprochen: Was es für ihn heißt, Künstler zu sein; die Workshops mit Freiwilligen; Meerestiere aus Plastikflaschen. Gesprächspartner*innen: George Nuku (* 1964 in Omahu, Aotearoa, Neuseeland) ist ein hoch angesehener und international bekannter Māori-Künstler, der mit Stein, Knochen, Holz, Muschel, Styropor und Plexiglas arbeitet. Seine Werke reichen von zarten Jade- und Perlenamuletten bis hin zu lebensgroßen Skulpturen aus Stein und Plexiglas, wobei er traditionelle Elemente der Maori-Kultur verwendet. Dorothea Deterts ist Ethnologin und Kuratorin der pazifischen Sammlungen am Ethnologischen Museum Berlin. Manatunga – artistic interventions by George Nuku At the invitation of the Ethnologisches Museum, the sculptor George Nuku has developed three interventions for the Oceania exhibition areas in the Humboldt Forum. He takes up the themes of the exhibition spaces and the exhibits on display there and puts the historical works from the Ethnologisches Museum’s collections into a new perspective with his contemporary works of art made of Plexiglas and plastic. Together with Dorothea Deterts, the curator for the collections from Oceania, George spoke to us in the studio about his work for the interventions: what it means to him to be an artist, the workshops with volunteers, sea creatures made from plastic bottles. Interviewees: George Nuku (* 1964 in Omahu, Aotearoa, New Zealand) is a highly regarded and internationally known Māori artist working in stone, bone, wood, shell, polystyrene, and plexiglass. His works range from delicate jade and pearl amulets to life-size stone and plexiglass sculptures in which he uses traditional elements of Māori culture. Dorothea Deterts ist Ethnologin und Kuratorin der pazifischen Sammlungen am Ethnologischen Museum Berlin.

Langzeitkooperation mit der Dorfgemeinschaft Macucu in Kolumbien
Im Kollaborativen Museum geht es sehr viel um Kooperationen mit internationalen Partner*innen. Wenn die Beteiligten länger und vertrauensvoll miteinander arbeiten, dann wachsen die Inhalte über projektförmige, punktuelle Maßnahmen hinaus und es entsteht ein gemeinsamer Prozess, in dem die Aktivitäten aufeinander aufbauen. In dieser Folge von „Gegen die Gewohnheit“ berichtet die Kuratorin Andrea Scholz über ihre bereits sieben Jahre dauernde enge Zusammenarbeit mit einer Dorfgemeinschaft in Kolumbien. Macucu befindet sich am Fluss Vaupés im Amazonasgebiet an der Grenze zu Brasilien. Andrea hat bei ihrem letzten Aufenthalt dort auch mit zweien ihrer Partner*innen über die gemeinsame Arbeit gesprochen. Nachdem es in früheren Jahren um Keramik, Pflanzenfasern und den Bau eines neuen Gemeinschaftshauses ging, legte die Dorfgemeinschaft 2024 einen botanischen Garten an. Andrea Scholz ist Kuratorin für transkulturelle Zusammenarbeit im Ethnologischen Museum und Museum für Asiatische Kunst in Berlin. Sie ist ausgebildete Anthropologin mit dem Schwerpunkt Amazonien und arbeitet seit 12 Jahren in verschiedenen Kooperationsprojekten mit Indigenen Gemeinschaften und Bildungsprojekten, hauptsächlich in Lateinamerika. Orlando Villegas Rodriguez ist Kotiria, in Macucu geboren und aufgewachsen und hat dann die weiterführende Schule in Mitú und die pädagogische Universität in Bogotá besucht. Er ist Sportlehrer an der Indigenen Oberschule ENOSIMAR in Mitú und engagiert sich gewerkschaftlich und im Bereich der Indigenen Selbstorganisation. Jaiver Ramírez ist Desana, in der Nähe von Macucu aufgewachsen, und hat an der brasilianischen Grenze die Schule besucht. Seit vielen Jahren lebt er mit seiner Frau Márcia (Kotiria) und seinen Töchtern in Macucu. Jaiver ist der Capitán der Gemeinschaft und vertritt ihre Interessen nach außen. Orlando Villegas Rodriguez wurde im Deutschen gesprochen von Daniel Séjourné. Jaiver Ramírez wurde im Deutschen gesprochen von Julian Mehne.

Cultural belongings aus Kamerun im Ethnologischen Museum
Cultural belongings aus Kamerun im Ethnologischen Museum Wer Ethnologisches Museum hört, denkt häufig an Raubkunst, Kolonialismus, Afrika. Zeit, dass wir dem Komplex eine Folge widmen. Im Gespräch mit Debangoua Legrand Tchatchouang, Mitglied der kamerunischen Kommission für die Rückgabe von illegal exportierten Kulturgütern und Berater des Ethnologischen Museums Berlin, und den Kuratorinnen Verena Rodatus und Maria Ellendorff erfahrt Ihr, wie das Museum und die Kommission gemeinsam an der Vorbereitung von Rückgaben arbeiten. Wer spricht mit wem? Welche cultural belongings gehen wahrscheinlich als erstes zurück nach Kamerun? Gesprächspartner: Prinz De Bangoua Legrand Tchatchouang wurde 1980 in Kamerun geboren und interessierte sich schon früh für die Geschichte seines Heimatlandes. Aufgewachsen als einer von vielen Söhnen eines Königs, lebt er heute mit in Berlin Dr. Verena Rodatus ist verantwortliche Kuratorin für die Sammlungen West- und Südliches Afrika am Ethnologischen Museum Berlin. Von 2015 bis 2021 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Kunst Afrikas an der Freien Universität Berlin. Als Kuratorin ist sie maßgeblich an der Restitution der während der Zeit des deutschen Kolonialismus illegal ausgeführten Kulturgüter aus Kamerun beteiligt. Maria-Antonie Ellendorff ist stellvertretende Kuratorin für die Sammlungen West- und Südliches Afrika am Ethnologischen Museum Berlin. Seit 2024 verantwortet sie insbesondere die Koordination des Bereichs Kamerun und fördert den Austausch zwischen Künstler*innen, Forscher*innen und anderen Akteur*innen.

Shiva Linga: Eine visuelle Reise
Shiva Linga: Eine visuelle Reise In den Sammlungen des Museums für Asiatische Kunst befindet sich ein Shiva Linga kosh. Das ist eine aus Kupferblech getriebene, vergoldete Hülle für einen Shiva Linga – eine Darstellungsform des Gottes Shiva als stilisierter Phallus. Wie ist dieser Shiva Linga kosh aus Nepal nach Berlin gekommen? Das Museum für Indische Kunst (es ging 2006 im Museum für Asiatische Kunst auf) kaufte das Kunstwerk 1993, Nepal hatte die Ausfuhr von Kulturgut aber bereits 1956 verboten. Dieser Frage der Herkunft gehen der nepalesische Filmemacher Deepak Tolange und die Provenienzforscherin Sophia Bokop im Projekt „Shiva Linga: A visual quest“ nach. Die beiden haben sich mit uns für den Podcast über ihre Forschungsmethoden und die vorläufigen Ergebnisse unterhalten. Gesprächspartner*innen Deepak Tolange ist Filmemacher, Fotograf und Forscher aus Nepal, der sich für Innovation, Geschichte, Kultur, Umwelt und soziale Gerechtigkeit interessiert. Er absolvierte seinen Master in Visual and Media Anthropology in Berlin mit einem DAAD-Masterstipendium (2014 – 2016). Nach seinem Abschluss arbeitete Deepak zwei Jahre lang als freiberuflicher Filmemacher und Fotograf in Deutschland und Tansania. Seit 2018 ist er als Gastdozent an der Kathmandu University tätig, wo er Fotojournalismus und Filmproduktion unterrichtet. Seine Gemälde, Fotografien und Dokumentarfilme Shelter (2013) und Dust (2016) wurden mit mehreren Preisen ausgezeichnet. 2024 war er Fellow beim „Kollaborativen Museum“. Sophia Bokop ist Provenienzforscherin im Projekt „Das Kollaborative Museum“ im Ethnologischen Museum und Museum für Asiatische Kunst. Gemeinsam mit internationalen Partner*innen erforscht sie ausgewählte Sammlungskonvolute und deren Kontexte von Erwerb, Aneignung und Translokation im Rahmen kollaborativer, transdisziplinärer Projekte. - Shiva Linga: A visual quest In the collection of the Museum für Asiatische Kunst, there is a Shiva Linga kosh. This is a gilded copper-sheet sheath for a Shiva Linga – a representation of the god Shiva as a stylised phallus. How did this Shiva Linga kosh get from Nepal to Berlin? The Museum für Indische Kunst (which was integrated into the Museum für Asiatische Kunst in 2006) acquired the work of art in 1993; Nepal, however, had already banned the export of cultural property in 1956. In the project “Shiva Linga: A visual quest”, Nepalese filmmaker Deepak Tolange and provenance researcher Sophia Bokop investigate this question of origin. The two talked to us for the podcast about their research methods and preliminary results. Interviewees: Deepak Tolange is a filmmaker, photographer, and researcher from Nepal who is interested in innovation, history, culture, the environment, and social justice. He completed his MA in Visual and Media Anthropology in Berlin thanks to a DAAD Masters scholarship (2014 – 2016). After graduation, Deepak worked in Germany and Tanzania as a freelance filmmaker and photographer for two years. Since 2018, Deepak has been working as a visiting faculty member at Kathmandu University, teaching Photojournalism and Film Production. His paintings, photography, and documentary films SHELTER (2013) and DUST (2016) received multiple awards. In 2024 he was a fellow with the “Collaborative Museum”. Sophia Bokop is a provenance researcher in the project “The Collaborative Museum” at the Ethnologisches Museum and Museum für Asiatische Kunst. Together with international partners, she researches selected collections and their contexts of acquisition, appropriation and translocation as part of collaborative, transdisciplinary projects.

Mio Okido
Mio Okido Vom 14. September 2024 bis zum 5. Februar 2025 zeigt die Ausstellung „Mio Okido. Erinnerte Bilder, imaginierte Geschichte(n) – Japan, Ostasien und ich“ vier neue Werke der Künstlerin Mio Okido. Sie beschäftigen sich mit der Erinnerungskultur in Japan, China und Korea im Kontext des japanischen Imperialismus/Kolonialismus/Faschismus in Ostasien von ca. 1872 bis 1945. Für diese Folge von „Gegen die Gewohnheit“ haben wir mit der Künstlerin und den beiden verantwortlichen Kurator*innen über ihre Kollaboration für die Ausstellung gesprochen. https://smart.smb.museum/media/exhibition/82712/Broschuere-Mio-Okido-2024.pdf https://www.smb.museum/ausstellungen/detail/mio-okido/ Gesprächspartner*innen: Mio Okido wurde 1986 in Japan geboren. Sie lebt und arbeitet seit 2015 in Deutschland. Der aktuelle Fokus ihrer künstlerischen Arbeit liegt auf Erinnerungsarbeit zum japanischen Kaiserreich und seiner Rolle als nicht-weißer Kolonialmacht in Asien, dem Verhältnis asiatischer Migrant*innen und asiatisch-deutscher Menschen zur zeitgenössischen Geschichte Asiens und ihrer Identität sowie zur Fragmentierung deutscher Identität durch die Teilung des Landes. https://www.miookido.net/ Alexander Hofmann ist seit zwanzig Jahren Kurator für Kunst aus Japan beim Museum für Asiatische Kunst Berlin. Er hat in Heidelberg und in Tokyo europäische und ostasiatische Kunstgeschichte mit Schwerpunkt Japan studiert. Er zeichnet immer wieder verantwortlich für Ausstellungen zeitgenössischer Künstler*innen, wie zuletzt Keiko Sadakane, Yuken Teruya und Matthias Beckmann. Kerstin Pinther ist seit 2021 Kuratorin für moderne und zeitgenössische Kunst im globalen Kontext beim Ethnologischen Museum und beim Museum für Asiatische Kunst. Die Kunsthistorikerin hat lange an der Universität gearbeitet, aber auch Ausstellungen gemacht, vielfach zur zeitgenössischen Kunst Afrikas. Sie zeichnete bei Ausstellungen im Humboldt Forum zuletzt verantwortlich für “Kimsooja. (Un)Folding Bottari” und für “Über Grenzen. Künstlerischer Internationalismus in der DDR”; an letzterer ist auch Mio Okido beteiligt.

Verflochtene Erinnerungen
Das Projekt „Verflochtene Erinnerungen“ setzt sich mit der Erinnerung an die Shoah und die Verbrechen des Kolonialismus auseinander – und daran, wie sie miteinander verbunden sind. Dafür haben sich im Juli 2024 vier internationale Partner*innen mit Kurator*innen aus dem Ethnologischen Museum und dem Museum für Asiatische Kunst Berlin, aus der Stiftung Humboldt Forum und weiteren Menschen aus der Berliner Stadtgesellschaft für zehn Tage getroffen. Ihr Ziel war es, Vermittlungsformate zur Erinnerung an Kolonialismus und Shoah zu entwickeln, die spezifisch nicht nur auf die Sammlungen des Ethnologischen Museum, sondern auch auf den Ort Humboldt Forum im Berliner Schloss eingehen.

A Slice of Life
A Slice of Life Die Kuratorin Gina Knapp arbeitet seit 2022 bei den Staatlichen Museen zu Berlin, kooperiert aber für ihre ethnologische Forschung schon seit mehr als 20 Jahren mit den Menschen des Dorfes Napamogona in Papua-Neuguinea. 2006 brach dort ein Krieg aus, dem viele Menschen zum Opfer fielen. Nach einem Waffenstillstand und dem Wiederaufbau wollte die Dorfgemeinschaft Bewusstsein dafür schaffen, dass bewaffnete Konflikte den beteiligten Parteien keine Lösungen, sondern nur Leid bringen. Dafür drehten sie 2021 mit Gina den Pilotfilm für eine Community-Telenovela, „A Slice of Life“. Wie es zu diesem Projekt kam, wie die Dreharbeiten verliefen, welche Gedanken die Menschen in Napamogona antrieben, darüber haben wir mit Gina gesprochen. Sie hat für diesen Podcast zwei Partner*innen vor Ort in Papua-Neuguinea interviewt und das Gespräch für uns aus Tok Pisin übersetzt. Ihr könnt den Pilotfilm hier online sehen: https://www.dropbox.com/scl/fi/3twqawk9x72wjcjxca68h/Slice-of-Life-HD.mp4?rlkey=2p1mcg1h4175xx5wggxdu5xsp&st=mccbk706&dl=0 Gesprächspartner*innen: Gina Knapp ist Kuratorin für Visuelle Anthropologie in der Medienabteilung des Ethnologischen Museum und Museum für asiatische Kunst in Berlin. Sie ist Anthropologin und Filmemacherin mit umfangreicher Forschungs- und Filmerfahrung in Papua-Neuguinea, wo sie seit 1997 Forschungsprojekte durchführt. Mama Daisy Meko Samuel ist Frauenrechtsaktivistin und Subsistenzbäuerin in der Gemeinde Napamogona im östlichen Hochland von Papua-Neuguinea. Seit 1996 ist sie eine enge Freundin, Adoptivmutter und Kooperationspartnerin von Gina Knapp und hat mit ihr in Film und Forschung zusammengearbeitet. Daisy ist eine engagierte Frauenrechtlerin und darum bemüht, in ihrer Dorfgemeinschaft und darüber hinaus Frauen zu beraten und zu unterstützen. Seit der Zerstörung ihres Hauses im Jahr 2006 engagiert sich Daisy zunehmend für die Förderung des Friedens in ihrer Region. David Papua’e ist ein Subsistenzbauer und Dorfältester in der Gemeinde Napamogona im östlichen Hochland von Papua-Neuguinea. Während des Krieges hat er versucht, zwischen den gegnerischen Parteien zu vermitteln und setzt sich seitdem für Friedensprozesse ein. Davids Ziel ist es, vor allem den jungen Männern des Dorfes friedliche Wege der Konfliktlösung zu vermitteln. Mama Daisy Meko Samuel wurde im Deutschen gesprochen von Bettina Kurth. David Papua’e wurde im Deutschen gesprochen von Julian Mehne.

Aspekte des Islam
Im 3. Stock des Humboldt Forums in den Ausstellungen des Ethnologischen Museums befindet sich der Ausstellungsraum „Aspekte des Islam“. Der Islam ist eine Religion mit verschiedene Ausprägungen und Berlin eine Stadt mit einer bunten islamischen Community. Deshalb hat das Ethnologische Museum mit Menschen aus verschiedenen muslimischen Gemeinden kooperiert, damit sie selber den Besuchenden der Ausstellung erzählen, wie sie ihren Glauben täglich leben. Wir haben für diese Folge von „Gegen die Gewohnheit“ mit zwei Vertreterinnen dieser Gemeinden gesprochen, damit sie uns mehr über die Ausstellung, ihre Zusammenarbeit mit dem Museum und dem Humboldt Forum und ihren Glauben erzählen. Gesprächspartnerinnen: Seyran Ateş ist Gründerin der Ibn Rushd-Goethe Moschee, Juristin, Buchautorin, Menschenrechts und Frauenrechtsaktivistin. Sie ist Co-Kuratorin der Community-Vitrinen in der Ausstellung „Aspekte des Islam“ im 3.OG der Ethnologischen Sammlungen im Humboldt Forum. Feride Funda G.-Gençaslan ist Vorsitzende des Sufi-Zentrum Rabbaniyya, Europäisches Zentrum für Sufismus und interreligiöse Begegnungen e. V. Sie ist Co-Kuratorin der Community-Vitrinen in der Ausstellung „Aspekte des Islam“ im 3.OG der Ethnologischen Sammlungen im Humboldt Forum.

Der Gungervaa – ein mongolischer Schrein
Der Gungervaa – ein mongolischer Schrein In der Sammlung des Ethnologischen Museums Berlin gibt es einen mongolischen Holzschrein mit verschiedenen, im Buddhismus verehrten Gegenständen. Er gelangte zu Anfang des 20. Jahrhunderts nach Berlin und ist heute einzigartig auf der Welt, weil die Gegenstände darin fast alle erhalten geblieben sind. Wie kann das Museum diesen Schrein bewahren, wie am besten zeigen, was ist dabei zu berücksichtigen? Die Restauratorin und Ethnologin Birgit Kantzenbach ist in die Mongolei gefahren und hat sich mit vielen Menschen darüber beraten, denen der Schrein etwas bedeutet. Als Übersetzerin mit dabei war die mongolische Kunsthistorikerin Dulamjav (Duka) Amarsaikan. Wir haben mit den beiden gesprochen: über den Schrein, seine Herkunft, die Reise und das Restaurieren. Gesprächspartnerinnen: Dulamjav (Duka) Amarsaikhan ist eine mongolische Kunsthistorikerin. Sie hat in verschiedenen Fuktionen, u. a. als Forscherin und Leiterin der Sammlungsabteilung, für das Zanabazar Fine Arts Museum in Ulaanbaatar in der Mongolia gearbeitet. Birgit Kantzenbach ist Restauratorin und Ethnologin mit Schwerpunkt Mongolei. Sie arbeitet am Ethnologischen Museum Berlin und hat bereits an verschiedenen Kooperationsprojekten mitgewirkt.

Ukrainische Samstage und Sonntage im Humboldt Forum
Ukrainische Samstage und Sonntage im Humboldt Forum Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 flohen viele Menschen aus der Ukraine, auch nach Deutschland. Die Staatlichen Museen zu Berlin haben 2022 Stipendien an ukrainische Forscher*innen verliehen, um Geflüchteten zu helfen. Mit dabei war Roksolana Ludyn, die von August bis Dezember 2022 ein solches Stipendium hatte und sich in dieser Zeit in die Arbeit der Bildung und Vermittlung des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst im Humboldt Forum eingebracht hat. Seitdem ist sie als freie Vermittlerin in den Ausstellungen dort unterwegs und macht besondere Programme für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Wir haben uns mit ihr und Dr. Patrick Helber über diese Programme unterhalten. Gesprächspartner*innen: Roksolana Ludyn ist freie Vermittlerin und Organisatorin von Veranstaltungen für Menschen mit Fluchterfahrung aus der Ukraine im Projekt „Das Kollaborative Museum“ im Ethnologischen Museum und im Museum für Asiatische Kunst. Dr. Patrick Helber ist Kurator für Bildung und Vermittlung im Projekt „Das Kollaborative Museum“ im Ethnologischen Museum und im Museum für Asiatische Kunst.

Gegen den Strom
Gegen den Strom Francis La Flesche war Umonhon (auch Omaha genannt) und Indigener Ethnologe. Zwischen 1894 und 1898 sammelte er im Auftrag des Königlichen Museums für Völkerkunde (heute: Ethnologisches Museums) in Nebraska cultural belongings seiner eigenen Kultur und schickte sie nach Berlin. Teile dieser Sammlung sind seit 2022 in der Ausstellung „Gegen den Strom. Die Omaha, Francis La Flesche und seine Sammlung“ im Humboldt Forum zu sehen. Die Ausstellung haben Lehrende und Studierende aus dem Nebraska Indian Community College gemeinsam mit Kolleg*innen der Stiftung Humboldt Forum und des Ethnologischen Museums erarbeitet. Drei Kurator*innen dieser Ausstellung haben mit uns über diese Zusammenarbeit gesprochen und auch darüber, was sie für das Ethnologische Museum, das Humboldt Forum und für die Omaha bedeutet. Gesprächspartner*innen: Vanessa Dawn Hamilton ist Mitarbeiterin am Nebraska Indian Community College, Macy, USA. Sie gehört der Umonhon Nation an. Wynema Morris ist Privatdozentin für Native American Studies am Nebraska Indian Community College, Macy, USA. Sie gehört der Umonhon Nation an. Ilja Labischinski ist Provenienzforscher bei den Staatlichen Museen zu Berlin.

Die Global Cultural Assembly
Die Global Cultural Assembly Im September 2022 hat das Humboldt Forum in Berlin die letzten Teile seiner Dauerausstellungen eröffnet. Aus diesem Anlass waren mehr als 80 internationale Gäste gekommen, die in einer vom Ethnologischen Museum, dem Museum für Asiatische Kunst und der Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss akteursübergreifend organisierten Workshopwoche Ideen entwickelt und Forderungen gestellt haben für die Zukunft des Forums und der Museen. Die Ergebnisse dieser Woche sind in dem Papier „Würde – Transparenz – Kontinuität“ zusammengefasst. Eine der Ideen ist die „Indigene Botschaft“, die „Indigenous Embassy“. Im Oktober 2023 haben zehn internationale Partner*innen in einer neuen Workshopwoche in Berlin diese Idee weiterentwickelt zur Global Cultural Assembly, der GCA. Eine wichtige Frage des Workshops 2023 war, wie man das Museum dazu bringt, Gewohnheiten zu hinterfragen, sich neuen Ideen zu öffnen und nichts für gegeben hinzunehmen. Gerade richtig also für die erste Folge von „Gegen die Gewohnheit“. Einige der Teilnehmer*innen haben sich die Zeit genommen, mit uns über den Workshop zu sprechen. Ihr findet im 3. Obergeschoss des Humboldt Forums einen Ausstellungsraum, der die Arbeit der GCA zeigen und begleiten wird. Gesprächspartner*innen in der Reihenfolge ihres Auftritts: Deepak Tolange ist ein in Kathmandu, Nepal, ansässiger Filmemacher und Fotograf. Er unterrichtet an der Kathmandu University. Achilles Bufure ist Direktor des National Museum & House of Culture in Dar Es Salaam, Tansania. Michael Nicoll Yahgulanaas ist Künstler. Er hat Erfahrung im internationalen Bereich der philanthropischen Innovation und der regionalen Arbeit in der Kommunalverwaltung. Ihr findet sein Atelier unter mny.ca. Fabiano Kueva ist ein ecuadorianischer Künstler und Kurator, der für seine kritische und dekoloniale Dekonstruktion von Alexander von Humboldt bekannt ist. Augustine Moukoudi ist Autorin, Regisseurin und Produzentin aus Kamerun. Sie forscht zur Kolonialgeschichte und ist General Secretary des kamerunischen Arms der Worlds Association of Cultural Actresses zur Stärkung der Rolle von Frauen in der Kulturwelt. Feride Funda Gençaslan ist Vorsitzende des Sufi-Zentrum Rabbaniyya, Europäisches Zentrum für Sufismus und interreligiöse Begegnungen e. V. und Co-Kuratorin im Modul „Mystische Dimensionen des Islam“ im 3.OG der Ethnologischen Sammlungen im Humboldt Forum.

Trailer: Gegen die Gewohnheit
Von Januar 2023 bis Dezember 2025 probieren das Ethnologische Museum und das Museum für Asiatische Kunst Berlin im Projekt „Das Kollaborative Museum“, kurz CoMuse, neue Formen der internationalen Zusammenarbeit aus: beim Kuratieren von Ausstellungen, beim Erforschen der Sammlungen, in Vermittlungsformaten, in künstlerischen Interventionen und in der Restaurierung. Dafür stellen Anna Schäfers als Mitarbeiterin im Projekt und Katharina Erben als freiberufliche Kulturredakteurin verschiedene Projekte innerhalb von CoMuse vor. Sie sprechen mit Vertreter*innen Indigener Gesellschaften, internationalen Partner*innen und Fellows, Leuten aus der pluralen Berliner Stadtgesellschaft und den Menschen aus dem Museum, die mit ihnen kooperieren, z. B. Kurator*innen, Vermittler*innen, Restaurator*innen.