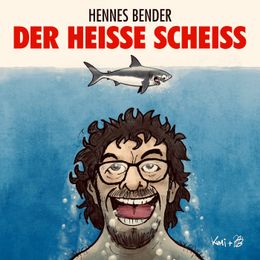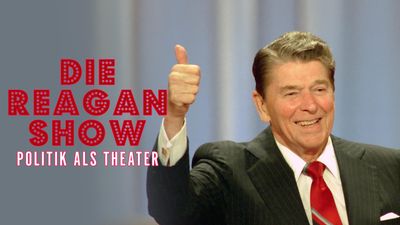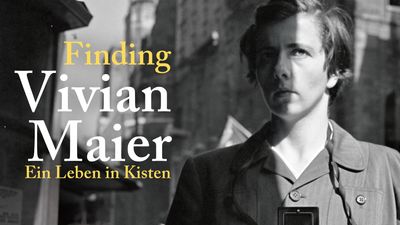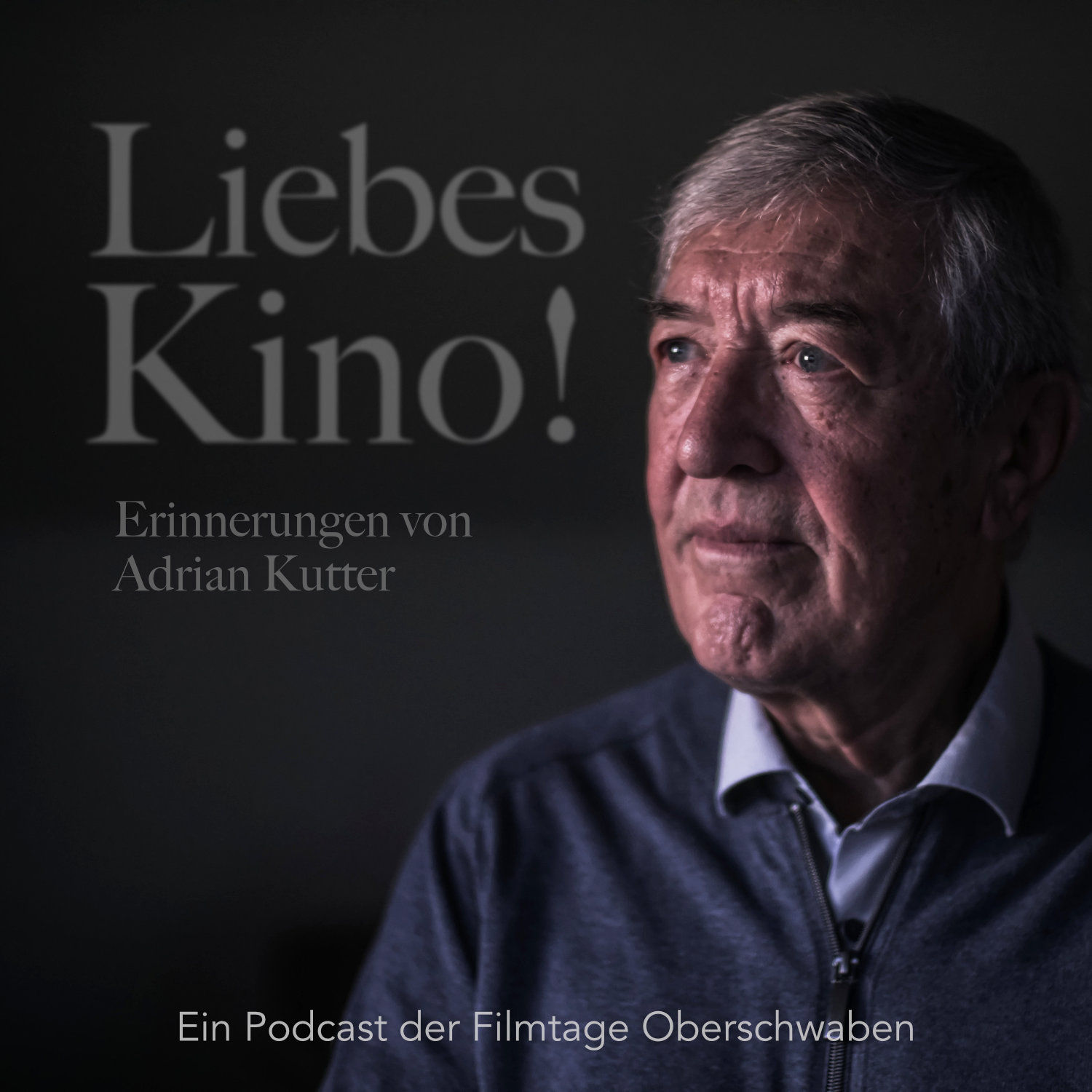
Liebes Kino! Erinnerungen von Adrian Kutter
Die Geschichte des deutschen Kinos ist eng mit Adrian Kutter verbunden. Bereits als Jugendlicher sammelte er Erfahrungen als Kinomacher im väterlichen Kino in Biberach. Schon damals ging es ihm um mehr als das bloße Filmvorführen. "Kino ist mehr als Filmschauen", sagt Adrian Kutter auch heute noch. Als langjähriger Präsident der Gilde Deutscher Filmkunsttheater beeinflusste er in ganz Deutschland die Art und Weise, wie Filme programmiert werden. Und als Gründer der Biberacher Filmfestspiele schenkte er dem neuen deutschen Film einen eigenen Treffpunkt und eine Plattform, auf der sich Publikum und Filmemacher abseits des Rampenlichts treffen und austauschen konnten. In diesem Podcast sammelt der Journalist Michael Scheyer im Auftrag der Filmtage Oberschwaben in Ravensburg Adrian Kutters wertvolle Erinnerungen an die deutsche Filmgeschichte.
Alle Folgen
FILMTAGE SPEZIAL: Diskussion "Lichtblicke – Die Bedeutung von Filmfestivals abseits der Metropolen" | 2025
In Baden-Württemberg gibt es eine Vielzahl von kleineren Filmfestivals. Sie alle tragen zur kulturellen Vielfalt im Ländle bei. Aber sind Sie „relevant“? Welche Bedeutung haben sie für Filmschaffende und Publikum? Wir möchten darüber reden – mit Experten und mit Ihnen! Teilnehmende der Diskussion: - **Helga Reichert,** Intendantin der Filmtage Oberschwaben in Ravensburg - **Cathrin Ehrlich**, Programmberatung Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg - **Michael Scheyer,** Filmemacher aus dem Bodenseekreis und Wettbewerbsteilnehmer - **Christoph Holthof**, Kurhaus Production Baden-Baden - Moderation: **Paolo Percoco**, Radiomoderator Donau3FM

Adrian, welchen Hitchcock-Film muss jeder mal gesehen haben? (Folge 15)
In dieser Folge setzen wir unser Alfred Hitchcock-Special fort und tauchen noch tiefer in das faszinierende Schaffen des Meisterregisseurs ein. Zunächst beleuchten wir einige seiner Oscar-Nominierungen, wobei wir feststellen, dass Hitchcock trotz seiner bemerkenswerten Karriere nie einen Oscar gewann. Wir analysieren die Filme, für die er nominiert wurde, darunter „Rebecca“, „Verdacht“, „Das Rettungsboot“ und „Psycho“, und diskutieren die starken Wettbewerber, gegen die er antreten musste. Besonders interessant sind die herausragenden Leistungen der weiblichen Hauptdarstellerinnen in seinen Filmen, die beharrlich im Zentrum der Geschichte stehen. Ein weiterer zentraler Aspekt dieser Episode ist die Charaktertiefe und psychologische Komplexität seiner Figuren. Bei Filmen wie „Rebecca“ und „Verdacht“ wird deutlich, wie Hitchcock oft Frauen in herausfordernden Situationen präsentiert, während sich gleichzeitig die männlichen Protagonisten, wie Cary Grant, mit ihren Schwächen und zweifelhaften Absichten auseinandersetzen. Die Diskussion geht weiter mit einer Betrachtung von Hitchcocks einzigartigen Erzähltechniken, einschließlich seiner berühmten Kameratechniken und Schnitttechniken, die bei Filmen wie „Vertigo“ und „Cocktail für eine Leiche“ zum Tragen kommen. Auch die Herausforderungen, die Hitchcock bei der Produktion seiner Filme hatte, werden thematisiert, wobei besonderes Augenmerk auf sein festes Team und seine innovative Nutzung von Storyboards gelegt wird. Wir werfen einen Blick auf Hitchcocks Leben sowohl hinter als auch vor der Kamera. Er steht im engen Austausch mit seiner Frau Alma, die nicht nur als seine Lebensgefährtin, sondern auch als engste Mitarbeiterin eine zentrale Rolle in seinem Schaffen spielt. Ihr Einfluss auf seine Arbeit wird als unverzichtbar angesehen, auch in Bezug auf die Entwicklung seiner Drehbücher und den Schnittprozess. Im Verlauf der Episode werden die verschiedenen Techniken und Mittel, die Hitchcock einsetzte, um Spannungsmomente zu erzeugen, detailliert erläutert. Dies umfasst sowohl seine Präferenz für Außendrehorte, die eine lebendige Kulisse bieten, als auch seine Fähigkeit, mit Musik und Sounddesign eine fesselnde Atmosphäre zu schaffen. Der Podcast endet mit einer Vorschau auf die nächste Episode, in der wir uns mit einem Filmmuseum im Zusammenhang mit Baden-Württemberg beschäftigen und die bemerkenswerten Protagonisten und deren Beiträge zur Filmgeschichte beleuchten. Diese Entdeckungstour durch die Welt von Hitchcock und darüber hinaus wird nicht nur die Fans des Genres fesseln, sondern auch eine neue Perspektive auf die Kunst des Filmemachens präsentieren.
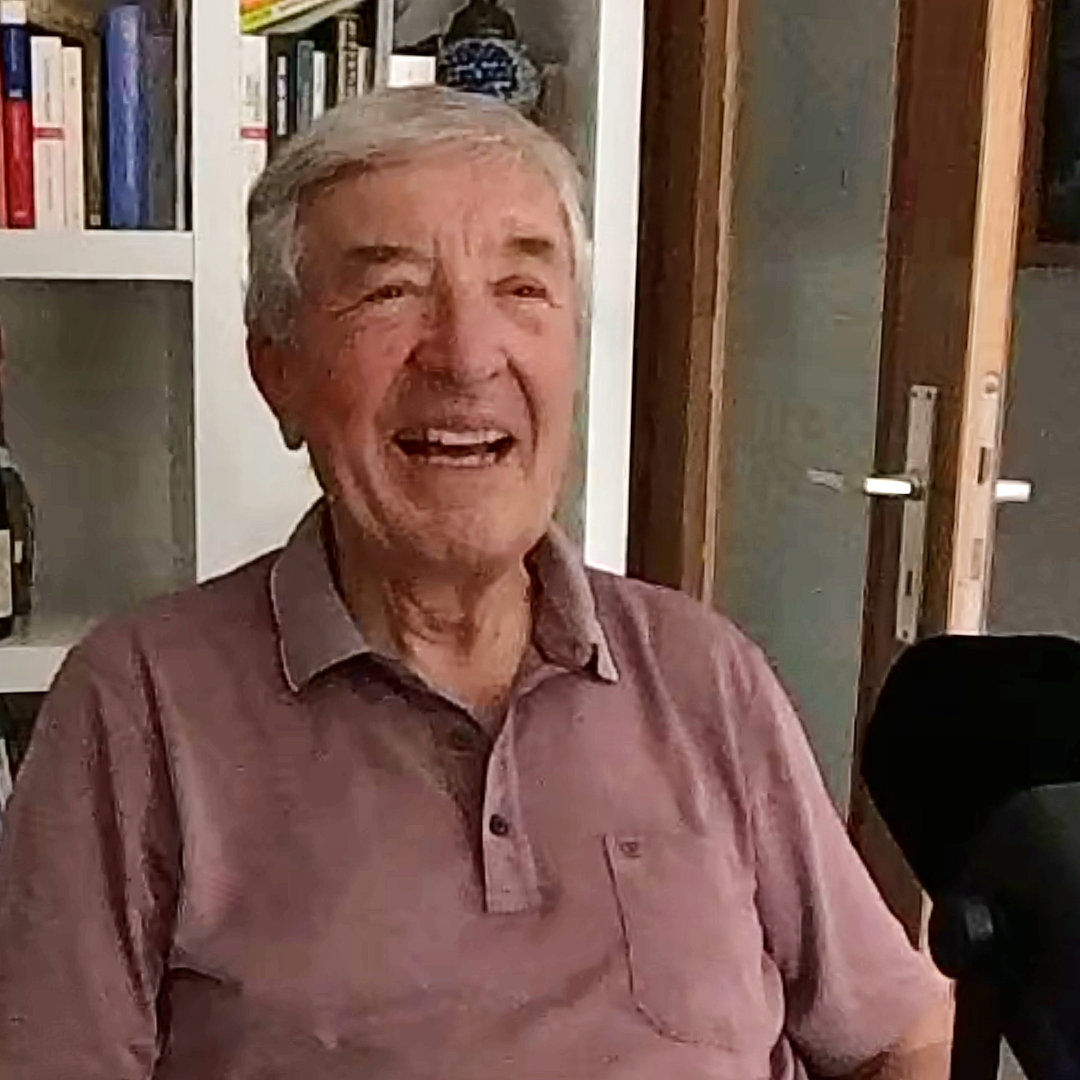
Adrian, was fasziniert Dich so an Alfred Hitchcock? (Folge 14)
In dieser Episode unseres Podcasts „Liebes Kino“ widmete sich Adrian Kutter dem filmischen Schaffen des legendären Alfred Hitchcock, eines der einflussreichsten Regisseure der Filmgeschichte. In dieser umfassenden Untersuchung seines Lebens und seiner Werke begeben wir uns auf die Spuren von Hitchcocks eindrucksvoller Karriere, die in einem bescheidenen Umfeld begann und ihn zu einem der bekanntesten Filmemacher der Welt machte. Von seinen ersten Schritten im Filmgeschäft als Zeichner von Zwischentiteln bis hin zu seinen ikonischen Meisterwerken erzählten wir die Geschichte eines Mannes, der die Kunst des Spannungsaufbaus perfektionierte und Generationen von Film- und Krimifreunden prägte. Wir begannen unser Gespräch mit der Frage nach Adrian Kutters ersten Erinnerungen an Hitchcock-Filme, die sich auf den Charakter des Regisseurs und seine einzigartige Fähigkeit, Publikum zu fesseln, konzentrierten. Hitchcock, geboren 1899 in England, drehte insgesamt 53 Filme und prägte den Thriller-Genre nachhaltig. Adrian erzählte von den Anfängen seiner Faszination für Hitchcock und wie dessen Werke sein cineastisches Interesse weckten. Mit einem Lächeln erinnerte er sich an seinen ersten Hitchcock-Film „Das Fenster zum Hof“ und die Nervenkitzel, den dieser bei ihm hinterließ – die voyeuristische Perspektive des Protagonisten, gespielt von James Stewart, ließ das Publikum an seinen Entdeckungen und Ängsten teilhaben. Ein zentrales Thema unserer Diskussion war Hitchcocks meisterhafte Anwendung von „Suspense“. Wir beleuchteten, wie Hitchcock das Publikum in einen emotionalen Konflikt zog, indem er oft mehr Informationen über die Situation hatte als die Charaktere der Filme selbst. Der Zuhörer wurde so zum Komplizen im Geschehen, was den Spannungsbogen seiner Filme einzigartig machte. Adrian erklärte, dass diese Technik einen entscheidenden Beitrag zu Hitchcocks Erfolg leistete und gleichzeitig die Erwartungen des Publikums über die Erzählstruktur herausforderte. Eine weitere wichtiges Element der Episode war Hitchcocks besondere Beziehung zu seinen Hauptdarstellerinnen, insbesondere zu Grace Kelly. Adrian berichtete von der bedingungslosen Hingabe, die Hitchcock für seine Protagonistinnen empfand, und analysierte die Komplexität der Frauenrollen in seinen Filmen. Diese Reflexion über die oft ambivalente Darstellung weiblicher Charaktere in Hitchcocks Werken führte zu einer tieferen Diskussion über seine filmische Ästhetik und die gesellschaftlichen Normen seiner Zeit. In der Fortsetzung der Episode setzten wir unsere Analyse fort und beleuchteten dabei nicht nur einige von Hitchcocks bedeutendsten Filmen, wie „Psycho“ und „Vertigo“, sondern auch die zahlreichen Cameo-Auftritte des Regisseurs selbst in seinen Filmen. Adrian erzählte von den Geschichten und Anekdoten über Hitchcock und schloss mit dem feinen Gespür des Filmemachers für Ironie und Humor, auch in den dunkelsten Szenarien. Diese Episode ist ein umfassendes Porträt eines cineastischen Genies und eine Hommage an das Erbe, das Alfred Hitchcock hinterlassen hat.

Adrian, was hat Werner Herzog an den Protesten in Biberach so gut gefallen? (Folge 13)
In dieser Episode von "Liebes Kino" bespreche ich gemeinsam mit Adrian Kutter die filmhistorischen Kontroversen der 68er Jahre und deren Einfluss auf die deutsche Filmszene. Adrian, als Betreiber eines Kinos in dieser dynamischen Zeit, teilt seine Erlebnisse, insbesondere zu den Protesten rund um den Film „Die letzte Versuchung Christi“. Wir diskutieren die politische Dimension der damaligen Proteste und die Rolle von Kinos als Orte des Diskurses. Zudem blicken wir auf die Entwicklungen des deutschen Kinos seit den 68ern und die Herausforderungen für zeitgenössische Filmemacher. Adrian reflektiert auch über seine persönlichen Lieblingsfilme und deren Bedeutung für ihn. Zum Abschluss geben wir einen Ausblick auf zukünftige Episoden, in denen wir uns mit Alfred Hitchcock auseinandersetzen werden.

Adrian, gegen welchen Film haben Menschen vor Deinem Kino so fanatisch protestiert? (Folge 12)
In dieser Episode des Podcasts „Liebes Kino, Erinnerungen von Adrian Kutter“ vertiefen wir uns in die faszinierende und oft kontroverse Geschichte der Filmfreigaben in Deutschland. Moderator Michael Scheyer begleitet Adrian Kutter, einen ausgewiesenen Experten der Kinogeschichte und selbst langjährigen Kinobetreiber, durch einen regen Austausch über die Herausforderungen, die sowohl Finanzierungsproblematiken als auch religiöse Sensibilitäten im Filmgeschäft mit sich bringen. Wir beginnen mit dem Überraschungsmoment der zwölften Episode, in der die beiden Protagonisten sowohl die Höhepunkte der vorherigen Folgen reflektieren als auch auf die heutige Thematik eingehen – den stillen Feiertag. Hierbei wird deutlich, dass bei der Freigabe von Filmen auch die sozialen und religiösen Kontexte eine entscheidende Rolle spielen. Adrian hebt hervor, dass über 700 Filme für die Vorführung an stillen Feiertagen in Deutschland nicht freigegeben werden – eine Zahl, die sowohl historische als auch aktuelle Dimensionen in die Diskussion beihebt. Besonders spannend wird es, als Adrian die Liste der Filme durchgeht, die in der Vergangenheit an Feiertagen für nicht geeignet erklärt wurden. Diese Filme reichen von Horror- bis Actionfilmen, doch auch überraschende Titel finden sich darunter, wie Jacques Tatis „Traffic“. Adrian diskutiert die Veränderungen in den Freigabekriterien über die Jahrzehnte und wie die Wahrnehmung von Kunst und Schaffensfreiheit sich gewandelt hat. Eine weitere zentrale Thematik der Folge sind die gesellschaftlichen Reaktionen auf kontroverse Filme. Anhand von Adrian Kutters eigenen Erfahrungen mit dem Film „Die letzte Versuchung Christi“ von Martin Scorsese schildert er die heftigen Reaktionen, die bei der Aufführung des Films in Deutschland, insbesondere in seiner Region, von verschiedenen religiösen Gemeinschaften und Einzelpersonen angestoßen wurden. Diese Erzählungen sind nicht nur informativ, sondern verdeutlichen auch wie Film als Medium sowohl als Kunstform als auch als gesellschaftliches Werkzeug fungiert, das polarisieren und Debatten entfachen kann. Adrian erzählt eindringlich von den Drohungen, den massiven Protesten und den Beschwerden, die er als Kinobetreiber erleben musste, als er entschloss, diesen Film zu zeigen. Dabei wird klar, dass es hierbei nicht nur um den Inhalt des Films geht, sondern auch um die zivilgesellschaftlichen Grundlagen der Meinungsfreiheit und der künstlerischen Freiheit im Allgemeinen. Seine unerschütterliche Entschlossenheit, das Publikum mit hochwertigen Filmen zu unterhalten und zu bilden, zeigt sich auch in der Rückschau auf die Filmfestspiele sowie den kulturellen Einfluss, den er über die Jahre hatte. Die Episode schließt mit einem Aufruf zur Sensibilisierung für süchtig machende Themen in der Film- und Medienwelt, während Adrian und Michael sich auf die nächste Folge freuen, in der weitere spannende Einblicke in die Erinnerungen und die Kinogeschichte von Adrian Kutter gegeben werden. Es ist eine tiefgründige und reflektierte Diskussion, die die Hörer zum Nachdenken anregt und umfassendes Wissen über die Filmfreigabe-Problematik in Deutschland bietet.

Adrian, zwischen Kalifornien und der Ukraine, was hast Du mit der Gilde auf Reisen erlebt? (Folge 11)
In dieser Episode von "Liebes Kino" sprechen wir ausführlich mit Adrian Kutter über seine Reisen für die Gilde der Deutschen Filmkunsttheater und die international bedeutenden Filmfestivals, die er besucht hat, um den deutschen Film zu präsentieren und Netzwerke zu knüpfen. Adrian, unser Dauergast und Filmexperte, beginnt mit einem Rückblick auf die Geschichte der Gilde und beschreibt, wie sie seit ihrer Gründung im Jahr 1953 in die Internationalität expandiert hat. Die Gilde hat sich im Laufe der Jahre mit anderen Verbänden fusioniert, wodurch sie sich als wichtiger Vertreter der Filmkunst in Deutschland etabliert hat. Adrian erörtert die Motive hinter den Reisen. Ursprünglich wurden sie initiiert, um den Austausch zwischen deutschen Kinobetreibern und internationalen Kollegen zu fördern. Er hebt hervor, dass die Reisen nie rein touristisch waren, sondern vor allem dem gegenseitigen Informationsaustausch und der Analyse von Kino- und Filmstrukturen dienten. Dabei schildert er auch besondere Erlebnisse, wie die Teilnahme an verschiedenen internationalen Filmfestivals in Cannes, Venedig und Locarno, sowie an bedeutenden historischen Orten wie Paris und Budapest. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den technischen Entwicklungen im Kino, die Adrian während seiner Reisen beobachtet hat. Er spricht über die Einführung von Multiplex-Kinos und deren wirtschaftliche Relevanz sowie die technischen Innovationen, die das Kinoerlebnis revolutioniert haben. Von Kinos in New York und Los Angeles bis hin zu den beeindruckenden Filmstudios in Moskau und Kiew erzählt Adrian von den vielfältigen Perspektiven und dem Wissen, das er und die Gilde aus diesen Erfahrungen mit nach Deutschland brachten. Ein Höhepunkt der Episode ist die Erzählung über die Gilde-Reise nach Kalifornien im Jahr 1989, in der Adrian beeindruckende Einblicke in die amerikanische Filmindustrie und Kinokultur bietet. Er teilt amüsante Anekdoten über die Organisation der Reise und die Herausforderungen, ein großes Mitgliederkollektiv aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus thematisiert Adrian die emotionalen Erlebnisse, die er während seiner Reisen in Osteuropa, insbesondere während der Wendezeit in der DDR und der Sowjetunion, hatte. Diese Segmente sind nicht nur informativ, sondern zeigen auch die menschliche Seite der Filmindustrie und die Bedeutung des kulturellen Austauschs in bewegenden Zeiten der Geschichte. Abschließend äußert Adrian den Wunsch, noch mehr solcher Geschichten zu teilen, um das Erlebnis des Kinos und die Mission der Gilde weiter in die Welt zu tragen. Dies führt zu einem Ausblick auf zukünftige Episoden, in denen noch mehr über seine Reisen erzählt werden soll.

Adrian, findest Du nicht, dass es zu viele Filmfestivals gibt? (Folge 10)
In dieser Folge von "Liebeskinoerinnerungen" widme ich mich dem Thema Filmfestivals, insbesondere dem Locarno Film Festival, meinem Lieblingsfilmfestival, und teile persönliche Erfahrungen sowie spannende Geschichten aus über zwei Jahrzehnten meiner Festivalteilnahme. Ich beginne mit dem ersten Mal, als ich nach Locarno reiste. Eingeladen wurde ich durch meine Rolle als Vorstandsmitglied der Gilde Deutscher Filmkunsttheater. Locarno war für mich eine Offenbarung – die bezaubernde Atmosphäre am Lago Maggiore, die malerische Altstadt und die köstliche Tessiner Küche haben mich sofort in ihren Bann gezogen. Das Festival erstreckt sich über zehn bis zwölf Tage und zieht Filmkunstliebhaber aus der ganzen Welt an. Wir hatten die Gelegenheit, nicht nur Filme im Wettbewerb zu sehen, sondern auch auf der Piazza Grande Filme unter freiem Himmel zu genießen, was jeder Erfahrung ein magisches Flair verleiht. Im Laufe der Jahre habe ich zahlreiche Juroren und Festivaldirektoren kennengelernt und einige prägende Momente erlebt, darunter die Darbietung meiner eigenen Rede auf der Piazza Grande vor einem Publikum von rund 6000 Menschen. Diese Erfahrungen waren oft die Höhepunkte eines arbeitsreichen, aber sehr erfüllenden Festivallebens. Locarno ist für mich nicht nur ein Festival, sondern ein Ort voller Erinnerungen, herzlicher Begegnungen und filmischer Höhepunkte – eine echte Schatzkammer der Filmkunst. Gleichzeitig betrachte ich das Festival als Plattform für aufstrebende Filmemacher und internationale Debütfilme, die oft nicht die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen. Der Fokus auf arthausorientierte Filme unterscheidet Locarno von anderen Großveranstaltungen wie Cannes oder Venedig und verleiht ihm einen einzigartigen Charakter. Dies ist ein Grund, warum das Festival für mich so besonders ist – eine Feier des Kinos in seiner künstlerischen Form und ein Ort der Begegnung mit Gleichgesinnten. Zusätzlich sinniere ich über meine Erfahrungen mit anderen Filmfestivals, wie zum Beispiel in Portugal. Das Festival in Figueira da Foz war ein weiterer Ort, der mir ans Herz gewachsen ist, und ich erlebte die Entstehungsgeschichte eines Festivals, das dank der Leidenschaft eines einzelnen Filmbegeisterten entstand. Diese Festivals sind oft stark mit der Person verbunden, die sie leitet, und zeigen, wie wichtig Engagement und Liebe zur Filmkunst für den Erfolg eines Festivals sind. Abschließend reflektiere ich über den gegenwärtigen Zustand von Filmfestivals im Allgemeinen. In den letzten Jahren erlebte ich eine wachsende Anzahl an Festivals, die oft einer "Inflation" von Veranstaltungsarten gleichen, wobei viele die Identität der Filmkunst zu verwässern scheinen. Es wird zunehmend schwierig, die Vielfalt und den kulturellen Reichtum zu bewahren, während sich viele Festivals eher auf die Prominenz konzentrieren, um Aufmerksamkeit zu generieren. Ein echtes Festival sollte jedoch vor allem die Filmkunst feiern und die Filmemacher unterstützen, die möglicherweise nicht in der Lage sind, auf den größeren Bühnen dieser Weltgesehen zu werden. Für die nächste Folge plane ich, über meine Reisen zu sprechen und die faszinierenden Erlebnisse, die ich auf meinen Festivalbesuchen sammeln konnte, zu teilen.

Adrian, warum hast Du damals in Biberach als einziger Tom Tykwers ersten Film gezeigt? (Folge 9)
In dieser Episode dreht sich alles um die entscheidende Rolle der Filmförderung in der deutschen Filmindustrie, beleuchtet aus der Perspektive von Adrian Kutter. Er teilt seine Erfahrungen aus der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg und gibt Einblicke in seine Anfänge im Kinosystem. Die Entwicklung der Biberacher Filmfestspiele Kutter berichtet über die Entwicklung der Biberacher Filmfestspiele, die er als wichtige Plattform für junge Filmemacher etabliert hat. Er beleuchtet, wie diese Veranstaltung dazu beiträgt, aufstrebenden Talenten eine Bühne zu bieten und ihre Projekte zu fördern. Arten der Filmförderung und historische Entwicklung Die Episode erörtert die verschiedenen Arten der Filmförderung auf Landes- und Bundesebene. Adrian Kutter diskutiert die historische Entwicklung der Filmförderung in Deutschland und zieht Vergleiche zu anderen Ländern, insbesondere den USA. Dabei wird deutlich, wie finanzielle Unterstützung Filmemachern hilft, innovative Projekte zu realisieren. Persönliche Anekdoten und Ausblick Adrian Kutter teilt zudem persönliche Anekdoten zu Netzwerken und Talenten, darunter auch zu namhaften Regisseuren wie Tom Tykwer. Abschließend gibt er einen Ausblick auf die nächste Episode, die sich ebenfalls mit dem Thema Filmfestivals beschäftigen wird.
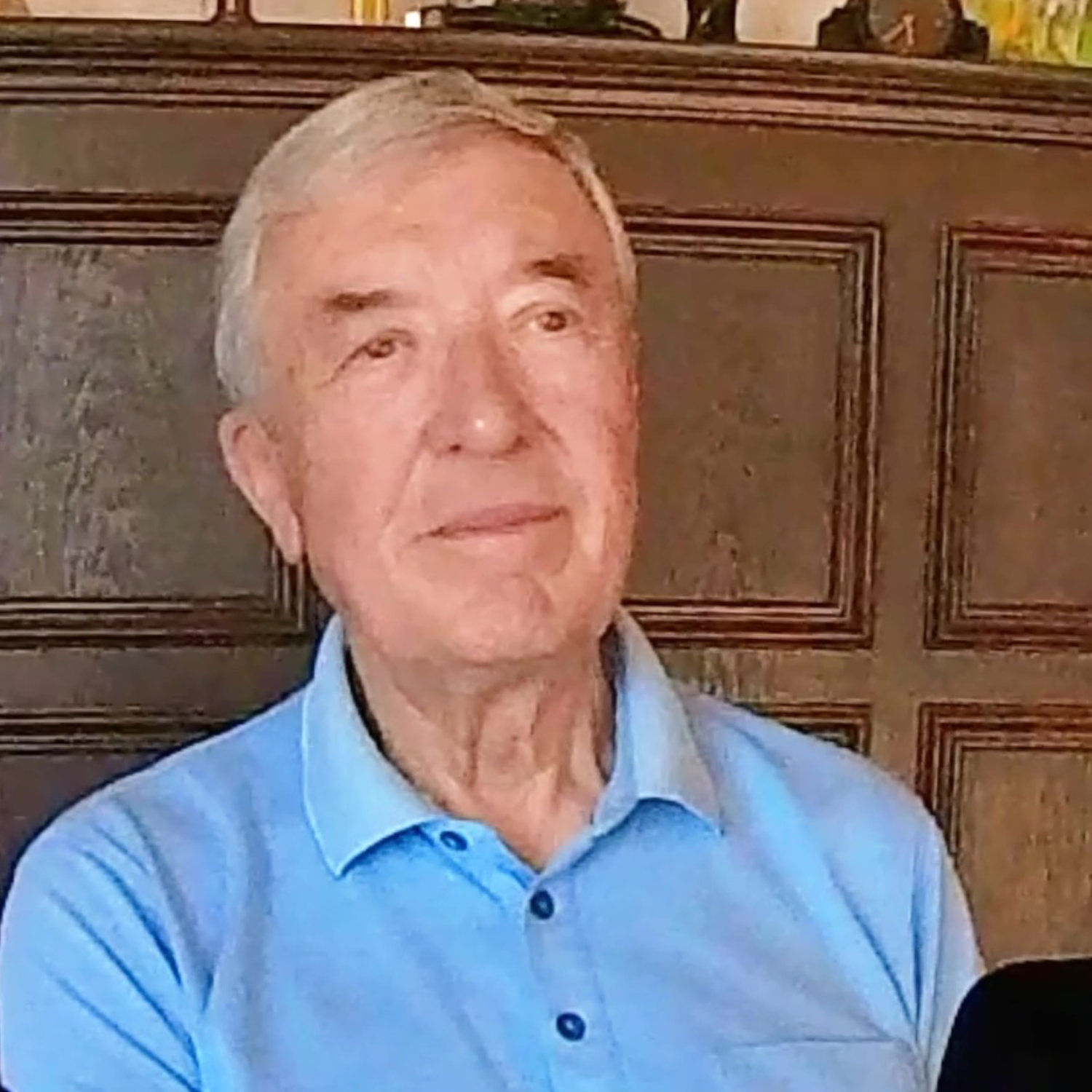
Adrian, warum hat der Film "Rambo" das "Prädikat Wertvoll" verdient? (Folge 8)
In dieser Episode teile ich meine Erfahrungen und Einblicke aus vier Jahrzehnten als Jurymitglied und Vorsitzender der Filmbewertungsstelle. Wir beleuchten die Historie der Filmbewertung in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, die Richtlinien zur Vergabe von Prädikaten sowie die künstlerischen und technischen Aspekte, die in die Bewertung einfließen. Ich diskutiere die Herausforderungen, denen sich Jurymitglieder gegenübersehen, und betone die Verantwortung, wertvolle Filme zu erkennen und zu fördern. Anhand des Films "Rambo" zeigt sich, wie tiefere gesellschaftliche Botschaften trotz kritischer Betrachtungen vermittelt werden können. Außerdem reflektieren wir die notwendige Weiterentwicklung des Bewertungssystems im Zeitalter von Streamingdiensten und den kulturellen Einfluss von Filmen. Letztlich hoffe ich, die Zuhörer dazu anzuregen, den kulturellen Wert von Filmen zu hinterfragen und verschiedene Perspektiven zu bedenken.

Adrian, wie hast du das angestellt, Filme aus dem historischen Giftschrank im Kino zu zeigen? (Folge 7)
In dieser Episode widmen wir uns einem faszinierenden Aspekt Adrian Kutters Schaffens: Wie ich es geschafft habe, Filme zu zeigen, die offiziell nicht mehr im Kino präsentiert werden dürfen, insbesondere Nazi-Propagandafilme, die im sogenannten "Giftschrank" liegen. Angefangen bei der Konzeptentwicklung, über die Kontaktaufnahme mit der Akademie für politische Bildung, bringe ich Licht in die Prozesse, die es ermöglichten, diese Filme im Kino zu zeigen. Dabei spielt der Film "Jud Süß" eine zentrale Rolle – ein Paradebeispiel für die Herausforderung und die Relevanz, sich mit unserer cineastischen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Mein Werdegang begann 1973, als ich nach meinem Studium in Mannheim nach Biberach zurückkehrte und entschloss, das Kino neu zu gestalten. Zwei große Theater übernahm ich, wobei ich ein Haus für anspruchsvolle Kommerzfilme und das andere als Filmkunstkino mit einem Schwerpunkt auf deutscher Filmkultur umfunktionierte. Hierbei wollte ich nicht nur Filme zeigen, sondern auch einen Dialog mit dem Publikum fördern. Daher entstand die Idee, Seminare zur Filmanalyse anzubieten, um den Zuschauern zu helfen, Filme auf einer tieferen Ebene zu betrachten. Beginnend mit einem Seminar über Filmanalyse habe ich zusammen mit Experten, vor allem Dr. Gerd Albrecht, eine Plattform geschaffen, um die Filmkunst in der breiten Öffentlichkeit sowie in Schulen zu belehren. Wir organisierten Schulvorstellungen und public screenings, kombiniert mit Diskussionen, die das Verständnis für Film und seine Geschichte vertiefen sollten. Durch diese Initiativen wurde das Interesse an unserer filmhistorischen Verantwortung geweckt und viele hatten die Möglichkeit, mit Hilfe von Experten in die Thematik des Nationalsozialismus einzutauchen. In diesen Seminaren konnten wir sogar vollständige Filme des Dritten Reiches zeigen, einschließlich der Propagandawochenschauen, die den Umgang mit dieser belastenden Zeit aufzeigten. Die Möglichkeit, die Filme auf diese Weise zu präsentieren, erforderte eine Genehmigung vom Bundesarchiv und eine sorgfältige Planung, um sicherzustellen, dass das Publikum in der angemessenen Rahmenbedingungen über die Filme diskutieren konnte. Im Laufe der Jahre haben wir zahlreiche Seminare zu unterschiedlichen zeitgeschichtlichen Themen veranstaltet. Als einer der ersten Schritte zur Aufklärung und Bildung über das Dritte Reich, haben wir spezifische Filmreihen kuratiert, die ein breites Publikum, darunter auch Schüler und Mitglieder der Bundeswehr, ansprachen. Diese Veranstaltungen fanden großes Interesse und trugen entscheidend zur Aufarbeitung der filmischen Geschichte bei. Durch den Austausch mit Delegationen aus anderen Ländern habe ich auch einen Einblick in die Filmproduktion in anderen Kulturen gewonnen. Bei der Zusammenarbeit mit Filmteams aus dem Ostblock und China erlebte ich nicht nur die Herausforderungen und Schönheiten ihrer Filmproduktionspraktiken, sondern auch, wie wichtig der interkulturelle Dialog in Zeiten politischer Spannungen ist. Diese Erfahrungen bereicherten meine Sicht auf das Kino als Medium der Verständigung und des Austauschs. Abschließend reflektiere ich die heutige Situation des Filmgeschäfts im Hinblick auf politische Strömungen. Ich sehe Parallelen zwischen der Rückkehr autoritärer Tendenzen und den Herausforderungen, denen sich die Filmkunst heute gegenübersieht. Gerade in solch kritischen Zeiten ist es umso wichtiger, sich mit der Filmgeschichte auseinanderzusetzen und den Dialog aufrechtzuerhalten. Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft relevante und bedeutende Geschichten erzählen können, indem wir die Lektionen der Vergangenheit nutzen, um die gegenwärtige und zukünftige Filmkultur zu gestalten.

Adrian, wie ist es deinem Vater Anton gelungen, dass er direkt nach dem Krieg wieder Filme drehen durfte? (Folge 6)
In dieser Episode von "Liebes Kino, Erinnerungen von Adrian Kutter" setze ich meine Gespräche über das Leben meines Vaters fort, diesmal ab dem Jahr 1940, dem Zeitpunkt, an dem der Film "Weltraumschiff 1 startet" produziert wurde. Ich teile meine Eindrücke von diesem zeitlosen Werk, das auch auf YouTube verfügbar ist, und wir tauchen tief in die Details seiner Entstehung ein. Besonders spannend finde ich, wie mein Vater sein Wissen um die Astronomie und die Filmproduktion kombinierte, um nicht nur einen unterhaltsamen, sondern auch einen in seiner visuellen Umsetzung beeindruckenden Film zu schaffen. Wir diskutieren die kreative und technische Herangehensweise, die er bei der Gestaltung des Films verwendete, einschließlich der faszinierenden Verwendung von Tricktechnik und realistischen Darstellungen der Mondoberfläche. Es ist interessant zu erfahren, dass die beeindruckenden Mondaufnahmen in dem Film nicht nur aus Fantasie entstanden sind, sondern auf den echten fotografischen Arbeiten meines Vaters basieren, die er mit einem besonderen Teleskop machte. Diese Kreativität und technische Expertise fanden wir auch in den Herausforderungen, die mein Vater während der Dreharbeiten erlebte, insbesondere in Bezug auf die Eingriffe, die das nationalsozialistische Regime in die Filmproduktion vornahm. Des Weiteren bietet die Episode Einblicke in die neuen Herausforderungen, die sich für meinen Vater ab 1945 ergaben, als er und seine Familie nach dem Zweiten Weltkrieg in Biberach ein neues Leben aufbauen mussten. Ich erkläre, wie mein Vater es schaffte, ein Kino zu eröffnen und schließlich einen wieder wachsenden Einfluss in der deutschen Filmindustrie auszuüben. Es ist berührend zu sehen, wie er nicht nur als Filmemacher, sondern auch als Astronom eine bedeutende Rolle spielte, insbesondere in Bezug auf den Bau von Sternwarten. Die Erneuerung seines Filmschaffens in den späten 1940er Jahren in der Besatzungszeit zeigt seine Resilienz und Entschlossenheit. Ich erkläre, wie mein Vater schließlich wieder auf die Beine kam und dokumentarische Filme über landwirtschaftliche Kooperativen und heilige Stätten drehte, die in der Nachkriegszeit enormen Anklang fanden. Diese Rückkehr zur Filmarbeit bildet einen faszinierenden Kontrast zur düsteren Vergangenheit und reinigt die Wunden seiner früheren Erfahrungen. Im Laufe des Gesprächs erforschen wir auch die Philosophie meines Vaters über die Filmkunst und die hohen Standards, die er für seine eigenen Produktionen hegte. Ich teile, wie sehr mich seine Leidenschaft für den Film geprägt hat und wie dies meine eigene Karriere im Kino beeinflusste. Diesbezüglich betonen wir die Bedeutung von Qualität und den Anspruch, den das Kino erfüllen sollte – nicht nur als Unterhaltungsmedium, sondern als Kunstform, die das Publikum zur Reflexion anregen kann. Abschließend werfen wir einen Blick nach vorn und besprechen die Themen, die in zukünftigen Episoden behandelt werden, darunter meine eigene Zusammenarbeit mit der Akademie für politische Bildung und die Wiederentdeckung von Filmen, die wichtige gesellschaftliche Fragen aufwerfen, aber nicht mehr gezeigt werden dürfen. Diese fortlaufenden Gespräche bieten nicht nur einen Einblick in die Filmgeschichte, sondern auch eine spannende persönliche Perspektive auf die Entwicklung von Film und Kultur im Deutschland nach dem Krieg.
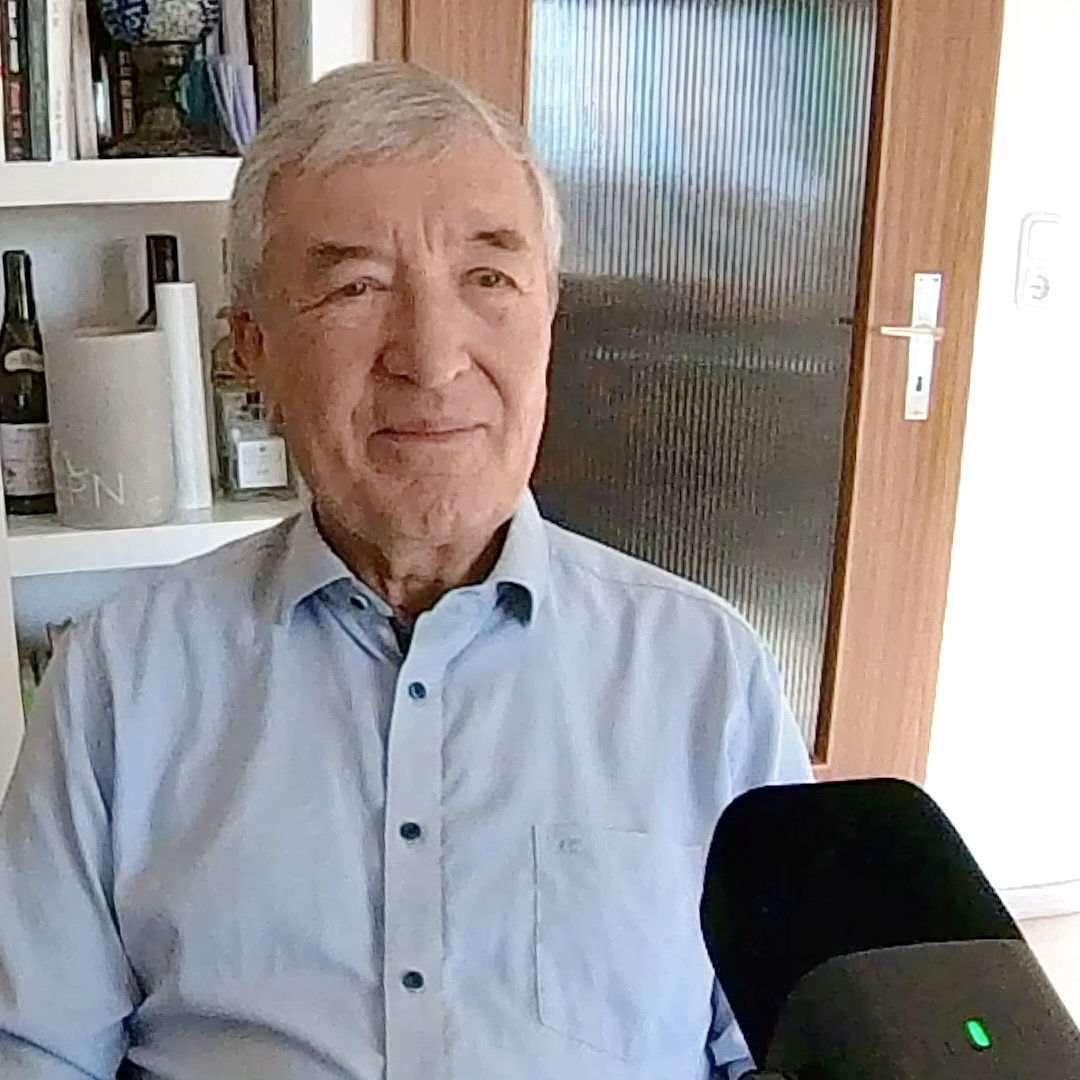
Adrian, wieso hat ein Oscar-Preisträger für Spezialeffekte um Fotos von deinem Vater gebeten? (Folge 5)
In dieser Episode der Gesprächsreihe mit Adrian Kutter erforschen wir das faszinierende Leben seines Vaters, Anton Kutter, einem Pionier der deutschen Filmkunst. Wir beginnen mit den Anfängen seiner Karriere und seiner Verbindung zur Astronomie, die prägend für seine Filmprojekte war. Adrian berichtet über Anton Kutters bahnbrechenden Film „Weltraumschiff 1 startet“ und die beeindruckenden Tricktechniken, die er einsetzte. Dabei thematisieren wir die Herausforderungen der NS-Zensur, die seinen Schaffensprozess beeinflussten, und wie er sich weigerte, der NSDAP beizutreten. Die Episode beleuchtet sein Erbe und die Auswirkungen seiner kreativen Arbeiten auf die deutsche Filmkunst.

Adrian, wie war das, in Jurys der Berlinale zu sitzen und was ist so schlimm an Cannes? (Folge 04)
In dieser Episode setzen wir unser Gespräch mit Adrian Kutter fort und tauchen tiefer in die faszinierende Welt der Filmfestivals ein. Adrian teilt seine persönlichen Erfahrungen und Eindrücke aus über 50 Jahren in der Film- und Kinobranche, beginnend mit seiner Verbindung zur Gilde Deutscher Filmkunsttheater. Wir erfahren von seinen ersten Schritten im Festivalwesen, seiner Jury-Erfahrung und dem Gilde Filmpreis, den er seit 1977 begleitet. Besonders die Berlinale nimmt einen großen Teil des Gesprächs ein, wo Adrian über seine Erfahrungen in internationalen Jurys spricht und die Entwicklung des Festivals reflektiert. Zudem vergleicht er die Berlinale mit Cannes und beleuchtet die Herausforderungen und Veränderungen in der Festivalkultur. Cannes, erzählt er, ist ein hochgradig kommerzielles Festival geworden, das auch viel Kriminalität in die Stadt zieht. Und es gibt einen triftigen Grund, warum er es nie wieder besuchen wird.

Adrian, wie kam es dazu, dass du die Biberacher Filmfestspiele gegründet hast? (Folge 03)
Im Interview diskutiert Adrian Kutter seine Leidenschaft für das Kino und die Gründung der Biberacher Filmfestspiele, inspiriert von deutschen Regisseuren. Er betont die Notwendigkeit eines interaktiven Austausches unter Filmemachern, um Herausforderungen wie Finanzierung und Zensur zu adressieren. Kutters Festival begann 1978 mit etwa 20 Regisseuren und förderte den Dialog zwischen Filmemachern und Publikum. Zudem schafft er Räume, die junge Talente unterstützen und soziale Interaktion ermöglichen. Kutter reflektiert über die Entwicklung des Festivals, die Einbindung von Dokumentarfilmen und die Herausforderungen bei der Filmkuratierung. Er bleibt optimistisch über die Rolle des Films als Plattform für gesellschaftliche Diskussionen und setzt sich für die Förderung des deutschen Films ein.

Adrian, wie lange, glaubst du, wird es das Kino noch geben? (Folge 02)
Michael Scheyer interviewt Adrian Kutter, einen erfahrenen Kinomacher, über dessen Werdegang und Herausforderungen im Kino. Adrian übernahm die Kinos in Biberach und wandelte eines in ein Filmkunsthaus um, um anspruchsvollere Filme zu zeigen. Mit dem Ziel, Kino als kulturellen Raum zu etablieren, förderte er Bildung und Diskussion. Der Besuch von Werner Herzog war ein Wendepunkt und führte zu Netzwerken mit prominenten Filmemachern. Adrian reflektiert über die Konkurrenz durch neue Medien und bleibt optimistisch über die Zukunft des Kinos als sozialen Raum.

Adrian, erinnerst du dich noch an deinen allerersten Kinofilm? (Folge 01)
Im Interview reflektiert Adrian Kutter über seine von der Filmwelt geprägte Kindheit in einer Kinobesitzerfamilie und beschreibt seine erste heimliche Kinovorführung von "Les Enfants du Paradis". Seine Kreativität zeigte sich früh in der Gestaltung von Kinodekorationen und der Gründung eines Filmclubs für Jugendliche. Nach dem Militärdienst führte er an der Universität Mannheim Filmvorführungen ein, die das kulturelle Angebot bereicherten. Kutter betont die gesellschaftliche Verantwortung des Films als Medium für Kunst und Emotionen. Die Episode endet mit der Aussicht auf eine Fortsetzung, in der er über seine Herausforderungen in der Filmbranche spricht.