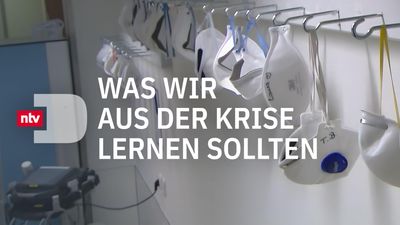Sinneswandel ist ein Podcast zwischen Philosophie und Popkultur. Die Journalistin Marilena Berends spricht über Sinnsuche, Kreativität, Selbstzweifel, gesellschaftliche Brüche und das Leben im Dauerwandel. Sie denkt laut über Themen wie Nachhaltigkeit, Sinn, Zukunft der Arbeit oder gesellschaftliche Veränderungen nach. Dabei verbindet sie persönliche Beobachtungen mit philosophischen Gedanken. Menschen und Geschichten stehen im Mittelpunkt – sie zeigen, wie wir anders denken und handeln können, wenn wir wollen.
Alle Folgen
Wem gehört meine Zeit?
In dieser Folge des Sinneswandel-Podcasts gehe ich der Debatte um sogenannte „Lifestyle-Teilzeit“ nach. Ausgelöst wurde sie durch politische Forderungen, wonach Teilzeit nur aus „legitimen Gründen“ wie Care-Arbeit oder Weiterbildung erlaubt sein solle. Freizeit wird dabei moralisiert – und persönliche Lebensgestaltung zur gesellschaftlichen Bedrohung erklärt. Ich spreche über Arbeit, Erschöpfung und Produktivität: darüber, warum immer mehr Menschen ihre Arbeitszeit reduzieren wollen, warum vor allem Frauen in Teilzeit arbeiten und weshalb Burnout längst kein individuelles Problem mehr ist. Anhand von Stimmen aus Journalismus, Ökonomie und Pädagogik frage ich, ob mehr Arbeit wirklich mehr Wohlstand bedeutet – oder ob freie Zeit nicht ein zentraler Bestandteil einer funktionierenden Demokratie ist. Es geht um Ungleichheit, Erbschaften, Care-Arbeit und um die Frage, warum Erschöpfung privatisiert wird, während Produktivität öffentlich verhandelt wird. Und darum, ob eine wohlhabende Gesellschaft nicht weniger fragen sollte, wie sie Menschen zu mehr Arbeit bringt – sondern warum freie Zeit überhaupt als Problem gilt.

Laut gedacht: Sind Utopien delulu?
Utopien sind gerade nicht besonders populär. In Zeiten von Krisen, Klimawandel und politischer Unsicherheit wirken Ideen von einer besseren Zukunft oft unrealistisch oder überholt. In dieser Folge spreche ich mit Thomas über Utopien, Delulu, Solulu und das Konzept der Präfiguration – Begriffe, die auf unterschiedliche Weise beschreiben, wie Menschen über Zukunft nachdenken und sie sich vorstellen. Wir erkunden, wie Utopien heute funktionieren können, wie Anti-Dystopien als Gegenentwurf zur alltäglichen Krisenerfahrung wirken und warum der Weg in eine wünschenswerte Zukunft oft im Hier und Jetzt beginnt. Ein Gespräch über Zeitgeist, Vorstellungskraft, gesellschaftliche Perspektiven und das Spannungsfeld zwischen Idealvorstellung und Realität

Neues Jahr, neues Ich?
Zum Jahresanfang sind sie überall: Neujahrsvorsätze. Und gleichzeitig wirken sie auf viele von uns abgenutzt, moralisch aufgeladen oder wie ein weiterer Akt der Selbstoptimierung. In dieser Folge frage ich mich, warum wir ausgerechnet am 1. Januar neu anfangen wollen – und woher dieses Ritual eigentlich kommt. Ich spreche über den psychologischen Fresh-Start-Effekt, über die Geschichte der Neujahrsvorsätze und darüber, warum so viele von ihnen scheitern. Gleichzeitig geht es um philosophische und feministische Kritik an Vorsätzen: Um Selbstoptimierung, Care und die Frage, können Vorsätze auch solidarischer und weniger leistungsorientiert sein?

Alles wird anders – und jetzt?
Es ist die letzte Folge des Jahres, und ich spüre diese diffuse Erschöpfung, die viele von uns gerade kennen. In dieser Episode reflektiere ich über Wandel als kollektive Erfahrung: die Beschleunigung unseres Alltags, die Unsicherheit in Politik, Klima, Wirtschaft und Technologie, und das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren alles verdichtet hat. Ich spreche darüber, wie wir mit Wandel [besser] umgehen können - Gleichzeitig hinterfrage ich die Idee, dass wir einfach nur resilienter werden müssen. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Soziologe Zygmunt Bauman und seine Idee der „flüssigen Moderne“. Und die Frage, ob Wandel nicht nur etwas ist, das wir “aushalten” müssen – sondern etwas, das wir auch gemeinsam gestalten können.

Laut gedacht: Bin ich jetzt alt?
Was bedeutet es eigentlich erwachsen zu sein? Diese Frage treibt mich – wie viele Millennials – schon eine ganze Weile um. Ich bin Anfang/Mitte 30, aber oft fühlt sich mein Leben eher nach einem ewigen „Dazwischen“ an. In dieser „Laut gedacht“-Folge spreche ich mit meiner Freundin Denise darüber, wie es ist, als Millennial groß geworden zu sein: mit MTV, Myspace, Röhrenjeans und Klapphandys – und gleichzeitig in einer Arbeitswelt zu landen, die von Unsicherheit, Prekarität und dauerndem Wandel geprägt ist. Wir sprechen über das Erwachsenwerden, Quarterlife-Crisis, Generation Y vs. Generation Z, über Nostalgie, Selbstzweifel und darüber, warum so viele von uns sich nicht wirklich „angekommen“ fühlen. Und wir fragen uns: Muss Erwachsensein überhaupt bedeuten, einen klaren Lebensplan zu haben? Oder geht es eher darum, mit Veränderung leben zu lernen?

Labubus, Matcha Latte – Wieso wird etwas zum Hype?
Labubus, Matcha, Dubai-Schokolade – gefühlt entsteht jede Woche ein neuer Hype. Dinge, die plötzlich überall sind und genauso schnell wieder verschwinden. Ich frage mich: Was macht etwas überhaupt zum Hype? Und was sagt diese kollektive Begeisterung über unsere Gegenwart aus?

Laut Gedacht: Softness als Widerstand?
In einer Welt, die auf Leistung, Härte und Resilienz setzt, scheint „soft sein“ fast ein Widerspruch. Aber was, wenn darin gerade eine Form von Widerstand liegt? Mit meinem guten Freund Daniele spreche ich über Verletzlichkeit, Fürsorge und die politische Kraft von Sanftheit.

I’m cringe, but free – Ist peinlich das neue Cool?
Peinlich war lange das Schlimmste, was man sein konnte. Coolness bedeutet Kontrolle, Distanz, bloß keine Gefühle zeigen. Jetzt scheint sich das zu drehen: auf Tiktok und in der Popkultur wird das „Cringe-sein“ gefeiert – als neue Form von Ehrlichkeit. Aber steckt darin wirklich Freiheit? Oder ist selbst das “Unperfekte” längst wieder Performance?

Sinn-Flation: Warum Un-Sinn sinnvoll ist
Gefühlt muss heute alles Sinn machen: Yoga für die Selfcare, Reisen für die Horizonterweiterung, sogar Schlaf wird zum Biohacking. Aber manchmal nervt genau dieser permanente Sinn-Overload. In dieser Folge frage ich mich, ob wir nicht mehr Unsinn brauchen. Vom TikTok-Trend “German Brainrot” über dadaistische Lautgedichte bis hin zu Albert Camus: Kann das Sinnlose nicht manchmal das Sinnvollste sein?

Laut gedacht: Was wäre gewesen, wenn…?
Gleichzeitigkeit – ein Konzept, das zunächst abstrakt wirkt, im Alltag aber ständig präsent ist. Wir erleben Dinge parallel, denken an Vergangenes, während wir in der Gegenwart handeln, und nehmen Welten wahr, die scheinbar im Widerspruch zueinanderstehen. Mit meinem Freund David spreche ich darüber, wie diese Gleichzeitigkeit unser Denken, Fühlen und Handeln beeinflusst – und warum es manchmal befreiend sein kann, Widersprüche einfach nebeneinander existieren zu lassen.

Generation AirPod: Können wir Stille nicht mehr aushalten?
Die kleinen, weißen Stöpsel im Ohr sind omnipräsent. Auch ich greife oft reflexhaft zu meinen AirPods, sobald ich aus dem Haus gehe. Wir hören Musik, Podcasts, telefonieren – überall. Hauptsache, es ist nie ganz still. Aber warum eigentlich? Was macht dieses permanente Grundrauschen mit uns – mit unserer Wahrnehmung und dem Miteinander?

Ist Smalltalk unterschätzt?
Ein kurzer Blick, ein flüchtiges Lächeln – und trotzdem bleibt etwas hängen. In dieser Folge geht es um all die Mikrobegegnungen im Alltag: der Plausch mit der alten Dame im Zug, der Kioskverkäufer der einem nett zulächelt oder der Nachbar mit Hund im Park, der einen immer grüßt. Warum berühren uns ausgerechnet solche Momente manchmal mehr als lange Gespräche mit Freund*innen? Und was passiert, wenn solche losen Bekanntschaften seltener werden?

Ist Chaos in Ordnung?
Chaos stresst mich – und fasziniert mich. In dieser Folge geht es um das Bedürfnis nach Ordnung, die Angst vor Kontrollverlust und die Frage, warum viele in unsicheren Zeiten einfache Antworten suchen. Ich spreche über philosophische, gesellschaftliche und ganz praktische Perspektiven auf das Chaos – und darüber, was passiert, wenn wir lernen, es auszuhalten. Ist Chaos wirklich so schlecht, wie sein Ruf? Oder hat es vielleicht sogar seine eigene Ordnung?

Hi ChatGPT, mir geht es gerade nicht gut…
Immer mehr Menschen sprechen mit KI wie ChatGPT über ihre Gefühle – auch ich habe es ausprobiert. In dieser Folge geht es um die Frage: Kann KI eine echte Psychotherapie ersetzen? Ich teile persönliche Erfahrungen, aktuelle Studien und gesellschaftliche Hintergründe – und frage, was diese Entwicklung eigentlich über uns als Gesellschaft aussagt.

Wozu das alles? Über kreative Krisen und Sinnfragen
In dieser Folge reflektiere ich über meine aktuelle kreative Krise und frage, wie Kreativität und Sinn zusammenhängen. Zwischen Zweifel und dem Wunsch nach echtem Ausdruck suche ich nach einem freieren Umgang mit Kreativität – und danach, was unsere Gesellschaft und das System mit dieser Suche zu tun haben.

Thomas Galli: Eine Welt ohne Gefängnisse - Utopie?
Gefängnisse machen unsere Gesellschaft sicherer“ – oder? Ex-Gefängnisdirektor und Jurist Thomas Galli sieht das anders. Er sagt: Der Strafvollzug ist teuer, ineffektiv und trifft oft die Falschen. Warum Haftstrafen besonders arme Menschen treffen, Resozialisierung kaum funktioniert und welche Alternativen es geben könnte, darüber spricht Marilena Berends mit Thomas Galli.

Sebastian Klein: Sollten wir Milliardäre abschaffen?
Wie fühlt es sich an, wenn man über Nacht zur Millionär*in wird? Sebastian Klein hat das erlebt. Mit der Gründung seines StartUps Blinkist wurde er reich – so reich, dass er irgendwann beschloss, 90 Prozent seines Vermögens wieder abzugeben. Wieso er davon überzeugt ist, dass extremer Reichtum die Demokratie gefährdet und abgeschafft gehört, darüber hat Marilena Berends mit Sebastian Klein gesprochen.

Sebastian Tigges: Was ist ein "guter Vater"?
Warum scheitert gleichberechtigte Elternschaft so oft an der Realität? Obwohl viele Väter sich mehr Zeit mit ihren Kindern wünschen, nehmen die meisten nicht mehr als zwei Monate Elternzeit – wenn überhaupt. Liegt es am Geld, an gesellschaftlichen Erwartungen oder an politischen Strukturen? Über Mental Load, den “Daddy Bonus” und die Frage, was einen guten Vater ausmacht, spricht Marilena Berends in dieser Folge mit Dadfluencer Sebastian Tigges.

Franka Frei: [Wann] kommt die Pille für den Mann?
Warum tragen immer noch vor allem Frauen die Verantwortung für Verhütung? Und warum werden Nebenwirkungen der Pille bei Frauen toleriert, während sie bei Männern verhindern, dass eine Pille überhaupt auf den Markt kommt? Verhütung ist ungerecht – dabei geht es auch fair. Darüber spricht Marilena Berends in dieser Folge mit der Autorin und Journalistin Franka Frei.
![Franka Frei: [Wann] kommt die Pille für den Mann?](https://media.plus.rtl.de/podcast/sinneswandel-fws7tnmgprzgn.jpeg)
Jakob Springfeld: War die Brandmauer eine Illusion?
Warum wird der Rechtsruck in Deutschland immer noch vor allem als “Ostproblem” gesehen? Welche Rolle spielen dabei alte Narrative und blinde Flecken in der politischen Debatte? Über "Verantwortungs-Pingpong" und die Illusion der sogenannten “Brandmauer” spricht Marilena Berends in dieser Folge mit Aktivist und Autor Jakob Springfeld.

Jagoda Marinić: Was macht dir Hoffnung?
Was macht uns Hoffnung inmitten all der Veränderung? Jagoda Marinić, Autorin und Podcasterin, spricht mit Marilena Berends über „Sanfte Radikalität“, den Mut zur Veränderung und wie wir die Balance zwischen Idealismus und Realität finden.

Oke Göttlich: Wie [un]politisch darf Fußball sein?
Wem gehört der Fußball? Darüber spricht Marilena Berends mit Oke Göttlich, Präsident vom FC St. Pauli. Der Verein hat vor kurzem als erster im Profifußball eine Genossenschaft gegründet und will damit den Sport revolutionieren. Im Gespräch geht es um Mitbestimmung, die Rolle der Fans und die Frage, wie politisch Fußball eigentlich sein darf - oder sogar sein sollte?!
![Oke Göttlich: Wie [un]politisch darf Fußball sein?](https://media.plus.rtl.de/podcast/sinneswandel-fws7tnmgprzgn.jpeg)
Kilian Trotier: Kann die Suche nach Sinn [un]glücklich machen?
Was passiert, wenn die Sinnfrage zur (Sinn)Krise wird? ZEIT-Journalist Kilian Trotier beschäftigt sich in seinem neuen Buch “Sinn finden Warum es gut ist, das Leben zu hinterfragen” mit den großen Fragen. Im Gespräch mit Marilena Berends erzählt er von der wachsenden „Sinn-Branche" und darüber, ob diese Suche wirklich glücklich macht oder vielleicht doch mehr Druck schafft.
![Kilian Trotier: Kann die Suche nach Sinn [un]glücklich machen?](https://media.plus.rtl.de/podcast/sinneswandel-fws7tnmgprzgn.jpeg)
Korbinian Frenzel: Wie streiten wir richtig?
Reden wir noch miteinander – oder längst aneinander vorbei? Korbinian Frenzel, Journalist und Moderator, sieht unsere Gesellschaft in zunehmend polarisierten Debatten gefangen. In seinem Buch Defekte Debatten fordert er eine neue Streitkultur. Mit Marilena Berends spricht er über Cancel Culture, Filterblasen und Wege zu einem besseren Miteinander.

Kristina Hänel: [Warum] sollten Abtreibungen legal sein?
Abtreibungen sind in Deutschland grundsätzlich illegal und nur unter bestimmten Bedingungen straffrei. Kristina Hänel kämpft seit Jahren für die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Die Ärztin hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Paragraph 219a abgeschafft wurde, der es ihr verbot, über Abtreibungen zu informieren. Im Podcast spricht Marilena Berends mit Kristina Hänel unter anderem über Papayaworkshops und was es bedeuten würde, das Selbstbestimmungsrecht von ungewollt Schwangeren zu achten.
![Kristina Hänel: [Warum] sollten Abtreibungen legal sein?](https://media.plus.rtl.de/podcast/sinneswandel-fws7tnmgprzgn.jpeg)
Beate Absalon: Ist Sex überbewertet?
Warum gilt ein erfülltes Sexleben als erstrebenswert? Was macht guten Sex aus? Und was, wenn ich gar keinen Bock auf Sex habe, oder keinen Sex haben kann? Ist das auch okay? In dieser Folge spricht Marilena mit Kulturwissenschaftlerin Beate Absalon. In Ihrem Buch “Not giving a Fuck” erkundet sie, weshalb Sex in unserer Gesellschaft einen so hohen Stellenwert hat und was der Druck, ständig performen zu müssen, mit uns machen kann. Dabei geht es ihr nicht um Moralisierung oder sogar ein Sexverbot, sondern eher um einen spielerischen Umgang mit Sex, der vieles sein kann, aber nichts muss.

Kim de l'Horizon: Wie brechen wir das Schweigen?
Wer bin ich? Und wie bin ich zu dem Menschen geworden, der ich heute bin? Weil ich es wollte, weil ich es so gelernt habe oder weil ich es musste? Auch von diesen Fragen handelt das Blutbuch von Autor*in Kim de I’Horizon. 2022 gewann Kim damit als erste nonbinäre Person den Deutschen und Schweizer Buchpreis. In dieser Podcast Folge spreche ich mit Kim über das Menschsein, ob Schreiben heilen kann/sollte und über Hexerei.

Theresia Enzensberger: Ist Schlaf[losigkeit] politisch?
Statistiken zufolge schlafen rund 80 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland schlecht - Tendenz steigend. Die Autorin Theresia Enzensberger ist eine von ihnen und hat unter anderem deshalb ihr neues Buch dem Schlaf gewidmet. Darin geht es allerdings nicht um Einschlaftipps. Vielmehr beleuchtet sie die verschiedenen Facetten des Schlafs, die bis in die soziale und politische Sphäre eindringen. Weshalb Schlaf[losigkeit] politisch ist, darüber spricht Marilena Berends mit Theresia Enzensberger im Podcast.
![Theresia Enzensberger: Ist Schlaf[losigkeit] politisch?](https://media.plus.rtl.de/podcast/sinneswandel-fws7tnmgprzgn.jpeg)
Weibliche Lust - [k]ein Tabu?
Wie aufgeklärt, offen und frei sind wir wirklich, wenn besonders Frauen und nicht-männlich gelesene Personen sehr schnell verstummen, wenn es um die eigene Lust geht? Ist weibliches Begehren noch immer ein Tabu? Wenn das so ist, dann sollten wir das ändern und uns mehr darüber austauschen! Das dachten sich auch die Herausgeberinnen von “Wir kommen”, ein Kollektivroman, in dem sich 18 Autor*innen, verschiedener Herkünfte und Generationen über Sexualität und Begehren austauschen. Im Podcast spricht Marilena Berends mit Verena Güntner, Elisabeth R. Hager und Julia Wolf, den Herausgeberinnen von “Wir kommen”.
![Weibliche Lust - [k]ein Tabu?](https://media.plus.rtl.de/podcast/sinneswandel-fws7tnmgprzgn.jpeg)
Ann-Katrin Müller: Sollte die AfD verboten werden?
Die AfD ist überall, in den Nachrichten, auf TikTok, auf Plakaten, sogar in Talkshows. Und das nicht erst seit die Recherchen von Correctiv zum geheimen Potsdamer-Treffen von AfD-Politikern und Rechten öffentlich wurden. Trotz massiver Proteste gegen die AfD nimmt die Zahl ihrer Mitglieder zu. Woran liegt das? Wer sind die Wähler*innen der AfD? Und wie sinnvoll wäre ein Parteiverbot? Darüber spricht Marilena Berends mit Ann-Katrin Müller, Redakteurin im Politikressort des Spiegels.

Louisa Dellert: Ist #MentalHealth nur ein Trend?
Warum sprechen auf Social Media plötzlich alle über Mental Health? Allein der Hashtag #Depression hat auf TikTok über 18 Milliarden Views. Und hilft dieser Content [wirklich] dabei, dass psychische Krankheiten entstigmatisiert werden? Oder ziehen vor allem Unternehmen ihren Nutzen daraus, indem sie Menschen, die eigentlich Hilfe suchen, Produkte verkaufen? Über all das hat Marilena mit Influencerin und Autorin Louisa Dellert gesprochen.

Sophia Fritz: Gibt es Toxische Weiblichkeit?
Über toxische Männlichkeit wird längst in Büchern, Talkshows und beim Abendbrot diskutiert. Aber was ist mit toxischer Weiblichkeit - gibt es die überhaupt? Autorin Sophia Fritz hat sich ausgiebig mit diesem Phänomen beschäftigt und herausgefunden, dass toxisch weibliches Verhalten vor allem Frauen selbst schadet. Sie plädiert für ein neues feministisches Miteinander, das erst entstehen kann, wenn wir unsere eigene Sozialisierung verstehen. Wie das gelingen kann, darüber spricht Marilena mit Sophia in dieser Folge.

Elly Oldenbourg: [Warum] sollten wir weniger arbeiten?
New Work wird gerne als Buzzword verwendet - aber was steckt eigentlich dahinter? Mit dieser Frage beschäftigt sich Ex Google-Managerin Elly Oldenbourg in ihrem Buch “Workshift”. Darin stellt sie die Frage, warum wir anders arbeiten müssen, um unser Morgen zu retten. Wie das konkret gelingen kann, darüber hat sie mit Marilena Berends in dieser Folge gesprochen.
![Elly Oldenbourg: [Warum] sollten wir weniger arbeiten?](https://media.plus.rtl.de/podcast/sinneswandel-fws7tnmgprzgn.jpeg)
Benedikt Bösel: Wie[so] wurdest du vom Banker zum Bauern?
Spätestens seit den Bauernprotesten sprechen alle über die Landwirtschaft. Aber auch darüber hinaus gibt es Grund genug, sich mal genauer mit den Bedingungen auseinanderzusetzen, unter denen unser täglich Brot entsteht. Um die steht es nicht allzu gut, sagt zumindest Benedikt Bösel. Auch er ist Landwirt - allerdings kein Konventioneller. Bevor er in Brandenburg den Acker bewirtschaftete, arbeitete er als Banker. Und auch heute versucht er vieles anders zu machen. Was es mit Benedikts Sinneswandel auf sich hat und welche Hoffnung er in die Landwirtschaft hat, darüber hat Marilena Berends mit dem Öko-Landwirt gesprochen.
![Benedikt Bösel: Wie[so] wurdest du vom Banker zum Bauern?](https://media.plus.rtl.de/podcast/sinneswandel-fws7tnmgprzgn.jpeg)
Laura Cazés: Was bedeutet Jüdischsein [in Deutschland]?
Wenn in Deutschland über jüdisches Leben gesprochen wird, dann vor allem bezogen auf die Shoah und Antisemitismus. Ihr eigenes Leben mit all seinen Realitäten taucht in gesellschaftlichen Diskursen kaum auf. Warum ist das so? Und welche Auswirkungen hat das? Gemeinsam mit Laura Cazés, Herausgeberin von “Sicher sind wir nicht geblieben”, spricht Marilena über die vielfältigen Aspekte jüdischen Lebens in Deutschland. Aber auch darüber, wie wir Antisemitismus besser erkennen und bekämpfen können und was ihn so anschlussfähig macht.
![Laura Cazés: Was bedeutet Jüdischsein [in Deutschland]?](https://media.plus.rtl.de/podcast/sinneswandel-fws7tnmgprzgn.jpeg)
Moritz Eggert: Ist KI [die] Zukunftsmusik?
Dass Künstliche Intelligenz die Musikbranche verändern und womöglich revolutionieren wird, daran glaubt auch Moritz Eggert. Als Komponist, Performer, Autor und Präsident des Deutschen Komponistenverbandes hat er nicht nur ein gutes Gespür für die Musikwelt. Er ist auch dafür bekannt, sich und die Kunst immer wieder neu zu erfinden, mit Grenzen zu spielen und Wandel als Chance für Neues zu begreifen. Welche Chancen und Risiken birgt Künstliche Intelligenz für die Musikwelt? Darüber hat Marilena Berends mit Moritz Eggert gesprochen.
![Moritz Eggert: Ist KI [die] Zukunftsmusik?](https://media.plus.rtl.de/podcast/sinneswandel-fws7tnmgprzgn.jpeg)
Khesrau Behroz: Welchen Sinneswandel wünschst du dir?
Khesrau Behroz ist ein begnadeter Geschichtenerzähler. Seine Stimme kennen vermutlich viele durch Podcasts, wie “Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?" oder “Legion”. Khesrau ist darüber hinaus auch als Journalist viel im Weltgeschehen unterwegs und hat ein wachsames Auge, was in der Gesellschaft so passiert. Quasi der perfekte Gast für ein kleines Jahres-Resumé. Aber Khesrau ist nicht der einzige Gast von Marilena: Am Ende des Gesprächs wartet noch eine kleine Überraschung - also dran bleiben!

Daniel Schreiber: Wie verändert [uns] Trauer?
Trauer ist etwas zutiefst menschliches, sagt Autor Daniel Schreiber und fragt sich, wieso sie so wenig Raum in unserem Alltag erhält. Ausgehend von seiner persönlichen Erfahrung mit dem Tod seines Vaters erzählt er in seinem neuen Essay "Die Zeit der Verluste” davon, wie die Trauer ihn verändert hat. Und er spricht über all jene Verluste, die über das Persönliche hinausgehen. Über gesellschaftliche Umbrüche, die wir gerade durchleben. Wie gehen wir mit ihnen um? Geben wir uns genug Raum um Abschied zu nehmen? Und muss Trauer wirklich überwunden werden? Mehr dazu im Gespräch mit Marilena Berends im Sinneswandel Podcast.
![Daniel Schreiber: Wie verändert [uns] Trauer?](https://media.plus.rtl.de/podcast/sinneswandel-fws7tnmgprzgn.jpeg)
Ferechta Paiwand: Wem gehört das Weltall?
Die Kommerzialisierung des Weltraums schreitet voran, immer mehr staatliche, aber vor allem private Akteure drängen auf den Markt. Aber, wer darf im Weltall eigentlich Geschäfte machen? Und wem gehört überhaupt das Universum? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Ferechta Paiwand. Sie ist Juristin für Weltraumrecht und setzt sich dafür ein, dass mehr Chancengerechtigkeit im All herrscht.

Stevie Schmiedel: Warum brauchen wir [k]einen “Genderwahn”?
Der Feminismus ist gespalten, so Stevie Schmiedel. Das sei vor allem ein Generationenproblem, sagt die Genderforscherin und Gründerin von Pinkstinks Germany. Zwischen jungen, “radikalen” und alten, “gemäßigteren” Feminist*innen versucht sie eine Brücke zu schlagen. Wie und ob ihr das gelingt, darüber hat Marilena Berends mit Stevie Schmiedel gesprochen.
![Stevie Schmiedel: Warum brauchen wir [k]einen “Genderwahn”?](https://media.plus.rtl.de/podcast/sinneswandel-fws7tnmgprzgn.jpeg)
Saralisa Volm: Muss ich meinen Körper lieben?
Wie viel Hyaluron passt in das Gesicht einer intelligenten Frau? Wie viel Botox kann ich meiner politischen Haltung zumuten? Überall ist Körper. Überall ist Bewertung. Kein Entkommen. Was macht das mit uns [Frauen]? Darüber spricht Marilena Berends mit Schauspielerin, Filmproduzentin und Kuratorin Saralisa Volm. Im April 2023 hat sie ihr autobiographisches Buch, “Das ewige Ungenügend. Eine Bestandsaufnahme des weiblichen Körpers”, herausgebracht.

Woher kommt der Hass auf die Letzte Generation?
Die "Letzte Generation" stört nicht nur den Verkehr - manche behaupten sogar, sie habe das Potential, eine ganze Gesellschaft zu spalten. Aber wer sind die Gesichter hinter den Schlagzeilen? Was treibt diese Menschen an, so viel zu riskieren? Und ist die Letzte Generation wirklich so radikal, wie viele meinen? Um das herauszufinden, haben sich Celiné Weimar-Dittmar und Daphne Ivana Sagner ein halbes Jahr lang unter die Aktivist*innen gemischt und sie im Alltag und bei Protestaktionen begleitet. Daraus entstanden ist “HITZE”, ein sechsteiliger Storytelling-Podcast von TRZ Media und rbb, über den Marilena mit den beiden Journalistinnen in dieser Folge spricht.

Paulita Pappel: Brauchen wir ethische Pornos?
Pornos sind beliebt, aber die Vorurteile sitzen tief: Sie seien sexistisch, gewaltverherrlichend und vor allem frauenfeindlich. Auf einige trifft das sicherlich zu - aber auf alle? Kann man eine ganze Branche über den Kamm scheeren? Pornodarstellerin und -regisseurin Paulita Pappel sagt, genau hier liegt das Problem: Indem wir die gesamte Industrie in den Schatten stellen, verhindern wir eine Verbesserung. Eine Politik der Verbote führt eher zu einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und der Produkte. Aber was macht eigentlich einen “guten” Porno aus? Und passen Porno und Feminismus überhaupt zusammen?

El Hotzo: Wofür schämst du dich [nicht]?
Seine Tweets erreichen täglich Millionen Menschen. Darin geht es um Haferschleim, der im Gewand des Porridge ein Comeback feiert. Nicht selten handeln sie aber auch von Selbstzweifeln und Depressionen. Auf jeden Fall schwingt in seinen Worten oft eine Gesellschaftskritik mit, was beweist, dass Humor alles andere als belanglos sein oder auf Kosten anderer gehen muss. Die Rede ist von Sebastian Hotz - besser bekannt als El Hotzo. Mit ihm hat Marilena Berends über Selbstfindung, Selbstzweifel und seinen Debüt Roman “Mindset” gesprochen.
![El Hotzo: Wofür schämst du dich [nicht]?](https://media.plus.rtl.de/podcast/sinneswandel-fws7tnmgprzgn.jpeg)
Fikri Anıl Altıntaş: Was bedeutet Männlichkeit [für dich]?
Was bedeutet Männlichkeit? Das fragt sich Autor Fikri Anıl Altıntaş in seinem Buch, “Im Morgen wächst ein Birnbaum”. Er wächst als Sohn türkischer Eltern in einer hessischen Kleinstadt auf, zerrissen zwischen dem drängenden Wunsch, »deutsch« zu sein und seinen eigenen Weg als türkisch-muslimischer Mann zu finden. Er sehnt sich nach einem Leben jenseits von Klischees, in dem Männlichkeit und Zärtlichkeit keine Gegensätze bilden. In dem er ein türkisch-muslimisch Mann und Feminist sein kann. Für manche passt das nicht zusammen, für Anıl schon. Welchen Sinneswandel er sich wünscht, wie er heute zu seinem Vater steht und was das alles mit einem Birnbaum zutun hat, darüber hat sich Marilena Berends mit Autor Fikri Anıl Altıntaş unterhalten.
![Fikri Anıl Altıntaş: Was bedeutet Männlichkeit [für dich]?](https://media.plus.rtl.de/podcast/sinneswandel-fws7tnmgprzgn.jpeg)
Oliver Nachtwey: Das moderne Freiheitsversprechen, gescheitert? [live]
Die Freiheit ist gekränkt, so lautet die Diagnose von Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey. Die beiden der Soziolog*innen haben sich im Querdenken Milieu umgehört. Ihre Beobachtungen haben sie in einer Studie festgehalten, aus der eine Theorie entstanden ist: Der “libertäre Autoritarismus”. Um zu verstehen, was sich hinter dem Begriff verbirgt, hat sich Marilena Berends mit dem Soziologen Oliver Nachtwey und der politischen Theoretikerin Rahel Süß unterhalten.
![Oliver Nachtwey: Das moderne Freiheitsversprechen, gescheitert? [live]](https://media.plus.rtl.de/podcast/sinneswandel-fws7tnmgprzgn.jpeg)
Linus Giese: Selbstbestimmt leben, [wie] geht das?
Wer heutzutage seinen Namen- und Personenstand ändern möchte, muss dafür den Weg über das sogenannte Transsexuellengesetz (TSG) gehen. Obwohl große Teile davon für verfassungswidrig erklärt wurden, existiert es bis heute noch. Das soll sich im Sommer diesen Jahres womöglich ändern, sollte das neue Selbstbestimmungsgesetz eingeführt werden. Ein längst überfälliger Schritt, sagt trans Autor Linus Giese.
![Linus Giese: Selbstbestimmt leben, [wie] geht das?](https://media.plus.rtl.de/podcast/sinneswandel-fws7tnmgprzgn.jpeg)
Gernot Wagner: Mit Geoengineering den Klimawandel stoppen?
Was, wenn es eine Lösung gäbe, die sowohl günstig, als auch mit einfachen Mitteln die Erderwärmung weltweit stoppen könnte? Es gibt sie bereits, sagt Klimaökonom Gernot Wagner. Und sie nennt sich “Solares Geoengineering”. In seinem neuen Buch: “Und wenn wir einfach die Sonne verdunkeln?” warnt er allerdings vor einem leichtsinnigen Einsatz der Technologie. Wieso und vor allem, um besser zu verstehen, was solares Geoengineering überhaupt ist, hat sich Marilena Berends mit Gernot Wagner unterhalten.

Raphael Thelen: Letzter Ausweg “Letzte Generation”?
Raphael Thelen berichtete als Journalist unter anderem für SPIEGEL und ZEIT über die Klimakrise. Allerdings scheint er dort an Grenzen gestoßen zu sein, weshalb er kürzlich verkündete, sich der Letzten Generation anzuschließen. Keine Entscheidung, die ihm leicht gefallen sein wird, denn es ist auch eine gegen den Journalismus. Deswegen hat Marilena Berends Raphael im Sinneswandel Podcast gefragt, warum er seinen Beruf aufgibt und weshalb er sich ausgerechnet der Letzten Generation anschließt.

Teresa Bücker: Wie finden wir mehr Zeit [für einander]?
Zeit ist die zentrale Ressource unserer Gesellschaft. Aber sie steht uns längst nicht gleichermaßen zur Verfügung. Mit der Autorin und Journalistin Teresa Bücker spricht Marilena Berends über Ideen, wie eine neue Zeitkultur aussehen kann, die für mehr Gerechtigkeit, Lebensqualität und gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgt.
![Teresa Bücker: Wie finden wir mehr Zeit [für einander]?](https://media.plus.rtl.de/podcast/sinneswandel-fws7tnmgprzgn.jpeg)
MARYAM.fyi: Wieso bist du [nicht] frei?
Maryam oder auch MARYAM.fyi, wie sie sich als Künstlerin nennt, ist in Deutschland aufgewachsen. Dass sie hier in Freiheit leben kann, verdankt sie ihrem Vater, der damals aus dem Iran geflohen ist. Doch was bedeutet unsere Freiheit hier, wenn überall auf der Welt Menschen und insbesondere Frauen gewaltsam unterdrückt werden? Über diese Frage spricht Marilena mit Maryam, deren Leben sich seit der Ermordung der 22-jährige Iranerin Mahsā Amīnī radikal verändert hat. Eigentlich studiert sie Medizin und macht Musik - jetzt ist sie vor allem Aktivistin.
![MARYAM.fyi: Wieso bist du [nicht] frei?](https://media.plus.rtl.de/podcast/sinneswandel-fws7tnmgprzgn.jpeg)
Eva Biringer: Wie wurdest du [un]abhängig vom Alkohol?
Alkohol ist längst nicht mehr nur “Männersache”. Die Zahl trinkender Frauen, im Vergleich zu Männern, steigt seit 1980 immer weiter an. Und das nicht ohne Grund, sagt Autorin und Food-Journalistin Eva Biringer. Sie war selbst abhängig und schreibt in ihrem Buch “Unabhängig: Vom Trinken und Loslassen” davon, warum Alkohol ausgerechnet auf junge, emanzipierte Frauen eine so starke Anziehung ausübt. Heute ist Eva unabhängig und sagt, dass sei die beste Entscheidung ihres Lebens gewesen. Denn nüchtern sei sie nicht nur glücklicher, sondern auch eine “bessere Feministin”. Was Eva Biringer der Alkohol damals gegeben und wie sie sich von ihm gelöst hat, darüber spricht sie mit Marilena Berends.
![Eva Biringer: Wie wurdest du [un]abhängig vom Alkohol?](https://media.plus.rtl.de/podcast/sinneswandel-fws7tnmgprzgn.jpeg)
Sebastian Vettel: Wo siehst du deine Zukunft?
Motorsport und Nachhaltigkeit - passt das zusammen? Diese Frage hat sich auch Rennfahrer Sebastian Vettel zunehmend gestellt. Bis 2030 will die Formel 1 klimaneutral sein. Zu diesem Zeitpunkt wird Vettel bereits ausgestiegen sein. Denn am 20. November 2022 fährt er sein vorerst letztes Rennen. Weshalb er seine Karriere in der Formel 1 beendet und wo er seine Zukunft sieht, darüber hat sich Marilena Berends mit dem viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel unterhalten.

Cesy Leonard: Warum bist du [so] radikal?
Immer mehr Menschen in Deutschland fühlen sich ohnmächtig, angesichts der Vielzahl von Krisen. Was hilft daher, um aus diesem Ohnmachtsgefühl herauszukommen? Selbstwirksamkeit, sagt Aktionskünstlerin Cesy Leonard. Sie hat die “Radikalen Töchter” gegründet, mit denen sie Workshops gibt, in denen der “Mutmuskel” trainiert wird. Denn den braucht es, so Cesy, um (politisch) aktiv zu werden und ins Handeln zu kommen. Wie genau das geht, darüber spricht Cesy Leonard mit Marilena Berends im Sinneswandel Podcast.
![Cesy Leonard: Warum bist du [so] radikal?](https://media.plus.rtl.de/podcast/sinneswandel-fws7tnmgprzgn.jpeg)
Pheline Roggan: [Wie] geht Grünes Drehen?
Film ist Unterhaltung. Aber nicht nur. Jeder Film(-dreh) verbraucht CO2-Emissionen. In der Produktion und natürlich auch beim Streamen. Und zwar nicht gerade wenig. Wenn die Filmindustrie zukunftsfähig werden will, muss sie sich also wandeln. Und das tut sie bereits! Wo und wie genau, darüber habe ich mit Schauspielerin und Changemakers.Film-Gründerin Pheline Roggan (Jerks) gesprochen.
![Pheline Roggan: [Wie] geht Grünes Drehen?](https://media.plus.rtl.de/podcast/sinneswandel-fws7tnmgprzgn.jpeg)
Markus Gabriel: [Why] are we animals? [live]
"What is to be human?", this question Kant already asked himself hundreds of years ago. And exactly this question, the philosopher Markus Gabriel raises again in his new book, “Der Mensch als Tier” (“The Human animal - Why we still do not fit into nature”). Because it is on this question, or rather its answer, that our life depends on. Why, the author explains in this podcast episode, which was recorded on the 26th of October 2022 during a live event at THE NEW INSTITUTE in Hamburg.
![Markus Gabriel: [Why] are we animals? [live]](https://media.plus.rtl.de/podcast/sinneswandel-fws7tnmgprzgn.jpeg)
Das «Ewige Eis» schmilzt - Sinnbild des Wandels?
Seit Beginn der Industrialisierung haben Gebirgsgletscher mehr als die Hälfte ihrer Fläche und ein Drittel ihres Eisvolumens verloren. Das klingt nicht nur alarmierend, sondern sollte es auch sein, wenn man bedenkt, dass Gebirgsgletscher als eine Art “globales Fieberthermometer” gelten. Das “Ewigen Eis”, es schmilzt. Immer schneller - bis es irgendwann ganz verschwunden ist? Mit Fotograf Olaf Otto Becker hat sich Marilena Berends über die Schönheit und Zerbrechlichkeit der schwindenden Eismassen unterhalten. Das Gespräch ist Teil des “Art’nVielfalt’-Podcast des Museum Sinclair-Haus und der Stiftung Kunst und Natur.

Wieso brennen immer mehr Musiker*innen aus?
Endlich wieder live Konzerte - wer hat sich darauf nicht gefreut, nach gut zwei Jahren Corona bedingter Abstinenz?! Doch aller Euphorie zum Trotz, sagen immer mehr Musiker*innen weltweit - Haftbefehl, Shawn Mendes, Arlo Parks, Robbie Williams, Justin Bieber, Sam Fender - ihre Konzerte und ganze Tourneen ab. Auch Malte Huck von Beachpeople und Rapper Ahzumjot kennen den Druck der Branche. Im Podcast erzählen sie offen und ehrlich über ihre Liebe zur Musik, über Einsamkeit, Wut, Hoffnung und Verletzbarkeit.

Victoria Reichelt: Wie politisch ist Social Media?
Social Media kann Zeitvertreib sein, aber eben nicht nur. Es ist auch ein Ort des Austauschs, der Information und sogar des Protests, wie sich gerade erneut zeigt. Wie können die sozialen Medien zu einem Ort werden, der uns dient und nicht überfordert oder gar schadet? Über diese und weitere Fragen haben sich Journalistin Victoria Reichelt und Marilena Berends unterhalten.

Sinnkrise: Wer bin ich, ohne meinen Job?
“Tu, was du liebst und du musst nie wieder arbeiten” oder “Erschaffe dir ein Leben, von dem du keinen Urlaub mehr brauchst”, Zitate wie diese lassen sich reihenweise finden. Ob als Inspiration in Sozialen Netzwerken oder zur Motivation und Orientierung in Selbsthilferatgebern - es gilt (s)einen Sinn im Job zu finden und sich in ihm selbst zu verwirklichen. Work-Life-Balance war gestern - vielmehr sollen sie verschmelzen, die Grenzen zwischen Leben und Arbeit. Sich vereinen, vom Beruf zur Berufung werden, die alles in sich vereint: Geld und Passion. Doch was passiert, wenn der Job zum einzigen Lebensinhalt wird? Und bis zu welchem Grad ist die Identifikation mit dem Beruf überhaupt gesund?

Wie solidarisch sind wir wirklich?
Die Forderung nach Solidarität hat seit Jahren Hochkonjunktur. Sie ist zu einem Schlüsselbegriff, zum Leitwort gegenwärtiger Krisen geworden: Ob im Zuge der Pandemie, des Klimawandels oder des Angriffskriegs auf die Ukraine. Und zweifelsohne ist Solidarität in bewegten Zeiten wie diesen elementar. Zeitgleich zeigen sich auch ihre Begrenzungen. In ihrem Kommentar stellt Gastautorin Isabell Leverenz den Solidaritätsbegriff auf die Probe und kommt zu dem Ergebnis: Solidarität braucht einen Beat, den wir gemeinsam ausgestalten und komponieren müssen.

Balbina: [Warum] sollten wir Spotify canceln?
Etwa 0,003 Euro erhalten Musiker*innen auf Spotify pro Stream. Bei einer Million macht das rund 3.000 Euro. Klar, das ist nicht nichts, aber macht es das schon fair? Streaming hat unsere Welt und wie wir Musik hören, ja sogar wie sie produziert wird, verändert. Nicht nur zum Guten, meint Musikerin Balbina. Sie ist eine Stimme der Bewegung, die sich u.a. für eine faire Vergütung von Künstler*innen und mehr Transparenz in Sachen Streaming einsetzt. Wie das gelingen kann, darüber hat Marilena Berends mit Balbina im Sinneswandel Podcast gesprochen.
![Balbina: [Warum] sollten wir Spotify canceln?](https://media.plus.rtl.de/podcast/sinneswandel-fws7tnmgprzgn.jpeg)
Machen Tinder und Co. [die Liebe] kaputt?
Jede dritte Person in Deutschland sucht heute online nach dem nächsten Date. Einige mehr, andere weniger “erfolgreich”. Aber wovon ist das abhängig, was suchen Menschen auf Dating-Apps wie Tinder? Und wie gleichberechtigt sind wir in der Partnersuche? In dieser Episode geht Marilena dem (Online)-Dating auf die Spur, wie es unser Sein und Tun beeinflusst (hat) und wo mögliche Chancen und Risiken liegen. Zu Wort kommen zudem drei Autorinnen: Ann-Kristin Tlusty, Pia Kabitzsch und Anne-Kathrin Gerstlauer.
![Machen Tinder und Co. [die Liebe] kaputt?](https://media.plus.rtl.de/podcast/sinneswandel-fws7tnmgprzgn.jpeg)
"Oben ohne" für alle - längst überfällig?
“Free the Nipple”, “Gleiche Brust für alle”, “oben Ohne Demos” - immer wieder wird darauf hingewiesen - meist von weiblich gelesenen und queeren Personen - dass Brust nicht gleich Brust ist. Dass die Brüste weiblich gelesener Personen seit jeher und noch immer objektifiziert und sexualisiert werden. Die weibliche Brust, sie ist eigentlich nur dann sichtbar, wenn sie dazu dient, etwas zu verkaufen oder in der Welt des Pornos. In der Öffentlichkeit, ob auf der Straße oder im Netz, stellt sie meist nur ein verpixeltes Phantom dar. Hier lautet Verhüllung die Devise! Zum Schutz versteht sich - aber vor was oder wem eigentlich? Und wieso ist das scheinbar Aufgabe der Frau?

Antonis Schwarz: Ist Erben (un)gerecht?
Während eine gängige Redewendung lautet, “Über Geld spricht man nicht, man hat es”, wird genau das heute getan. Und zwar mit Antonis Schwarz, den Marilena in München besucht hat, um zu erfahren, was der Millionenerbe mit der Initiative “tax me now” zu bewegen hofft. Denn eines ist klar: Die soziale Schere und Vermögensungleichheit wird immer größer: Allein in Deutschland besitzen die reichsten 10 Prozent mehr als die Hälfte aller Vermögen. Und das bedeutet auch Macht. Macht, die Welt massiv zu beeinflussen - ist das (noch) demokratisch?

Behaarte Frauen, eine Provokation?
Behaarte Frauen, wo sind sie? Überall nur haarlose Frauenkörper – auf der Straße, in Filmen oder Werbebotschaften. Glatte Haut wird vorausgesetzt und eine Alternative scheint es nicht zu geben. Enthaaren sich Frauen nicht, wird ihnen oftmals ihre “Weiblichkeit” abgesprochen. Aber warum rufen Haare eigentlich je nach Geschlecht unterschiedliche Reaktionen von Anziehung bis Ekel hervor? Warum können wir nicht die Vielfalt von Körperhaarfrisuren zelebrieren, egal ob Wildwuchs, Stoppeln oder Haarlosigkeit? Um das herauszufinden, hat sich Marilena mit Anna C. Paul, Herausgeberin von Super(hairy)woman*, über das Infragestellen von Schönheitsidealen unterhalten und gemeinsam einen Blick in die Kulturgeschichte der Enthaarung geworfen.

Wandelmut: Wie wollen wir in Zukunft zusammenleben?
Wie sehen nachhaltige Alternativen zum konventionellen Bauen und Zusammenleben aus? Um das herauszufinden, haben Architekt Leopold Banchini und Künstler Lukas Feireiss Lloyd Kahn, einen Pionier des nachhaltigen Bauens, in seinem selbstgebauten Haus in Kalifornien besucht. Die daraus entstandene Installation verbindet Kahns Gedanken mit der Gegenwart und wirft die Frage auf, wie Architektur und nachhaltige Lebensweisen zusammengedacht werden können. Wie kann das gelingen? Um Antworten auf diese Frage zu erhalten, hat sich Marilena mit Lukas Feireiss unterhalten. Der Podcast ist der zweite Teil der 3-teiligen Podcastreihe “Wandelmut”, die im Auftrag des Museum Sinclair-Haus entstanden ist.
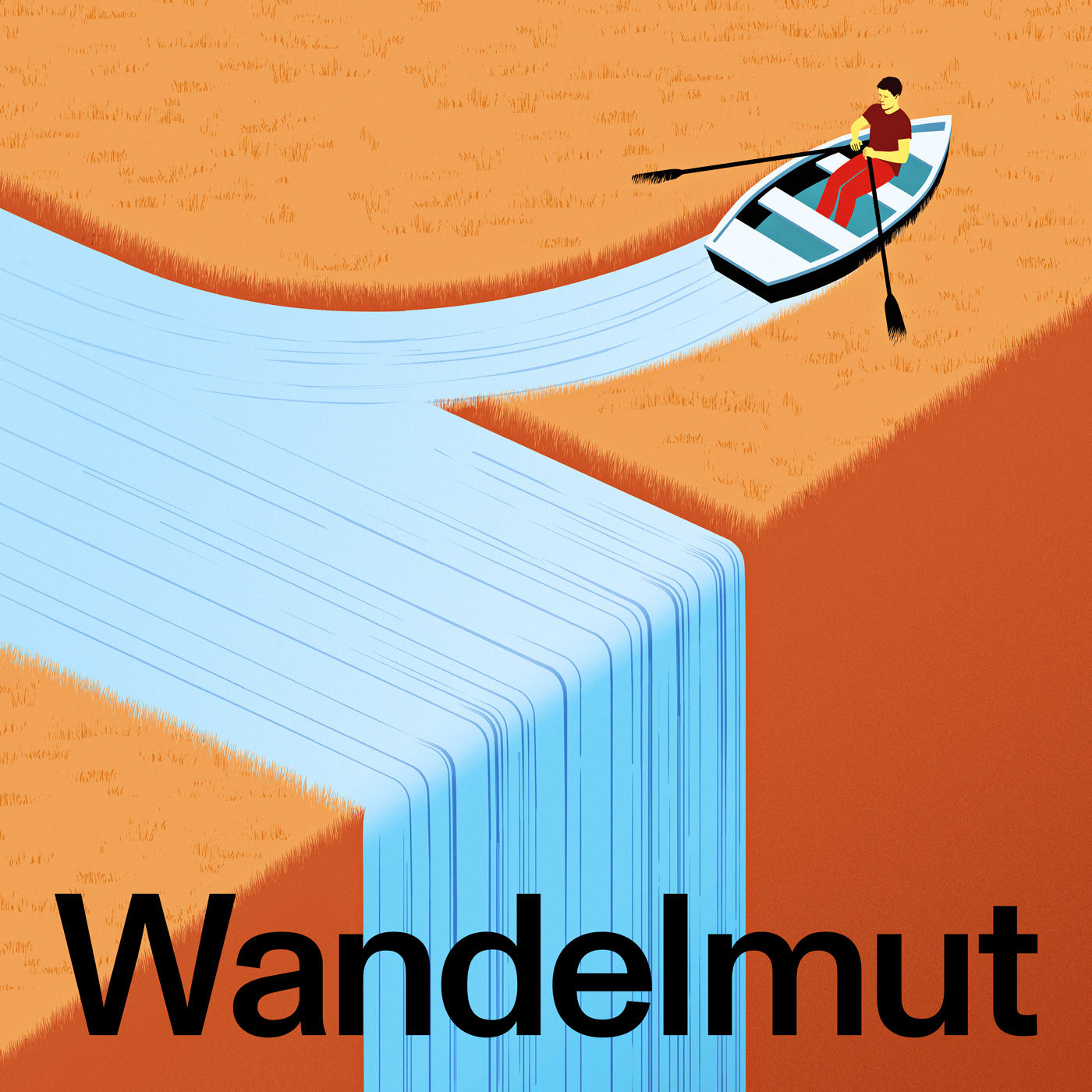
Christian Uhle: (Lebens-)Sinn, eine Beziehungssache?
Sinn ist also eine Beziehungssache. Er ist nicht in uns versteckt, liegt nicht irgendwo außerhalb in der Welt verborgen, sondern mitten drin - in den Zwischenräumen. Aber gerade die übersehen wir schnell mal. In der Hektik des Alltags, im Streben, Stratzen und Straucheln, unter all den Anforderungen, die das Leben an uns stellt. Welchen Sinneswandel bedarf es, damit wir heute (wieder) Sinn empfinden können? Mit dieser Frage befasst sich der zweite Teil des Gesprächs mit Philosoph Christian Uhle.

Christian Uhle: Wie finden wir (unseren) Sinn?
Wozu das alles? Wie entsteht eigentlich Sinn? Ist er in uns versteckt, außerhalb von uns, in der Welt - oder wohlmöglich dazwischen? In einer Zeit, in der vielen Menschen der Sinn (im Leben) abhanden zu kommen scheint, erlangt auch die Philosophie plötzlich mehr Aufmerksamkeit. Aber kann sie Antworten auf die Frage nach dem Sinn liefern? Wirft sie nicht eher noch mehr Fragen auf? Um das herauszufinden, hat sich Marilena Berends mit Philosoph Christian Uhle auf eine philosophische Reise zum Sinn des Lebens begeben. Dies ist der erste Teil der Reise.

Zukunftsfähiges Feiern, geht das?
Allein an einem einzigen Wochenende verbraucht ein kleiner Berliner Club so viel Strom wie ein Single-Haushalt in einem ganzen Jahr. Auch beim Feiern entstehen Co2-Emissionen - die lassen sich nicht einfach Wegtanzen. Wie kann daher zukunftsfähiges Feiern aussehen, das nicht die planetaren Grenzen sprengt, ohne, dass dabei der Spaßfaktor flöten geht? Ganz einfach, indem wir Feiern, als gäbe es ein Morgen! Der Überzeugung ist jedenfalls Konstanze Meyer, Projektleiterin von Clubtopia - eine Initiative für “grüne Clubkultur”, die sich für einen nachhaltigen Wandel der Clubsszene einsetzt. Denn die hat auch einen Impact und vor allem kreatives Potential - um Impulse für ein Umdenken in der Veranstaltungsbranche, aber auch darüber hinaus, zu setzen.

Laut gedacht: Unterschätzen wir die Freundschaft?
“Die Freundschaft gehört zum Notwendigsten in unserem Leben. Denn ohne Freunde möchte niemand leben, auch wenn er die übrigen Güter alle zusammen besäße.”, schreibt Aristoteles in seiner Nikomachischen Ethik. Für den Philosoph ist sie die „Urzelle des Politischen“, weil sie überhaupt erst Zusammenleben schafft. Aber was macht gute Freundschaft eigentlich aus? Was unterscheidet sie von romantischen Beziehungen? Und wie verändert sich unser Verständnis von Freundschaft in Zeiten von Social Media und Co.? Um dem Wesen der Freundschaft auf die Spur zu kommen, hat sich Marilena zwei bereits bekannte Gäste in den Podcast eingeladen: Die Journalistin Luisa Thomé und den Autor Fikri Anıl Altıntaş.

Toxische Positivität - ist zu viel Optimismus schädlich?
“Kopf hoch! Einfach positiv denken!” Wer hat diesen oft gut gemeinten Rat nicht schon einmal gehört? Ja, es stimmt, manchmal hilft es, nicht zu verzagen. Aber manchmal eben auch nicht. Weil wir längst nicht alles in den Händen haben, auch, wenn uns das diverse Selbsthilfe Ratgeber suggerieren. Glück sei zum modernen Fetisch geworden, so die These der Politologin und Autorin Juliane Marie Schreiber. In ihrem Buch “Ich möchte lieber nicht”, schreibt sie von der “Rebellion gegen den Terror des Positiven”. Denn der nerve, belaste und schwäche den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Weil wir Glück als Prestige betrachten und eigentlich politische Probleme als persönliches Versagen verstehen. Eine fatale Entwicklung, gegen die nur Rebellion hilft. Denn die Welt wurde nicht von den Glücklichen verändert, sondern von den Unzufriedenen.

Je digitaler die Welt, desto analoger die Träume?
Florian Kaps, der von allen nur Doc genannt wird, liebt das scheinbar Unmögliche. Deshalb hat er 2008 nicht nur sein gesamtes Vermögen riskiert und damit die letzte Polaroid-Fabrik vor dem Aussterben gerettet, sondern auch das „Supersense“ eröffnet. Eine Manufaktur, die analoge Technologien vor dem Verschwinden bewahrt. Denn Doc ist fest davon überzeugt, dass Analoges auch in einer digitalen Gesellschaft seinen Nutzen hat - vielleicht sogar mehr denn je. Wieso und, was es mit der Sehnsucht nach dem vermeintlich “Echten” auf sich hat, darüber hat sich Marilena in Wien mit Florian Kaps unterhalten.

Yasmine M'Barek: Brauchen wir radikale Kompromisse?
Mehr und mehr kennzeichnet radikale Kompromisslosigkeit die Diskurse in Politik und Gesellschaft, die das Vorankommen in wichtigen Themen, wie Coronapolitik, Klimawandel oder Rassismus verhindert. Die Fronten sind klar: Ihr oder wir. Wie lässt sich ein Ausweg aus diesem Dilemma finden? Durch “radikale Kompromisse”, lautet die Antwort von Journalistin Yasmine M'Barek. Aber gibt es nicht Umstände, die radikalere Maßnahmen erfordern - dauert Realpolitik nicht einfach zu lange? Und was unterscheidet gute von faulen Kompromissen? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, hat Marilena sich Yasmine M'Barek in den Podcast eingeladen.

Workism - warum arbeiten wir (heute) so viel?
Beschäftigt zu sein, sei zu einem modernen Narrativ geworden, meint Hans Rusinek. Der kreative Kapitalismus mache Arbeit zu einer neuen Ersatzreligion – und wir machen mit - so Hans These, der seit einigen Jahren zu Sinnfragen in einer sich wandelnden Wirtschafts- und Arbeitswelt forscht und publiziert. Warum arbeiten wir heute noch immer so viel? Welchen Stellenwert hat Lohnarbeit in unserer Gesellschaft? Muss Arbeit Sinn machen? Das sind nur einige der Fragen, über die ich gemeinsam mit Hans Rusinek in dieser Episode gesprochen habe.

Laut gedacht: Was trauen wir Männern zu?
Gesundheitsvorsorge - aber als Porno getarnt - denn “Aufklärung muss dort stattfinden, wo sie die Menschen erreicht”, um es mit den Worten der Techniker Krankenkasse auszudrücken. Die hat kürzlich im Rahmen einer Hodenkrebsvorsorge-Kampagne ein Video veröffentlicht, das im Netz nun für reichlich Aufruhr sorgt. Was daran genau problematisch ist, diskutiert Marilena Berends in dieser Episode gemeinsam mit Journalistin Luisa Thomé und Autor Fikri Anıl Altıntaş. Denn das Video bietet definitiv Anlass, um über Geschlechterrollen, Männlichkeitskonstruktionen und Sexismus zu sprechen.

Fridtjof Detzner: Nachhaltig Investieren, geht das?
Kann Geld die Welt retten? Oder ist es nicht gerade das liebe Geld und die Gier nach mehr, die unseren Planeten, zerstören? Eines ist klar: Geld bedeutet Macht. Dass es selten Gutes bedeutet, wenn viel davon in wenigen Händen liegt, zeigen Menschen wie Zuckerberg, Bezos und Co. Aber was, wenn Geld dazu eingesetzt würde, Nachhaltigkeit und Gemeinwohl zu fördern? In der heutigen Episode spricht Marilena mit Fridtjof Detzner über “nachhaltiges Investment. Er hat “Planet A” gegründet - ein Impact Investment Fonds, der als Risikokapitalgeber in Ideen und junge Unternehmen investiert, die eine klimapositive Wirtschaft voranbringen wollen.

Veganes Mett - warum imitieren wir Fleisch?
Immer mehr Menschen entscheiden sich auf Fleisch zu verzichten und vegetarisch oder sogar vegan zu leben. Aus ökologischer Sicht ist das mehr als sinnvoll - aber auch ökonomisch betrachtet, erweist sich der “Veggie-Boom” als ergiebig. Immer mehr Produkte erobern den Markt, die Steak und Fischstäbchen zu imitieren versuchen - darunter auch “blutende” Burger-Patties. Die kommen auf Konsumentenseite bislang gut an, werfen aber die Frage auf: Warum muss Fleischersatz eigentlich wie das Original schmecken, riechen und aussehen - wozu imitieren wir überhaupt Fleisch?

Dominik Erhard: Wozu spielen wir eigentlich?
Wir alle tun es, haben es seit jeher getan. Als Kinder, wie als Erwachsene - selbst Tiere tun es: wir alle spielen. Aber wozu eigentlich? Nicht nur, um uns die Zeit zu vertreiben, wenn es nach dem Kulturhistoriker Johan Huizinga geht. Spielen ist Weltzugang. Und doch gilt das “Daddeln” nicht selten als sinnloser Zeitvertreib. Außer, wer aus dem Spiel Kapital schlägt, ob als Fußballprofi, Schachmeister*in oder Online-Gamer*in. Aber ist das dann überhaupt noch ein Spiel? Zeichnet das Spiel nicht gerade seine Absichtslosigkeit aus? In der Hoffnung, eine Antwort auf diese Fragen zu erhalten, hat sich Marilena mit Dominik Erhard, Redakteur beim Philosophie Magazin, getroffen.

kæte mayor: (W/H)ANDELN
Ich habe lange überlegt, mit welchen Worten ich Sinneswandel in diesem Jahr verabschieden möchte. Am Ende sind es nicht mal meine Eigenen geworden - aber irgendwie auch doch. Denn gibt es etwas Schöneres, als sich in den Gedanken eines anderen wiederzufinden? In ihrem Gedicht bewegt sie sich kæte mayor von “friedlicher Zerrissenheit”, Umkehrschlüssen, Wagnissen auf der Reise durchs “kosmische Chaos”, das sich Leben nennt. Ein stetiges “(W/H)ANDELN”.

I’ll be your mirror
Spiegelneuronen - ohne die Nervenzellen in unseren Gehirnen wären wir vielleicht nicht in der Lage, uns in andere hineinzuversetzen. Reflexion, sich spiegeln - im Außen, wie im Innen. Dafür braucht es Substanz - etwas, auf dem sich Projizieren lässt, sonst sehen wir nicht. Wie ein Diaprojektor, den man in die Leere richtet. Nichts. Betrachten wir Kunst, werden wir einerseits mit uns selbst konfrontiert, wie auch mit der Künstlerin - eine Synthese zweier Blicke. Inspiriert durch den Besuch der Ausstellung “Klasse Gesellschaft” in der Hamburger Kunsthalle mit den Künstlern Lars Eidinger und Stefan Marx, ist dieser kurze Impuls entstanden.

Florian Illies: (Braucht es mehr) Liebe in Zeiten des Hasses?
Es sei nicht möglich, eindeutige Lehrsätze aus der Vergangenheit für die Gegenwart zu ziehen, aber jede Generation solle versuchen Fragen an die Geschichte zu stellen - weil das Überraschende sei, so Florian Illies, dass die Geschichte uns dann ganz neue Antworten gebe. In seinem neuen Buch “Liebe in Zeiten des Hasses” erkundet der Autor und Kunsthistoriker die “Goldenen Zwanziger” anhand ihrer Beziehungskonstellationen. Denn die Liebe, so Illies, eröffne uns neue Perspektiven auf die Zeit. Was wir aus der Geschichte und durch die Gefühlseindrücke der Protagonisten aus der Berliner und Pariser Boheme lernen können, darüber hat Marilena Berends mit dem Autor selbst gesprochen.

Samira El Ouassil: Können Geschichten die Welt verändern?
Eine Geschichte kann die Welt retten, ebenso, wie sie zerstören. Eine Geschichte kann Wahlen entscheiden, Kriege auslösen, aber auch Menschen miteinander verbinden. Das behaupten zumindest Samira El Ouassil und Friedemann Karig. Die zwei Autor*innen haben ein Buch geschrieben: „Erzählende Affen“. Es handelt von Mythen, Lügen, Utopien - eben Geschichten, die unser Leben bestimmen. Früher, als wir noch um das Lagerfeuer herum saßen und unsere Erlebnisse teilten, wie auch heute, wenn wir twittern oder Zeitung lesen. Der Mensch sei nun mal ein “homo narrans”, so lautet Samiras und Friedemanns These. Mit ihrem neuen Buch wollen sie aufzeigen, welche kollektiven Erzählungen uns heute gefährden und weshalb es an der Zeit ist für neue Narrative.

Tatjana Schnell: (Lebens-)Sinn - etwas Kollektives?
Es scheint ganz so, als genüge es uns Menschen nicht, einfach nur zu Existieren. Wir brauchen einen Grund weshalb wir uns morgens aufraffen - die Freude am Sein allein, sie mag Mönche und Buddhisten beglücken - den postmodernen Menschen berauscht sie längst nicht mehr. Kein Wunder, möchte man sagen! Sind die Büchereien doch gefüllt mit Ratgeberliteratur, deren Titel uns aufmunternd zurufen: “Finde dich selbst!” Sie ist zum Greifen nah, die Erfüllung, wir müssen nur die Hand ausstrecken und zugreifen. So zumindest lautet das Glücksversprechen des modernen Kapitalismus. Aber ist das wirklich so? Existiert so etwas, wie ein individueller Lebenssinn, eine Art Berufung, die es zu Suchen und Finden gilt? Oder entsteht Bedeutung nicht vielmehr im Kollektiv(en)? Um das herauszufinden, habe ich mich mit Psychologin und Sinnforscherin Prof. Dr. Tatjana Schnell unterhalten.

Helmut Milz: Ist uns die Sinnlichkeit abhanden gekommen?
Seit jeher existiert in den Geisteswissenschaften ein reger Diskurs über die Frage nach der menschlichen Existenz und was sie ausmacht. Beseelter Leib? Beleibte Seele? Auch Mediziner und Publizist Helmut Milz unternimmt in seinem Buch „Der eigen-sinnige Mensch“ eine Reise durch die Sinnwelten unseres menschlichen Seins, die uns vom Leib über Körperbilder, bis zum “Quantified Self” der Postmoderne führt. Um einer Vergeistigung und gleichzeitigen Entsinnlichung der Welt entgegenzuwirken, plädiert Helmut Milz für eine Förderung “sinnlicher Intelligenz”. Nicht nur des eigenen Wohlbefindens wegen, sondern auch, weil ohne diese Fähigkeit kein gesellschaftlicher Sinnes-wandel möglich sei. Was das genau bedeutet, darum soll es in dieser Episode gehen.

Michael Brüggemann: Wie neutral kann Journalismus wirklich sein?
Bereits in der letzten Episode haben wir über den sogenannten “Transformativen Journalismus” gesprochen. Also Journalismus, der neben der Problembeschreibung auch Lösungsansätze präsentiert und versucht, Akteure die eine nachhaltige Transformation begünstigen, durch Sichtbarkeit zu stärken. Da wir das Thema für sehr spannend halten und euch die Möglichkeit geben wollen etwas mehr in die Tiefe zu gehen, präsentieren wir euch heute das Gespräch mit dem Kommunikationswissenschaftler Michael Brüggemann in ganzer Länge. Thema ist nicht nur, wie der Klimawandel bisher in der Medienlandschaft repräsentiert wird, sondern auch, welcher Umgang in Medien mit Klimaskeptikern und -leugnern sinnvoll ist.

“Klimajournalismus” - ist das schon Aktivismus?
Ist der Begriff “Klimawandel” zu schwach? Sollten Journalist*innen lieber Begriffe, wie “Klimakrise” oder “Klimanotstand” verwenden - oder ist das vielleicht sogar eher kontraproduktiv? Immer häufiger wird über die Frage diskutiert, wie neutral oder objektiv Journalist*innen und Medienschaffende in der Berichterstattung von Klimafakten sein sollten. Darf man sich wirklich unter keinen Umständen mit einer Sache gemein machen, auch nicht mit einer Guten? In dieser Episode betrachten wir unterschiedliche Perspektiven auf den “Transformativen Journalismus” - u.a. mit Kommunikationsforscher Prof. Michael Brüggemann.

Kennt Google uns besser, als wir selbst?
Laufen wir im Sand, hinterlassen wir Fußabdrücke. Gleiches gilt für die digitale Welt. Nur sind wir uns, anders als im analogen Leben, selten darüber bewusst, welche Spuren wir hier hinterlassen. Geschweige denn, wer unsere digitalen Fußabdrücke zurückverfolgen kann und welche Rückschlüsse daraus gezogen werden können. Erleben wir vielleicht heute schon einen digitalen Kontrollverlust? Die Künstler*innengruppe Laokoon hat sich auf eine digitale Spurensuche begeben und anhand eines interaktiven Datenexperiments eindrucksvoll veranschaulicht, wie weitreichend die Einblicke in unser Seelenleben und unsere intimsten Geheimnisse sind, die wir Google, Facebook und Co. jeden Tag gewähren. Gemeinsam mit Moritz Riesewieck von der Laokoon Gruppe hat sich Marilena Berends in dieser Episode die Frage gestellt, ob das Internet wohl mehr über uns weiß, als wir selbst.

Ciani-Sophia Hoeder: Mit Wut zur Veränderung?
Die Wut ist wohl eine der grundlegendsten, menschlichen Emotionen - doch wird sie selten als positives Gefühl angesehen, als vielmehr für ihren manchmal destruktiven Charakter verschmäht. Das gilt ganz besonders für wütende Frauen: als hysterisch, zu emotional oder gar inkompetent werden sie häufig bezeichnet. Wut ist untrennbar mit Macht verknüpft und ihre Unterdrückung daher keineswegs belanglos oder zufällig, schreibt die Autorin und Journalistin Ciani-Sophia Hoeder in ihrem Buch “Wut und Böse”. Mehr “Wut zur Veränderung”, lautet ihr Plädoyer. Welche transformative Kraft in der Emotion steckt und, wie sie zum positiven Katalysator der Veränderung werden kann, darum soll es in dieser Episode gehen.

Laut gedacht: Wieviel Idealismus ist realistisch?
Wir alle haben Ideale oder zumindest eine Idee davon, wie die Welt aussehen sollte. Eine Welt ohne eine Ideale, ist schwer vorstellbar, prägen sie doch ganz entscheidend die Wirklichkeit - zumindest, wenn es nach den Idealisten geht. Doch inwieweit lassen sich Ideen verwirklichen? Oder noch ein Schritt zurück: Wieviel Raum ist überhaupt vorhanden, um Ideen zu entwickeln? Braucht es dazu nicht zumindest Zeit und Muße? Zwingt uns der Kapitalismus gar zum Realismus? Als Sinneswandel Redaktion, haben wir uns unter anderem diese Fragen gestellt und gemeinsam laut darüber nachgedacht. Zu diesem Gedankenexperiment möchten wir, Ariane, Katharina, Edu und ich, euch heute einladen.

Künstliche Intelligenz - Fluch oder Segen?
“Künstliche Intelligenz” - ein Begriff, der den meisten von uns schon mal begegnet sein dürfte. Obwohl wir ihnen nicht in persona begegnen, durchwalten sie unseren Alltag - ob hinter Social Media Plattformen oder Dating Apps. Was das aber genau ist, KI, scheint vielen von uns gar nicht so bewusst zu sein. Dazu kommt, dass bildgewaltige, meist dystopische Filme von bösen Maschinen erzählen, die drohen die Menschheit auszulöschen. Ist das der Grund, weshalb wir Künstlicher Intelligenz tendenziell eher skeptisch gegenüberstehen? Kulturwissenschaftler Edu Alcaraz hat sich in seinem Essay aus philosophischer Perspektive heraus mit KI befasst und, inwiefern sie ein Thema ist oder viel mehr sein sollte, das uns alle betrifft und nicht bloß Informatiker*innen.

Carla Reemtsma: Ist die Klimabewegung zu elitär?
Carla Reemtsma, Pressesprecherin von Fridays For Future Deutschland, spricht nicht von Klimaschutz, sondern von “Klimagerechtigkeit” - also der Vereinbarkeit einer ökologischen und sozialen Transformation - die den Aktivist*innen besonders am Herzen liegt. Doch interessanterweise wird Carla und ihren Mitstreiter*innen von Fridays For Future immer wieder zum Vorwurf gemacht, die Bewegung selbst sei eine “Rebellion der Privilegierten”. Wie viel steckt tatsäch an dem Vorwurf, es handle sich bei den Klimaaktivist*innen vor allem um weiße Akademiker*innen-Kinder? Und, kann Netzaktivismus vielleicht dabei helfen, den Protest zugänglicher zu machen?

Rente und Rebellion - (wie) passt das zusammen?
Wer ist eigentlich Schuld am Klimawandel? Die älteren Generationen, weil sie, obwohl der Club of Rome bereits 1972 die “Grenzen des Wachstums” prophezeite, nicht handelten? Oder sind es nicht gerade die Großeltern, die noch wussten, was Maß und Mitte bedeutet? Ganz im Gegensatz zu den jüngst geborenen Generationen, die in einer Welt des Überflusses aufwachsen. Wie nachhaltig und sinnvoll ist die Suche nach einem Sündenbock? Geht es nicht vielmehr darum, gemeinsam Lösungen zu finden? Für eine Welt, die aus den Fugen geraten ist, deren Kipppunkte schon bald drohen überschritten zu werden - ist da nicht vielmehr sofortiges, generationsübergreifendes Handeln gefragt?

Jakob Blasel: Sind Politik und Aktivismus (un)vereinbar?
Die jungen Menschen, nicht selten werden sie als “politikverdrossen” bezeichnet - aber stimmt das? Sind es nicht gerade die nachkommenden Generationen, die immer wieder an Politiker*innen appellieren, wenn es um die Einhaltung der Pariser Klimaziele geht? Einer dieser jungen Menschen ist Jakob Blasel. Bereits mit 17 begann seine aktivistische Laufbahn, innerhalb weniger Jahre ist er zu einem der Gesichter von Fridays For Future Deutschland geworden. Heute, drei Jahre später, zieht er von der Straße in den Bundestag. Wir haben mit Jakob darüber gesprochen, wie es zu dieser Entscheidung kam. Stehen Aktivismus und Politik im Konflikt miteinander oder könnten sie gar eine Synthese bilden?

Carola Rackete: Wie radikal darf ziviler Ungehorsam sein?
Sie wisse, was sie riskiere und sei bereit für ihre Entscheidungen ins Gefängnis zu gehen, so Aktivistin Carola Rackete, die als Kapitänin der Sea-Watch 3 mit 53 libyschen Geflüchteten im Juni 2019, entgegen den Anweisungen des italienischen Innenministeriums, im Hafen von Lampedusa anlegte. Für die meisten wirkt ihr Verhalten mutig und tapfer, gar lebensmüde. Auch, wenn Racketes Geschichte durch die mediale Präsenz große Bekanntheit erfuhr, so ist sie bei weitem nicht die einzige Aktivistin, die sich gegen das Gesetze auflehnt und damit viel aufs Spiel setzt. Doch sind es Mut und Selbstlosigkeit allein, die Aktivist*innen wie Carola Rackete so weit gehen lassen?

Eva von Redecker: (Wie) Kann Aktivismus die Welt bewegen?
Als Sinneswandel Redaktion wollen wir in den kommenden Wochen unterschiedliche Aktivist*innen vorstellen, die den Status quo nicht hinnehmen, sondern sich für systemische Veränderung stark machen. Zudem möchten wir uns näher damit auseinandersetzen, was genau Aktivismus eigentlich ist, wie sich Protest abgrenzt, aber auch, wo die Trennlinien womöglich verschwimmen. Den Auftakt beginnen wir mit Philosophin Eva von Redecker und Aktivistin Franziska Heinisch, deren kürzlich erschienene Bücher sich dem zivilen Ungehorsam widmen. Beide Frauen verbindet der Glaube daran, dass nur durch ein aktives Aufbegehren Wandel gelingen kann. Denn eine freie Gesellschaft, eine Demokratie existiert nicht einfach, sie muss gelebt werden - und zwar von uns allen.

Marina Weisband: Brauchen wir eine (digitale) Bildungsrevolution?
Was muss Schule leisten, um junge Menschen auf das Leben vorzubereiten? Was ist die Aufgabe von Bildung? Darüber hat sich Marilena Berends mit Psychologin und Netzaktivistin Marina Weisband unterhalten. Denn gerade die Corona-Pandemie hat den Innovationsdruck in der Bildung verdeutlicht. Neue Konzepte sind gefragt, um kommende Generationen auf die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft vorzubereiten. Es bedarf Schulen, die Leidenschaft und Engagement bei jungen Menschen entfachen, um die notwendigen Veränderungen mitzugestalten.

Irritation - wieso brauchen wir Dissens?
Social Bubbles, von denen so oft die Rede ist, es gibt sie bei weitem nicht nur im World Wide Web. Auch im analogen Raum existieren sie. Oder anders gesagt, die Vielfältigkeit und damit auch die Andersartigkeit - zumindest das, was wir als das von uns Andere empfinden - ist uns nicht immer zugänglich. Suchen wir uns doch bewusst, wie unbewusst das aus, was zu uns passt. Ob Freunde, Hobbies, Jobs - gleich und gleich gesellt sich gern. Nur der öffentliche Raum, das, was gemeinhin als Gesellschaft bezeichnet wird, lässt uns erahnen, dass es da noch etwas Anderes gibt. Diese Öffentlichkeit scheint nun mit den Öffnungen von Cafes, Restaurants und Theatern zurückzukehren. In ihrem Essay erzählt die Gastautorin Katharina Walser von ihren Eindrücken seit der Wiedereröffnung vieler Orte, die in Zeiten der Pandemie ihre Türen schließen mussten und wieso sich die Rückkehr, trotz Irritation und Verunsicherung, lohnt.

Eckart v. Hirschhausen: Macht uns der Klimawandel krank?
Spätestens seit der Corona-Pandemie wissen wir, dass unsere Gesundheit nicht nur unbezahlbar, sondern auch bedroht ist. Aber nicht nur Viren, auch die Klimakrise gefährdet unsere Gesundheit. Allein in Deutschland starben nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts in den Rekordhitze-Sommern 2003, 2006 und 2015 rund 20.000 Menschen an den Folgen der Hitze. Wollen wir die Klimakrise noch rechtzeitig abwenden oder zumindest das Schlimmste verhindern, dann müssen wir auch das Gesundheitswesen anpacken. Wie das genau gelingen kann, darüber hat sich Journalistin Marilena Berends mit Umweltmedizinerin Claudia Traidl-Hoffmann sowie Arzt und Kabarettist Eckart von Hirschhausen unterhalten.

Mithu Sanyal: Ist Identität konstruiert?
Mithu Sanyals Roman „Identitti“ diskutiert nahezu alles, was wir derzeit tagtäglich verhandeln: Rassismus in Deutschland, Identitätspolitik und die Fragen, wer worüber sprechen darf, was bestimmt, wer wir sind, und wie das alles unsere Gesellschaft und unsere persönlichen Beziehungen beeinflusst. In unserem Gespräch erzählt die Autorin und Kulturwissenschaftlerin von dem Fall Rachel Dolezal, der sie zu ihrem Roman inspiriert hat, und wir diskutieren u.a. darüber, ob, wenn Menschen sich als transgender identifizieren, es auch “transrace” geben kann und sollte.

Im Gespräch mit Robert Franken über Privilegien und Gender Equality
In diesem Interview habe ich mit Robert Franken gesprochen. Robert bezeichnet sich selbst mehr als "Digitaler Potenzialentfalter", als dass er sich als Berater sieht. Außerdem ist er Feminist und setzt sich dafür ein, dass Frauen nicht weiter in Rollen und zur Anpassung gedrängt werden.

Wozu (ein) Sinneswandel?
Der Wandel, so könnte man sagen, ist das verbindende Glied der Fragmente, die sich zu unserem Leben zusammensetzen. Ein dynamischer Prozess, den wir selbst mitgestalten – bewusst wie unbewusst. Der Podcast ist ein Versuch und zugleich ein Wunsch, dazu anzuregen, sich für neue Perspektiven zu öffnen. Der ermutigt, den Status-Quo zu hinterfragen und sich selbst als aktive Zukunftskünstler:in zu begreifen.