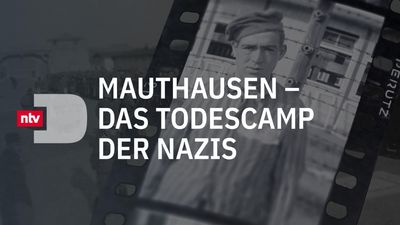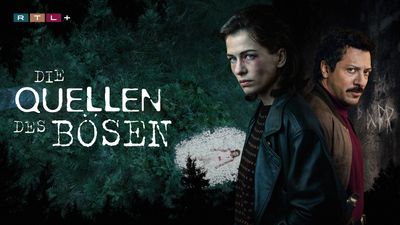Im History-Podcast "Wunder. Wissen. Weltkrieg" geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg. In jeder Folge spricht Raphaela Höfner mit ehemaligen Soldaten, mit US-Veteranen, mit Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs und des Nationalsozialismus. Im Fokus stehen die Schicksale, die man in keinem Geschichtsbuch findet. In den Gesprächen geht Raphaela Höfner den Fragen nach wie: Wie sah das Überleben im Konzentrationslager Auschwitz aus? Was haben Menschen auf der Flucht oder an der Kriegsfront erlebt? Wie gelang es ihnen nach dem Krieg, ein neues Leben aufzubauen? Hier hört ihr aus erster Hand all die Erlebnisse, die Schrecken und Wunder, die die Interviewgäste selbst erlebt haben. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden.
Alle Folgen
#062 Die Flucht
Brigitte Durner wird im April 1929 als einzige Tochter ihrer Eltern geboren. Die Mutter stamm von einem Gut in Westpreußen, der Vater kommt aus Thüringen. Brigittes Vater hat bereits im Ersten Weltkrieg mit Auszeichnung gekämpft, aber 1929 während der Weltwirtschaftskrise sein gesamtes Vermögen verloren. Brigitte wächst in Kamenz, in Sachsen, auf einem Rittergut auf, das die Familie landwirtschaftlich betreibt. Ein stattliches Gutshaus mit schönem Gelände und mit drei großen Karpfenteichen auf der Grünfläche. Ihr Bruder stirbt direkt nach der Geburt, weshalb Brigitte Einzelkind bleibt. Als die Pacht des Betriebes abgelaufen ist, geben die Eltern das Gut auf. Nach einem kurzen Umweg über Berlin, zieht die Familie nach Meißen, da der Vater dorthin versetzt wird. Im Herbst 1939 wird der Vater nach Budweis in die damalige Tschechoslowakei versetzt. Dort gibt es mehrere Staatgüter, dessen Verwaltung ihm übertragen wird. Das damalige Gebiet Böhmen und Mähren ist seit 15. März 1939 deutsches Protektorat. Nach dem Attentat auf Heydrich spitzt sich die Situation zu. Die Deutschen begehen Vergeltungsmaßnahmen und führen über 1000 Hinrichtungen durch. Brigittes Vater ist geschockt und mokiert das Benehmen der Deutschen. So könnt ihr nicht mit Menschen umgehen! Brigitte kommt zum Bund Deutscher Mädel und nimmt bei der Spierschar teil. Sie singt und spielt gerne. Die Mutter betrachtet die neue Leidenschaft der Tochter mit Argwohn. Als die Ostfront 1945 näherrückt, hören die Durners von den großen Flüchtlingsströmen aus dem Osten. Nach der Bombennacht über Dresden, die die Familie von der Entfernung miterlebt, will die Mutter nur eines: Weg von hier! Kurz bevor die Flucht losgehen soll, erkrankt Brigitte schwer an schwarzen Pocken. Nach Wochen kann sie erst wieder genesen. Der Vater bereitet alles für die Flucht vor, spannt die Pferde vor den Wagen und packt nur das Nötigste ein. Ihr Ziel: Haidl, ein kleiner Ort im Böhmerwald, in der Nähe von Böhmisch Eisenstein, eine Grenzstadt. Tieffliegerangriffe donnern auf den Flüchtlingstreck herab. Die Amerikaner beschießen den Ort mit Artillerie. Die Dunners wollen weiterziehen, doch amerikanische Soldaten versperren ihnen den Weg und sperren sie in einer Scheune ein. Angst kommt auf, dass sie in die Hände der Russen fallen und reden in gebrochenem Schulenglisch auf die GIs ein. Glücklicherweise lassen sich die Soldaten mit Alkohol bestechen, sodass sie die Grenze passieren dürfen. Die nächsten Jahre lebt die Familie sehr bescheiden in Bayrisch Eisenstein. Brigitte geht ins 1,5 Stunden entfernte Regensburg zur Schule. Dort wird sie als Flüchtlingskind gehänselt. Später findet Brigitte in Oberbayern eine neue Heimat. Die Erinnerungen an den krieg, die Flucht und die Nachkriegszeit werden sie bis an ihr Lebensende begleiten. Interviewpartnerin in dieser Folge: Brigitte Durner Buchtipp: Fort, nicht wie fort (Rosenheimer Verlagshaus) Beginn des Interviews ab: 8 Minuten, 30 Sekunden History Wissen: Bayrisch Eisenstein ab 1 Stunde, 7 Minuten

#061 Stalingrad - Massengrab an der Wolga
Am 2. Februar 1943 kapitulieren in den Trümmern von Stalingrad die Reste der 6. Armee der Wehrmacht. 110.000 von ehemals 260.000 Soldaten gehen in Gefangenschaft. Zehntausende bleiben auf dem Schlachtfeld. Die NS-Propaganda stilisiert ihren Tod zum "Heldenepos". Doch Hitlers Soldaten sterben sinnlos und elendig – durch Hunger, Kälte, Seuchen und die Waffen eines überlegenen Gegners. Die Soldaten waren ausgezehrt, dem Hungertod nahe, bei minus 30 Grad durchgefroren, fast ohne Munition und Lebensmittel, denn der Nachschub aus der Luft bliebt ein leeres Versprechen des großmäuligen Reichsmarschalls Hermann Göring. Er hatte den größenwahnsinnigen Diktator und Oberbefehlshaber der Wehrmacht, Adolf Hitler, bestärkt, der 6. Armee den Ausbruch aus dem Kessel in Stalingrad zu verbieten. Die Rote Armee hatte die deutschen, spanischen und rumänischen Truppen mit der Operation Uranus Ende November 1942 eingekesselt. Generalfeldmarschall Friedrich Paulus, Befehlshaber der 6. Armee, begab sich Ende Januar 1943 in Stalingrad mit seinem Stab in Gefangenschaft. Knapp 100.000 deutsche Soldaten marschierten im Schneesturm im Februar 1943 ins Ungewisse, nur 6000 kehrten in den 1950er-Jahren nach Deutschland zurück. Heute geht es um die Schlacht von Stalingrad Buchtipp in dieser Folge: Vermißt in Stalingrad von Dieter Peeters, Zeitgut Verlag

#060 Erinnerungen einer vergessenen Generation
In der heutigen Folge spreche ich mit Ludwig Steinherr. Ludwig wurde am 22.07.1932 in Dingenbrunn im Bayerischen Wald geboren und wächst nach einigen Umzügen in Ebrach in der Nähe von Schweinfurt auf. Er erinnert sich an zahlreiche Erlebnisse in der Kidnheit, wie an seine Schulzeit, Erlebnisse des Vaters aus dem Einsatz in Polen sowie Fliegerangriffe. Ganz lebendig schildert er die Ankunft der Amerikaner. Ein Erlebnis ist Ludwig ganz besonders in Erinnerung geblieben: Beim Spielen im Steinbruch entgeht er mit seinem Freund dem Angriff eines Tieffliegers. Ludwig wohnt seit vielen Jahren in München. Beginn des Interviews ab:4 Minuten 37 Sekunden History Wissen: ab 1 Stunde 49 Minuten Die deutschen Kugellagerfabriken in Schweinfurt Interviewpartner in dieser Folge: Ludwig Steinherr Folgt @wunder.wissen.weltkrieg oder @raphaelahoefnerautorin auf Instagram Schreibt gerne an: autorin@raphaela-hoefner.de

#059 Bombennächte
In der heutigen Folge spreche ich mit Ulrike Meier. Ulrike wurde im November 1935 in Hagen in Nordrhein Westfalen geboren. Hagen liegt im Ruhrgebiet, sodass dort ein großes Industriegebiet war, weshalb später zahlreiche Bombenangriffe stattfanden. Ulrike wächst behütet auf. Die Mutter ist Hausfrau, der Vater arbeitet bei der Deutschen Reichsbahn. Als die Angriffe auf deutsche Städte stärker werden, beschließt die Mutter, ihre Heimat zu verlassen und ins sichere Mecklenburg-Vorpommern zu gehen und bei einer Familie unterzukommen. Dort verbringt Ulrike eine schöne Zeit und erlebt viele glückliche Stunden. Die Mutter leidet jedoch unter so großem Heimweh, dass sie einen Fehler begeht. Sie packt ihre beiden Kinder ein und reist wieder zurück nach Hagen. Dort erlebt die Familie zahlreiche Bombenangriffe. Ulrike erlebt in den stickigen Kellern was Todesangst bedeutet. Die Mutter ist zu diesem Zeitpunkt mit dem Baby beschäftigt, sodass Ulrike selbst klarkommen muss. Sie erinnert sich, dass sie bei einer Bombardierung die kleine Schwester im Kinderwagen bis zu einem Luftschutzbunker schieben wollte. Gerade noch rechtzeitig konnte eine Nachbarin die beiden Kinder retten. Das Trauma aus dieser Zeit sitzt auch heute noch tief und hat sich ins Gedächtnis von Ulrike gegraben. Beginn des Interviews ab:5 Minuten History Wissen ab:1 Stunde, 43 Minuten Die Stadt Hagen im Ruhrgebiet Interviewpartnerin in dieser Folge: Ulrike Meier Kontakt: autorin@raphaela-hoefner.de Instagram: raphaelahoefnerautorin oder wunder.wissen.weltkrieg.

#058 Schule in der Diktatur
Die wichtigste Aufgabe der Schule bestand darin, den Kindern die Rassenideologie der Nationalsozialisten schon möglichst früh zu vermitteln. So sah Hitler in der Schule nur eine Vorstufe für die Wehrmacht. Schule sollte nicht in erster Linie Bildung vermitteln und Kinder zu mündigen, kritischen und selbstständigen Menschen erziehen, sondern sie zu willenlosen Anhängern des Nationalsozialismus machen. Das sollte so früh wie möglich beginnen. Schon die Vorschulerziehung wollte die Kinder vom Nationalsozialismus überzeugen. Dennoch sahen die Nationalsozialisten die Schule für die Herausbildung ihres Nachwuchses als nicht ganz so wichtig an wie die Hitlerjugend. Ganz zu vernachlässigen war sie aber auch nicht. Heute geht es um das Schulwesen im "Dritten Reich."

#057 Der letzte Sommer
Mein heutiger Gast ist Frau Annemarie Naujok. Frau Naujok wurde am 09. April 1934, ein Jahr nachdem Hitler an der Macht war, in Mönchengladbach geboren. Mit ihren Eltern wohnte sie damals in Reydt, eine Stadt in der rheinischen Tiefebene. Der Himmel wölbt sich dort weit und hoch über das flache Land. Weiden und Äcker wechseln sich ab, werden von Baumkronen und Entwässerungsgräben unterbrochen. Spitze Kirchtürme ragen in den Himmel. Man kennt diese Landschaft von alten holländischen Gemälden. Reydt ist auch die Geburtsstadt von Joseph Goebbels, dem damaligen Propagandaminister, der Hitler bis zuletzt die Treue hielt. Im 2. Weltkrieg erlebte Gladbach den allerersten Luftangriff in Deutschland. Die eigene Industrie und das nahe Ruhrgebiet waren ein Grund dafür, aber auch die geografische Lage im äußersten Nordwesten Deutschlands. Die Städte waren für die englischen Piloten schnell zu erreichen. 1937 zog Annemarie Naujok mit ihren Eltern nach Berlin. Ihr Vater arbeitete dort für die Deutsche Reichsbahn. Sie wohnten dort in Lichtenberg, im Osten der Stadt. Bei unserem Interview hat sie mir erzählt, wie sie die Bombennächte als Kind miterlebt hat. Beginn des Interviews ab: 7 Minuten History Wissen: ab 1 Stunde 59 Minuten Der Vorzeichen vor Kriegsausbruch 1939 Interviewpartnerin in dieser Folge: Frau Annemarie Naujok

#056 Jugend in Gefangenschaft
Wolfgang Enzenauer wurde am 10. Juli 1926 in Essen geboren und ist jetzt 98 Jahre alt. Wolfgang wuchs zunächst unbeschwert in Essen auf, erinnert sich aber an den schrecklichen Autounfall im Jahr 1935, bei dem seine Großmutter verstarb und seine Eltern schwer verletzt wurden. Er selbst kam wie durch ein Wunder ohne große Verletzungen davon. Herbert besucht die Schule und erinnert sich an den Tag, als seine ganze Klasse am 15. Februar 1943 morgens in die Aula kommandiert wurde. Dort wurde den Jungen, fast alle 16 Jahre alt, mitgeteilt, dass ab sofort kein Schulunterricht stattfinden würde und sie als Luftwaffenhelfer in den Flakbatterien der Stadt in der Fliegerabwehr eingesetzt werden würden. Am 05. März 1943 bricht das große Unglück auf die Stadt Essen herein. Etwa 1000 Bomben fallen in der Nacht, zerstören Häusern, setzten alles in Brand und hinterlassen ein Niemandsland. Herbert beobachtet das Inferno von seinem Geschützstand aus. Die Ungewissheit, ob das Elternhaus getroffen ist und die Familien noch leben, treibt die Burschen fast in den Wahnsinn. Am nächsten Morgen machen sich die Jungen auf, um nach ihren Familien zu suchen. Dabei durchquert Herbert die Trümmerlandschaft. Die Freude ist von kurzer Dauer: Die Eltern leben, doch das Haus eines guten Freundes hat einen Volltreffer bekommen. Er und seine Eltern sterben in den Trümmern. Herberts Eltern erhalten das Angebot von Verwandten, nach Mössingen in Tübingen zu ziehen. Die Schlüters verfügten über einen eigenen Bunker in 17 Meter Tiefe. Herberts Vater schreibt einen Brief an den Batteriechef, mit der Bitte, seinen Sohn zu versetzen und somit wird Herbert entlassen, geht wieder zur Schule und ist plötzlich wieder Zivilist. Am 10. März 1944 verstirbt Herberts Vater. Wenige Wochen später flattert die Einberufung zur Wehrmacht in den Briefkasten der Enzenauers. Es herrschen Trübsal, Trauer, Unmut und vor allem Sorge. Herbert fährt in eine Kaserne in der Nähe von Karslruhe. Er meldet sich mit einigen anderen Kameraden freiwillig zur Reserve Offiziers Anwärter Ausbildung und entgeht somit der Ostfront und damit dem sicheren Tod. Dort dient er dem Hauptfeldwebel als Putzer und erhält somit einige Privilegien. Im Dezember 1944 rückt die Front von Western immer näher und näher. Herbert soll mit Kameraden die vollgelaufenen Bunker des Westwalls leerpumpen. Unter allen Umständen möchte er nach Mössingen zurück. Auf einem Feld verkriecht sich Herbert in einen Heuschober und verbringt dort die Nacht. In der Früh wird er von einem lauten Knall geweckt. Ein feindlicher Panzer hat einen Warnschuss abgefeuert um alle aus der Scheune zu treiben. Die Eroberer, Soldaten aus Französisch Marokkko, nehmen alle gefangen. Zu Fuß wird Herbert mit all den anderen Kriegsgefangenen bis nach Straßburg getrieben. In Kohlewaggons geht es ins Herzen Frankreichs bis in die Stadt Tulle / Correze. Hier müssen sie zu einem Kriegsgefangenlager laufen. Dort erlebt Herbert, was Hunger bedeutet. Läuse plagen ihn, Heimweh bringt ihn fast um den Verstand. Doch das Glück bleibt auf seiner Seite: Er meldet sich für den Arbeitsdient in der Landwirtschaft und gelangt wenig später als Arbeiter auf den Bauernhof der Familie Viratelle in Südfrankreich. Dort bekommt er zu essen und wird durch und durch menschlich und gut behandelt. Auf dem Hof lernt Herbert die Holzarbeiten im Wald, das Pflügen mit langsamen Ochsen, das Beladen von Heuwagen, die Getreideernte, Tabak pflanzen und das Nüsse sammeln. Mittlerweile spricht er fließend fanzöisch. Drei Jahre später wird Herbert endlich entlassen und kehrt nach Essen zurück. Das Wiedersehen mit der Mutter ist tränenreich. Nach Kriegsende hält Herbert weiterhin Kontakt zur Familie Viratelle aus Frankreich und besucht diese viele Male. Eines ist all die Jahre aber auf der Strecke geblieben: Seine Jugend. Beginn des Interviews: Ab 10 Minuten 45 Sekunden History Wissen: Das Kriegsende und die Kriegsgefangenschaft in Frankreich ab 1 Stunde, 21 Minuten

#055 Der Krieg im Pazifik
In der heutigen Folge spreche ich mit Louis Giarusso. Louis wurde am 11. Mai 1923 in Lawrence in Massachusetts von seinen aus Italien stammenden Eltern Silvestro und Antonia geboren. Er wuchs zusammen mit seinem älteren Bruder Anthony und seinem jüngeren Bruder Michele während der großen Depression auf. Als Lous 9 Jahre alt war, zog die Familie nach Rhode Island um. Nach Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg, also nach dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbor, wurde er gedraftet. Er stieß zur 77 Infantery Division und erlebte die schweren Kämpfe bei Leyte auf den Phillipinen und Okinawa in Japan mit. Nach Kriegsende blieb er noch drei Monate mit der US Occupation Force in Japan stationiert. Nachdem er nach Hause zurückkehrte, studierte er im Johnson und Wales College und machte dort 1948 seinen Abschluss. Bei General Electrics machte er Karriere und ging als Business Systems Analyst in Rente. Louis spielte aktiv Schach und nahm als ältester Teilnehmer bei Schachtournieren teil. Leider verstarb er am 09. September 2024 im hohen Alter von 101 Jahren. Interviewpartner in dieser Folge: Louis Giarusso Beginn des Interviews ab: 5 Minuten 28 Sekunden History Wissen ab: 41 Minuten Die Schlacht um Okinawa in Japan Abonniere den Kanal Wunder. Wissen. Weltkrieg. auf WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaPNh04KbYMTiKNhpJ47 Instagram: @wunder.wissen.weltkrieg. Autorin@raphaela-hoefner.de

#054 Blutrache
Ingrid Gräfin von Hardenberg wurde im April 1932 in Freiwaldau geboren. Heute heißt die Stadt Jeseník, und gehört mit ihren rund 11.000 Einwohnern zur Tschechischen Republik. Nach dem Münchner Abkommen, also ein Jahr nach Ingrids Geburt, wurde die Stadt zusammen mit dem Sudetenland in das Deutsche Reich eingegliedert, mit dem es bis 1945 verbunden blieb. Ingrid wächst zusammen mit ihrer älteren Schwester auf. Die Menschen in Freiwaldau leben im Einklang mit der Natur. Vom Krieg ist hier noch wenig zu spüren. Erst als Ingrids Vater eingezogen wird, ändert sich das Familienleben. Die Mutter muss nun plötzlich allein für inzwischen vier Kinder sorgen. Die Rote Armee rückt näher und näher. Ingrid erlebt den Einmarsch der Russen mit, bekommt fürchterliche Szenen hautnah mit und möchte nur eines: Überleben. Der Vater kehrt nie aus Russland heim. Bis heute weiß die Familie nichts über sein Schicksal. Ingrids Familie lebt unter russischer Besatzung und erlebt die Rache und den Zorn der tschechischen Bevölkerung mit. Bis heute kann sie weder vergessen noch verzeihen. Zu schlimm sind die Verbrechen der einstigen Nachbarn, Mitbewohner und Bekannten. Gemeinsam mit ihrer Mutter und den Geschwistern wird sie als „Deutsche“ für Vogelfrei erklärt. Mir nur wenig Gepäck müssen sie Haus und Hof sowie die geliebte Heimat verlassen. Als Flüchtlinge kommen sie in Deutschland an und sind dort genauso wenig erwünscht wie einst in Freiwaldau. Ingrid braucht lange Zeit um ihr Herz für eine neue Heimat zu öffnen. Die alte wird sie aber nie vergessen. Bis heute plagen sie hin und wieder Alpträume aus dieser Zeit. Beginn des Interviews ab 6 Minuten 30 Sekunden History Wissen ab 1 Stunde 12 Minuten Das Blutgericht von Landskron Abonniere den Kanal Wunder. Wissen. Weltkrieg. auf WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaPNh04KbYMTiKNhpJ47 Instagram: @wunder.wissen.weltkrieg. Autorin@raphaela-hoefner.de

#053 Die vergessenen Welten
In dieser Folge spreche ich mit dem Journalisten, Historiker und Buchautorin Gisbert Strodrees. Nordrhein Westfalen ist heute die Heimat der größten jüdischen Gemeinschaft in Deutschland und zählt etwa 27.000 Menschen. In Köln gibt es die älteste jüdische Gemeinschaft. Über jüdisches Leben in Großstädten, vor allem zur Zeit nach der Machtübernahme Hitlers sowie während des Zweiten Weltkriegs ist recht viel bekannt. Ein Kapitel, über das man weniger weiß, ist wie Jüdinnen und Juden auf dem Land gelebt haben. Die Forschung blickt gerne auf die Großstädte wie Berlin, Düsseldorf, Köln aber auch München. Mein Interviewgast ist selbst auf dem Land aufgewachsen und ist Redakteuer für das Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben. Er hat jüdisch-deutsche Geschichten in Wetfalen über Jahre recherchiert und daraufhin ist sein Buch: Jüdisches Landleben-Vergessene Welten in Nordrhein Westfalen entstanden. Die Illustrationen aus seinem Buch stammen aus Archiven in ganz Deutschland, den USA und sogar aus Israel. Etliche Fotografien werden in dem Band zum ersten Mal veröffentlicht. Heute ist Gisbert Strodrees mein Gast und ich spreche mit ihm vor allem über Schicksale und Lebenswege: Von jüdischen Landwirten, Viehhändlern, Tierärzten, ländlichen Kaufleuten und sogar von der Geschichte einer jüdischen Familie, die auf dem Land von Bauern versteckt wurde. Beginn des Interviews ab: 8 Minuten History Wissen ab: 1 Stunde 2 Minuten Marga Spiegel Buchtipp in dieser Folge: "Jüdisches Landleben-Vergessene Welten in Nordrhein-Westfalen" von Gisbert Strotdrees "Retter in der Nacht: Wie eine jüdische Familie in einem münsterländischen Versteck überlebte" von Marga Spiegel Fimtipp: "Unter Bauern-Retter in der Nacht" Abonniere den Kanal Wunder. Wissen. Weltkrieg. auf WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaPNh04KbYMTiKNhpJ47 Instagram: @wunder.wissen.weltkrieg. Autorin@raphaela-hoefner.de

#052 Die Schlacht im Hürtgenwald
Larry Howe wurde im März 1925 in Massachusetts geboren und diente während des Zweiten Weltkriegs in der US-Armee. Er meldete sich im Juli 1943 zum Dienst und absolvierte eine Grundausbildung in Fort Bragg in North Carolina. Er wurde im Dezember 1943 nach Europa verschifft und landete am Strand in der Normandie, um der Vierten Division beizutreten. Er diente als Funker für eine Gruppe von Stürmerbeobachtern. Nachdem er sich am 25. Juni 1944 die Halbinsel Cherbourg gesichert hatte, reiste er nach Paris, Frankreich, und betrat die Stadt am 25. August 1944, eine der ersten Personen, die dies taten. Von Paris folgte seine Division den Deutschen zur Siegfried-Linie nach Deutschland. Vom 7. November bis 11. Dezember 1944 war er Teil der Schlacht im Hurtgen-Wald, wo er sich eine Beinverletzung zuzog. Am 29. März 1945 überquerte er den Rhein und überquerte später am 25. April die Donau, nachdem seine Division am weitesten nach Deutschland eingedrungen war. Im Mai 1945 wurde er in die Staaten zurückgeschickt und nach einem 35-tägigen Urlaub an Fort Devons zurückgeschickt. Mr. Howe war noch in Fort Devons, als der Tag des Sieges über Japan am 15. August 1945 angekündigt wurde, aber kurz darauf entlassen wurde. Er verbrachte das zivile Leben für den Boston Herald-Traveler. Leider ist Harry im April dieses Jahres mit 99 Jahren verstorben. Das macht seine Geschichte nur umso wertvoller. Interviewpartner in dieser Folge: Larry Howe Beginn des Interviews: 8 Minuten History Wissen: 47 Minuten Die Schlacht im Hürtgen Wald Abonniere den Kanal Wunder. Wissen. Weltkrieg. auf WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaPNh04KbYMTiKNhpJ47 Instagram: @wunder.wissen.weltkrieg. Autorin@raphaela-hoefner.de

#051 Die Gestapo
Die Gestapo (kurz für Geheime Staatspolizei) war die berüchtigte politische Polizei des NS-Regimes. Während der Dauer der NS-Zeit erweiterte und veränderte sich die Gestapo als Institution. Die von der Gestapo ins Visier genommenen Gruppen wechselten je nach Politik und Prioritäten des Regimes. Eines blieb jedoch immer gleich: Die Gestapo war stets ein brutales Werkzeug zur Durchsetzung der radikalsten Aspekte der NS-Politik.7 Die Gestapo war für ihre Brutalität berüchtigt. Die Einrichtung und ihre Mitglieder gelten bis heute als Synonym für autoritäre Überwachung. Die Gestapo hatte ihren brutalen Ruf nicht ohne Grund. Ihre Mitglieder setzten bei Verhören Folter und Gewalt ein. Die Gestapo koordinierte ferner die Judentransporte in die Todeslager. Darüber hinaus unterdrückte sie gewaltsam die Widerstandsbewegung in Deutschland und in dem von Deutschland besetzten Europa. Heute geht es um die Gestapo. Abonniere den Kanal Wunder. Wissen. Weltkrieg. auf WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaPNh04KbYMTiKNhpJ47 E-Mail: autorin@raphaela-hoefner.de Die Stimmen der Zeitzeugin und des Zeitzeugen: Zeitzeugen- Portal

#050 Verlassen in der Normandie
Horst Dübsch wurde am 30.12.1926 im Spreewald geboren. Er wächst dort auf dem elterlichen Hof auf und arbeitet als Junge bereits auf dem Hof mit. Mit seinem Vater geht er gerne die Felder und Äcker ab, um dort Schätzungen zu machen. Diese Gabe, die von klein auf gefördert wird, rettet Horst später das Leben. Sein älterer Bruder wird eingezogen und 1944 ist auch er selbst an der Reihe. Beim „Reichsarbeitsdienst“ kommen Männer der SS vorbei, sie brauchen Nachschub und suchen bei den 16-Jährigen nach Freiwilligen. Nachdem sich keiner den jungen Burschen meldet, werden diese zu einer Unterschrift gezwungen. Horst wird in seiner Ausbildung an der FLAK ausgebildet. Hier kann er sein grandioses Augenmaß unter Beweis stellen. Er kann die Entfernungen der Flugzeuge und deren Bewegung ganz genau einschätzen. Schließlich wird seine Truppe an die Normandieküste abkommandiert. Nur wenige Wochen nach Beginn der Invasion. Horst gerät unter Beschuss und bleibt hinter feindlichen Linien zurück. Am nächsten Morgen ist seine Einheit spurlos verschwunden. Horst gerät in amerikanische Gefangenschaft und gelangt er nach Kriegsende zurück auf den Hof im Spreewald. Dort sind zu dieser Zeit die Russen „eingefallen“. Ende der 50er Jahre flieht er aus der DDR und beginnt, sich sein ganz eigenes und unabhängiges Leben aufzubauen. Beginn des Interviews: Beginn ab 6 Minuten History Wissen: Beginn ab 2 Stunden, 6 Minuten Die FLAK Interviewpartner in dieser Folge: Horst Dübsch

#049 Der letzte Zug
Brigitta Matheja-Thiele wird 1938 in der Nähe von Breslau geboren und wächst bei ihren Großeltern auf dem Land auf. Ihre Kindheit ist glücklich und unbeschwert. Die Mutter ist berufstätig, der Vater als Soldat eingezogen. Ende 1944 wird ihre kleine Schwester geboren. Brigittas Leben ändert sich schlagartig, als die Rote Armee näherrückt und nun auch die Front fast vor der Haustür ist. Ihnen bleibt nur eines. Fliehen um jeden Preis. Brigittas Mutter packt einen einzigen Koffer, in dem nur das Nötigste eingepackt werden kann. Dann begibt sie sich mit ihren beiden Töchtern an den Bahnhof. Mehr als zwei Tage harrt Brigitta dort aus und wartet auf einen der letzten Züge, die die Zivilisten aus der Stadt bringen sollen. Als Verwundete ausgeladen werden, merkt Brigitta mit einem Schlag, was Krieg wirklich bedeutet. Ihre Mutter schafft es, für sich und die beiden Töchter einen der heißumkämpften Plätze zu ergattern. Der Zug rollt Richtung Westen. Eine eigene Stadt, in der Kinder geboren werden, aber auch Menschen sterben. Sie erreichen Bayern und kommen dort als „Flüchtlinge“ auf einem Bauernhof unter. Dort werden sie auch wieder mit dem Vater und den Großeltern vereint. Nach ihrer Schulzeit zieht die Familie nach München, wo Brigitta heute noch lebt. Hört jetzt rein in das Interview, damit ihr Brigittas Erzählungen aus erster Hand erfahren könnt. Interviewpartnerin in dieser Folge: Brigitta Matheja-Thiele Beginn des Interviews ab 8 Minuten History Wissen:ab 1 Stunde Die Flucht und Vertreibung aus den "Ostländern"

#048 Der längste Tag
Der D-Day bezeichnet den 6. Juni 1944. Den Tag, an dem alliierte Truppen (USA, Großbritannien, Kanada, Frankreich) 1944 an den Stränden der Normandie landeten und eine zweite Front gegen das Dritte Reich im Westen eröffneten. Der D-Day ist Teil der Operation Overlord, die den Feldzug der alliierten Armee in Nordfrankreich bis zur Befreiung von Paris am 25. August 1944 beschreibt. Filmtipp in dieser Folge: Der Soldat James Ryan Der längste Tag Folge dem Kanal auf Instagram: Wunder.Wissen.Weltkrieg sowie dem WhatsApp Kanal: Wunder.Wissen.Weltkrieg. https://whatsapp.com/channel/0029VaPNh04KbYMTiKNhpJ47 E-Mail: Autorin@raphaela-hoefner.de

#047 Vier ungelebte Leben
Reinhold Beckmann wurde 1956 in Twistringen geboren. Seine Fernsehkarriere beginnt er beim WDR. Nach einem Ausflug zu den privaten Sendern mit ran und ranissimo moderiert er in der ARD zwei Jahrzehnte lang die Bundesliga-Sportschau und diskutiert in seiner eigenen Talksendung "Beckmann" politische und gesellschaftliche Themen. Heute ist er als Produzent und Filmemacher aktiv und mit seiner Band unterwegs. Mit seiner Initiative NestWerk e.V. setzt er sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche ein. Reinholds Mutter Aenne wird am 01. August 1921 in Wellingholzhausen geboren. Ihr Leben ist früh von Verlusten gezeichnet. Ihre Mutter stirbt, als Aenne noch ein Baby ist. Vier Brüder hatte sie, alle im Krieg gefallen. Anders als viele ihrer Generation hat Aenne über diese Zeit nie geschwiegen. Ihre Brüder und Eltern blieben immer gegenwärtig, in Gesprächen, Fotos und Erinnerungen. Im Interview erzählt Reinhold Beckmann die Geschichte von Aenne, Franz, Hans, Alfons und Willi, zwischen hartem Alltag auf dem Dorf, katholischer Tradition und beginnender Diktatur. Und davon, was der Krieg mit Menschen macht. wenn keiner zurückkehrt. Beginn des Interviews ab 13 Minuten History Wissen ab 1 Stunde Die Rolle der Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus Inteviewpartner in dieser Folge: Reinhold Beckmann Buchtipp in dieser Folge: "Aenne und ihre Brüder" von Reinhold Beckmann Folge dem Kanal auf Instagram: Wunder.Wissen.Weltkrieg sowie dem WhatsApp Kanal: Wunder.Wissen.Weltkrieg. https://whatsapp.com/channel/0029VaPNh04KbYMTiKNhpJ47 E-Mail: Autorin@raphaela-hoefner.de

#046 Der Sohn des Generals
Wolfgang Deckert wurde im November 1940 in Meissen geboren. Er ist das jüngste von drei Kindern. Der Vater ist der General Hans Joachim Deckert. Großvater Max Hildebrand hat eine riesige Fabrik in Freiberg, die Familie wird später enteignet. Wolfgang flieht mit seiner Mutter zu seinen Großeltern, die auf dem Fabrikgelände einen eigenen Bunker haben. Dort erlebt er die Ankunft der Russen. Sein Vater soll zu diesem Zeitpunkt die heiß umkämpfte Stadt Breslau halten. Siegen um jeden Preis, siegen, obwohl schon alles verloren ist. Als General weiß er, wie es wirklich aussieht und schickt seiner Familie wichtige Informationen zu. Wolfgang wird von seinen Geschwistern getrennt und gelangt mit seiner Mutter in den Westen. Sein Vater wird von den Russen gefangengenommen und zum Tode verurteilt. Die Familie erfährt erst 1946, dass er noch am Leben ist. Immer wieder schreibt Wolfgangs Vater kurze Briefe aus der Gefangenschaft. Für die Deckerts geht das Leben nach dem Krieg weiter. Wolfgangs Mutter kümmert sich aufopferungsvoll um ihr Nesthäkchen, trifft eigene Entscheidungen, wird zu einer selbstständigen, emanzipierten Frau. Das Todesurteil des Vaters ist inzwischen in 25 Jahre umgewandelt worden. 1955 kommt der gefallene General als sog. Spätheimkehrer nach Hause. 10 Jahre Gefangenschaft! Das Leben hat sich jedoch weiterentwickelt. Der Vater ist Wolfgang fremd. Für ihn beginnt nun die schlimmste Zeit seines Lebens. Interviewpartner in dieser Folge: Wolfgang Deckert Beginn des Interviews: 8 Minuten, 26 Sekunden History Wissen: 1 Stunde, 16 Minuten Filmtipp in dieser Folge: Das Wunder von Bern Folge dem Kanal auf Instagram: Wunder.Wissen.Weltkrieg sowie dem WhatsApp Kanal: Wunder.Wissen.Weltkrieg.

# 045 Auschwitz- Das Symbol des Holocaust
Arbeit macht frei: Als die Rote Armee am 27. Januar 1945 Auschwitz erreichte und unter den Lettern des Eingangstors hindurchgeht, bietet sich den Soldaten ein grauenhaftes Bild: Nur etwa 7.000 Häftlinge in den drei Komplexen des größten deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers waren noch am Leben; die meisten von ihnen Elendsgestalten, die zu krank oder zu schwach für den Marsch in die Lager im Westen waren - fort von der näherrückenden Front. Fast 60.000 Häftlinge aus Auschwitz waren nur wenige Tage vor dem Eintreffen der Russen zu Fuß auf die "Todesmärsche" in die eisige Kälte des polnischen Winters geschickt worden. Das NS-Regime versuchte in den letzten Kriegsmonaten fieberhaft, die Spuren seiner Taten zu verwischen. Experten schätzen, dass jeder vierte Häftling auf dem langen Marsch in den Westen starb. Sie erfroren, verhungerten oder wurden erschossen, wenn sie nicht mithalten konnten. Diejenigen, die auch diese Tortur überlebten, wurden in die Lager Mittelbau-Dora, Buchenwald, Dachau und Flossenbürg gepfercht. Dort ging das Morden fast bis zum letzten Kriegstag weiter. Auschwitz steht seither wie kein anderes Lager für die Verbrechen der Deutschen und wurde als "Todesfabrik" Symbol für den Mord an den europäischen Juden. Und Auschwitz ist heute der zentrale Ort für die Trauer um die Opfer - sei es für staatliches Gedenken oder für individuelles stilles Erinnern an die Verbrechen. Heute erfährst du etwas über die Geschichte des Lagers, den Aufbau sowie den Lageralltag in Auschwitz selbst. Folge dem Kanal auf Instagram: Wunder.Wissen.Weltkrieg sowie dem WhatsApp Kanal: Wunder.Wissen.Weltkrieg. https://whatsapp.com/channel/0029VaPNh04KbYMTiKNhpJ47 E-Mail: Autorin@raphaela-hoefner.de Buchtipp in dieser Folge: Der Junge, der seinem Vater nach Auschwitz folgte von Jeremy Dronfield

#044 Das Mädchen aus Auschwitz
Dita Kraus wurde 1929 in Prag geboren und wächst als einziges Kind einer jüdischen Familie auf. Ihre Kindheit ist zunächst glücklich und unbeschwert. Dies ändern sich jedoch, als die Tschechoslowakei die „sudetendeutschen“ Gebiete nach dem Münchner Abkommen (29. 09. 1938) an das „Deutsche Reich“ abgeben muss. 1942 wird Dita mit ihren Eltern zunächst nach Theresienstadt, dann nach Auschwitz deportiert, wo ihr Vater stirbt. Dort lebt sie unter schrecklichen Bedingungen im Theresienstädter Familienlager, wo sie täglich ums Überleben kämpft. Der Blockälteste Fredy Hirsch hat dort heimlich eine Schule errichtet, dessen wertvollster Besitz acht alte und zerfallene Bücher sind. Dita wird zur Bibliothekarin ernannt und soll die Bücher schützen und verstecken. „Doktor Tod“, wie Mengele von den Häftlingen genannt wird, steht sie mehrfach bei Selektionen gegenüber. Mit ihrer Mutter gelangt Dita über Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme in das KZ Bergen-Belsen, wo beide am 15. April 1945 befreit werden. Kurz danach stirbt ihre Mutter. Dita kehrt alleine nach Prag zurück. 1949 entschließt sie sich mit ihrer jungen Familie nach Israel zu emigrieren und muss sich dort unter schwierigsten Bedingungen ein neues Leben aufbauen. Sie bleibt von Schicksalsschlägen nicht verschont und muss den Tod von zwei ihrer drei Kinder erleben. Gleichwohl schafft sie es, sich ihren Lebensmut zu bewahren. Seit Anfang der 1990er Jahre berichtet sie als Zeitzeugin über ihre bewegte Lebensgeschichte. Heute erwartet euch ein ganz besonderes Interview, das unter die Haut geht und lange Zeit nachbebt. Hört jetzt rein in das Interview, um Ditas Erzählung aus erster Hand zu erfahren. Interviewgast in dieser Folge: Dita Kraus Beginn des Interviews ab 8 Minuten, 31 Sekunden Histroy Wissen ab 1 Stunde 2 Minuten Fredy Hirsch Buchtipps in dieser Folge: Ein aufgeschobenes Leben- Dita Kraus Die Bibliothekarin von Auschwitz- Antonio Iturbe Folge dem Kanal auf Instagram: Wunder.Wissen.Weltkrieg sowie dem WhatsApp Kanal: Wunder.Wissen.Weltkrieg. https://whatsapp.com/channel/0029VaPNh04KbYMTiKNhpJ47 E-Mail: Autorin@raphaela-hoefner.de

#043 Der andere Kampf
Schon immer wurden Chirurgen durch ihren Militärdienst geprägt und in ihrem chirurgischen Handeln beeinflusst. Im antiken Schrifttum wird über die Erfahrungen von Ärzten auf dem Schlachtfeld berichtet, wenngleich es um das Überleben verwundeter Krieger nicht gut bestellt war, da deren Versorgung erst am Ende einer Schlacht stattfinden konnte. Dies änderte sich auch im Mittelalter nicht wesentlich, wenn Wundärzte und Baader sich dem Schicksal der Verwundeten annahmen. Mit der Entwicklung moderner Waffen, die auf größere Entfernung ihre Wirkung entfalteten, begannen sich Sanitäter bereits während der laufenden Kampfhandlungen um verwundete Kameraden zu kümmern, alleine schon um durch deren Schreie nicht den Rest der Truppe zu demoralisieren. Jeder Krieg erfordert stets die Versorgung der eigenen Männer. Schnelles Handeln ist erforderlich und rettet Leben. Heute widme ich mich den Ärzten an der Front und ihren Aufgaben, Erlebnissen sowie ihren chirurgischen Fähigkeiten, ihren ganz eigenen Kampf zu kämpfen. Den Kampf gegen das Sterben. Folge dem Kanal auf Instagram: Wunder.Wissen.Weltkrieg sowie dem WhatsApp Kanal: Wunder.Wissen.Weltkrieg. https://whatsapp.com/channel/0029VaPNh04KbYMTiKNhpJ47 E-Mail: Autorin@raphaela-hoefner.de

#042 Kriegskind
Noch vor Kriegsausbruch wird Herbert 1939 in Alten-Buseck in Hessen geboren. Zunächst erlebt er eine schöne und behütete Kindheit auf dem elterlichen Hof. Doch schon bald kommt der Krieg mit all seinen Schwierigkeiten. Herberts Vater und sein geliebter Onkel Willi werden nach Russland eingezogen. 1942 kehrt der Vater schwer verwundet zurück. Der Bruder seiner Mutter fällt 1943 in Russland. Herberts Patenonkel Willi fällt nur wenige Tage vor Kriegsende an der Oder. Die Mutter ist mit ihrem Kummer und der vielen Arbeit zu Hause allein. Sie kümmert sich um den Großvater, Herberts Cousinen Dodo und Mimi. 1944 wird noch der kleine Manfred geboren. Arbeit gibt es mehr als genug: Die Landwirtschaft. Der Garten. Die Küche. Die Wäsche. Die Kinder. Alles und jeder will versorgt werden. In der Nähe des Hofes leben russische und französische Kriegsgefangene. Ausgemergelte und zaundürre Gestalten, denen Herbert hin und wieder einen Apfel oder ein Stück Brot vorbeibringt. Die Franzosen helfen den Bauern auf den Feldern bei der Arbeit. Leo und Andres, zwei dieser Männer wachsen dem kleinen Herbert besonders ans Herz. Heiße Tränen fließen, als diese nach Ende des Krieges in die Heimat zurückkehren. Am 06. Dezember 1944 wird Gießen angegriffen. Amerikanische Flugzeuge werden Bomben ab und legen die Stadt in Schutt und Asche. Herbert erinnert sich an die vielen verkohlten und verbrannten Leichen. Die Front rückt immer näher und näher. Im Frühjahr wird Alten Buseck von den Amis besetzt. Herbert erlebt die Jahre des Nachkriegszeit und trägt die Erinnerungen auch heute noch mit sich. Beginn des Interviews ab 12 Minuten History Wissen ab 1 Stunde 11 Minuten Interviewpartner in dieser Folge: Herbert Rau Folge dem Kanal auf Instagram: Wunder.Wissen.Weltkrieg sowie dem WhatsApp Kanal: Wunder.Wissen.Weltkrieg. https://whatsapp.com/channel/0029VaPNh04KbYMTiKNhpJ47 E-Mail: Autorin@raphaela-hoefner.de

#041 Der Todesengel
Er ist einer der berüchtigtsten Verbrecher des NS-Regimes: Josef Mengele, der Arzt von Auschwitz, hat an Insassen des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers grausame Experimente durchgeführt. Bereits im Mai 1945 wird er offiziell wegen Massenmordes gesucht. Doch er kann untertauchen – und schließlich nach Übersee entkommen Heute erfolgt ein Portrait über Josef Mengele Buchtipp: Ich habe den Todesengel überlebt- Ein Mengele Opfer erzählt von Eva Mozes Kor Folge dem Kanal auf Instagram: Wunder.Wissen.Weltkrieg sowie dem WhatsApp Kanal: Wunder.Wissen.Weltkrieg. https://whatsapp.com/channel/0029VaPNh04KbYMTiKNhpJ47 E-Mail: Autorin@raphaela-hoefner.de

#040 Untergetaucht
Ernst Krakenberger wurde am 22. Dezember 1940 in Naarden, Niederlande, geboren. Sein Vater Otto Krakenberger arbeitet mit zwei jüdischen Partnern zusammen im Hopfenhandel in Nürnberg und muss das Geschäft nach der „Arisierung“ 1938/1939 aufgeben. Gemeinsam mit seiner Frau Martha flieht er in die benachbarten Niederlande, da er dort gute Kontakte zu einem deutschen Geschäftsmann namens Stockmann pflegt. Im Mai 1940 kapitulieren die Niederlande jedoch vor Nazi-Deutschland. Die deutschen Besatzer beginnen fast unmittelbar nach der Kapitulation, Maßnahmen gegen die niederländischen Juden zu ergreifen. Martha Krakenberger ist zu diesem Zeitpunkt schwanger. Wissend, was auf Juden in von Deutschen besetzten Länder zukommen wird, macht Familie Stockmann der Familie Krakenberger folgendes Angebot: „Wenn etwas ist, wir nehmen das Kind!“ Ab Mitte Mai lebt der knapp zweijährige Ernst bei Familie Stockmann in Aerdenhout, während die eigenen Eltern deportiert werden. Seine Hauptbezugsperson wird die erst 18-jährige Tochter der Familie, Maja Stockmann. Diese geht eine Scheinehe ein und gibt den kleinen Ernst als ihren eigenen Sohn aus. Die Familie versteckt noch ein weiteres jüdisches Kind, den 12-jährigen Herbert, der stets im Haus bleiben muss. Im Notfall können sich die beiden Jungen unter dem Boden eines Schrankes im Esszimmer verstecken. Ab 1943 lebt „Erni“ mit Maja alleine an verschiedenen wechselten Orten, da Familie Stockmann nun selbst untertauchen muss, da sie Kontakte zum niederländischen Widerstand pflegt und von den Deutschen gesucht wird. Ernst Krakenbergers Eltern überleben vier Konzentrationslager und werden erst Ende 1945 mit ihrem Sohn vereinigt. Auf den Wunsch ihrer katholischen Retter hin, lassen die Eltern ihren Sohn katholisch taufen. 1966 zieht Ernst Krakenberger zurück nach Nürnberg, um das väterliche Hopfengeschäft weiterzuentwickeln. Maja Stockmann und ihre Eltern erhalten von Yad VaShem die Auszeichnung „Gerechte unter den Völkern“. Interviewpartner in dieser Folge: Ernst Krakenberger Beginn des Interviews ab 8 Minuten History Wissen:ab 1 Stunde 15 Minuten Die Niederlande im 2. Welkrieg Filmtipp: Die Schlacht um die Schelde Homepage: http://raphaela-hoefner.com/ Whatsapp: Wunder.Wissen.Weltkrieg Instagram: @wunderwissenweltkrieg oder @raphaelahoefnerautorin E-Mail: autorin@raphaela-hoefner.de

#039 Der Kommandant von Auschwitz
In der heutigen Folge geht es um den Kommandanten des Konzentrationslagers Auschwitz. Ein Mann, der selbst den Überblick über all die Verbrechen, die sich hinter dem Stacheldraht abgespielt haben, verloren zu haben scheint. Ein Mann, der mit seiner Frau und den Kindern nur wenige Meter entfernt vom Lager in einer Villa gewohnt hat. Ein Mann, der ein liebevoller Vater zu sein schien, der seine Pferde liebte und Ausflüge in die Natur. Wie konnte aus einem katholisch erzogenen Jungen ein solch abgebrühter Massenmörder werden, der lediglich Befehle ausführte? Heute folgt ein Portrait über Rudolf Höß. Hört jetzt rein, um etwas über seine Kindheit und Jugend sowie seinen Werdegang bis hin zu den Gerichtsverhandlungen und letztendlich seine Hinrichtung zu erfahren.

#038 Nur das nackte Leben
Renate wurde 1937 in Berlin geboren. Als uneheliches Kind kann ihre leibliche Mutter sie zunächst nicht wie gewünscht versorgen, weshalb sie die ersten Jahre bei einer Pflegefamilie aufwächst. Ihr leibliche Vater arbeitet als persönlicher Chauffeur des späteren Reichministers Fritz Todt. Dieser rät ihm zur Heirat mit Renates Mutter. Mit vier Jahren muss Renate die geliebten Pflegeeltern verlassen und zieht zu ihrer Familie zurück. Kurz bevor Berlin Angriff der ersten Fliegerangriffe wird, rät Reichsminister Todt dem Vater, seine Frau und seine Kinder raus aufs sichere Land zu schaffen. Nach Pommern. Gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder erlebt Renate dort schöne und glückliche Monate. Im Winter 1945 rückt jedoch die Rote Armee weiter Richtung Westen vor. Die Familie muss ihre Habseligkeiten auf einem Leiterwagen zusammenpacken und fliehen. Renate ist eines der vielen Flüchtlingskinder, die sich durch die klirrende Kälte und den meterhohen Schnee bei bis zu -20 Grad schleppen muss. Für ihren jüngsten Bruder, zum Zeitpunkt der Flucht ein Säugling, sind die Strapazen der wochenlangen Flucht zu viel. Er stirbt in den Armen seiner Mutter. Renate erlebt Tieffliegerangriffe, sieht Dutzende Tote, Verletzte und erreicht letztendlich Berlin. Auch die Nachkriegszeit, die von Hunger geprägt ist, hat sie noch genau im Gedächtnis. Das Erlebte haben ihr gesamtes Leben geprägt. Heute lebt sie in Prien am Chiemsee. Interviewpartnerin: Renate Gross Beginn des Interviews ab: 7 Minuten History Wissen: Die Flucht aus Ostpreuße, Pommern, Schlesien, Brandenburg, etc. Beginn ab: 1 Stunde 30 Minuten Filmtipp in dieser Woche: Die Flucht - Verlorene Heimat Ostpreußen

#037 Der Architekt des Massenmords
Reinhard Heydrich (1904–1942) war einer der mächtigsten Männer des »Dritten Reichs«: Als Leiter des Reichssicherheitshauptamts und engster Mitarbeiter Heinrich Himmlers lenkte er den Terrorapparat der Nationalsozialisten. Bis zu seinem gewaltsamen Tod im Sommer 1942 hatte Reinhard Heydrich unter den Nationalsozialisten eine beispiellose Karriere gemacht. Als Leiter des Reichssicherheitshauptamts, stellvertretender Reichsprotektor von Böhmen und Mähren sowie Organisator der »Endlösung der Judenfrage« war er eine der Schlüsselfiguren der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik und einer der am meisten gefürchteten Männer des »Dritten Reichs«. Heute folgt ein Portrait über Reinhard Heydrich. Filmtipps in dieser Woche: Die Macht des Bösen (2017) und Die Wannseekonferenz (2022)

#036 Flucht in die Freiheit (Teil II)
Frank Cohn wurde am 2. August 1925 in Breslau als Franz Cohn geboren. Gemeinsam mit seiner Mutter gelingt ihm die Überfahrt in die USA und erreicht am 30. Oktober 1938 den Hafen von New York. Aufgrund der antisemitischer Hasswelle, der Reichsprogromnacht, vom 9. November 1938 dürfen die Cohn in den USA bleiben. Frank lernt über das Radio Englisch und geht schon bald zur Schule. Nur einen Monat nach seinem 18. Geburtstag 1943 meldet sich Frank freiwillig als Soldat und möchte dem Land, das ihn aufgenommen hat, etwas zurückgeben. Während seines Basic Training in Fort Benning, Georgia, wird er als US-Bürger vereidigt und der 87. Infanterie-Division zugeteilt. Über England gelangt Frank nach Frankreich, wo er nur wenige Monate nach der D-Das-Invasion im Juni 1944 am Omaha Beach ankommt. In Belgien entdeckt die Armee, dass Frank fließend Deutsch kann. So gelangt er zu einem zweiwöchigen Militärgeheimdienstkurs nach Le Vésinet, Frankreich, geschickt. Frank dient während der Ardenneoffensive und später in Deutschland als Mitglied eines sechsköpfigen Vernehmungsteams, das an die Geheimdiensteinheit namens T-Force, 12th Army Group, angeschlossen ist. Ihre Aufgabe ist es, den Wert von gefangenen Einzelpersonen und Gebäuden im Zusammenhang mit Regierung, Nazi-Partei, Industrie und Technologie für den Einsatz während der alliierten Besatzung und für die Verfolgung von Kriegsverbrechern zu bewerten. Während der anschließenden alliierten Besetzung Deutschlands setzt Frank seine Geheimdienstarbeit fort. An einem Punkt wird er beauftragt, deutsche Kriegsgefangene zu beaufsichtigen, die detailliert beschrieben wurden, um Nazi-Dokumente in die USA zu packen und zu versenden, um zukünftige Kriegsverbrecher zu verfolgen. Interviewpartner in dieser Folge: Frank Cohn Beginn des Interviews ab: 8 Minuten History Wissen ab 1 Stunde, 29 Minuten Die T-Force

#035 Flucht in die Freiheit (Teil I)
Frank Cohn wurde am 2. August 1925 in Breslau als Franz Cohn geboren. Als Einzelkind wächst er wohlbehütet auf, sein Vater besitzt ein Sportgeschäft. Schon früh bekommt die Familie den wachsenden Antisemitismus zu spüren. Franks Onkel wird 1927 von einer Gruppe Nazis schwer verprügelt. Er stirbt später an diesen Verletzungen. Nach der Machtübernahme der Nazis muss Franks Vater sein Geschäft aufgeben. Im August 1938 reist dieser in die USA, um von Verwandten eine Eidesstattliche Erklärung zu bekommen, um mit seiner Familie in die Vereinigten Staaten reisen zu dürfen. Währenddessen wird er bereits zuhause von der Gestapo gesucht. Franks Mutter kann ihren Mann mit einem Brief warnen und reist selbst mit ihrem Sohn mit dem Schiff über Rotterdam nach New York. Das Wiedersehen Ende Oktober ist von der Angst getrübt, sofort wieder zurückgeschickt zu werden. Am 9. November bricht jedoch eine Welle antisemitischer Gewalt herein, die als Reichsprogromnacht bekannt wird. Daraufhin verlängert Präsident Roosevelt alle Visa, sodass die Cohns in Amerika bleiben dürfen. Frank lernt über das Radio Englisch, geht zur Schule und meldet sich sofort nach seinem 18. Geburtstag 1943 freiwillig als Soldat. Er will dem Land, das ihn aufgenommen hat, etwas zurückgeben. Als Soldat reist er zurück nach Europa, um dort gegen die Deutschen zu kämpfen. Interrviewgast in dieser Folge: Frank Cohn Beginn des Interviews ab 9 Minuten History Wissen ab 1 Stunde 22 Minuten

#034 Verlorene Jugend
Kurt Losert wurde am 15. Juli 1927 in Tschirm, Kreis Troppau in Sudetenschlesien geboren, dem heutigen Tschechien.. Seine Kindheit verbringt er auf dem elterlichen Bauernhof und erinnert sich an viele glückliche Jahre. Mit gerade einmal 17 Jahren wird Kurt eingezogen und kommt an die Ostfront. Im eiskalten Winter Russlands geht es Tag für Tag nur um eines: Das nackte Überleben. Ums nach Hause kommen. Kurt erlebt die Not des Hungers, die Aussichtslosigkeit der gnadenlosen Kämpfe und das ständige Bewusstsein, vom Tode bedroht zu sein. Als er nach Kriegsende in die Heimat zurückkehren will, wird er zusammen mit Kameraden von einem Tschechen festgehalten und an die russischen Soldaten übergeben. Kurt ist jetzt einer von Millionen deutscher Kriegsgefangener. Mit einem Viehtransport wird er bis ins Herzen Russlands gebracht, haust in Erdbunkern, lebt unter schrecklichsten Bedingungen. Täglicher Begleiter ist der ständige Hunger. Mit bloßen Händen baut Kurt mit seinen Kameraden eine Straße bis nach Moskau. Über zwei Jahre darf er keinen Kontakt zu seinen Eltern aufnehmen. Er gilt als „vermisst.“ 1948 kehrt Kurt zurück nach Deutschland. Der Vater ist inzwischen verstorben, die Mutter aus der ehemaligen Heimat vertrieben. In Bayern treffen sich Mutter und Sohn endlich wieder. Seine Erzählungen sind ergreifend, emotional und ein erschütterndes Dokument dieser Zeit. Jugend? Begraben unter der Schneedecke Russlands, zusammen mit dutzenden Freunden und Kameraden. Heute lebt Kurt nach wie vor in München. Interviewpartner in dieser Folge: Kurt Losert Interviewbeginn ab: 6 Minuten, 40 Sekunden History Wissen ab 1 Stunde Gefangenschaft nach Kriegsende Filmtipp in dieser Folge: Soweit die Füße tragen Das Tribunal

#033 Das Erbe von Auschwitz
Dr. Eva Umlauf hat als eines der jüngsten Opfer die Deportation und Verbringung ins Konzentrationslager Auschwitz überlebt. Sie erblickt am 19. Dezember 1942 in einem Arbeitslager für Juden, im slowakischen Nováky, das Licht der Welt. Ihre Mutter erzählt ihr später, wie sie für die Mithäftlinge zu einem Symbol für das Leben wurde. Anfang November 1944 werden sie und ihre Eltern nach Ausschwitz deportiert. Mit dem Vorrücken der Roten Armee aus dem Osten, werden viele Tausend Insassen auf die sogenannten Todesmärsche Richtung Westen geschickt. Unter ihnen ist auch Evas Vater, der im KZ Melk stirbt. Eva überlebt als kleines Kind Auschwitz. Das grenzt an ein Wunder, denn es gab nur sehr wenige Kinder, die das Vernichtungslager überlebt haben. Im Juni 1945 verlässt die Mutter mit zwei kleinen Kindern Auschwitz in Richtung Slowakei und baut sich mit ihren Kindern ein neues Leben auf. Eva Umlauf zieht nach München, heiratet, wird Kinderärztin und bekommt drei Kinder. Bis heute ist für Eva Umlauf die Erinnerung an den Holocaust und der Umgang mit Antisemitismus zu einer wichtigen Lebensaufgabe geworden. Auf Lesungen und Vorträgen für Schulklassen erzählt sie jüngeren Menschen ihre beeindruckende Geschichte. Interviewpartnerin in der Folge: Dr. Eva Umlauf Interviewbeginn ab 9 Minuten History Wissen ab 58 Minuten Buchtipp in dieser Folge: Die Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen https://www.amazon.de/Nummer-deinem-Unterarm-deine-Augen/dp/3455503705

#032 Einsam gegen Hitler
Am 8.November 1939 explodiert die Bombe, die Hitler töten soll, planmäßig um 21:20 Uhr im Bürgerbräukeller in München. Der Saal verwandelt sich innerhalb von Sekunden in ein Trümmerfeld. Die Bombe zerschmettert nicht nur die Säule hinter dem Rednerpult und ihrer Umgebung, sondern lässt sogar die Decke einstürzen. Acht Menschen sterben, davon sieben NSDAP-Mitglieder und eine Kellnerin. 63 Personen werden verletzt. Aber Hitler selbst lebt. Zusammen mit den Vertretern von Partei und Regierung hat er seine Rede bereits um 21:07 Uhr beendet und daraufhin der Saal vorzeitig verlassen. Zeitgleich an der Schweizer Grenze. Zwei Zollbeamte nehmen einen Mann fest, der versucht über die Grenze zu gelangen. Sein Name ist Georg Elser. Als die Meldung vom Attentat Konstanz erreicht, erregen einzelne Gegenstände in Elsers Taschen Verdacht. Die Gestapo bringt ihn nach München. Dort wird Elser in der Staatspolizeileitstelle München verhört und auch gefoltert. Der gelernte Schreiner ist sich im September 1938 sicher, dass ein Weltkrieg – angezettelt durch die Nationalsozialisten – unvermeidbar ist. Deshalb beschließt Elser, die führenden Personen Hitler, Goebbels und Göring umzubringen, um das deutsche Volk und die ganze Welt zu retten. Mit dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 beginnt der Zweite Weltkrieg, und Georg Elser sieht sich in seinem Vorhaben bestärkt. Wer war dieser Mann, der aus einfachen Verhältnissen kam, der aber die Gefahr, die von Hitler ausging, deutlicher erkannte als die meisten anderen? Der bereit war zu handeln, als die anderen mitliefen oder schwiegen? Ein Portrait über Georg Elser. Filmtipp in dieser Folge: „Elser“

#031 Entscheidung an der Elbe
Hellmut Westermann wurde am 11. April 1926 im pommerschen Stettin (heute Szczecin) geboren. Als Hellmut drei Jahre alt ist, zieht die Familie nach Berlin um. Der Vater wird ans Verkehrsministerium versetzt. 1927 kommt sein Bruder Gerd zur Welt. 1930 kündigt der Vater seine Beamtenstelle und arbeitet als Prokurist und technischer Leiter einer Firma in Goslar, weshalb die Familie erneut umzieht. Die beiden Brüder erleben eine unbeschwerte und glückliche Kindheit. Diese endet jedoch abrupt, als ihre Mutter sehr überraschend im Frühjahr 1936 verstirbt. Dieses schreckliche Ereignis schweißt die beiden Jungen noch enger mit dem Vater zusammen. 1937 treten die „Gebrüder Westermann“ den „Pimpfen“ (einer Vorstufe der „Hitlerjugend“) bei. Mit dem Einmarsch der Deutschen Truppen in Polen im September 1939 beginnt der Zweite Weltkrieg. Hellmuts Vater muss als Reserveoffizier einrücken. Der Abschied schmerzt Hellmut ganz besonders. Während des Feldurlaubs 1942 wird Töchterchen Dagmar geboren. Im Juni 1943 werden die „Gebrüder Westermann“ zum Dienst als Luftwaffenhelfer einberufen. Hellmut meldet sich freiwillig als Soldat („Soldat werden musste man so oder so. So hatte man die Wahl der Waffengattung) und entschließt sich für die berittene Artillerie. Hier schätzt vor allem der Vater die Überlebenschancen höher ein als bei der Panzertruppe oder der Infanterie. Zweitens möchte Hellmut später Tierarzt werden. Im Juni 1944 tritt Hellmut seinen Dienst an und wird bei einem Auswahl-Lehrgang ausgebildet. Am 16. Januar 1945 erfolgen schwere Bombenangriffe auf Magdeburg. Von den Kasernen aus kann Hellmut das Inferno sehen. Sofort rücken die Männer aus, um aus der brennenden Stadt noch Menschen zu retten. Bilder, die er bis heute nicht vergessen kann. Am 10. April 1945 wird seine Truppe bei Rokyzani zu einem letzten Aufgebot aufgerufen. Die Division „Ullrich von Hütten“ hatte von Hitler den Befehl bekommen, das bereits eingekesselte Berlin zu befreien. Zur Abschreckung vor Fahnenflucht muss Hellmut sogar der Exekution eines Soldaten beiwohnen. Am 27. April kommt der Vorstoß der Truppe zum Stehen. General Weck war nicht Hitlers Befehl gefolgt, die russische Armee im Raum Berlin anzugreifen. Sein Ziel: Den eigenen Männern die Chance zu geben, sich in den Westen durchzuschlagen. Als einer der letzten Soldaten gelingt es Hellmut über die Elbe zu kommen. Dort gerät er in amerikanische Gefangenschaft, die jedoch nach einigen Monaten endet. Hellmut wird anschließend Werbefachmann. Seit Wunsch heute: Nie wieder Krieg! Interviewpartner in dieser Folge: Hellmut Westermann Beginn des Interviews ab 8 Minuten History Wissen ab 1 Stunde 11 Minuten General Walther Wenck Buchtipp in dieser Folge: Was ich noch sagen wollte...

#030 Gegen das Vergessen
Daniel Müller wurde 1989 geboren und ist als ehrenamtlicher Vorsitzender des Vereins „Zeugen der Zeitzeugen“ aktiv. „Zeugen der Zeitzeugen“ ist ein Bildungsprojekt von und vor allem für junge Menschen. Ziel ist es, mit der letzten Generation der Holocaust-Überlebenden, deren Kindern und Enkeln in Kontakt zu kommen, mit ihnen in einen Dialog zu treten und auch in Zukunft das Gedenken an den Holocaust lebendig zu halten. Antisemitismus soll in allen Erscheinungsformen entgegengewirkt und deutsch-israelische Beziehungen gestärkt werden. Mit Daniel blicke ich im Interview zurück auf die Geschichte, spreche über Erlebnisse von Zeitzeugen sowie über Antisemitismus sowie Israel 75. Interviewgast in dieser Folge: Daniel Müller Infos und Links: https://youtu.be/rudMjq0dgzQ?feature=shared https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2QxN2U2NjY4LWFiODMtNDgzMS1iZWNjLTk1NTFjZGUzNzY2MQ https://www.zeugen-der-zeitzeugen.de/

#029 Der Hölle entkommen
Albert Schiller wird am 29. April 1921 in Stuttgart-Untertürkheim als einziges Kind einer evangelischen Familie geboren. Sein Vater ist Buchbinder, die Mutter Hausfrau. Kurz nach Alberts Geburt zieht die Familie nach Bad Cannstatt. Dort verbringt er seine Kindheit und Jugend. Er durchläuft das Jungvolk und die Hitlerjugend. Mit nur 15 Jahren beendet Albert die Schule und beginnt ein Lehrer als Mechaniker. Am 1.September 1939 bricht der Zweite Weltkrieg aus. Knapp ein Jahr später wird Albert beim Wehrbezirkskommando Stuttgart gemustert. Der Entscheid lauter: Kriegsverwendungsfähig. Ab 1.Februar 1941 wird sein gesamter Jahrgang eingezogen. Mit 20 Jahren wird er beim Nachr.-Ers.-Battr. 5 in Karlsruhe eingestellt und beginnt dort seine Ausbildung. Anfangs ist Albert Funker und Ladekanonier eines Panzer-III, später dann eines Sturmgeschützes. Wenn ein Soldat gefallen oder erkrankt ist, wird er als Ersatzmann im Panzer eingesetzt. Albert wird der Sturm-Geschütz-Abteilung 177 zugeteilt und am 6.September 1941 mit der Bahn nach Russland, in den Raum Smolensk, gefahren. Nach dem Vormarsch steht seine Truppe kurz vor Moskau. Nach den schweren Winterkämpfen wird die Abteilung im März 1942 nach Mogilew verlegt. Im August überschreiten die deutschen Soldaten den Don und der Vormarsch nach Stalingrad geplant. Kurz bevor Alberts Einheit in die heiß umkämpfte Stadt vordringen soll, erkrankt er schwer an Typhus. Im Nachhinein ein Wunder. Keiner seiner Kameraden überlebt. Insgesamt wird er noch dreimal verwundet. Albert Schiller gerät in amerikanische Kriegsgefangenschaft und wird am 3.Juli 1945 entlassen. Eine dort erlebte Misshandlung bereitet ihm sein ganzes Leben lang Schwierigkeiten. Interviewgast in dieser Folge: Albert Schiller Beginn des Interviews ab: 6 Minuten History Wissen ab 55 Minuten Die Sturmgeschütz-Abteilung 177 Buchtipp: Albert Schiller- Ein Zeitzeuge erinnert sich

#028 Hitlers "Vollstrecker"
Heinrich Luitpold Himmler (* 7. Oktober 1900 in München; † 23. Mai 1945 in Lüneburg) war ein deutscher Politiker der NSDAP und einer der Hauptverantwortlichen des Holocaust. Der Sohn eines katholischen Gymnasiallehrers träumt von einer Offizierskarriere, kommt 1918 jedoch nicht mehr an die Front und wird aus dem Heeresdienst entlassen. Als Student der Landwirtschaft in München schließt er sich antisemitisch-völkischen Kreisen an, tritt in die rechtsgerichtete NSDAP ein und beteiligt sich 1923 am Putschversuch Hitlers in München. Sein Aufstieg beginnt 1929 mit der Ernennung zum „Reichsführer-SS“. Der unscheinbare und blasse Biedermann, der das Christentum durch Germanenkult ersetzen will und neuheidnische Bräuche liebt, erweist sich als skrupelloser Politiker. Himmler baut mit der SS eine parteiinterne Ordnungstruppe zur Eliteeinheit aus und bringt den gesamten „braunen“ Sicherheitsapparat unter seine Kontrolle. Seine Waffen-SS wird zu einem Wehrmachtsteil und beteiligt sich vor allem an der Ostfront an grausamen Kriegsverbrechen. Bis 1945 organisiert Himmler den systematischen Mord an europäischen Juden. Darüber hinaus plant er ein riesiges Umsiedlungs- und Vertreibungsprogramm. Gegen Kriegende versucht er mit den Westmächten zu verhandeln. Hitler entzieht ihm daraufhin alle Ämter. Nach der deutschen Kapitulation flieht Himmler, wird jedoch aufgegriffen und nimmt sich am 23. Mai 1945 in einem britischen Vernehmungslager mit einer Zyankalikapsel das Leben. Buchtipp in dieser Folge: Heinrich Himmler: Biographie von Peter Longerich

#027 Die Kraft der Heimat
Sigrid Leneis wurde am 25. Oktober 1934 in Schluckenau im damaligen „Sudetenland“ (heute Tschechien) geboren. Die ersten Jahre verbringt sie mit ihrem vier Jahre älteren Bruder in der Geborgenheit des Elternhauses. Der Vater arbeitet als Lehrer, die Mutter als Haus-und Geschäftsfrau. Zu Beginn des Krieges wird der Vater bereits eingezogen. Er kehrt nicht mehr nach Hause zurück. Bis heute weiß die Familie nichts über sein Schicksal. Kurz vor Kriegsende beschließt Sigrids Mutter, mit ihren beiden Kindern vor der herannahenden Roten Armee zu fliehen. Es ist jedoch bereits zu spät. Sie kehren zurück in ihr Haus, als die Kriegshandlungen eingestellt werden. Zuhause angekommen erleben sie dann, was für sie nun der neue Alltag bedeutet: Plünderungen und Misshandlungen, willkürliche Erschießungen, Massenvergewaltigungen. Sigrids Familie wird als „vogelfrei“ erklärt. Im Frühsommer werden die Drei von Soldaten mit Maschinengewehren aufgefordert, sofort zu packen und das Land zu verlassen. Der Beginn einer wochenlangen Flucht, die geprägt ist von Hunger und Not. Endlich erreichen sie Altdorf bei Landshut, wo sie bleiben dürfen und neue Wurzeln schlagen. Der Weg der Integration ist hart und sehr steinig. Sigrid wird selbst Lehrerin und gründet als junge Frau die Sudetendeutsche Jugend mit. Bis vor kurzem war sie federführend in der Sudetendeutschen Landmannschaft und hat viele Dialoge und Treffen mit Tschechien organisiert, unterstützt und gefördert. Für ihr herausragendes Engagement in der Vertriebenenarbeit und der Bewahrung des Kulturgutes wurde sie mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. Interviewpartnerin in dieser Folge: Sigrid Leneis Beginn des Interviews ab 7 Minuten History Wissen ab 55 Minuten Die Flucht aus dem damaligen Sudentenland

#026 Fahnenflucht
Ralph Paschke wurde 1929 in Görlitz geboren. Er wächst bei seinen Eltern, einem Oberpostbeamten und einer Hausfrau, und seinem neun Jahre älteren Bruder auf. Dieser lässt sich zum Piloten ausbilden und gilt nach einem Einsatz als vermisst. Ralph tritt der Hitlerjugend bei und muss zahlreiche Dienste leisten. Gegen Kriegsende hin wird er zusammen mit Nachbarsjungen und Klassenkameraden zum Volkssturm eingezogen. In der Unterkunft „Königshainer Schloss“ wird sein Name von einer Liste gestrichen, die immer wieder eine große Rolle in Ralphs Leben gespielt hat. Zusammen mit zwei Kameraden beschließt Ralph im März 1945, dass sie sich nicht weiter verheizen lassen und zurück nach Hause wollen. Flucht um jeden Preis. Das Problem: Sie tragen noch immer ihre Uniformen. Ab sofort gelten sie als fahnenflüchtig. Nach einer nervenaufreibenden Kontrolle steigen die Jungen aus einem Zug aus und schlagen sich bis in die Heimat durch. Dort wird Ralph von seinen Eltern versteckt. Er erlebt das Kriegsende in Görlitz und den Einmarsch der Roten Armee. Die Familie baut sich ein neues Leben in der damaligen DDR auf. Beginn des Interviews ab 7 Minuten History Wissen:ab 1 Stunde 29 Minuten Der Volkssturm Interviewpartner in dieser Folge: Ralph Paschte und

#025 Hitlers Komplize
In der heutigen Folge geht es um Hitlers Komplizen. Der zweite Mann im Dritten Reich will vor allem eins. Macht. Luxus. Einfluss. Reichtum. Drogen. Er ist der wohl schillerndste Charakter im Nationalsozialismus und verstrickt in alle Verbrechen des Regimes. Viele, die Göring persönlich kannten, nannten ihn einen Blender. Doch wer war dieser Mann? Hermann Göring war die joviale Maske des Nationalsozialismus; der hochdekorierte Weltkriegsheld, der Hitlers Partei in den zwanziger Jahren den Zugang zu breiten Schichten der deutschen Gesellschaft öffnete; aber auch der skrupellose Gefolgsmann, der 1933/34 die Explosion der Gewalt gegen politische Gegner organisierte und 1941 die Ermächtigung für die "Endlösung der Judenfrage" unterschrieb. Zugleich war Göring ein grenzenlos selbstverliebter Mann, der gern protzte mit unrechtmäßig angeeignetem Besitz, der sich in der Schorfheide nördlich Berlins die riesige Residenz "Carinhall" errichten ließ und sie bis 1953 zum "Hermann-Göring-Museum" ausbauen wollte. Heute geht es um das Portrait von Hermann Göring. Quellen: Stefan Martens: Hermann Göring. „Erster Paladin des Führers“ und „Zweiter Mann im Reich“. Schöningh, Paderborn 1985. Richard Overy: Hermann Göring. Machtgier und Eitelkeit. Heyne, München 1986. Alfred Kube: Pour le mérite und Hakenkreuz. Hermann Göring im Dritten Reich. 2. Auflage. Oldenbourg, München 1987. Guido Knopp: Göring. Eine Karriere. Goldmann, München 2007. https://www.youtube.com/watch?v=hCtrxHvVNXY https://www.youtube.com/watch?v=gf9Xt01b3Cc https://www.youtube.com/watch?v=wuTylymVg0Y

#024 Im Schatten des Krieges
Ulrikes Vater wird 1922 in Westfalen geboren und zieht mit zehn Jahren mit seinen Eltern auf einen Hof im damaligen Schlesien. Dort muss er früh anpacken und erlebt zunächst den Kriegsausbruch vor der Haustür mit. Als Soldat wird er 1941 eingezogen und bei einem Einsatz an der Krim schwer verwundet. Für „Volk und Vaterland“ verliert er ein Bein, kämpft wochenlang ums Überleben und kehrt als „Kriegsversehrter“ zurück in die Heimat. Diese ist aber kurz darauf bedroht, sodass er mit einem Pferdegespann vor der Roten Armee fliehen muss. Auch Ulrikes Mutter kämpft in Ostpreußen um eine Ausreise. Mit dem Zug flieht sie von Danzig aus und verlässt Haus und Hof für immer. Ihre schwere Reise ist nach dem Zweiten Weltkrieg jedoch noch nicht zuende. Als „Krüppel“ findet Ulrikes Vater keine Arbeit und kann die eigene Familie kaum ernähren. Sie selbst wird in einer Flüchtlingsunterkunft geboren. In der heutigen Folge erzählt sie, wie sie die Vergangenheit der Eltern bis heute begleitet. Beginn des Interviews ab 6 Minuten, 30 Sekunden History Wissen ab 53 Minuten Schlesien

#023 "Unternehmen Barbarossa"
Es ist ein Feuerschlag, wie ihn die Welt bis dahin noch nicht erlebt hat. Am 22. Juni 1941, um 3:05 Uhr, bricht entlang der 2.130 Kilometer langen deutsch-sowjetischen "Interessengrenze" zwischen Ostsee und Schwarzem Meer die Hölle los. Aus mehr als 7.100 Geschützen eröffnet die deutsche Wehrmacht an diesem Sonntagmorgen das Feuer auf Stellungen und Befestigungen der Roten Armee in Litauen, Ostpolen-Weißrussland (Belarus), der Ukraine und in Moldau. Am 22. Juni 1941 marschiert die deutsche Wehrmacht in die Sowjetunion ein. Mit dem "Unternehmen Barbarossa" beginnt ein machtpolitisch, wirtschaftlich und rassenideologisch motivierter Vernichtungskrieg. Heute geht es darum, wie es zur Planung und Umsetzung des Unternehmens Barbarossa kam und um den Kriegsverlauf. Außerdem lese ich euch einige Stellen aus dem Tagebuch meines Großvaters vor, der als Truppenarzt mit dem 63.Panzergrenadierregiment bis kurz vor Stalingrad gekommen ist. Was war der Wendepunkt des Deutsch-Sowjetischen Krieges und was führte letztendlich zur größten Katastrophe? Filmtipp: Unsere Mütter, unsere Väter

#022 Der letzte Zeuge
Kurt Salterberg wurde am 08. Januar 1923 in Pracht bei Altenkirchen geboren. Das ist liegt in Rheinland-Pfalz. Im Alter von 17 Jahren meldet sich Kurt Salterberg freiwillig zum Militärdienst. Nach seiner Ausbildung wird er mit der Panzerabwehr-Kompanie der 34. Infanterie-Division an der Ostfront eingesetzt. Dort erlebt er Schreckliches, über das er heute, so viele Jahre später, kaum sprechen kann. Im Oktober 1943 wird Salterberg in die Kaserne nahe dem damaligen Rastenburg im heutigen Polen versetzt. Rastenburg gehörte früher zu Ostpreußen. Dort dient er als Hitlers Wachsoldat im Führerbegleitbataillon im Führerhauptquartier, der Wolfsschanze. Kurt Salterberg ist der letzte lebende Zeitzeuge des Attentats vom 20. Juli 1944. . Er selbst hatte den geheimen Widerstandskämpfer Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg an seiner Wache passieren lassen. Die Bombe explodiert und kostet einigen Männern das Leben. Hitler überlebt nur leichtverletzt. Noch am selben Tag wird Salterberg verhört und anschließend zu einer kämpfenden Einheit versetzt. Mit der neuen Einheit nimmt er an der Ardennenoffensive bis vor Bastogne teil. Die Einheit verliert jedoch nach einem Volltreffer die gesamte Führung. Daraufhin kommt Salterberg wieder an die Ostfront. Bei einem Angriff auf die Russischen Linien erhält er einen Lungendurchschuss. Es folgen fünf Monate Lazarettaufenthalte. Aus dem Reservelazarett Halle an der Saale holen die Amerikaner alle Verwundete, obwohl sie zehn Tage zuvor die Stadt den Russen übergeben haben. Sie bringen die Männer in die amerikanische Zone. Vom Lazarett Marburg aus geht Salterberg nach seiner Entlassung zu Fuß nach Hause bis nach Pracht. Als Redner trat er bei vielen Gedenkfeiern auf und erhält im Jahr 2015 die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz. Beginn des Interviews ab 10 Minuten History Wissen ab 51 Minuten Die Wolfsschanze Buchtipp in dieser Folge: Kurt Salterberg: Als Soldat in der Wolfsschanze

#021 "Operation Walküre"
Am 20. Juli 1944 ließ der Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg eine Bombe im „Führerhauptquartier“ in Ostpreußen detonieren. Doch die Bombe verfehlte ihr Ziel und Hitler überlebte mit leichten Verletzungen. Dieser Fehlschlag sowie Lücken in der Vorbereitung und das Zögern beim Auslösen der „Operation Walküre“, des Planes zum Staatsstreich, ließen den Umsturzversuch scheitern. Die Beteiligten der Verschwörung, die Personen des 20. Juli 1944, stammten vor allem aus dem früheren Adel, der Wehrmacht und der Verwaltung. Unter den mehr als 200 Hingerichteten und Verurteilten sticht ein Mann ganz besonders hervor. Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Der Mann mit der Augenklappe muss noch in derselben Nacht mit seinem Leben bezahlen. Doch wie wurde aus dem damaligen Anhänger Hitlers ein Widerständler, der bereit war, sein eigenes Leben zu opfern? Was waren die Gründe für das Scheitern des Attentats, das schon bald 79 Jahre zurückliegt? Buchtipp in dieser Folge: Claus Schenk Graf von Stauffenberg- Ulrich Schlie Claus Schenk Graf von Stauffenberg: Die Biographie – Peter Hoffmann Stauffenberg und das Attentat vom 20. Juli 1944: Darstellung, Biographien, Dokumente (Die Zeit des Nationalsozialismus – »Schwarze Reihe«) – Gerd R. Ueberschär Filmtipp: Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat

#020 Duell über den Wolken
Joe Peterburs wird am 25. November 1924 in St. Paul, Minnesota geboren, wächst aber vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise hauptsächlich in Wisconsin auf. Joe stammt aus einer Familie mit militärischer Tradition: Sein Vater wandert 1906 aus Deutschland in die USA aus und dient im 1. Weltkrieg. Zusammen mit seinen Brüdern tut Joe alles, was sie können, um die Familie in den mageren Jahren der Depression zu unterstützen. Als kleiner Junge besucht er eine katholische Schule und möchte später Priester werden. Als am 07. Dezember 1941 Pearl Harbor angegriffen wird, meldet er sich freiwillig. An seinem 18. Geburtstag wird Joe vereidigt und beginnt seine Ausbildung als Pilotenanwärter. 1944 erreicht er Europa. Joe fliegt eine P-51 Mustang, seine Hauptaufgabe besteht darin, die Bomber zu eskortieren und zu schützen, fliegt aber auch Bodenunterstützungsmissionen auf der Suche nach Gelegenheitszielen. Am 10. April gerät er in einen Luftkampf mit einem deutschen Piloten – mit einer Messerschmidt 262. Joe gelingt es, den Deutschen abzuschießen. Später wird er selbst getroffen, kann aber über Feindesland mit dem Fallschirm abspringen und wird gefangengenommen. Im Chaos des Jahres 1945 gelingt ihm die Flucht. Viele Jahre später kann Joe durch Zufall Kontakt zu dem deutschen Piloten aufnehmen, den er damals abgeschossen hat. Es ist das bekannte Fliegerass Walter Schuck, genannt Tiger der Tundra. Bis zu Walters Tod 2015 bleiben sie eng verbunden. Beginn des Interviews ab 9 Minuten History Wissen ab 1 Stunde 17 Minuten Walter Schuck Gesprächspartner in dieser Folge: Joe Peterburs Buchtipp: WWII Memories of a P51 Mustang Pilot Joe Peterburs Autobiography Abschuss!: Von der Me 109 zur Me 262: Von der Me 109 zur Me 262. Erinnerungen an die Luftkämpfe beim Jagdgeschwader 5 und 7 Von Walter Schuck

#019 Die "Elite" des Grauens
Es klingt wie aus einem Krimi. Die Elite des Grauens im Alltag. Ein schwarz-weißes Foto, das die Lagerbesatzung des KZ Auschwitz zeigt. Lachend. Sichtlich glücklich. Vermutlich ist das Bild am 15.Juli 1944 aufgenommen worden. Das Foto zeigt keine Leichen. Kein Blut, auch keine Transportwaggons. Die Bilder aus dem „Auschwitz-Album“ illustrieren Lageraufseher, die sich trotz des von ihnen mit zu verantwortendem Massenmord offenbar ausgelassen amüsieren. Da hocken fein frisierte KZ-Aufseherinnen auf einem Holzgeländer und essen fröhlich Blaubeeren. Höcker spielt mit seinem Schäferhund "Favorit", der Pfötchen gibt. Im SS-Erholungsheim "Solahütte" liegen die Täter und Täterinnen lachend in Sonnenstühlen, und ein Chor von Aufsehern in Uniform schmettert zum Klang eines Akkordeons Lieder. Von Gewissensbissen keine Spur. Jeder von ihnen ist ein Zahnrad im funktionierenden System der Nationalsozialisten. Ein Teil der Mordmaschinerie. Wie wurden aus Menschen Maschinen, die mordeten, folterten und die „Endlösung“ vorantrieben? Heute geht es um das Leben der KZ-Aufseherinnen und Aufseher, ihre Ausbildung und ihren Alltag. Zudem werden die Tätigkeiten innerhalb des Stacheldrahts näher beleuchtet. Buchtipp in dieser Folge: Das Höcker-Album: Auschwitz durch die Linse der SS Von Christophe Busch Quellen: Die Konzentrationslager-SS: Sozialstrukturelle Analysen und biographische Studien von Karin Orth https://www.youtube.com/watch?v=SOLzzP7Tz-A (Stand Juni 2023) Dachau Lied https://www.youtube.com/watch?v=uLgzDn0E_zY Rede Himmler (Stand Juni 2023) https://www.youtube.com/watch?v=wU7-06cj7C4 Zeitzeugen-Portal, Edith Kamnitzer Folgt @wunder.wissen.weltkrieg und @raphaelahoefnerautorin auf Instagram. Dort bekommt ihr mehr Infos zu den Folgen, Fotos, Fakten und Recherche-Einblicke.

#018 Das Grauen von Grenoble
Sepp Heinrichsberger wurde am 03. Oktober 1925 in München geboren. Die Familie zieht auf den Doberhof in Höslwang, ein Dorf in der Nähe des Chiemsees in Oberbayern. Schon als kleiner Bub muss Sepp auf dem Bauernhof mitarbeiten. Mit 17 Jahren erhält er seinen Einberufungsbefehl. Er wird der 3. Kompanie des Pionierbataillons zugeteilt und fährt von München aus mit Güterwaggons an die französische Atlantikküste. In Grenoble, eine Stadt in den französischen Alpen, müssen die deutschen Soldaten stets mit Partisanenangriffen aus dem Hinterhalt rechnen. Sepps bester Freund Bart Huber wird bei einem Einsatz direkt neben ihm von einer tödlichen Kugel getroffen. Ein Tunnel, der von seinen Kameraden durchquert werden muss, wird von den Partisanen mit Dynamit gesprengt. Alle Männer sterben. Sepp muss mit ansehen, wie Vergeltungsmaßnahmen an Zivilisten verübt werden. Kurz nach der Landung der Alliierten erlebt er eine schreckliche Odyssee in amerikanischer und französischer Kriegsgefangenschaft unter anderem in Gibraltar, New York und New Mexiko. In einer Kohlemine in Frankreich gerät Sepp zwischen einen Kohlewagen und bricht sich den Schädel. Fluchtversuche scheitern. Wie durch ein Wunder erreicht der Schwerverletzte an Heilig Abend 1947 seine Heimat. Die Erlebnisse belasten ihn noch heute. Interviewbeginn ab 8 Minuten History Wissen ab 1 Stunde und 11 Minuten Die Stadt Grenoble im Zweiten Weltkrieg Interviewpartner in dieser Folge: Sepp Heinrichsberger Folgt @wunder.wissen.weltkrieg und @raphaelahoefnerautorin auf Instagram. Dort bekommt ihr mehr Infos zu den Folgen, Fotos, Fakten und Recherche-Einblicke. Buchtipp in dieser Folge: „Irgendwie überlebt-Soldatenschicksale im Zweiten Weltkrieg“ von Klaus G. Förg, erschienen bei „Edition Förg“

#017 Die "Erste Dame" des Dritten Reichs
Magda Behrend wird 1901 als Tochter des 20jährigen, ledigen Dienstmädchens Auguste Behrend in Berlin-Kreuzberg geboren. Der Ingenieur Oskar Ritschel, den Auguste Behrend kurz darauf heiratet, erkennt das Kind zwar nicht als seines an, kümmert sich aber um dessen Erziehung, obwohl die Ehe bereits 1904 geschieden wird. Ritschel hat beruflich häufig in Belgien zu tun, und er kann Auguste überreden, die fünfjährige Magda in die Klosterschule der Ursulinen in Vilvoorde bei Brüssel zu geben, wo sie acht Jahre lang einer strengen, prüden, Gehorsam und Selbstdisziplin fordernden Erziehung ausgesetzt ist. Obschon Auguste evangelisch ist und mittlerweile wieder geheiratet hat – den freigeistig-jüdischen Kaufmann Richard Friedländer – ist sie einverstanden und zieht mit ihrem neuen Ehemann ebenfalls nach Brüssel. Nach Ausbruch des Krieges und der Verletzung der belgischen Neutralität werden 1914 die Deutschen aus Belgien ausgewiesen. Die Friedländers lassen sich in Berlin nieder, wo Magda das Kollmorgensche Lyzeum besucht.Im Herbst 1919 macht Magda Abitur. Sie ist zwar ehrgeizig, aber ihr Ehrgeiz ist auf kein bestimmtes Ziel gerichtet. Während einer Eisenbahnfahrt lernt Magda den Berliner Industriellen und Multimillionär Günther Quandt kennen. Nach einer Bedenkzeit willigt sie trotz der Einwände ihrer Mutter in seinen Heiratsantrag ein. Am 1. November 1921 wird der gemeinsame Sohn Harald geboren. Die Ehe zerbricht. Magda Quandt ist nun eine unabhängige, wohlhabende Frau, die das Leben in vollen Zügen genießt. Aber sie hat keine Aufgabe. Aus Langeweile besucht sie im Sommer 1930 eine politische Veranstaltung der Nationalsozialisten im Berliner Sportpalast. Dort spricht Goebbels, den sie später persönlich kennenlernt. Goebbels ist so hingerissen von ihr, dass er sie unbedingt heiraten will. Sie willigt ein, obwohl sie dann die großzügigen Zuwendungen ihres Ex-Mannes verliert. Die Hochzeit findet im Dezember 1931 statt; Hitler ist Trauzeuge. Im Laufe der nächsten Jahre bringt Magda sechs Kinder zur Welt. Da Hitler keine Frau an seiner Seite hat, wird Magda die Rolle der „ersten Dame“ im Deutschen Reich zugedacht. Sie begleitet den Führer bei Staatsbesuchen, Empfängen und Veranstaltungen. So posieren Magda und selbst die Kinder für Propagandazwecke: Immer wieder wird sie als Mustergattin und Vorzeigemutter auf Zeitschriftenfotos oder in der Wochenschau gezeigt (allein 1942 werden die Goebbels-Kinder 34-mal in der Wochenschau präsentiert). Im April 1945 zieht sie gemeinsam mit ihrem Mann Joseph Goebbels und ihren Kindern in den Führerbunker. Eine Flucht lehnt sie strikt ab. Am Abend des 01.Mai 1945 vergiftet Magda Goebbels schließlich ihre sechs Kinder im Kinderzimmer des Führerbunkers und nimmt sich einige Stunden später selbst das Leben. Folgt @wunder.wissen.weltkrieg und @raphaelahoefnerautorin auf Instagram. Dort bekommt ihr mehr Infos zu den Folgen, Fotos, Fakten und Recherche-Einblicke. Fimtipp: Der Untergang

#016 Das Wunder von Auschwitz
Dr. Leon Weintraub wurde am 1. Januar 1926 als Sohn eines Altkleidersammlers (Lumpen, Schmates) und einer Wäschereibetreiberin in Łódź/Polen geboren. Leon wächst in ärmlichen, aber glücklichen Verhältnissen am Rande zum Armenviertel in Łódź auf, wo sich das Leben auf der Straße abspielt. Mit seinen vier Schwestern redet Leon zu Hause Polnisch, mit seiner Mutter Jiddisch. 1939, als Leon 13 Jahre alt ist, marschiert die Wehrmacht in Polen ein und einige Monate später wird die Familie Weintraub ins Ghetto Litzmannstadt gebracht. Dort arbeitet Leon in einer Fabrik (Galvanisation, Klempnerei und Elektrische Werkstatt). Als die Deportationen aus Litzmannstadt beginnen, versteckt sich die Familie Weintraub, wird jedoch entdeckt. Im August 1944 folgt dann die Deportation ins KZ Auschwitz-Birkenau. Dort entgeht Leon der Vergasung durch den unbemerkten Anschluss eines Gefangentransports. So gelingt er ins KZ Groß-Rosen Außenkommando Dörnhau, wo er elektrische Arbeiten verrichtet. Ein Jahr später verlegt man Leon ins KZ Flossenbürg und später ins KZ Natzweiler-Struthof/Kommando Offenburg. Nach einem Monat gelingt Leon die Flucht vom Transport in Richtung Bodensee. Nach einigen Wochen Behandlung im Lazarett-Donaueschingen, kommt er nach Konstanz am Bodensee. Durch Zufall erfährt Leon, dass drei seiner Schwestern das KZ Bergen-Belsen überlebt haben, die er schließlich auch dort findet. Nach dem Kriege studiert Leon in Göttingen Medizin und promoviert 1966 in Warschau. Im Jahre 1969, als er seine Anstellung als Oberarzt verloren hat, wandert er nach Schweden aus, wo er bis heute noch lebt. Beginn des Interviews ab 8 Minuten History Wissen ab 1 Stunde 17 Minuten Das Ghetto Litzmannstadt Interviewgast in dieser Folge: Dr. Leon Weintraub Folgt @wunder.wissen.weltkrieg und @raphaelahoefnerautorin auf Instagram. Dort bekommt ihr mehr Infos zu den Folgen, Fotos, Fakten und Recherche-Einblicke. Buchtipp in dieser Folge: Die Versöhnung mit dem Bösen (Leon Weintraub und Magda Jaros)

#015 Der Propagandaminister
Joseph Goebbels wurde im Jahr 1897 im heutigen Mönchengladbach geboren. Seine Eltern sind streng gläubige Katholiken. Durch eine Krankheit hat er seit seiner Kindheit einen Klumpfuß und kann nur schlecht laufen. Darum darf er nicht als Soldat im Ersten Weltkrieg kämpfen. Stattdessen studiert er an der Universität und bekommt am Ende einen Doktortitel in Germanistik. Im Jahr 1924 trifft er in Weimar erstmals Anhänger des Nationalsozialismus und beginnt für deren Zeitung zu schreiben. Innerhalb der Partei steigt Goebbels schnell auf. Im Jahr 1926 ist er bereits Gauleiter, also Partei-Chef für die Stadt Berlin. Nachdem Hitler im Jahr 1933 zum Reichskanzler ernannt wird, gründet Goebbels das Propaganda-Ministerium. Dieses neue Ministerium kontrollierte Radio, Fernsehen und Zeitungen, aber auch Theater und Kinos. In den letzten Kriegstagen versteckt sich Goebbels mit seiner Familie in Hitlers Bunker in Berlin. Hitler begeht Suizid, ernennt Goebbels vorher aber noch zum neuen Reichskanzler. Er versucht noch, mit der Sowjetunion Frieden zu schließen. Die Russen verlangen aber von Deutschland, dass es den Krieg ohne Bedingungen beendet. Daraufhin vergiftet Goebbels sich, seine Frau und die Kinder. Erst 25 Jahre später werden die Leichen verbrannt und die Asche in Sachsen-Anhalt verstreut. Buchtipp in der Folge: Joseph Goebbels: Biographie von Peter Longerich erschienen im Siedler Verlag Folgt @wunder.wissen.weltkrieg und @raphaelahoefnerautorin auf Instagram. Dort bekommt ihr mehr Infos zu den Folgen, Fotos, Fakten und Recherche-Einblicke. Für Interviewanfragen: autorin@raphaela-hoefner.de Quellen: Joseph Goebbels: Biographie von Peter Longerich erschienen im Siedler Verlag https://youtu.be/md6lbxsF6J0 Rede im Sportpalast (Stand 21.05.2023) https://youtu.be/2pJvft8AUPo Infos aus der Doku sowie Stimmen der Goebbels-Kinder (Stand 21.05.2023) https://youtu.be/XMDRYDpt89s Lied „Wie machen Musik“ von Ilse Werner (Stand 21.05.2023) https://youtu.be/b8FKmDQi1kc Goebbels Rede „Der Rundfunk gehört uns“ (Stand 21.05.2023) https://youtu.be/md6lbxsF6J0 Goebbels Rede 1932 (Stand 21.05.2023)

#014 Sterben für die Freiheit
Am 09. Mai 1921 wird Sophie Scholl in Forchtenberg geboren und wächst in Ulm auf. Februar 1943: Die Geschwister Scholl verteilen etwa 1.500 Flugblätter in der Münchner Uni. Ein Hausmeister, der sie dabei beobachtet hält sie fest. Die Gestapo verhaftet Hans und Sophie Scholl, ebenfalls Christoph Probst, ein weiteres Mitglied der „Weißen Rose“. 22. Februar: Nach dreitägigem Verhör folgt der Prozess vor dem Volksgerichtshof. Den Vorsitz führt der aus Berlin angereiste Roland Freisler. Hans und Sophie Scholl werden gemeinsam mit Christoph Probst zum Tod verurteilt und noch am selben Tag im Strafgefängnis München-Stadelheim hingerichtet. Tim Pröse ist freier Journalist und Buchautor. Er studierte an der Uni Essen Kommunikationswissenschaften, Politik und Psychologie und schrieb als freier Mitarbeiter für diverse namenhafte Zeitungen. 2002 wechselte er zum „Focus“, wo er als Redakteur in erster Linie Reportagen und Portraits schrieb. In seinem Longseller „Jahrhundertzeugen. Die Botschaft der letzten Helden gegen Hitler“ portraitiert er achtzehn Widerstandskämpfer, Lebensretter sowie Überlebende der NS-Terrors. Unter anderem begegnet er dabei Inge Aicher-Scholl, Schwester von Sophie und Hans. Mit seiner szenischen Lesung „Eine Hommage an Sophie Scholl“ besucht er unter anderem viele Schulen, um an diese mutige junge Frau zu erinnern, die bereit war, für ihre Überzeugungen zu sterben. Im Interview spreche ich mit Tim darüber, weshalb Sophie ein leuchtendes Vorbild und eine Mutmacherin gegen Hass und Hetze ist. Zudem erinnert er sich an weitere „Jahrhundertzeugen.“ Beginn des Interview ab 10 Minuten History Wissen ab 56 Minuten Die Widerstandsgruppe "Weiße Rose" mit Sophie und Hans Scholl Interviewgast in dieser Folge: Tim Pröse Folgt @wunder.wissen.weltkrieg und @raphaelahoefnerautorin auf Instagram. Dort bekommt ihr mehr Infos zu den Folgen, Fotos, Fakten und Recherche-Einblicke. Für Interviewanfragen: autorin@raphaela-hoefner.de Buchtipp: „Jahrhundertzeugen. Die Botschaft der letzten Helden gegen Hitler“ von Tim Pröse „Hans-Erdmann Schönbeck: »… und nie kann ich vergessen«“ von Tim Pröse beide Bücher sind im Heyne Verlag erschienen

#013 Jugend für den Führer
Hans Müncheberg wurde am 9. August 1929 in Templin geboren. Zusammen mit seinem älteren Bruder wächst Hans in der Familie eines Friseurmeisters auf. Im Frühjahr 1938 wird er beim Spielen von einem PKW angefahren und erleidet eine schwere Schädelverletzung. Er kann sich weder an die Eltern oder seinen Bruder, noch an sein bisheriges Leben erinnern. Innerhalb eines Jahres kann er den Lernrückstand aufholen. Mit zehn Jahren wird Hans für eine Ausbildung an einer Nationalpolitischen Erziehungsanstalt (NPEA / Napola) in Potsdam ausgewählt. Sein Versuch, sich den Schikanen durch eine Flucht nach Hause zu entziehen, scheitert. 1945 wird Hans von Potsdam aus im Rahmen des einer Versehrteneinheit der Waffen-SS unterstellten Volkssturm in der Verteidigungsschlacht gegen Berlin eingesetzt. Mit seinen nur 15 Jahren wird er am 2. Mai bei Staaken stark verwundet und überlebt nur durch ein Wunder. Hans Müncheberg arbeitete als deutscher Fernseh-Dramaturg, Schriftsteller, Fernseh- und Drehbuchautor. Beginn des Interviews ab 6 Minuten History Wissen ab 1 Stunde 11 Minuten Napola (Nationalpolitische Bildungsanstalt) Interviewpartner in dieser Folge: Hans Müncheberg Folgt @wunder.wissen.weltkrieg und @raphaelahoefnerautorin auf Instagram. Dort bekommt ihr mehr Infos zu den Folgen, Fotos, Fakten und Recherche-Einblicke. Für Interviewanfragen: autorin@raphaela-hoefner.de Buchtipp: Gelobt sei, was hart macht – Hans Müncheberg (NoRa Verlag)

#012 Das Trümmermädchen
Karin Kasimir wurde 1938 in Berlin geboren. Sie bezeichnet sich selbst als „waschechte Berlinerin“, da ihre Großeltern aus Schlesien kamen. Während des Krieges evakuierte sie mit ihrer Mutter in den Spreewald, wo auch ihre jüngere Schwester geboren wurde. Dort erlebte Karin Kasimir den Einmarsch der Roten Armee. Als sie sechs Jahre alt ist, erwischt ihre Familie einen der letzten Züge von Lübbenau (Spreewald) nach Berlin. In den Abteilen kauern Verwundete. Der Zug wird immer wieder angehalten, überfallen, die Passagiere ausgeraubt. Zehn Stunden kann sie sich nicht bewegen. Endlich erreichen sie den Bahnhof Zoo in Berlin. Zu Fuß muss die junge Mutter mit der sechsjährigen Karin an der Hand und der kleinen Schwester im Kinderwagen quer durch die Stadt nach Hause laufen. Der Vater ist im Krankenhaus. Der Alltag in der Hauptstadt ist nach Kriegsende knüppelhart. So ist Karin eine der ersten Schülerinnen nach dem Krieg in Berlin-Neuköln. 40-45 Mädchen sind damals in ihrer Klasse. Schulbücher fehlen, genauso Bleistifte. Der Hunger ist täglicher Begleiter. Noch heute kann Karin Kasimir nicht in einem dunklen Raum schlafen, da dieser sie an einen Luftschutzbunker erinnert. Beginn des Interviews ab 05:55 Minuten History Wissen ab 1 Stunde 8 Minuten Die Kesselschlacht von Halbe Interviewgast in dieser Folge: Frau Karin Kasimir Folgt @wunder.wissen.weltkrieg und @raphaelahoefnerautorin auf Instagram. Dort bekommt ihr mehr Infos zu den Folgen, Fotos, Fakten und Recherche-Einblicke. Für Interviewanfragen: autorin@raphaela-hoefner.de http://raphaela-hoefner.com

#011 In der Hölle der Westfront
David Marshall wurde am 20. September 1924 in New York geboren. Nach dem Angriff auf Pearl Harbor meldet er sich wie viele andere junge Amerikaner freiwillig zur Army. Nach seinem Draft im Februar 1943 wird David ins Trainingslager Camp Pickett nach Virginia geschickt. Dort hat er mit einigen antisemitischen Anfeindungen zu kämpfen. Anschließend wird er dem 84. Infanterieregiment, den sogenannten „Railsplitters“ zugeteilt. Dort lernt er seinen besten Freund Benedict George Schmitt („Smitty“) kennen. Im September 1944 wird Davids Einheit mit dem Boot über den Atlantik nach England gebracht. Am 01. November 1944 erreichen die Railsplitters Frankreich und arbeiten sich an die sogenannte „Siegfried Line“ durch. Am 19. November 1944 kämpft David bei der Schlacht um Geilenkirchen. Der kleine Ort ist ein wichtiger Knotenpunkt vor Aachen. Hier verliert er seinen besten Freund „Smitty“. Im eiskalten Winter 44/45 befinden sich die Railsplitters mitten in der Ardennenoffensive. Die Männer müssen bei Minus 20 Grad in Erdlöchern ausharren und immer wieder erbitterte Schlachten kämpfen. Die Amerikaner rücken immer weiter und weiter, bis David den Rhein überquert. Am 10. April 1945 befreit seine Einheit das Konzentrationslager Ahlem in der Nähe von Hannover. Das Kriegsende erlebt David im Mai 1945 an der Elbe. David ist inzwischen 98 Jahre alt und lebt nach wie vor in New York. Immer wieder kehrt er in die Niederlande zurück und besucht den Soldatenfriedhof in Margraten, auf dem Smitty begraben liegt. Beginn des Interviews: 6 Minuten 40 Sekunden History Wissen: Die Ardennenoffensive Ab 53 Minuten Interviewpartner in dieser Folge: David Marshall Buchtipp in dieser Folge: Das große Finale meiner 3.Reich-Saga „Von Freiheit und Wundern“. Die Kapitel über „Levi“ basieren auf Davids Erzählungen Folgt @wunder.wissen.weltkrieg und @raphaelahoefnerautorin auf Instagram. Dort bekommt ihr mehr Infos zu den Folgen, Fotos, Fakten und Recherche-Einblicke. Für Interviewanfragen: autorin@raphaela-hoefner.de http://raphaela-hoefner.com/Romane/Recherche/ Serientipp: Band of Brothers

#010 Ein unvergessenes Leben- Erinnerungen an Anne Frank
Anne Frank wird am 12. Juni 1929 in Frankfurt am Main als zweite Tochter von Otto Frank und Edith Frank-Holländer geboren. Die Familie wandert 1934 in die Niederlande aus, um der Verfolgung durch die Nationalsozialisten zu entgehen. Am 10. Mai 1940 werden die Niederlande von der deutschen Wehrmacht angegriffen und besetzt. Juden werden vom gesellschaftlichen Leben und allen öffentlichen Einrichtungen ausgeschlossen. Das Kino-Verbot trifft die lebenslustige Anne besonders hart. An ihrem 13 Geburtstag bekommt Anne von ihrem Vater ein Tagebuch geschenkt. Noch am selben Tag beginnt sie ihr Tagebuch zu schreiben und nennt es „Kitty“. Am 06. Juli 1942 zieht die Familie Frank ins Hinterhaus von Ottos Firma, das es monatelang mit mutigen Helfern vorbereitet hat. In diesem Versteck hält Anne all ihre Erlebnisse und Gedanken im Tagebuch fest. Am Morgen des 4. August 1944 gegen 10 Uhr morgens erscheint die Ordnungspolizei und verhaftet alle Menschen, die im Hinterhaus versteckt leben. Anne und Margot Frank sterben etwa Ende Februar 1945 in Bergen-Belsen. Otto Frank kehrt nach dem Krieg in die Niederlande zurück und veröffentlicht Annes Tagebuch. Dieses gilt als historisches Dokument aus der Zeit des Holocaust und Anne als Symbolfigur gegen die Unmenschlichkeit des Völkermordes in der Zeit des Nationalsozialismus. Buddy (Bernd), 1925 in Frankfurt geboren und in Basel aufgewachsen, ist der Cousin von Anne. Er wird nach seiner internationalen Karriere als Eisclown und Schauspieler Präsident des Anne Frank Fonds in Basel. Otto Frank besucht seine jüngere Schwester Leni (Buddys Mutter) regelmäßig in Basel. Auch die Sommerferien verbringt Buddy mit seiner jüngeren Cousine Anne und teilt mit ihr die Liebe zum Eislaufen. Am 3. Juni 1942 schreibt Anne einen Geburtstagsbrief an ihren Cousin Buddy. Es ist der letzte direkte Kontakt zwischen den beiden… Beginn des Interviews ab:9 Minuten History Wissen: ab 1 Stunde, 5 Minuten Anne Frank Interviewpartner in dieser Folge: Oliver Elias Folgt @wunder.wissen.weltkrieg und @raphaelahoefnerautorin auf Instagram. Dort bekommt ihr mehr Infos zu den Folgen, Fotos, Fakten und Recherche-Einblicke. Für Interviewanfragen: autorin@raphaela-hoefner.de Buchtipp in dieser Folge: "Grüße und Küsse an alle: Die Geschichte der Familie von Anne Frank" von Mirjam Pressler

#009 Soldat wider Willen
Eduard Gutkas wurde am 10. Dezember 1927 in München geboren. Als einziges Kind seiner Eltern, die eine Gaststätte in München betreiben, wächst er in der „Hauptstadt der Bewegung“ auf. Edi wird zum Beitritt bei der Hitlerjugend gezwungen und als Flakhelfer ausgebildet. Mit seiner Truppe ist er vor den Toren Münchens positioniert, als über 500 alliierte Flieger einen Angriff starten und Bomben auf die Stadt abwerfen. Sie sollen die Flugzeuge aus der Luft holen und abschießen. Ebenso bewacht Edi mit seinem Freund das Konzentrationslager Dachau und soll „auf jeden schießen, der durch das Tor rennt.“ Um der SS zu entgehen, meldet sich Edi freiwillig bei den Gebirgsjägern, da er ein sehr guter Skifahrer und überdurchschnittlich sportlich ist. Ende April 1945 steht er den Amerikanern in Schongau gegenüber, kommt nach München und taucht drei Tage vor dem Einmarsch der amerikanischen Truppen bei einem Freund unter. Noch immer werden „Fahnenflüchtige“ denunziert und standesrechtlich erschossen. In seiner Zeit als Soldat hat Edi mehr als nur ein Wunder erlebt. Beginn des Interviews ab: 06 Minuten History Wissen ab 1 Stunde, 20 Sekunden: Edis Geburtsstadt München im Zweiten Weltkrieg Interviewpartner in dieser Folge: Eduard Gutkas Folgt @wunder.wissen.weltkrieg und @raphaelahoefnerautorin auf Instagram. Dort bekommt ihr mehr Infos zu den Folgen, Fotos, Fakten und Recherche-Einblicke. Für Interviewanfragen: autorin@raphaela-hoefner.de Buchtipp: 111 Orte in München auf den Spuren der Nazi-Zeit von Rüdiger Liedtke

#008 D-Day: Schlacht um die Normandie
George Sarros wurde am 17. April 1925 in Chicago, USA, geboren. Mit 18 Jahren kam er zur US-Army und arbeitete auf der LST 515 im Maschinenraum. Sarros nahm an der Geheimmission „Exercise Tiger“ im April 1944 teil. Dort trainierten die britischen und US-amerikanischen Streitkräfte an den „Slapton Sands“ im englischen Devon am Ärmelkanal die geplante Landung in der Normandie. Deutsche U-Boote torpedierten jedoch die Schiffe und versenkten zwei von acht Landungsbooten in der Nacht, wobei 946 US-Soldaten starben. George erlebt diesen Angriff hautnah mit. Am 06. Juni 1944 landet er mit seinem Schiff um 1 Uhr Mittag am Omaha Beach in der Normandie. Er sagt: „They opened the doors and out came tanks, troops, and ambulances. We looked up and a German plane was right above us. I knew that was the end.“ Sein Schiff bringt die Verwundeten zurück nach England. Noch immer hört er die Schreie der Männer, die ihr Leben an diesem Tag verloren haben. George war bereits zweimal am Ort des Geschehens und plant erneut, den Kriegsschauplatz zu besuchen. Interviewpartner in dieser Folge: George Sarros Beginn des Interviews ab 6 Minuten 55 Sekunden History Wissen ab 47 Minuten Exercise Tiger Folgt @wunder.wissen.weltkrieg und @raphaelahoefnerautorin auf Instagram. Dort bekommt ihr mehr Infos zu den Folgen, Fotos, Fakten und Recherche-Einblicke. Für Interviewanfragen: autorin@raphaela-hoefner.de Buchempfehlung: Exercise Tiger: The D-Day Practice Landing Tragedies Uncovered by Richard T. Bass

#007 Kindheit unterm Hakenkreuz
Margarete Meyer wurde am 06.Mai 1930 in Leipzig geboren, ihre Heimatstadt ist jedoch Dresden. Sie wächst bei ihrer Mutter und deren Familie auf, ihre Eltern sind getrennt. 1936 zieht Margarete mit nach Rathen, wo sie eingeschult wird. Die Mutter arbeitet in der Pension einer „Halbjüdin“ als Wirtschafterin, die jedoch nach Kriegsbeginn schließen muss. Daraufhin ziehen die beiden zurück nach Dresden. Die schweren Luftangriffe auf Dresden vom 13.-15. Februar erlebt die damals 14-Jährige in einem Vorort mit. Sie sieht die amerikanischen Tiefflieger, die auf die Flüchtenden schießen und bekommt schreckliche Zerstörungen mit. Ihr eigenes Haus liegt in Schutt und Asche. Die Rote Armee marschiert ein und die Jugendliche muss sich an die allmähliche Umgestaltung des Lebens und ihrer Schule im Sinne der SED gewöhnen. Nach ihrem Abitur 1949 studiert „Gretl“ an der Fachschule für Bibliothekare in Leipzig, lernt dort ihren Ehemann kennen und findet später eine Anstellung in Berlin. Insgesamt hat Margarete vier deutsche Regierungen miterlebt. Beginn des Interviews ab 7:00 Minuten History Wissen ab 39 Minuten Der 09. November in der Deutschen Geschichte Interviewpartnerin in dieser Folge: Margarete Meyer Folgt @wunder.wissen.weltkrieg und @raphaelahoefnerautorin auf Instagram. Dort bekommt ihr mehr Infos zu den Folgen, Fotos, Fakten und Recherche-Einblicke. Für Interviewanfragen: autorin@raphaela-hoefner.de

#006 Mein Vater, der Naziverbrecher
Niklas Frank wurde am 09. März 1939 als Sohn des nationalsozialistischen Politikers Hans Frank in München geboren. Im selben Jahr tritt der Vater sein Amt als Generalgouverneur in dem von der Wehrmacht besetzten Teil Polens an. Ab November 1939 residierte er auf der Krakauer Burg Wawel, dem Stammsitz der polnischen Könige. Während sich das Land draußen in ein einziges großes Todeslager verwandelt, lebt die Familie Frank in einem für Kriegsverhältnisse unvorstellbaren Luxus und in Sicherheit. Niklas Frank wächst mit seinen vier Geschwistern in einem kleinen privaten Königreich auf, in dem alles da ist, nur die Liebe fehlt. Manchmal darf der kleine Junge mit seiner Mutter zum „Einkaufen“ ins Ghetto fahren. Bevor die Rote Armee einfällt, zieht sich die Familie Frank auf ihr Anwesen in Neuhaus in Oberbayern zurück. Dort erlebt Niklas Frank die Verhaftung seines Vaters durch die amerikanische Militärpolizei. Hans Frank wird in Nürnberg als Kriegsverbrecher angeklagt, 1946 zum Tode verurteilt und gehängt. Niemand erklärt dem siebenjährigen Niklas, wieso. Später rekonstruierte er das Lebens seines Vaters aufgrund jahrelanger Recherchen, in deren Verlauf er das ungeheure Ausmaß von dessen Verbrechen erkennen muss. Niklas wird Journalist und schreibt als Reporter jahrelang für das Wochenmagazin „Stern“. Zudem hat er zahlreiche Bücher geschrieben. Beginn des Interviews ab 06:33 Minuten History Wissen ab 1 Stunde 1 Minute Hans Frank Interviewpartner in dieser Folge: Niklas Frank Folgt @wunder.wissen.weltkrieg und @raphaelahoefnerautorin auf Instagram. Dort bekommt ihr mehr Infos zu den Folgen, Fotos, Fakten und Recherche-Einblicke. Für Interviewanfragen: autorin@raphaela-hoefner.de Weitere Infos über Niklas Frank unter: https://niklasfrank.de/

#005 Der Junge aus Theresienstadt
Gidon Lev wurde am 03. März 1935 in Karlsbad, in der damaligen Tschechoslowakei geboren, und wird dieses Jahr 88 Jahre alt. Seine Familie floh 1938 aus dem Sudetenland nach Prag, nachdem die Nazis dieses annektiert hatten. 1941, nur wenige Jahre später, wird Gidon mit seiner Familie in das Konzentrationslager Theresienstadt, ein Nazi-Ghetto, transportiert. Damals ist er erst sechs Jahre alt. 26 von seinen Familienmitgliedern werden im Holocaust ermordet. Darunter ist auch Gidons Vater, der auf dem Transport von Auschwitz nach Buchenwald stirbt. Gidon erlebt als Kind die Schrecken in Theresienstadt, den schlimmen Hunger und die harte Arbeit. Er ist zehn Jahre alt, als die Rote Armee das Konzentrationslager im Mai 1945 befreit. Von den über 9000 inhaftierten Kindern ist er eines von mehr als 2000, die schätzungsweise überlebt haben. Heute kämpft Gidon auf TikTok gegen Hass und Antisemitismus und will vor allem die junge Generation über den Holocaust aufklären. Beginn des Interviews ab 7:00 Minuten History Wissen ab 1 Stunde 8 Minuten Das Ghetto Theresienstadt Interviewpartner in dieser Folge: Gidon Lev Folgt @wunder.wissen.weltkrieg und @raphaelahoefnerautorin auf Instagram. Dort bekommt ihr mehr Infos zu den Folgen, Fotos, Fakten und Recherche-Einblicke. Buchtipp in der Folge: The True Adventures of Gidon Lev: Rascal. Holocaust Survivor. Optimist. (von Julie Gray) TikTok: https://www.tiktok.com/@thetrueadventures https://www.thetrueadventures.com/media-appearances-interviews Für Interviewanfragen: autorin@raphaela-hoefner.de

#004 Himmelfahrtskommando
Ed Cottrell wurde am 17. Januar 1922 geboren und wuchs in Slippery Rock, Pennsylvania, USA auf. Als die Amerikaner 1941 in den Krieg eintreten, beschließt Ed, Pilot zu werden. Nach seiner Ausbildung in Wisconsin kommt der 22-Jährige zur „48th Fighter Group, 493rd Fighter Squadrin“ und wird in Frankreich als Jagdflieger eingesetzt. Ed fliegt eine P-47 Thunderbolt Maschine. Seine Aufgabe besteht unter anderem darin, Brücken, Schienen, Maschinengewehr-und Panzerstellungen zu bombardieren. Jeder einzelne Flug ist ein Himmelfahrtskommando. Am 17. Dezember 1944 erlebt Ed sein persönliches Wunder, als sein Flugzeug von feindlichen Fliegern getroffen wird. Am selben Tag stirbt einer seiner Zimmergenossen. Die bei den Amerikanern als „Battle of the Buldge“ bekannte Ardennenoffensive fordert die Männer auf beiden Seiten aufs Äußerste. Beginn des Interviews ab 5:30 Minuten History Wissen ab 46:30 Minuten Die Jagdflugzeuge der Deutschen und Amerikaner Interviewpartner in dieser Folge: Ed Cottrell Folgt @wunder.wissen.weltkrieg und @raphaelahoefnerautorin auf Instagram. Dort bekommt ihr mehr Infos zu den Folgen, Fotos, Fakten und Recherche-Einblicke. Buchtipp in der Folge: The Rifle: Combat Stories from America's Last WWII Veterans, Told Through an M1 Garand von Andrew Biggio Ed Cottrells Sprung aus dem Flugzeug: https://www.youtube.com/watch?v=ri7vu32a8Is

#003 Tränen, Tod und Trümmer
Adolf Knoblich wurde 1932 in Radebeul geboren und verbrachte einen Teil seiner Kindheit in Breslau. Auf der Flucht vor der Roten Armee fährt seine Familie genau am Abend des 13. Februars 1945 nach Dresden. Bei einer Tante wollen sie Schutz im Inneren des „Deutschen Reichs“ suchen. Alles kommt anders als erwartet. Unglücklicherweise geraten sie in den schweren Bombenangriff auf Dresden. Adolfs Zwillingsbruder wird dabei sehr schwer verletzt. Nur knapp gelingt es der Familie zu überleben. Beginn des Interviews ab 6 Minuten History Wissen ab 52 Minuten Breslau-Geschichte einer Stadt im Zweiten Weltkrieg Interviewpartner in dieser Folge: Adolf Knoblich Folgt @wunder.wissen.weltkrieg und @raphaelahoefnerautorin auf Instagram. Dort bekommt ihr mehr Infos zu den Folgen, Fotos, Fakten und Recherche-Einblicke. Für Interviewanfragen: autorin@raphaela-hoefner.de

#002 Die Feuerhölle von Dresden
In der zweiten Folgen von "Wunder. Wissen. Weltkrieg" spricht Raphaela Höfner mit Eva-Maria Mathes. Diese wird 1932 in Dresden geboren, wächst in der Stadt auf und geht dort zur Schule. In der Nacht vom 13. Februar 1945 erlebt Eva-Maria als damals Zwölfjährige einen der verheerendsten Luftangriffe auf eine Stadt im Zweiten Weltkrieg. Dresden brennt. Bomben fallen. Zigtausende verlieren in wenigen Stunden ihr Leben. Eva-Maria kann der Feuerhölle in letzter Sekunde entkommen. Die schrecklichen Bilder haben sich bis heute tief in ihr Gedächtnis gebrannt. Beginn des Interviews ab 04:00 Minuten History Wissen ab 1:06 Stunde: Der Luftangriff auf Dresden vom 13./14. Februar 1945 Interviewpartnerin in dieser Folge: Eva-Maria Mathes Folgt @wunder.wissen.weltkrieg und @raphaelahoefnerautorin auf Instagram. Dort bekommt ihr mehr Infos zu den Folgen, Fotos, Fakten und Recherche-Einblicke. Für Interviewanfragen: autorin@raphaela-hoefner.de

#001 Inferno an der Ostfront
In der ersten Folge von "Wunder. Wissen. Weltkrieg" spricht Raphaela Höfner mit dem ehemaligen Frontsoldaten Fritz Roller. Dieser wird 1922 geboren und erlebt seine Jugend unter der Hakenkreuzflagge in Stuttgart. Der Vater ist Kommunist und gerät ins Visier der Nazis. Fritz wird eingezogen, kommt zur Nachrichtentruppe und wird an die Ostfront geschickt. Dort wird er Augenzeuge eines der größten Massaker der Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Die schrecklichen Szenen verfolgen ihn bis heute. Beginn des Interviews ab 05:33 Minuten History Wissen ab 1:21 Stunde: Das Massaker von Babyn Jar am 30. September 1941 Interviewpartner in dieser Folge: Fritz Roller Folgt @wunder.wissen.weltkrieg und @raphaelahoefnerautorin auf Instagram. Dort bekommt ihr mehr Infos zu den Folgen, Fotos, Fakten und Recherche-Einblicke. Für Interviewanfragen: autorin@raphaela-hoefner.de

Trailer
Am 27. November 2022 startet der History-Podcast "Wunder. Wissen. Weltkrieg". Raphaela Höfner geht auf Zeitreise und interviewt ehemalige Soldaten, US-Veteranen, Flüchtlinge, Überlebende und Opfer des Zweiten Weltkriegs und des Nationalsozialismus. Erlebt alle Schrecken und Wunder, die die Gäste erlebt haben, hautnah. Hier seid ihr richtig, wenn ihr euch für den Tatort "Zweiter Weltkrieg" interessiert. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen.