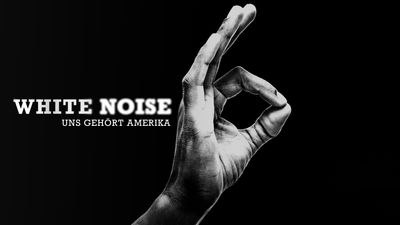Die Theologinnen Karoline Ritter und Katharina von Kellenbach gehen den christlichen Traditionslinien hinter modernen antisemitischen Stereotypen nach. Moderne antisemitische Stereotype wurzeln oft in antijüdischen Auslegungen biblischer Texte und Motive, die jahrhundertelang von der christlichen Theologie tradiert wurden. Selbst in heutigem Judenhass und Verschwörungsglaube wirken diese christlich grundierten Zerrbilder unbewusst weiter. Die Theologinnen Karoline Ritter und Katharina von Kellenbach gehen diesen Traditionslinien auf den Grund. In jeder Folge dieses Podcasts sprechen sie über ein bestimmtes antisemitisches Motiv aus der christlichen Tradition. Den Ausgangspunkt bildet stets eine konkrete Darstellung zum Beispiel in einem Schulbuch oder in den sozialen Medien. Mit den Mitteln von Theologie und Religionswissenschaft sowie mit Erkenntnissen aus dem jüdisch-christlichen Dialog schlagen Ritter und von Kellenbach Interpretationen biblischer Motive und Geschichten vor, die ohne antijüdische Codes und Projektionen auskommen. Katharina von Kellenbach ist Projektreferentin, Karoline Ritter Mitarbeiterin im Projekt "Bildstörungen: Elemente einer antisemitismuskritischen Theologie und Religionspädagogik" an der Evangelischen Akademie zu Berlin. Das Projekt wird gefördert vom Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus sowie vom Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Mehr zum Projekt Bildstörungen unter www.eaberlin.de/bildstoerungen und auf Instagram unter @projektbildstoerungen. Fragen, Kritik, Anregungen? Wir freuen uns über Feedback! Weiterführende Informationen zum Thema bietet die Broschüre „Störung hat Vorrang“ (www.eaberlin.de/stoerung-hat-vorrang), die das Projekt "Bildstörungen" gemeinsam mit dem Netzwerk antisemitismus- und rassismuskritische Religionspädagogik und Theologie (narrt) und weiteren Beteiligten erarbeitet hat. Die Broschüre wird vom DisKursLab der Evangelischen Akademie gemeinsam mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus herausgegeben. Die Musik im Podcast stammt von #Uppbeat (https://uppbeat.io/t/avbe/night-in-kyoto, License code: RZIY1FKHW89ELKUI).
Alle Folgen
Die Hure Babylon
Mit dem Bild der „Hure Babylon“ aus dem biblischen Buch der Apokalypse (Offenbarung) kommen wir unter anderem auf die Ereignisse vom 7. Oktober 2023 und auf sexuelle Gewalt gegen Frauen zu sprechen. Wir reden über die verzerrte christliche Rezeption apokalyptischer Bilder, aus denen starke Feindbilder geworden sind, die Gut und Böse klar unterscheiden und die sich auch in gegenwärtigem Israelhass zeigen. In der „Hure Babylon“ verbinden sich der Hass auf die sündige Stadt mit ihrem Luxus, ihrer Lust und ihrem Schmutz mit Frauen- und Judenhass. Westliche Dekadenz symbolisiert sich in Städten wie New York, Tel Aviv und Berlin – nicht zufällig Städte mit namhaften jüdischen Gemeinschaften. Sie werden zu Zielscheiben politischer und religiöser Reinigungsfantasien und terroristischer Attacken. Die Apokalypse spricht von Städten aber nicht nur als Feind sondern hat eine Vision eines „neuen Jerusalems“. Ermöglicht uns dieses Bild, Gesellschaftskritik mit Hoffnungen und Ängsten konstruktiv zu verbinden? Diese Folge haben wir live vor Publikum beim Sommerfest 2024 der Evangelischen Akademie zu Berlin aufgezeichnet.

David und Goliat
Ein Hirtenjunge, der mit ein paar Kieselsteinen und einer Steinschleuder gegen einen schwer gerüsteten Riesen antritt: Die Steinschleuder ist zum Symbol des palästinensischen Widerstandes geworden. Dabei ist es bei den diversen militärischen Playern überhaupt nicht so eindeutig, wer mit David und wer mit Goliat zu identifizieren wäre. Schon deshalb eignet sich diese biblische Geschichte nicht, um die Guten von den Bösen und die Ohnmächtigen von den Mächtigen zu unterscheiden. Wir schauen uns die Geschichte von David noch einmal an, der mit seiner schillernden Persönlichkeit gar nicht dazu taugt, zu heroisieren oder zu dämonisieren.
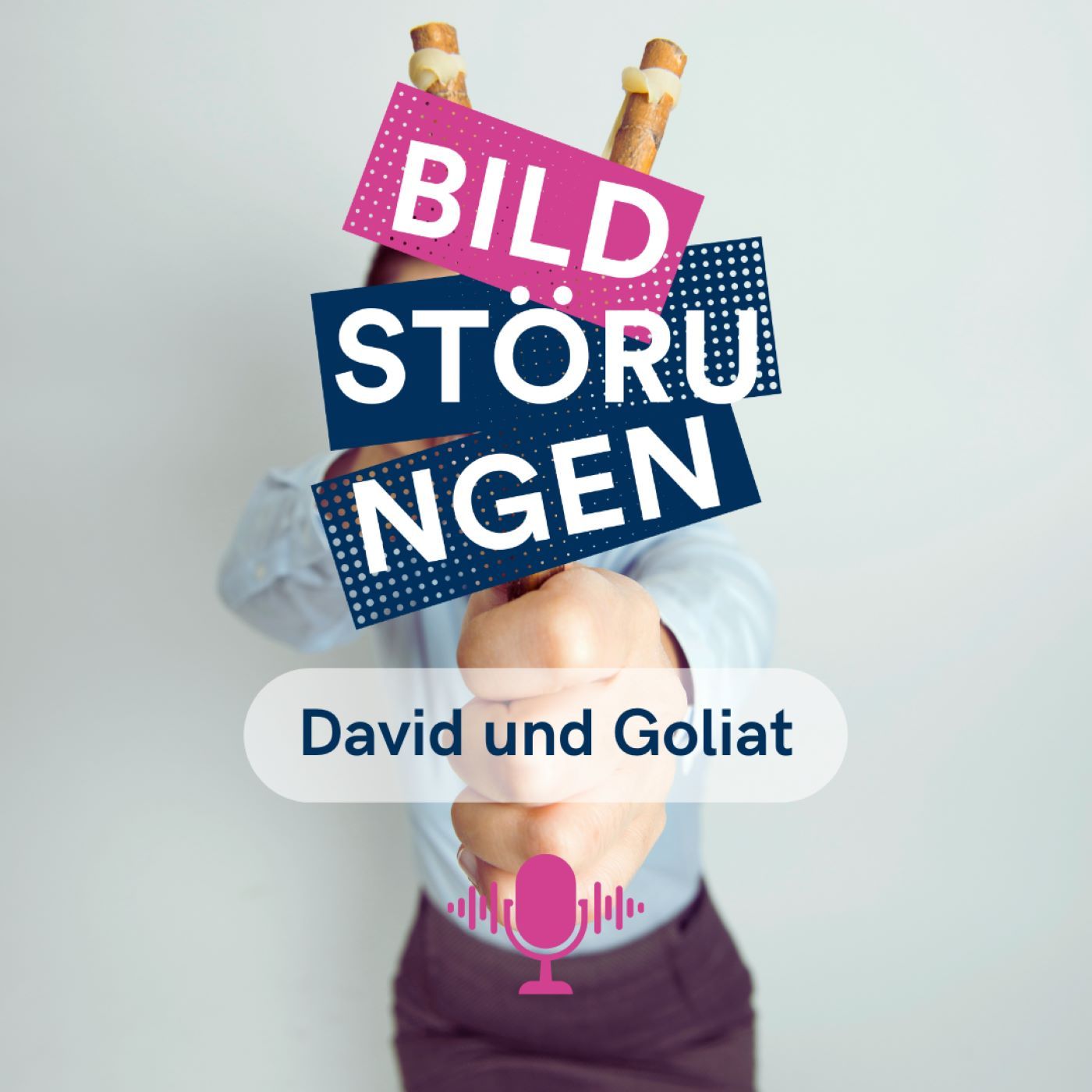
Auge um Auge, Zahn um Zahn
In den Medien wird oft von „Vergeltungsschlägen“ und „Racheakten“ gesprochen, wenn vom Krieg zwischen Israel und der Hamas berichtet wird. Dann wird vor der Logik des „Auge um Auge“ und einer drohenden Gewaltspirale gewarnt. Dass dies mit Blick auf Russlands Krieg gegen die Ukraine nicht geschieht, zeugt von einem Doppelstandard, der dem Staat Israel das Recht auf Verteidigung abspricht. Wir nehmen das Talionsprinzip aus der Tora (Auge um Auge) näher unter die Lupe, und fragen, wie dieser juristische Entschädigungsgrundsatz zur Beilegung von Konflikten eigentlich zur gewaltsamen Rache wurde.

„Kindermörder Israel“
Auf pro-palästinensischen Demonstrationen und in entsprechenden Stellungnahmen wird Israel immer wieder als „Kindermörder“ bezeichnet. Wenn furchtbare Kriegsereignisse benutzt werden, um den Mythos vom verschwörerischen, rituellen Blutopfer zu bedienen, wird der Staat Israel damit dämonisiert. Dieser Mythos ist nicht nur in der christlichen, sondern auch in der islamischen Welt weit verbreitet. Warum findet er so viel Anklang? Wir gehen zurück bis in die biblische Passionsgeschichte, um das Klischeebild einer jüdischen Verschwörung zu stören, die den unschuldigen Gottessohn vermeintlich quälen und töten will.

Antisemitische Bilder von Geld, Zins und Wucher: Eine historische Einführung mit Mathias Berek
Zu allen Zeiten war die überwiegende Mehrheit der Juden und Jüdinnen arm. Mit Mathias Berek vom Zentrum für Antisemitismusforschung und Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt sprechen wir über die wirtschaftlichen und politischen Bedingungen jüdischen (Über-)Lebens im christlichen Europa. Und Berek erklärt, was diese Vorurteile mit christlichem Abgrenzungsbedürfnissen, Konkurrenzsituationen und Projektionen eigenen Unbehagens im Umgang mit Geld zu tun haben.

Antisemitismus als Götzendienst: Yael Kupferberg zum biblischen Bilderverbot
Laut Yael Kupferberg wurzelt christlicher Judenhass in der Missachtung des biblischen Bilderverbots. Über diese These sprechen wir mit der Literaturwissenschaftlerin vom Zentrum für Antisemitismusforschung und Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt in dieser Folge. Dort wo „G-tt“ verdinglicht, verbildlicht, und vermenschlicht wird, so Kupferberg, werden Jüdinnen und Juden zur Zielscheibe, weil sie immer wieder auf der Unverfügbarkeit, Offenheit und Identitätslosigkeit des „Einen“ G-ttes Israels beharren. Antisemitismus ist nach dieser Lesart eine Form von Götzendienst, der sich tief in die christliche Theologie eingegraben hat.

Antisemitismus und Rassismus: Felix Axster über das Motiv des Sündenbocks
Die rassismuskritischen (postkolonialen) und antisemitismuskritischen Diskurse sind derzeit besonders aufgeladen und politisch brisant. Wir sprechen mit dem Historiker Felix Axster vom Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin über die Entstehungsgeschichte der Rassetheorie im frühen 19. Jahrhundert und darüber, was Antisemitismus von Rassismus unterscheidet. Axster will eine „Aufmerksamkeitskonkurrenz“ zwischen beiden Phänomenen verhindern und mehr Bewusstsein für die Parallelen und Unterschiede schaffen. Denn es gibt historische Parallelen zwischen den politischen Situationen von Juden und rassistisch Diskriminierten sowie bei den Mechanismen der Externalisierung und Ausgrenzung. Der Historiker plädiert dafür, Antisemitismus und Rassismus im gleichen Rahmen zu betrachten sowie die Ursachen der Ausgrenzung in der Mitte der Gesellschaft zu suchen und nicht an den Rändern.

Was ist überhaupt Antisemitismus? Gert Pickel über die sozialwissenschaftliche Vermessung der Judenfeindschaft
Kaum jemand will als Antisemitin oder Antisemit bezeichnet werden – allein schon, weil es strafbar sein könnte. Mit Gert Pickel von der Universität Leipzig haben wir darüber gesprochen, mit welchen Fragen die sozialwissenschaftliche Forschung judenfeindliche Ressentiments erfassen kann. Pickel erklärt die „Einstellungsbatterien“, mit denen die Forschung klassischen oder tradierten vom sekundären Antisemitismus oder israelbezogenen vom religiös-christlichen und muslimisch-migrantischen Antisemitismus unterscheidet. Je nach Unterform und sozialer Gruppe stimmen in Deutschland in Umfragen zwischen 10 und 30 Prozent der Menschen einschlägigen Aussagen zu. Gleichzeitig sind 70 bis 80 Prozent der hier lebenden Juden und Jüdinnen von Antisemitismus betroffen. Was bedeutet das für eine antisemitismuskritische Bildungsarbeit?
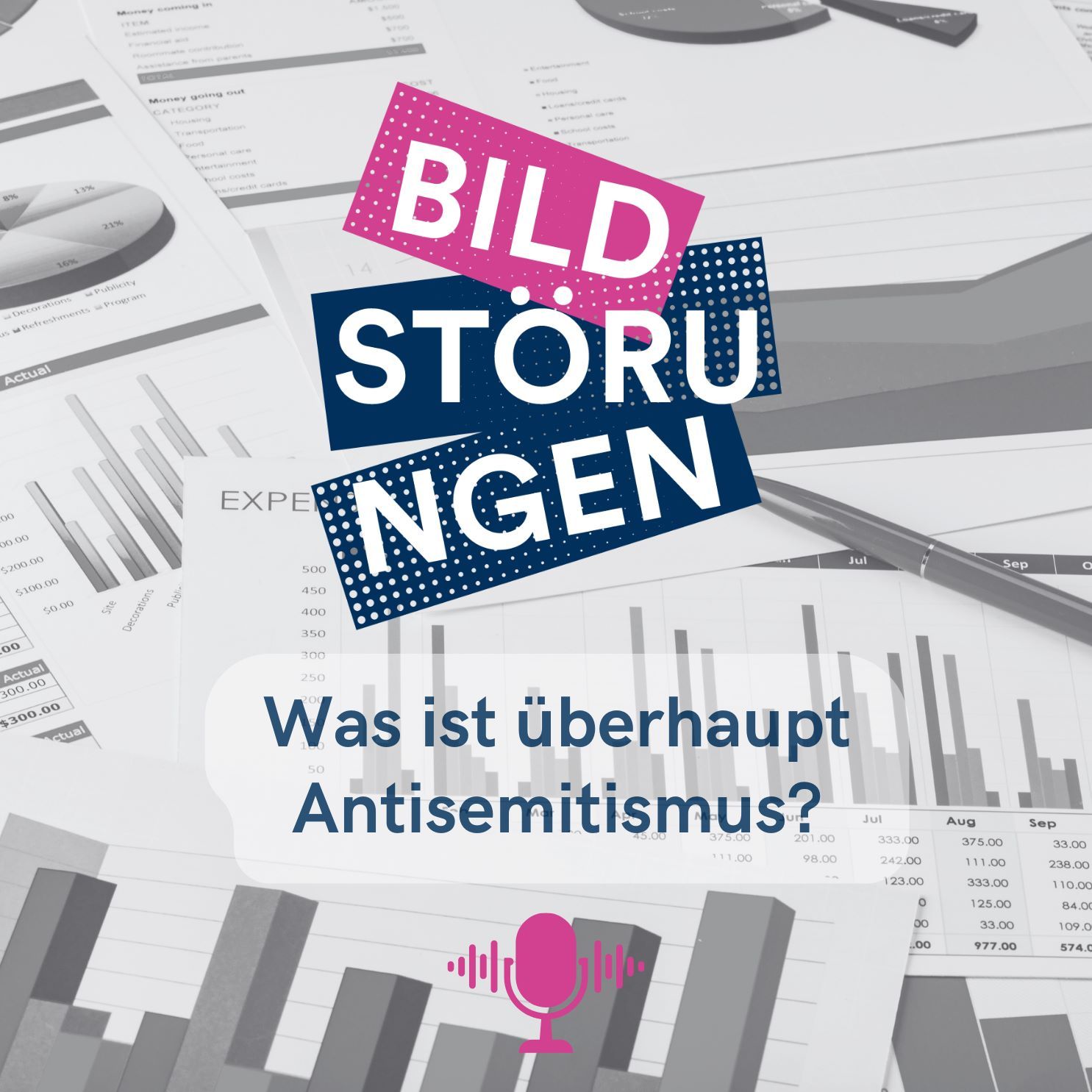
Antisemitismus in der Linken: Sina Arnold zur Geschichte des Antizionismus
Warum gibt es Antisemitismus in der linken Bewegung? An aktuellen Beispielen wie den Debatten um die documenta 15 und seit dem Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 zeigen sich irritierende Dynamiken. Im Extremfall führen sie dazu, dass sich junge Linke plötzlich mit einer konservativ-islamistischen Terrorbewegung solidarisieren, die einen Gottesstaat aufbauen will. In dieser Folge führt Sina Arnold, Wissenschaftlerin am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin und am Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt, in die geschichtlichen Hintergründe ein und identifiziert wichtige Anknüpfungspunkte für Antisemitismus in linkem Denken. Außerdem sprechen wir darüber, wo sich ähnlich verkürzende Fehlanalysen in Theologie und Kirche finden.

Weihnachtsgeschichte(n)
Maria, Josef und das Christkind in der Krippe gehören zu jedem Weihnachtsbild, ebenso Ochs und Esel im Stall, der Stern, die Hirten und die Heiligen Drei Könige. In diesem Ensemble werden zwei biblische Weihnachtserzählungen – die des Lukas- und die des Matthäusevangeliums – zu einer einzigen Geschichte zusammengefasst. Ochs und Esel kommen sogar überhaupt nicht in den neutestamentlichen Texten vor. Wie entstand dieses Bild, und warum bringt erst eine antisemitismuskritische Perspektive die Geburtsgeschichten des göttlichen Kindes zum Singen?

Luther lehren
In einer Sonderfolge zum Geburtstag Martin Luthers (10. November) sprechen wir mit dem tansanischen lutherischen Pfarrer Lusungu Mbilinyi über Anstößiges und bleibend Wichtiges in den Lehren Martin Luthers. In seinem Vikariat in Schmalkalden, einem der Brennpunkte der lutherischen Reformation im 16. Jahrhundert, stieß Mbilinyi auf die vehement antitürkischen und antisemitischen Schriften des Reformators. Inzwischen arbeitet er beim Lutherischen Weltbund in Genf. Im Gespräch erklärt Mbilinyi, warum er sich trotz der rassistischen, kolonialistischen, antisemitischen und sexistischen Aussagen Luthers auf dessen Theologie beruft.
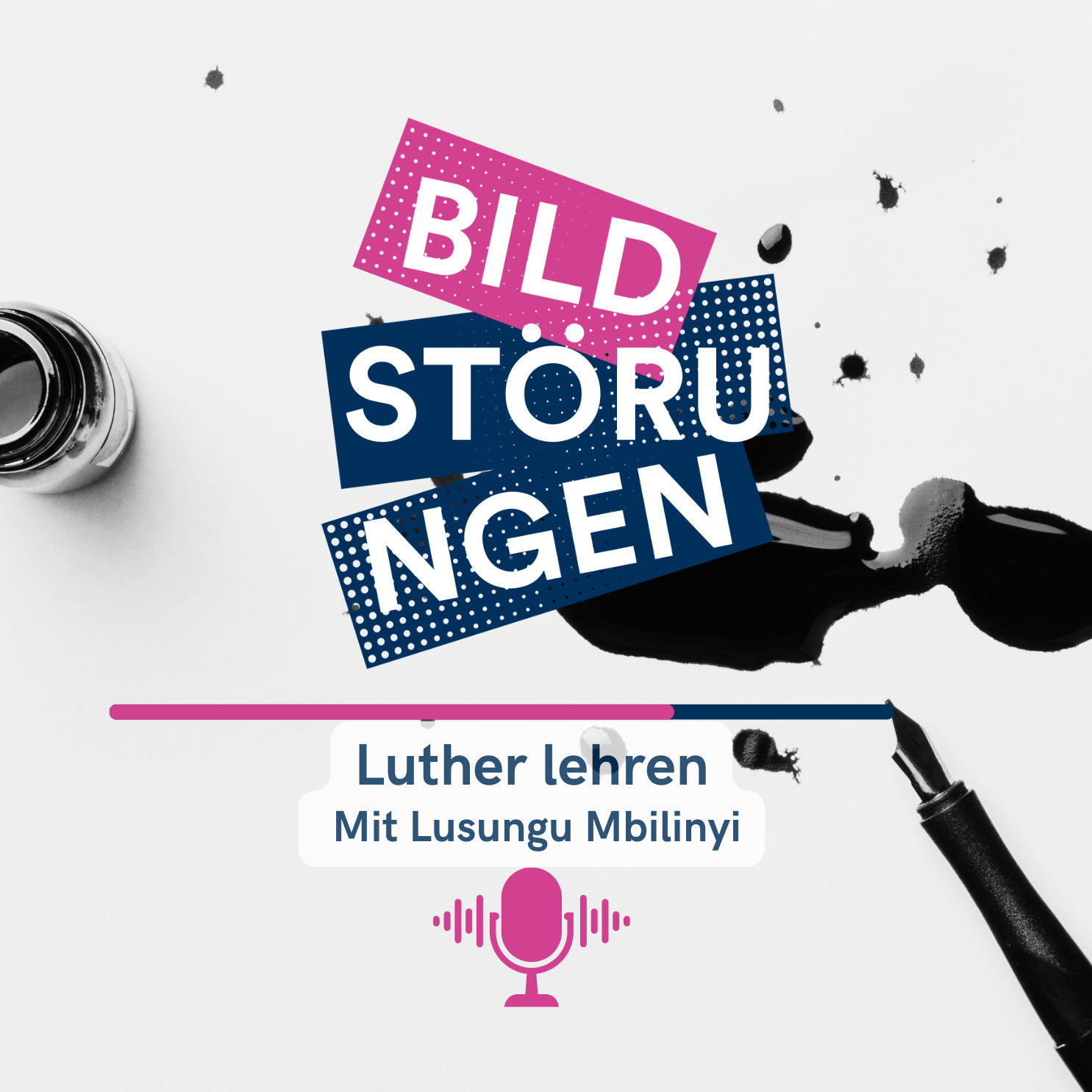
Der barmherzige Samariter
Das Bild vom barmherzigen Samariter ist weit über den Religionsunterricht hinaus geläufig – und beinhaltet als Gegenpol zwingend den hartherzigen jüdischen Priester. Das Erstaunliche ist, wie tief eine so schöne Geschichte über die Nächstenliebe in Antijudaismus verstrickt sein kann. In dieser – der vorerst letzten – Folge unseres Podcasts sprechen wir über die theologischen Gegenüberstellungen die in dieser biblischen Geschichte über die Hilfe für das Opfer eines Raubüberfalls anklingen: barmherzig und hartherzig, Gnade und Gesetz, Versöhnung und Vergeltung. Wie kann man diese Geschichte ohne antijüdische Projektionen lesen?
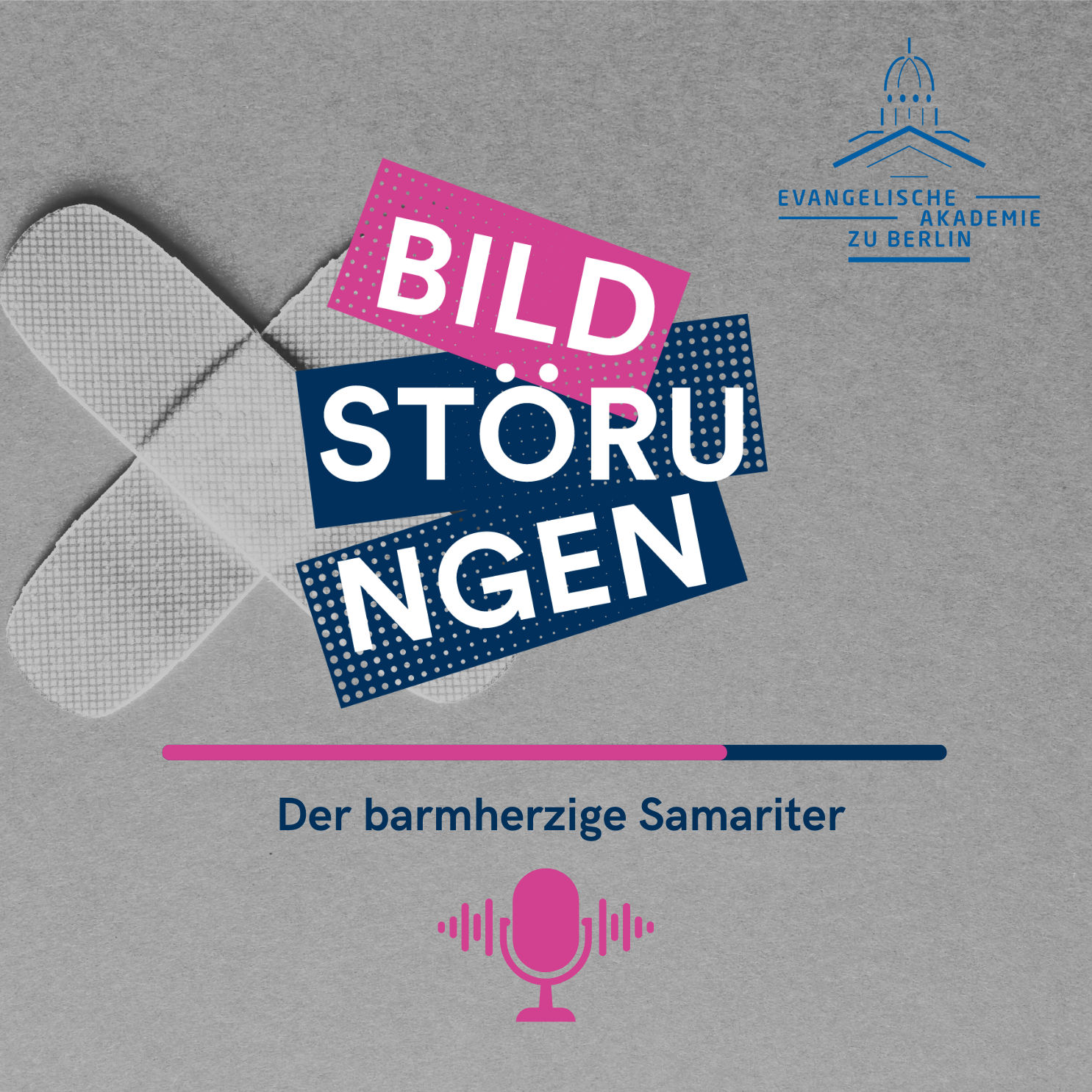
Jesus und die Ehebrecherin
Ausgehend von einer oft zitierten Darstellung der biblischen Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin, sprechen wir in dieser Folge über sexuelle Doppelmoral und die Unterdrückung von Frauen. Welche Funktion erfüllen „die Juden“ beim christlichen Versuch, sich als Frauenfreund*innen zu brüsten? Und wo kommt diese Projektion auch in gegenwärtigen Diskursen um Frauenrechte und Sexualmoral vor?

Das Sabbatgebot
Eine biblische Geschichte von Jesus, der mit Pharisäern über das Sabbatgebot diskutiert, wird gerne genutzt, um christliche gegenüber jüdischer Ethik als vermeintlich überlegen zu profilieren. Jesus erscheint dabei als Vertreter einer Moral, die freiheitlich, situativ flexibel und nur dem Liebesgebot verpflichtet ist. Den Pharisäern wird dagegen blinde Autoritätshörigkeit zugeschrieben. Wie sieht eine Freiheit aus, die sich nicht aus der vermeintlichen Unfreiheit und Unflexibilität anderer speist? Welche Perspektiven eröffnen sich, wenn man ohne Herabsetzung über die Wichtigkeit von Ritualen, Geboten und Regeln diskutiert und über den Sabbat als „Vorgeschmack auf das Paradies“?

Die Tempelreinigung
Die biblische Geschichte von Jesus, der die Händler mit einer Peitsche aus dem Tempel treibt, bringt Juden in einer Weise mit Handel, Geld und Macht in Verbindung, die auch im aktuellen Antisemitismus ein allgegenwärtiger Topos ist. In dieser Folge unseres Podcasts sprechen wir über den Tempel in Jerusalem zu der Zeit, in der die Evangelien entstanden, aber auch über christliches Unbehagen am Umgang mit Geld und Macht. Und wir überlegen, warum es so attraktiv ist, Befreiung und Erlösung als eine „Reinigung“ oder „Austreibung“ zu verstehen, bei der das Böse auf „die da oben“ begrenzt bleibt. Wie viel schwieriger ist es, eigene Ambivalenzen und Gebrochenheit einzugestehen.

Hassfigur Judas
„Du Judas“ ist ein Schimpfwort, und auf diesen Namen kann man in Deutschland kein Kind taufen lassen. Was macht die biblische Judasfigur so schaurig spannend? Warum wird Judas auf so vielen kirchlichen Bildern eindeutig „jüdisch“ dargestellt? Lassen sich die geballten Negativbilder von Verrat, Geldgier, teuflischer Besessenheit, Falschheit und Verdammung überhaupt noch aufbrechen, die in dieser Figur zusammenlaufen? Wie können wir uns der Geschichte des Jüngers Judas neu annähern, von dem in allen Evangelien immer wieder betont wird, dass er „einer der Zwölfe“ und damit einer von „uns“ war?
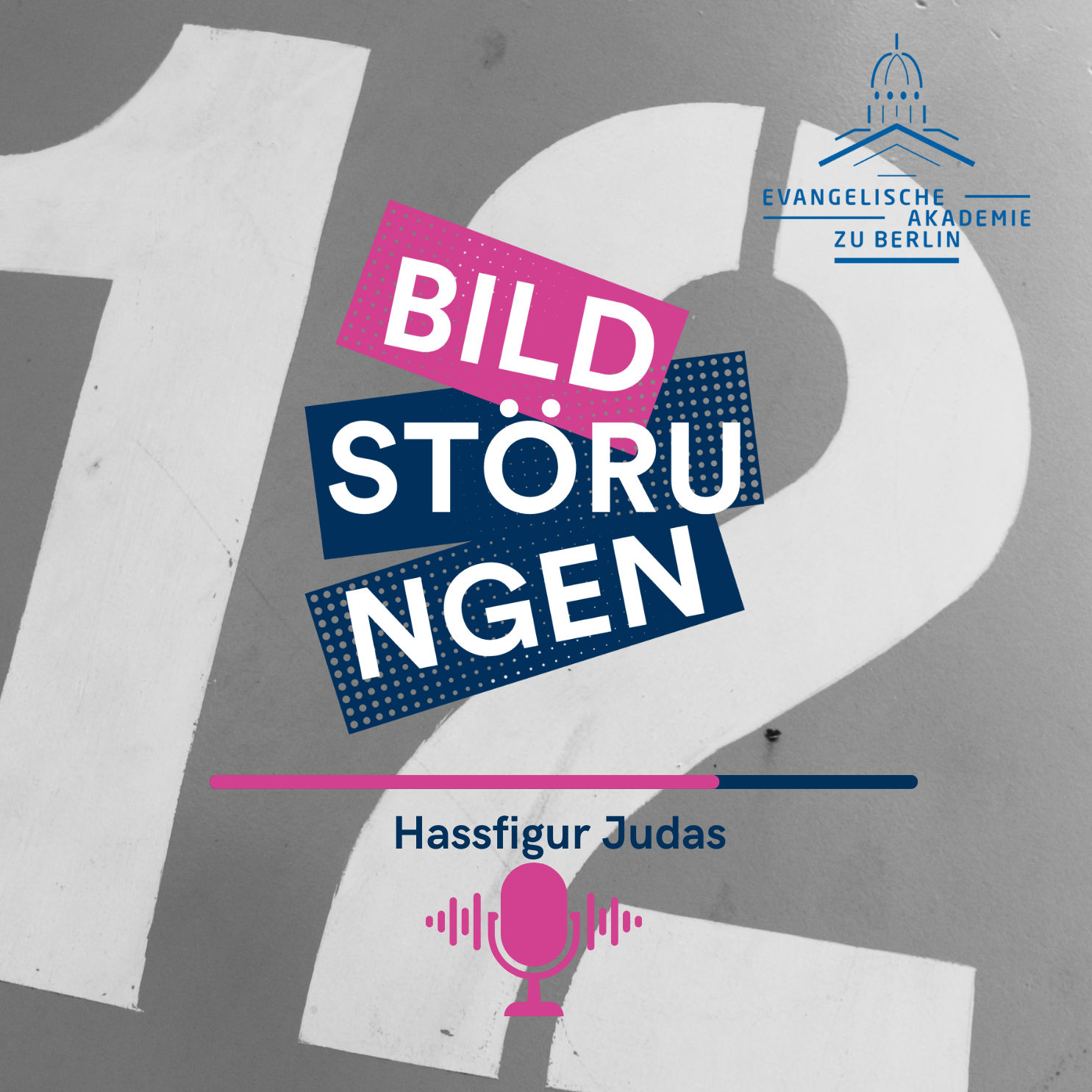
Christliche Stammbäume
Das Bild vom Judentum als Wurzel des Christentums mag wohlwollend gemeint sein. Aber wird damit nicht das Judentum in die Vergangenheit verbannt als eine altertümliche und archaische Religion, die verbessert und erneuert werden musste? Ausgehend vom Bild eines „Stammbaums“ der christlichen Kirchen in einem Schulbuch, suchen wir nach treffenderen Metaphern, um die vielförmigen Beziehungen zwischen jüdischen und christlichen Religionsgemeinschaften zu beschreiben. Wie könnten Bilder eines organischen Wachstums aussehen, die religiöse Vielfalt und die Unterschiede der jüdischen und christlichen Traditionen wertschätzen?

Synagoga und Ecclesia
An vielen Kirchen sind Darstellungen des allegorischen Figurenpaars „Synagoga und Ecclesia“ (Synagoge und Kirche) als sinnbildliche Verkörperungen von Judentum und Christentum zu finden. Die Symbolfigur für die Kirche ist dabei als Siegerin über die Synagoge dargestellt. Darin steckt viel Grundlegendes der antijüdischen Bildsprache des Christentums. Speziell die verbundenen Augen der Synagoga-Figur klingen auch in heutiger Bildsprache an und werfen die Frage auf, wie das Motiv der Blindheit metaphorisch und theologisch verwendet wird.

Warum Bildstörungen?
Moderne antisemitische Stereotype wurzeln oft in antijüdischen Auslegungen biblischer Texte und Motive, die jahrhundertelang von der christlichen Theologie tradiert wurden. Selbst in heutigem Judenhass und Verschwörungsglaube wirken diese christlich grundierten Zerrbilder unbewusst weiter. In ihrem Podcast gehen die Theologinnen Karoline Ritter und Katharina von Kellenbach vom Projekt "Bildstörungen" der Evangelischen Akademie zu Berlin diesen Traditionslinien nach.