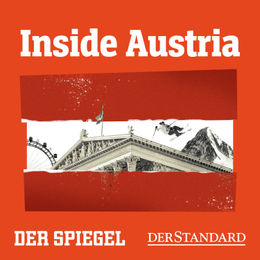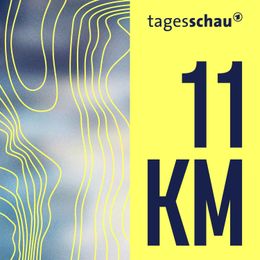Hamburg hat fast zwei Millionen Einwohner, einen Hafen, mehr Brücken und Baustellen als Venedig – und einen neuen Podcast. Jeden Samstag sprechen Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus ihrem Team über eine aktuelle Frage: Wird der Elbtower jemals fertig gebaut? Warum ist Hamburgs Innenstadt so öde? Wie geht’s der Kultur? Und warum gibt es auf den Spielplätzen der Stadt keine Toiletten? Mal ernst, mal locker, immer prägnant und persönlich. Und nie länger als 30 Minuten. Von Montag bis Freitag können Sie außerdem die Elbvertiefung als Newsletter lesen: www.zeit.de/elbvertiefung Dieser Podcast wird produziert von Pool Artists.
Alle Folgen
Mord im U-Bahnhof: Warum musste Asal sterben?
Ende Januar zeichnete eine Videokamera am Gleis 2 des U-Bahnhofs Wandsbek Markt eine junge Frau auf, die auf die Bahn wartet. Man sieht, wie ein Mann von hinten auf sie zugeht, sie packt und mit sich hinunter auf das Gleis reißt. Der einfahrende Zug erfasst sie, und beide sind sofort tot. Die Frau hieß Fatemeh Z., Freunde und Verwandte nannten sie Asal. Sie war gerade einmal 18 Jahre alt. Ihren Mörder, den 25-jährigen Ariop A., hatte sie offenbar nie zuvor gesehen. Seit dieser Tat herrscht Entsetzen in Hamburg, und es wird viel diskutiert: Sind deutsche Bahnhöfe sicher genug? Hätte man früher erkennen müssen, dass Ariop A. gefährlich war? Haben die Behörden im Umgang mit ihm, einem Geflüchteten aus dem Südsudan mit traumatischen Erfahrungen, versagt? In der neuen Folge des Podcasts Elbvertiefung spricht Maria Rossbauer aus der Hamburg-Redaktion der ZEIT mit ihren Kollegen Tom Kroll und Christoph Heinemann über den Fall. Die beiden erzählen von Fatemeh Z.s Träumen und ihrer Trauerfeier, von Ariop A. und dem Resettlement-Programm, über das er nach Deutschland kam, und sie erzählen von einer Scheindebatte, die nun ihrer Meinung nach geführt wird. Außerdem erklären sie, was sich in Hamburg wirklich ändern müsste, um solche Taten zu verhindern – und wie man der Familie von Fatemeh Z. seine Anteilnahme ausdrücken könnte. Im Podcast Elbvertiefung sprechen die Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker in jeder Folge mit Kolleginnen und Kollegen aus der ZEIT-Redaktion über ein Thema, das die Menschen in Hamburg gerade bewegt – pointiert, persönlich und selten länger als eine halbe Stunde. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Spart Hamburg seine Uni kaputt?
Bisher gab es in den Finanzen der Bundesländer so etwas wie ein ungeschriebenes Gesetz: Überall muss gespart werden – nur in Hamburg nicht. Das ändert sich nun, und insbesondere an der Universität Hamburg ist der neue Spardruck bereits spürbar. Im Hamburg-Podcast Elbvertiefung spricht ZEIT-Redakteur Oskar Piegsa mit Florian Zinnecker darüber, welche Folgen dies für die Hochschule hat – und für die Stadt, in der sie sich befindet. Im Podcast erläutert Oskar, warum der AStA der Hochschule nun von einem Studium in Hamburg abrät und wie die Leitung der Universität auf die Spar-Ankündigung reagiert. Steht nun der Exzellenz-Status der Uni auf dem Spiel? Und was wird aus der Idee, Hamburg könne sich künftig als Stadt der Wissenschaft positionieren? Auch darüber sprechen Oskar Piegsa und Florian Zinnecker in der aktuellen Folge – und sie diskutieren, wie die Politik mit der neuen Lage umgeht. Im Podcast Elbvertiefung sprechen die beiden Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker mit Kolleginnen und Kollegen aus der ZEIT-Redaktion in jeder Folge über ein Thema, das die Menschen in Hamburg gerade bewegt – pointiert, persönlich und möglichst nicht länger als eine knappe halbe Stunde. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Große Pläne, alle verworfen? Was aus dem Umbau des Hauptbahnhofs wird
Hamburg hat viel vor: Der Hauptbahnhof soll größer und moderner werden. Viele Brücken müssen dringend generalüberholt, die Köhlbrandbrücke soll sogar neu gebaut werden. Dazu kommen die neue U-Bahn-Linie U5, die Verlängerung der U4 und der S4 – und die neue S6. Am Diebsteich soll ein neuer Fernbahnhof gebaut werden, die Autobahn A26-Ost ebenfalls – und das alles möglichst vor dem Beginn der Olympischen Spiele, von denen Hamburg träumt und die weitere Bauprojekte erforderlich machen. Wie aber soll das alles klappen? Woher kommt das Geld? Und wann könnte es losgehen? Denn bis heute ist, abgesehen von der U5, noch keine dieser Baustellen konkret terminiert, geschweige denn begonnen. Über diese Fragen spricht ZEIT:Hamburg-Ressortleiter Florian Zinnecker in dieser Folge des Podcasts Elbvertiefung mit ZEIT-Redakteur Christoph Heinemann. Er erklärt, warum und wie ausgerechnet Olympia als großer Bau-Booster wirken soll, und warum sich die Sanierung und Erweiterung des Hauptbahnhofs immer weiter verzögert. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Kann Hamburg Winter?
In den ersten Januartagen schneite es in Hamburg so viel wie seit 15 Jahren nicht. Zwar ist Schneefall im Januar auch in Hamburg nichts Ungewöhnliches – diesmal schien die Stadt und ihre Bewohnerinnen und Bewohner von den Schneemassen aber deutlich überfordert. Im Podcast Elbvertiefung zieht ZEIT Hamburg-Ressortleiter Florian Zinnecker im Gespräch mit den beiden Hamburg-Reportern Tom Kroll und Christoph Twickel Bilanz: Was klappte gut, was weniger – und woran muss die Freie und Hansestadt Hamburg dringend arbeiten, um auf einen nächsten Wintereinbruch besser vorbereitet zu sein. Christoph Twickel schildert, wie der Hamburger Winterdienst im Vergleich zu anderen Städten aufgestellt ist. Er erklärt, warum Radwege zwar systematisch geräumt werden, aber oft dennoch unter Schneemassen begraben liegen. Und er sagt auch, welche Zusammenhänge es zwischen vereisten Gehwegen und der Hamburger Immobilienwirtschaft gibt. Tom Kroll war für die ZEIT am Tag des Sturmtiefs Elli in Hamburg unterwegs. Im Podcast schildert er seine Eindrücke und erzählt, wie überraschend die Hamburgerinnen und Hamburger auf die ungewohnte Lage reagiert haben. Der Podcast "Elbvertiefung" erscheint einmal pro Woche. In jeder Folge sprechen die beiden Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, abwechselnd mit Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade umtreibt. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Wie Hamburg von der Zeitenwende profitiert
Jahrzehntelang war die Hamburger Wirtschaft alles andere als stolz darauf, dass in ihrer Stadt Unternehmen sitzen, die beispielsweise Kriegsschiffe bauen oder Elektronik für Panzer herstellen. Mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine und der vom damaligen Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufenen Zeitenwende hat sich das gewandelt: Die Rüstungsbetriebe in der Hansestadt boomen und können sich vor Aufträgen und Bewerbern kaum retten. Ist das eine positive Entwicklung? Welche relevanten Betriebe sitzen in Hamburg? Und welche Folgen hat der Boom für die Hamburger Wirtschaft genau? Über diese Fragen spricht Florian Zinnecker, Ressortleiter von ZEIT:Hamburg und Podcast-Host der Elbvertiefung, in der aktuellen Folge mit der ZEIT-Autorin Kristina Läsker. Der ZEIT-Podcast Elbvertiefung erscheint einmal pro Woche. Abwechselnd sprechen die beiden Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, mit Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion über ein Thema, das die Menschen in Hamburg gerade umtreibt – pointiert, persönlich und nicht länger als eine knappe halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Hamburg, was war das bloß für ein Jahr!
Eine Volksabstimmung, die die Zukunft Hamburgs verändern wird. Eine Krise am berühmten Hamburg Ballett. Ein Milliardär, der der Stadt eine neue Oper schenken will. Taxis, die ohne Fahrer Menschen durch die Stadt befördern. Und drei Fußballvereine in der ersten Bundesliga – 2025 gab es viele Themen und Ereignisse, die die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands bewegten. In der 101. Folge des Podcasts "Elbvertiefung" blicken die beiden Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker zusammen mit den Redakteurinnen und Redakteuren sowie Stamm-Autoren aus dem Hamburg-Ressort der ZEIT auf die wichtigsten Themen des Jahres in Hamburg zurück – live auf der Bühne des Bucerius Kunst Forum. Der Podcast "Elbvertiefung" erscheint einmal pro Woche. Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, sprechen darin im wöchentlichen Wechsel mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Team über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands bewegt. Mit dem Jahresrückblick geht der Podcast in eine Weihnachtspause, die nächste Folge erscheint am 10. Januar. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Was hilft gegen prügelnde Fußballfans?
Im Januar fielen mehr als 150 vermummte Fans des Hamburger Sportvereins vor einem Lokal über Anhänger des 1. FC Köln her. Der Fall war extrem und schockierte ganz Deutschland. Doch es kommt immer wieder zu brutalen Auseinandersetzungen zwischen Fangruppen. Darum wird nicht nur in Hamburg diskutiert: Hat der Fußball ein Gewaltproblem? Wenn ja, wie groß ist es – und wie geht man damit um? In der neuen Folge des Podcasts Elbvertiefung sprechen die Hosts Maria Rossbauer und ZEIT-Hamburg Redakteur Christoph Heinemann darüber, wie verbreitet die Gewalt unter Fans ist, welchen Aufwand die Polizei deshalb bei großen Fußballspielen hat und darüber, warum viele Fans gerade in Stadien gegen Polizei und mögliche neue Regulierungen protestieren. Der Podcast Elbvertiefung erscheint einmal pro Woche. Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die gemeinsam das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, sprechen im wöchentlichen Wechsel mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Team über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands bewegt. Immer persönlich, prägnant und pointiert – und nur selten länger als eine halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Was macht Hamburg, wenn das Wasser steigt?
Im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg kämpfen gerade 16 Menschen darum, dass ihr Haus nicht abgerissen wird. Es soll weichen, weil die Stadt direkt nebenan einen Deich erhöht. Mit Vorhaben wie diesen will sich Hamburg besser gegen künftige Sturmfluten schützen – denn diese werden in Zukunft wegen des Klimawandels wohl heftiger ausfallen. In der neuen Folge des Podcasts Elbvertiefung sprechen Host Maria Rossbauer und der ZEIT-Redakteur Yannick Ramsel darüber, was Hamburg konkret plant und schon umsetzt, um das steigende Wasser abzuwehren, was dadurch auf die Hamburgerinnen und Hamburger zukommt – und wie es für die Bewohner des Wilhelmsburger Hauses weitergeht. Außerdem erklärt Yannick, wie man herausfinden kann, welche Gegenden Hamburgs von künftigen Sturmfluten besonders betroffen sind. Der Podcast Elbvertiefung erscheint einmal pro Woche. Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die gemeinsam das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, sprechen im wöchentlichen Wechsel mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Team über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands bewegt. Immer persönlich, prägnant und pointiert – und nur selten länger als eine halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Sie wollten eine Debatte über die neue Hamburger Oper? Hier ist sie!
Mit deutlicher Mehrheit stimmten die Abgeordneten der Hamburgischen Bürgerschaft in dieser Woche dafür, die Neubaupläne für ein Opernhaus in der HafenCity weiterzuverfolgen. Vorgesehen ist, dass die Stadt dafür das Grundstück zur Verfügung stellt und rund 250 Millionen Euro investiert, um es für den Bau vorzubereiten und zu gestalten. Das eigentliche Bauwerk will die Kühne-Stiftung bezahlen. Dafür ist eine Summe von mindestens 300 Millionen Euro im Gespräch. Heftige Gegenrede gab es in der Bürgerschaftssitzung von den Linken, die auch einen Protestbrief gegen die Oper präsentierten, den rund 100.000 Menschen unterschrieben haben sollen. Auch eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern forderte kurz vor der Abstimmung ein Moratorium, also eine Pausierung der Neubaupläne. In der neuen Ausgabe Elbvertiefung, des Hamburg-Podcasts der ZEIT, geht es um die Argumente der Kritikerinnen und Kritiker. Zu Gast ist Florian Zinnecker, Ressortleiter des Hamburg-Ressorts der ZEIT, moderiert wird – vertretungsweise – von Oskar Piegsa, Redakteur im Hamburg-Ressort. Die beiden versuchen abzuwägen: Welcher Einwand ist berechtigt, welcher vielleicht nicht? Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Was der Klimaentscheid für Hamburgs Wirtschaft bedeutet
Seit einer Volksabstimmung Mitte Oktober steht fest: Bis zum Jahr 2040 muss Hamburg klimaneutral werden. Doch diesen Klimaentscheid will die Hamburger CDU nun kippen, weil sie die Wirtschaft bedroht sieht. Was bedeutet Klimaneutralität bis 2040 tatsächlich für die rund 100.000 Firmen Hamburgs? Ist sie eine Bedrohung – oder auch eine Chance?Darüber sprechen in der aktuellen Folge des Podcasts Elbvertiefung ZEIT:Hamburg-Ressortleiter Florian Zinnecker und die Autorin Kristina Läsker. Es geht darum, wie die Hamburger Wirtschaft auf den Klimaentscheid reagiert hat, wo die Sorgen der Unternehmerinnen und Unternehmer liegen – und wer sich nun Hoffnung macht. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Die ganze Wahrheit über die "Elbvertiefung"
Woche für Woche dreht sich dieser Podcast um ein Thema, das die Menschen in Hamburg gerade umtreibt. Anders in dieser Woche: Zum zehnten Geburtstag des Hamburg-Newsletters "Elbvertiefung" gewährt die Redaktion in dieser Folge einen Blick hinter die Kulissen. Wer hatte die Idee zur Gründung? Warum heißt die "Elbvertiefung", wie sie heißt? Und wie viel Aufwand steckt hinter einer Ausgabe? Darüber sprechen die beiden Podcast-Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die auch das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, mit Mark Spörrle, der im CvD-Büro der ZEIT tätig ist und den Newsletter nicht nur gegründet, sondern auch drei Jahre lang koordiniert hat. Er verrät in der Folge auch, welche Ausgabe ihm besonders in Erinnerung geblieben ist. Außerdem zu Gast ist Gesa Woltjen, die als Community-Managerin das Leserpostfach verwaltet und dafür sorgt, dass alle Nachrichten beantwortet werden. Welche Zuschriften sie besonders freuen, welcher Hinweis aus der Leserschaft am häufigsten kommt und wie die Arbeit in der Redaktion ihren Blick auf die Stadt verändert hat – auch darüber berichtet sie im Podcast. Der Podcast "Elbvertiefung" erscheint immer freitags und ist persönlich und pointiert – und in dieser Woche ausnahmsweise länger als eine halbe Stunde. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Wie gefährlich ist Muslim Interaktiv?
Die Meldung kam am Mittwochmorgen: Die Vereinigung Muslim Interaktiv, die vor eineinhalb Jahren in Hamburg für die Einführung eines Kalifats demonstrierte, ist nun offiziell verboten. Im Podcast Elbvertiefung sprechen Christoph Heinemann und Tom Kroll, die seit Jahren über Muslim Interaktiv recherchieren, mit ZEIT:Hamburg-Ressortleiter Florian Zinnecker über die Hintergründe des Verbots – und erklären, wer hinter Muslim Interaktiv steckt und welche Ziele die Vereinigung erfüllt. Seit den Anschlägen vom 11. September in New York seien die Hamburger Behörden besonders sensibel, was die Aktivitäten mutmaßlicher Islamisten angeht, erklärt ZEIT-Redakteur Christoph Heinemann. Die Mitglieder von Muslim Interaktiv hätten zwar keine Anschläge geplant. Das bedeute aber nicht, dass von ihnen keine Gefahr ausgehe. Tom Kroll gibt einen Einblick in die Aktivitäten der Vereinigung auf TikTok und erklärt, wie die Forderung nach einem Kalifat einzuordnen ist. Außerdem sprechen die beiden über den Hang einiger Mitglieder, in luxuriösen Autos herumzufahren. Den in der Podcast-Folge erwähnten Hamburger Verfassungsschutzbericht können Sie hier lesen. Der Podcast Elbvertiefung erscheint immer freitags. Abwechselnd sprechen die beiden Hosts und Hamburg-Ressortleiter Maria Rossbauer und Florian Zinnecker mit Kolleginnen und Kollegen aus der ZEIT-Redaktion über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschland gerade umtreibt – pointiert, prägnant und persönlich, und selten länger als eine knappe halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Sagt, was ihr wollt: Wie viel Mitsprache verträgt Hamburg?
Ein neues Wohngebiet, eine Konzerthalle, ein Spielplatz – wenn in Hamburg etwas Neues entsteht, werden die Menschen, die in der Umgebung leben, zumindest informiert. Aber wie können sie auch mitentscheiden? Wie ist die gesetzliche Regelung? Und was klappt tatsächlich? In der neuen Folge des Podcasts "Elbvertiefung" spricht die ZEIT-Hamburg-Ressortleiterin Maria Rossbauer mit Christoph Twickel über Verfahren zur Bürgerbeteiligung. Der ZEIT-Autor berichtet von Fällen, in denen die Mitbestimmung im Desaster endete, er stellt eine Erfindung vor, die die Beteiligung der Hamburger Öffentlichkeit entscheidend verändert hat – und er erklärt, was unter dem Begriff "Beteiligungsdilemma" zu verstehen ist. Außerdem gibt er Tipps, wie man es schafft, sein Viertel mitzugestalten. Der Podcast "Elbvertiefung" erscheint immer freitags. Die beiden Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker leiten zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT – und sprechen von Woche zu Woche abwechselnd mit Kolleginnen und Kollegen aus der ZEIT-Redaktion über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade umtreibt – immer persönlich, pointiert und nur selten länger als eine knappe halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Ganz schön aufregend, was da gerade in Hamburgs Kulturszene los ist
Was im Hamburger Kulturbetrieb gerade los ist, gleicht einer Generalsanierung: Die Hamburgische Staatsoper etwa wird nun von Tobias Kratzer geleitet, die Hamburger Philharmoniker von Omer Meir Wellber, und im Thalia Theater, einer der beiden großen Sprechbühnen der Stadt, übernimmt Sonja Anders die Intendanz. Auch am Ernst Deutsch Theater, im Literaturhaus, im Ensemble Resonanz und dem Harbour Front Literaturfestival gibt es Neuerungen. Was ist da los? Und was bedeutet der Wandel für kulturbegeisterte Hamburgerinnen und Hamburger? Darüber unterhalten sich in der neuen Folge des Hamburg-Podcasts "Elbvertiefung" Maria Rossbauer und Florian Zinnecker aus dem Hamburg-Ressort der ZEIT – live auf der ersten Hamburger Podcast-Nacht im Hansa-Theater. Die beiden sprechen über verrückte Konzertabende, einen Intendanten, der zu 150 Prozent an das glaubt, was er tut, und darüber, ob die vielen gleichzeitigen Neuerungen eigentlich Zufall sind. Und natürlich gibt es auch einige Tipps für diese aufregende Kultursaison. Der Podcast "Elbvertiefung" erscheint immer freitags. Die Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die gemeinsam das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, sprechen abwechselnd mit ZEIT-Kolleginnen und -Kollegen über ein Thema, das die Menschen in der Stadt gerade bewegt – persönlich, prägnant und selten länger als eine halbe Stunde. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Wird der Elbtower jetzt echt fertig gebaut?
245 Meter hoch sollte der Elbtower in der HafenCity eigentlich werden, und ein neues Wahrzeichen Hamburgs. Ein glänzendes Riesenhaus, entworfen vom Staararchitekten David Chipperfield, mit schicken Büros und Geschäften. Doch nach hundert Metern war Schluss: Die Immobilienfirma Signa ging insolvent. Fortan gab es viele Diskussionen darüber, wie es mit dem Turm weitergehen kann – und er bekam so manchen Spitznamen, wie „kurzer Olaf“, weil Hamburgs Ex-Bürgermeister Olaf Scholz das Hochhausprojekt einst angeschoben hatte. In dieser Woche nun kündigte die Stadt Hamburg an, als Co-Investorin gemeinsam mit einem Konsortium um den Immobilienunternehmer Dieter Becken bei dem Projekt einzusteigen – und den Turm selbst zu Ende zu bauen. Dafür will die Stadt 595 Millionen Euro ausgeben. Wie kam es zu dieser Wende? Und ist das nun wirklich die Rettung für den „kurzen Olaf“? Darüber diskutieren in der aktuellen Folge des Hamburg-Podcasts Elbvertiefung der Host Maria Rossbauer und der ZEIT:Hamburg Autor Christoph Twickel. Die beiden sprechen darüber, warum nun ausgerechnet ein Naturkundemuseum in den unteren Teil des Turms ziehen, und warum er nur noch 199 Meter hoch werden soll. Es geht darum, ob es wirklich eine gute Idee der Stadt Hamburg ist, einen Teil des Turms zu kaufen – und natürlich sprechen die beiden auch darüber, wann – und ob – denn wohl tatsächlich weitergebaut wird. Der Podcast "Elbvertiefung" erscheint immer freitags. Die Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, sprechen abwechselnd mit ZEIT-Kolleginnen und -Kollegen über ein Thema, das die Menschen in der Stadt gerade bewegt – persönlich, prägnant und selten länger als eine halbe Stunde. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Diese Folge ist exzellent
In diesen Tagen strömen wieder Tausende Erstsemester-Studierende in die Stadt. Denn an der Universität Hamburg und an der Technischen Universität beginnen in der kommenden Woche die Vorlesungen. An beiden Universitäten startet das Wintersemester 2024/25 mit einer guten Nachricht: Sie bekommen zusätzliche Millionensummen. Der Grund dafür ist die Exzellenzstrategie von Bund und Ländern. Alle sieben Jahre wird dabei geprüft, welche Forschungsvorhaben als sogenannte Exzellenzcluster gefördert werden. Dieses Jahr war es wieder so weit, und es wurde entschieden: Alle vier bestehenden Exzellenzcluster der Uni Hamburg werden weiterhin gefördert. Zudem bekommt die Stadt ein fünftes, ganz neues Exzellenzcluster, das an der Technischen Uni beheimatet ist. Im Podcast spricht ZEIT-Redakteur Oskar Piegsa mit Podcast-Host Maria Rossbauer darüber, was der Geldsegen für die beiden Hochschulen bedeutet. Außerdem geht es darum, was in einigen der Exzellenzcluster in Hamburg besonders gut gelingt. Etwa dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen zusammenkommen – Antike-Forscher und Ingenieure, Meeresphysiker und Soziologen –, um gemeinsam an den Antworten auf große Fragen zu arbeiten. Der Podcast "Elbvertiefung" erscheint immer freitags. Die Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, sprechen abwechselnd mit ZEIT-Kolleginnen und -Kollegen über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade bewegt – persönlich, prägnant und selten länger als eine halbe Stunde. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Was der Hamburger Zukunftsentscheid verändern kann (und was nicht)
Bis 2045 will Hamburg klimaneutral sein. Dieses Ziel hat der rot-grüne Senat sich selbst gesteckt – doch allzu ambitioniert zeigt sich die Politik nicht, das Ziel auch zu erreichen. Zu diesem Ergebnis kommt ZEIT-Redakteur Frank Drieschner in der aktuellen Folge des Podcasts »Elbvertiefung«. Das könnte sich demnächst ändern: Bis 12. Oktober läuft die Abstimmung über den Hamburger Zukunftsentscheid. So heißt eine Initiative, die Hamburg zu einem neuen Klimaschutzgesetz verhelfen möchte. Welche Folgen hätte es für Hamburg, wenn sich die Initiative durchsetzt – und was passiert, wenn das Vorhaben scheitert? Darüber diskutiert Frank Drieschner mit dem Podcast-Host Florian Zinnecker. Im Podcast sprechen die beiden auch darüber, wie weit Hamburg auf dem Weg zur Klimaneutralität schon gekommen ist, wie die Hamburger Parteien auf den Zukunftsentscheid blicken – und ob eine Großstadt wie Hamburg überhaupt je klimaneutral wirtschaften kann. Der Podcast "Elbvertiefung" erscheint einmal pro Woche. Die beiden Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, sprechen abwechselnd in jeder Folge mit ZEIT-Kolleginnen und -Kollegen über das Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands am meisten bewegt – immer persönlich, prägnant und möglichst nicht länger als eine knappe halbe Stunde. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Hamburgs legendäre Musikclubs - sind sie zu retten?
Die Beatles, Jimi Hendrix, Udo Lindenberg: In Hamburger Musikclubs wurden Bands berühmt oder kamen aus aller Welt, um dort aufzutreten. Und hier traf sich die Szene –ganze Musikbewegungen gingen aus den Clubs hervor. Läden wie der Star-Club, der Mojo Club oder der Golden Pudel Club sind legendär, weit über die Stadtgrenzen hinaus. Nun aber stecken viele in der Krise, manche Clubbetreiber fürchten gar um ihre Existenz. In der neuen Folge des Hamburg-Podcasts Elbvertiefung – live vom Reeperbahn Festival – sprechen Annika Lasarzik, Oskar Piegsa und Christoph Twickel aus dem Hamburg-Ressort der ZEIT mit dem Host Maria Rossbauer über die sich wandelnde Musikkultur der Stadt. Die drei erzählen, wie sich Hamburg überhaupt zu dieser Musikstadt entwickelte, und was sich zu den besten Zeiten in den Clubs dieser Stadt zugetragen hat. Es geht darum, was die Club-Betreiberinnen und -Betreiber gerade umtreibt, was die Stadt unternimmt, um den Clubs zu helfen, und darum, wo aufstrebende Bands heute so auftreten – und natürlich gibt es auch viele Tipps von Clubs und Veranstaltungen, die sich heute zu besuchen lohnen. Der Hamburg-Podcast Elbvertiefung erscheint einmal pro Woche. Die beiden Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, sprechen abwechselnd mit Kolleginnen und Kollegen aus der ZEIT-Redaktion über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade umtreibt – immer persönlich, prägnant und nur selten länger als eine halbe Stunde. Schreiben Sie uns mit Kritik, Lob, Hinweisen oder Themenanregungen gerne an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Kriegswaffen, Militärmanöver, Spionagedrohnen: Hamburg rüstet auf
Anfang der Woche hat der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall angekündigt, im Zuge eines Deals mit der Lürssen-Gruppe die Hamburger Werft Blohm + Voss zu übernehmen. Schon jetzt werden in Hamburg Kriegsschiffe gebaut, künftig aber wohl in weitaus größerem Maße. In der kommenden Woche übt die Bundeswehr in Hamburg bei einem Manöver die Abläufe für den Ernstfall – 500 Soldaten werden durch die Stadt marschieren und mit Fahrzeugkolonnen nächtliche Truppenverlegungen trainieren. Und immer wieder werden über dem Hafen unbekannte Drohnen gesichtet, die nach Einschätzung von Experten zum Ausspionieren von Rüstungsbetrieben und anderer relevanter Infrastruktur dienen. Was bedeutet das alles für die Stadt, welche Folgen ergeben sich für die Menschen, die hier leben? Und auf welches Szenario genau bereitet sich Hamburg da vor? Über diese und weitere Fragen spricht der ZEIT:Hamburg-Ressortleiter Florian Zinnecker mit Hauke Friederichs, der als sicherheitspolitischer Korrespondent der ZEIT zu genau diesen Themen recherchiert und regelmäßig darüber berichtet. Im Podcast diskutieren sie unter anderem darüber, welche Rolle Hamburg schon heute bei der Produktion von Kriegswaffen spielt und inwieweit die Stadt davon profitiert. Sie beleuchten den Einbezug Hamburgs als Logistikdrehscheibe in die Strategie der Nato – und sie sprechen auch darüber, welche Rolle der Hamburger Bevölkerung beim bevorstehenden Manöver zukommt und mit welchen Einschränkungen des täglichen Lebens zu rechnen ist. Der Hamburg-Podcast Elbvertiefung erscheint einmal pro Woche. Die beiden Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, sprechen abwechselnd mit Kolleginnen und Kollegen aus der ZEIT-Redaktion über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade umtreibt – immer persönlich, prägnant und möglichst nicht länger als eine halbe Stunde. Schreiben Sie uns mit Kritik, Lob, Hinweisen oder Themenanregungen gerne an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Verliert die Mobilitätswende an Tempo?
Bis 2030 sollen mindestens 80 Prozent aller Wege in der Stadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt werden. Das ist das Ziel der Hamburger Mobilitätswende, die sich der Senat im Jahr 2020 als ehrgeiziges Ziel auf die Fahnen schrieb. Auf halber Strecke, zur Bürgerschaftswahl in diesem Frühjahr, ging Bürgermeister Peter Tschentscher aber auf Distanz – und verhängte ein Parkplatzmoratorium: Alle Projekte zur Umgestaltung der Stadt, bei denen mindestens ein Parkplatz wegfallen würde, wurden gestoppt und mussten neu aufgesetzt und vom Senat erneut freigegeben werden, egal, wie weit die Planungen schon fortgeschritten waren. Welche Folgen die Maßnahme hatte, welches politische Kalkül dahintersteckt und wie sie sich auf die Verkehrswende auswirkt – über diese Fragen sprechen Florian Zinnecker, Hamburg-Ressortleiter der ZEIT und Host des Podcasts Elbvertiefung, und ZEIT-Autor Christoph Twickel, in dieser Folge der Elbvertiefung. Die beiden diskutieren außerdem über die Fragen, wie sich Hamburg in fünf Jahren verändert haben könnte, mit welchen Mitteln der Autoverkehr in Hamburg tatsächlich reduziert werden könnte und wer etwas dagegen hat, und darüber, wie man in der Stadt am schnellsten einen Parkplatz findet. Der Podcast Elbvertiefung erscheint wöchentlich. Die beiden Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, sprechen Woche für Woche abwechselnd mit Kolleginnen und Kollegen aus ihrem Team über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade am meisten umtreibt – immer persönlich und pointiert, und so gut wie nie länger als eine knappe halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Der Hansaplatz ist wirklich schön, aber…
Nur wenige Schritte vom Hamburger Hauptbahnhof entfernt, mitten in St. Georg liegt der Hansaplatz. In seiner Mitte steht ein Brunnen aus dem 19. Jahrhundert, auf dem die Hansa thront, eine Bronze-Statue mit goldenem Zepter in der Hand, ein altes Symbol für Macht und Reichtum. Auf seiner Westseite prägen sanierte Altbauten das Bild, im Osten Cafés und Restaurants. Doch an der Südseite ist der Platz geprägt von Kellerkneipen, Prostituierten, trinkenden Männern und Gewalt. Anwohner berichten von Aggressionen, Drogenverstecken vor Kitas und einem ständigen Gefühl von Unsicherheit. Wie hat sich der Hansaplatz zu einem derart zerrissenen Ort entwickelt? Und was würde helfen, ihn friedlich und lebenswert zu machen? In der neuen Folge des Podcasts Elbvertiefung spricht Maria Rossbauer mit Annika Lasarzik über Hamburgs wohl widersprüchlichsten Platz. Annika Lasarzik ist ZEIT-Redakteurin und hat über viele Wochen vor Ort recherchiert. Sie erzählt von vielen Versuchen, den Platz umzugestalten – von Metallpollern bis zu Pollerbänken –, von der Strategie Hamburgs, mit Kameras und Polizei den Ort zu kontrollieren und darüber, warum es so schwer ist, die Lage am Hansaplatz zu verbessern. Es geht um den Alltag der Anwohner – und schließlich auch um die schönen Ecken des Hansaplatzes, an denen sich ein Besuch lohnt. Der Podcast "Elbvertiefung" erscheint einmal pro Woche. Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die gemeinsam das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, sprechen im wöchentlichen Wechsel mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Team über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands bewegt. Immer persönlich, prägnant und pointiert – und nur selten länger als eine halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Forschung aus Hamburg: Was Langeweile wirklich mit uns macht
Langeweile macht kreativ, heißt es oft. Tatsächlich aber, das zeigten viele Studien, leidet, wer öfter Langeweile empfindet, eher an Depressionen, Essstörungen und Suchterkrankungen. Aber was ist Langeweile überhaupt, und wie funktioniert sie? Das erforscht in Hamburg der Sportpsychologe Wanja Wolff – und ZEIT-Redakteur Yannick Ramsel hat sich in seinem Labor selbst anschließen lassen. In der neuen Folge des Podcasts "Elbvertiefung" spricht der Host Maria Rossbauer mit Yannick Ramsel über seine Labor-Erfahrungen, über die Geschichte der Langeweile-Überlegungen von Seneca bis Schopenhauer – und darüber, was Wanja Wolff herausgefunden hat. Es geht darum, welche Rolle Langeweile beim Sport spielt – und am Ende gibt es auch Tipps, wie man die produktive Kraft der Langeweile besser nutzen kann. Der Podcast "Elbvertiefung" erscheint einmal pro Woche. Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die gemeinsam das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, sprechen im wöchentlichen Wechsel mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Team über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands bewegt. Immer persönlich, prägnant und pointiert – und nur selten länger als eine halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Kühl bleiben, Hamburg
Sommer in Hamburg, das bedeutet volle Freibäder, lange Abende draußen – aber für viele Menschen auch eine Belastung. Besonders Ältere und Kranke leiden, wenn die Temperaturen steigen und selbst nachts nicht mehr sinken. In vielen Fällen hilft da nur: Räume abkühlen. Doch die 144 Altenheime der Stadt sind kaum mit genügend Klimaanlagen ausgestattet – obwohl diese gerade hier am dringendsten gebraucht würden. Warum ist das so? Und kann sich die Lage durch den neuen Hitzeaktionsplan, den Hamburg in diesem Jahr vorgestellt hat, verbessern? In der neuen Folge des Podcasts "Elbvertiefung" sprechen Host Maria Rossbauer und ZEIT:Hamburg-Autor Tom Kroll über den neuen Hamburger Hitzeaktionsplan, darüber, was er vorsieht und warum Kritiker die Maßnahmen als unzureichend ansehen. Im Podcast geht es auch darum, was bei Hitze tatsächlich hilft, ob die Klimaanlage wirklich alternativlos ist und wie andere Städte mit dem Thema Hitzeschutz umgehen. Und schließlich erzählt Tom Kroll, warum man gerade aus der Coronapandemie einiges über einen guten Umgang mit dem Thema Hitzeschutz lernen kann. Der Podcast "Elbvertiefung" erscheint einmal pro Woche. Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die gemeinsam das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, sprechen im wöchentlichen Wechsel mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Team über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands bewegt. Immer persönlich, prägnant und pointiert – und nur selten länger als eine halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Die schüchterne Banditin
Gisela Werler war eine stille Frau aus einfachen Verhältnissen. Mit Anfang 30 lebte sie noch bei ihren Eltern in einer kleinen Wohnung in Hamburg-Altona. Doch dann, 1964, lernte sie Hermann Wittorff kennen, einen Taxifahrer. Und Bankräuber. Sie verliebte sich, wurde seine Komplizin – und bald darauf selbst die berühmteste Bankräuberin des Landes. Stets vornehm und elegant gekleidet raubte die sogenannte Banklady vor 60 Jahren fast 20 Banken in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen aus. ZEIT-Hamburg-Autor Söhnke Callsen hat viel zum Leben von Gisela Werler recherchiert. In der neuen Folge des Hamburg-Podcasts "Elbvertiefung" erzählt er Podcast-Host Maria Rossbauer, wie Gisela Werler zur Bankräuberin wurde, wie sie mit einem cleveren System immer wieder der Polizei entkam, warum sie nach vielen erfolgreichen Überfällen irgendwann unvorsichtig wurde – und vom spektakulären letzten Überfall in Bad Segeberg. Zudem geht es darum, was es bedeutete, in den Sechzigern als Frau Banken auszurauben, in einer männlich dominierten Welt der Bankräuber. Der Podcast "Elbvertiefung" erscheint einmal pro Woche. Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die gemeinsam das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, sprechen im wöchentlichen Wechsel mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Team über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands bewegt. Immer persönlich, prägnant und pointiert – und nur selten länger als eine halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Hamburgs Rezept für schattige Plätzchen
Etwa ein Viertel von Hamburgs Fläche wird im Sommer von Bäumen beschattet. Sie kühlen die Stadt ab, sie filtern Schadstoffe aus der Luft, binden CO₂ – und sie sorgen durch ihre bloße Anwesenheit für Lebensqualität und Ruhe im Trubel der Großstadt. In Hamburg prägen seit Jahrzehnten vor allem Eichen und Linden das Stadtbild, 230.000 Bäume wachsen hier allein an Straßen, Alleen und Plätzen. Doch der Klimawandel setzt ihnen zu, sie leiden unter zu wenig Regen, bekommen leichter Krankheiten. Was also passiert mit Hamburgs Bäumen in der Zukunft? Und wie wappnet man sie gegen den Klimawandel? In der neuen Folge des Hamburg-Podcasts Elbvertiefung unterhalten sich Maria Rossbauer und ZEIT-Hamburg Autorin Kristina Läsker über Hamburgs Stadtbäume. Sie sprechen darüber, worunter die Bäume leiden, ob die Stadt wirklich genug neue Bäume pflanzt und welche die geeigneten für die Zukunft sind – und sie geben Tipps, wie man herausfinden kann, welcher Baum gerade vor einem steht. Der Podcast Elbvertiefung erscheint einmal pro Woche. Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die gemeinsam das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, sprechen im wöchentlichen Wechsel mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Team über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands bewegt. Immer persönlich, prägnant und pointiert – und nur selten länger als eine halbe Stunde. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Macht der Psychiatrieplan Hamburg sicherer?
Menschen, die unter schweren psychischen Erkrankungen leiden und in extremen Momenten zur Gefahr für sich selbst oder für andere werden – solche Fälle sind zum Glück selten. Dennoch geschieht es. Im Mai etwa stach eine Frau, die nach ZEIT-Informationen an einer paranoiden Schizophrenie leidet, am Hamburger Hauptbahnhof wahllos mit einem Messer auf Passanten ein. Die Stadt Hamburg legte vor Kurzem einen Plan vor, der Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen besser unterstützen und solche Fälle künftig verhindern soll. In der neuen Folge des Hamburg-Podcasts "Elbvertiefung" sprechen Podcast-Host Maria Rossbauer und ZEIT:Hamburg-Autor Tom Kroll über den Psychiatrieplan 2025. Tom Kroll erklärt, warum dieser für Hamburg dringend notwendig ist, was das Konzept genau beinhaltet und welche Herausforderungen bei der Umsetzung bestehen. Es geht um die Frage, ob ein solches Modell auch in anderen Regionen erfolgreich sein könnte und ob der Psychiatrieplan die Situation in Hamburg tatsächlich nachhaltig verändern kann. Der Podcast "Elbvertiefung" erscheint einmal pro Woche. Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die gemeinsam das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, sprechen im wöchentlichen Wechsel mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Team über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands bewegt. Immer persönlich, prägnant und pointiert – und nur selten länger als eine halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Campen auf Lühesand: Mist, alles wird besser
Lühesand, nur wenige Kilometer von Hamburgs Stadtgrenze entfernt, war über viele Jahre hinweg ein Rückzugsort für Naturfreunde und Campingenthusiasten. Doch jetzt steht die Insel vor einer grundlegenden Veränderung: Der alte Campingplatz soll modernisiert werden, mit neuen Sanitäranlagen, Tiny Houses und WLAN überall – und wesentlich höheren Preisen, die sich viele der alteingesessenen Camper nicht mehr leisten können. In der neuen Folge des Hamburg-Podcasts "Elbvertiefung" unterhalten sich der Host Florian Zinnecker und ZEIT:Hamburg-Autor Christoph Twickel über die "Glampifizierung" des Campingplatzes auf Lühesand. Sie sprechen darüber, was die Insel für viele Dauercamper in den vergangenen Jahren bedeutet hat, und über die geplanten Modernisierungsmaßnahmen. Es geht auch um den Wandel, den die Campingkultur in Deutschland gerade durchmacht – und schließlich gibt es auch Tipps für besondere Orte zum Zelten – oder "Glampen" – rund um Hamburg. Der Podcast "Elbvertiefung" erscheint einmal pro Woche. Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die gemeinsam das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, sprechen im wöchentlichen Wechsel mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Team über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands bewegt. Immer persönlich, prägnant und pointiert – und nur selten länger als eine halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Hamburgs El Chapo – wie Ermittler einen mächtigen Drogenboss fingen
Sein Name ist Princ Dobroshi, doch so wie der mexikanische Drogenbaron Joaquín Guzmán den Spitznamen "El Chapo" trägt, hat auch Dobroshi einen Rufnamen: "Peshkaqeni", der Hai. Der 61-Jährige galt einst als einer der einflussreichsten Drogenbosse Europas. Ermittler wähnten ihn schon im Ruhestand, doch nun soll er erneut tonnenweise Kokain über den Hamburger Hafen ins Land geschmuggelt haben. Wer ist dieser Mann, der sich einst das Gesicht operieren ließ, um der Polizei zu entkommen? Und was bedeutet es für Hamburg, wenn hier einem mutmaßlichen Drogenpaten dieser Größe der Prozess gemacht wird? Immerhin war er schon zuvor aus dem Gefängnis ausgebrochen, und seine Komplizen planten vor Jahren, den norwegischen Kronprinzen zu entführen, um Dobroshis Freiheit zu erpressen. In der neuen Folge des Hamburg-Podcasts "Elbvertiefung" sprechen der Host Maria Rossbauer und der ZEIT:Hamburg-Redakteur Christoph Heinemann über den Fall Dobroshi. Es geht darum, wie die Ermittler ihm auf die Spur kamen, wie die Verhaftung ablief und wie nun die Sicherheitsvorkehrungen im Gericht und im Gefängnis sind. Christoph Heinemann berichtet, warum gerade Hamburg zur Hochburg im Kampf gegen die internationale Drogenkriminalität werden soll, und es geht darum, wie sich solche Ermittlungserfolge auf den europäischen Drogenmarkt auswirken. Der Podcast "Elbvertiefung" erscheint einmal pro Woche. Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die gemeinsam das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, sprechen im wöchentlichen Wechsel mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Team über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands bewegt. Immer persönlich, prägnant und pointiert – und nur selten länger als eine halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Kunstwerke im Freien: Wo Hamburg ein Open-Air-Museum ist
In Hamburg kann man etliche Kunstwerke zu jeder Tageszeit besuchen, und das völlig kostenlos. Teils stammen sie von berühmten Künstlerinnen und Künstlern, teils haben sie selbst Kulturgeschichte geschrieben – dennoch bleiben sie häufig unbemerkt. Denn sie befinden sich nicht in einem Museum, sondern draußen, im öffentlichen Raum. Um diese Kunstwerke bekannter zu machen, hat Hamburg das Amt der Stadtkuratorin bzw. des Stadtkurators erfunden. Aktuell wird es von Joanna Warsza bekleidet, einer renommierten polnischen Kuratorin. Fünf Jahre lang soll sie die Diskussionen um Kunst im öffentlichen Raum beleben. Ende 2024 trat Warsza ihr Amt an, in diesen Tagen ist ihre erste Ausstellung zu sehen: From the Cosmos to the Commons (deutsch: Vom All zum Allgemeingut) im Stadtpark. In der neuen Folge des Hamburg-Podcasts "Elbvertiefung" spricht der Host Florian Zinnecker mit Oskar Piegsa über die Arbeit der Stadtkuratorin, über die Geschichte der Kunst im öffentlichen Raum, bei der Hamburg mehr als einmal wegweisend war – und natürlich geht es auch um die Kunstwerke, die man im Hamburg außerhalb der Museen entdecken kann, wie die Bismarck-Statue im Alten Elbpark und die Goldwand in der Veddel. Der Podcast "Elbvertiefung" erscheint einmal pro Woche. Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die gemeinsam das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, sprechen im wöchentlichen Wechsel mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Team über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands bewegt. Immer persönlich, prägnant und pointiert – und nur selten länger als eine halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Olympia in Hamburg: Eine gute Idee?
Angenommen, die Bewerbung Hamburgs für die Olympischen Spiele 2040 oder 2044 ist erfolgreich: Welche Folgen hat das für die Stadt und ihre Bewohnerinnen und Bewohner? Um diese Frage dreht sich die neueste Folge des ZEIT-Podcasts Elbvertiefung, aufgenommen bei der Langen Nacht der ZEIT 2025 im Abaton-Kino. Zu Gast sind diesmal gleich drei Kolleginnen und Kollegen: Christof Siemes, der für die ZEIT über alle Olympischen Spiele der vergangenen 25 Jahre berichtet hat – und der die Pläne aller deutschen Bewerberstädte (außer Hamburg bewerben sich Berlin und Leipzig, München sowie Nordrhein-Westfalen) genau analysiert hat. Annika Lasarzik, die das Frühjahr 2024 in Paris verbracht hat und hautnah erfuhr, wie sich die Olympischen Spiele auf das Alltagsleben der Menschen in der Stadt auswirken. Und Christoph Twickel, der seit Jahren über Stadtentwicklungsthemen schreibt und auch die beiden vergangenen Versuche Hamburgs verfolgt hat, Olympia in den Norden zu holen. Wie gut stehen die Chancen für die Hamburger Olympia-Bewerbung diesmal? Ist Hamburg überhaupt groß genug für Olympia? Wie müsste sich die Stadt verändern – und welche Hürden gibt es auf dem Weg zum Ziel? Moderiert von Florian Zinnecker, der zusammen mit Maria Rossbauer das Hamburg-Ressort der ZEIT leitet, diskutieren die drei Podcast-Gäste unter anderem über diese Fragen. Und sie sprechen auch darüber, was es für Hamburg zu gewinnen gäbe. Der Podcast "Elbvertiefung" erscheint einmal pro Woche. Immer samstags sprechen Maria Rossbauer und Florian Zinnecker abwechselnd mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Hamburg-Ressort der ZEIT über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade am meisten umtreibt. Immer persönlich, prägnant und pointiert – und diesmal live. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Wie Hamburg gerade den Wohnungsbau revolutioniert
Wer ein Haus bauen will, hat im Moment nicht unbedingt Spaß. Die Grundstückskosten steigen, genau wie – seit dem Krieg in der Ukraine – die Preise für die Baumaterialien. In manchen Städten legen Baugenossenschaften Projekte auf Eis, weil sie zu teuer geworden sind. Nun aber präsentiert Hamburgs Stadtentwicklungsbehörde einen Plan, der dem Wohnungsmarkt einen Schub geben soll. Eine Art Leitfaden namens Hamburg-Standard soll die Kosten für Neubauwohnungen um ein Drittel senken und so die Errichtung vieler neuer Häuser ermöglichen. Was ist das für ein Wundermittel? Und kann das wirklich funktionieren? In der neuen Folge des Hamburg-Podcasts "Elbvertiefung" spricht Maria Rossbauer mit Christoph Twickel über den Hamburg-Standard. Es geht darum, wie genau gespart werden soll, was das mit DIN-Normen und Trittschalldämmungen zu tun hat, und ob Wohnungen so noch schön und stilvoll werden können. Christoph Twickel erzählt, wo heute schon nach dem Hamburg-Standard geplant wird, und was das für Wohnungen werden. Und natürlich geht es auch darum, ob die Idee die Lage in Städten tatsächlich verändern kann – und wie man vorgehen sollte, wenn man nach dem Hamburg-Standard bauen will. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Wie Hamburg mit künstlicher Intelligenz durchstarten will
Container, die vollautomatisch entladen werden – mit einem autonomen Roboterarm. Arztbriefe, die wie von allein entstehen, sodass die Ärzte mehr Zeit haben, sich um Patienten zu kümmern. Theatervorstellungen, bei denen neben Menschen auch ein Bot auf der Bühne steht. Über diese – und weitere – Beispiele sprechen Kristina Läsker und Oskar Piegsa in der aktuellen Folge des Hamburgpodcasts "Elbvertiefung" zum Thema künstliche Intelligenz. Wie positioniert sich Hamburg beim Thema KI im Wettbewerb mit anderen Städten? Die Stadt habe Nachholbedarf, sagen Läsker und Piegsa, die beide als Journalisten für das Hamburgressort der ZEIT arbeiten, im Gespräch mit Podcast-Host Florian Zinnecker. Sie beantworten auch die Frage, wie der Nachholbedarf zu bewältigen wäre – und was es im Wettbewerb für Hamburg zu gewinnen gäbe. ZEIT-Redakteur Oskar Piegsa gibt außerdem Tipps, mit welchen KI-Anwendungen aus Hamburg man sich dem Thema ganz unkompliziert nähern kann. Der Podcast "Elbvertiefung" erscheint immer samstags. Im wöchentlichen Wechsel sprechen die beiden ZEIT-Hamburg-Ressortleiter Maria Rossbauer und Florian Zinnecker mit Kolleginnen und Kollegen aus ihrem Team über eine Frage, die die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade umtreibt. Haben Sie Fragen, Hinweise, Kritik oder Tipps? Dann schreiben Sie uns gerne an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Hamburg Ballett: Warum Demis Volpi wirklich gehen musste
Wer trägt die Verantwortung für das Scheitern des Hamburger Ballettintendanten Demis Volpi? Am Dienstag teilte die Kulturbehörde mit, die Hamburgische Staatsoper und Volpi hätten sich einvernehmlich auf eine Beendigung seines Engagements sowie seine sofortige Freistellung verständigt. Aber ganz so einvernehmlich wie behauptet dürfte die Trennung nicht verlaufen sein. War es tatsächlich die Kritik aus dem Ensemble am Führungsstil Volpis, die – schon wenige Monate nach seinem Amtsantritt – zu seiner Entlassung führte? In der aktuellen Folge der "Elbvertiefung" spricht Podcast-Host Maria Rossbauer darüber mit Florian Zinnecker, der zusammen mit Stella Schalamon zur Krise am Hamburger Ballett recherchiert. Im Podcast analysiert Florian Zinnecker die Vorwürfe, die in den vergangenen Wochen gegen Demis Volpi laut wurden, und beleuchtet die Rollen von Volpis Vorgänger John Neumeier, Gründer und jahrzehntelanger Leiter der Kompagnie, sowie Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda. Wie positionieren sich die beiden? Wie konnte der Konflikt, von dem noch bis vor Kurzem keine Rede war, so schnell eskalieren? Wem nutzt es, dass Volpi weg ist – und wie geht es nun weiter? Auch über diese Fragen wird in der aktuellen Folge diskutiert. Bereits im Mai haben Maria Rossbauer und Florian Zinnecker über die Lage am Hamburg Ballett gesprochen – die Podcast-Folge von damals finden Sie hier. Der Podcast "Elbvertiefung" erscheint einmal pro Woche. Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die als Doppelspitze das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, sprechen im wöchentlichen Wechsel mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Team (und manchmal, so wie diesmal, auch miteinander) über das Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade am meisten bewegt. Immer persönlich, prägnant und pointiert – und nur selten länger als eine knappe halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Achtung, die selbstfahrenden Autos kommen!
Wie wäre es, wenn in einer Großstadt viel weniger Autos herumständen? Wenn es stattdessen mehr Bäume und Parks gäbe, wenn Menschen kaum mehr im Stau stünden und Parkplätze suchen müssten – und trotzdem kämen alle überallhin, wo sie wollen, und das auch noch besonders sicher. Diese rosarote Zukunft, so hoffen einige, könnte mithilfe von selbstfahrenden Taxis wahr werden. Dann nämlich, wenn durch sie mehr und mehr die Privatautos verschwänden, mit all ihren Problemen. In der neuen Folge des Hamburg-Podcasts "Elbvertiefung" sprechen ZEIT:Hamburg-Redakteur Yannick Ramsel und Host Maria Rossbauer über das autonome Fahren. Yannick Ramsel erzählt, warum man womöglich in Hamburg schon ab diesem Sommer im Robotaxi durch die Innenstadt fahren kann, wie der Stand der technologischen Entwicklung ist – und wie es sich anfühlt, mit einem Auto ohne Fahrer durch die Stadt zu düsen. Der Hamburg-Podcast "Elbvertiefung" erscheint jeden Samstag. Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, sprechen jede Woche mit Kolleginnen und Kollegen aus ihrem Team über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade umtreibt – immer pointiert und persönlich, und nie länger als eine halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Eine Frau, ein Messer, ein voller Bahnsteig
Es dauerte nur wenige Stunden, bis klar war: Die 39-jährige Frau, die am vergangenen Freitag im Hamburger Hauptbahnhof wahllos mit einem Messer auf Reisende einstach, ist psychisch krank und wurde am Tag vor der Tat aus der Psychiatrie entlassen. Und: Sie ist polizeibekannt und bereits in mehreren Bundesländern auffällig geworden – weil sie sich selbst oder andere Menschen in Gefahr brachte. Wie also konnte sie dennoch auf den Bahnsteig gelangen? In der aktuellen Folge des Hamburg-Podcasts "Elbvertiefung" sprechen darüber Annika Lasarzik und Tom Kroll mit ZEIT:Hamburg-Ressortleiter Florian Zinnecker. Die beiden gehörten zum Rechercheteam, das unmittelbar nach der Tat mit der Arbeit begann, um für die ZEIT die Hintergründe aufzuklären. Tom Kroll schildert, welches Bild sich ihm im Hauptbahnhof bot, wie die Polizei auf den Vorfall reagierte und was in den Wochen, Tagen und Stunden vor der Tat geschah. Annika Lasarzik erklärt, auf welche Schwierigkeiten die Journalisten bei der Beurteilung der psychischen Konstitution der Täterin gestoßen sind, warum sie aus der Psychiatrie entlassen wurde und welche systemischen Probleme hier dringend gelöst werden müssen. Hätte sich die Tat verhindern lassen – und was muss geschehen, damit sie sich nicht wiederholt? Darauf finden die Journalisten im Podcast eine klare Antwort. Der ZEIT-Pocast "Elbvertiefung" erscheint immer samstags. Abwechselnd diskutieren die Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, mit Kolleginnen und Kollegen aus ihrem Team das Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade am meisten umtreibt – persönlich, pointiert und möglichst nicht länger als eine halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Ist Taubenfüttern ein Verbrechen?
Wer an Hamburg denkt, denkt zweifellos eher an Möwen. Dabei sind die Tauben in der Überzahl: Nach aktuellen Schätzungen leben bis zu 50.000 von ihnen in der Hansestadt – und es werden immer mehr. Deshalb ist es auf öffentlichen Plätzen verboten, Tauben zu füttern. Und auch, weil Taubenfutter Ratten anlockt. Um die Anzahl der Tauben in der Stadt unter Kontrolle zu halten, gäbe es allerdings deutlich wirkungsvollere Maßnahmen als ein Fütterungsverbot, erklärt ZEIT-Autor Tom Kroll in der neuesten Folge des Hamburg-Podcasts "Elbvertiefung". Und er erzählt von einer aktuellen Recherche auf dem Isemarkt, die mit einem Gerücht begann: Ein Mann, so hörte er, laufe nachts regelmäßig über das Marktgelände in Hoheluft – und verstreue heimlich den Inhalt eines großen Sacks Taubenfutter. Mehrere Versuche der Markthändler und auch der Hamburger Behörden, dem unbekannten Vogelfreund auf die Schliche zu kommen, waren schon gescheitert. Tom Kroll nahm die Verfolgung auf – und traf alsbald auf einen Mann mit überraschenden Motiven. Seinen Text, über dessen Recherche er im Podcast spricht, können Sie hier lesen. Wie groß ist das Taubenproblem in Hamburg wirklich? Gibt es überhaupt eines? Und warum ist das Thema so kontrovers? Darüber diskutiert Tom Kroll in dieser Podcast-Folge mit Florian Zinnecker, der – neben Maria Rossbauer – einer der beiden Moderatoren der "Elbvertiefung" ist. Die neuen Folgen dieses Podcasts erscheinen immer samstags. Abwechselnd sprechen Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, mit Kolleginnen und Kollegen aus ihrem Team in jeder Woche über ein Thema, das die Menschen in der Stadt umtreibt – persönlich, pointiert und möglichst nicht länger als eine knappe halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Wie der Sommer in der Stadt richtig gut wird
Im Eppendorfer Weg in Hamburg quetscht sich zwischen ein paar Parkplätzen auf der Straße ein Holzkonstrukt. Es ist etwa 24 Quadratmeter groß und sieht aus wie ein großes U. In der Mitte stehen Sitzbänke, die man vom Gehsteig aus erreichen kann, in den Holzwänden wachsen aus Beeten viele grüne Kräuter und Pflanzen. Dieses Konstrukt nennt sich Parklet, Anwohner betreiben es als eine Art Garten. Solche Stadtmöbel darf man in manchen Vierteln Hamburgs auf vormaligen Parkplätzen bauen, die Idee stammt ursprünglich aus San Francisco. Die Bewohner Hamburgs nämlich – und auch jene in vielen anderen Großstädten – ohne Garten oder Balkon, die trotzdem draußen ein wenig gestalten wollen, werden bisweilen ganz schön kreativ. Was alles möglich ist und wie es geht, darüber unterhalten sich Florian Zinnecker und Maria Rossbauer in der neuen Folge des Hamburgpodcasts "Elbvertiefung". Maria Rossbauer erzählt zum Beispiel, wie man Baumscheiben oder winzige Verkehrsinseln von der Stadt pachten und bepflanzen kann, wie der Bau von Stadtmöbeln gelingt und welche Genehmigungen dazu nötig sind. Es geht auch darum, wie viel Arbeit das alles macht und ob es sich lohnt – und für einen guten Sommer gibt es am Ende auch noch Empfehlungen zu den schönsten Biergärten Hamburgs. Der Hamburgpodcast "Elbvertiefung" erscheint jeden Samstag. Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburgressort der ZEIT leiten, sprechen als Hosts im wöchentlichen Wechsel mit Kolleginnen und Kollegen aus ihrem Team über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade umtreibt – immer pointiert und persönlich, und nie länger als eine halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Meuternde Tänzer und Vorwürfe – was passiert beim Hamburg Ballett?
Meuternde Tänzer und Vorwürfe – was passiert beim Hamburg Ballett? Im Sommer vergangenen Jahres bekam das weltberühmte Hamburg Ballett eine neue Leitung – nun beschweren sich Tänzerinnen und Tänzer öffentlich: Der Neue kann das nicht. Die Worte klingen dramatisch: Ihre aktuelle Leitung würde durch "schlechte Kommunikation, fehlende Transparenz und eine oft abschätzige Haltung" immer größere interne Probleme und ein toxisches Arbeitsklima entstehen lassen, schrieben 36 Tänzerinnen und Tänzer in einem Brief an den Hamburger Kultursenator. Sie bitten um Hilfe, denn sie wollen verhindern, dass ihr Ensemble – das weltberühmte Hamburg Ballett – zerbricht. Fünf Solistinnen und Solisten, teilweise Stars in der Ballettszene, haben schon gekündigt. 51 Jahre lang leitete John Neumeier das Hamburg Ballett. Er gilt als Legende, das Ensemble brachte er zu Weltruhm. Im August 2024 hörte der 86-Jährige auf, seither ist der deutsch-argentinische Tänzer und Choreograf Demis Volpi Intendant – und gegen ihn richtet sich nun die Kritik. Wie berechtigt aber ist sie? Das diskutieren in der neuen Folge des Podcasts Elbvertiefung Maria Rossbauer und Florian Zinnecker aus dem Hamburg-Ressort der ZEIT. Florian Zinnecker erklärt, warum derartige Probleme im Hamburg Ballett auf gewisse Weise abzusehen waren, was das mit dem Erbe John Neumeiers zu tun hat, und wie er Demis Volpi, den er kurz vor dem Start noch für ein Gespräch traf, einschätzt. Außerdem geht es darum, wie Demis Volpi den Vorwürfen begegnet – und wie es nun mit dem Hamburg Ballett weitergeht. Der Hamburg-Podcast "Elbvertiefung" erscheint jeden Samstag. Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, sprechen im wöchentlichen Wechsel mit Kolleginnen und Kollegen aus ihrem Team über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade am meisten umtreibt. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Neuer Koalitionsvertrag: Was Hamburgs Regierung nun plant – und was nicht
148 Seiten umfasst der neue Koalitionsvertrag, auf den sich der rot-grüne Senat in Hamburg zwei Monate nach der Bürgerschaftswahl verständigt hat. Ist er ein großer Wurf? Oder nur ein besseres Verwaltungsabkommen? Darüber diskutiert ZEIT-Hamburg-Ressortleiter Florian Zinnecker in der neuen Folge des Hamburg-Podcasts "Elbvertiefung" mit vier Kolleginnen und Kollegen: mit den ZEIT-Autoren Kristina Läsker und Christoph Twickel und den Redakteuren Frank Drieschner und Christoph Heinemann. Gelingt es dem Senat, das Wohnungsproblem in den Griff zu bekommen? Wie steht es um die Mobilitätswende? Wie sieht die Strategie für den Hafen aus? Und welche Prioritäten setzen SPD und Grüne bei der Sanierung von Straßen und Brücken? Diskutiert wird außerdem die Frage, wie der Senat auf die weltweite wirtschaftliche Krise reagiert – und wie innovativ die im Vertrag enthaltenen Ideen wirklich sind. Der Hamburg-Podcast "Elbvertiefung" erscheint jeden Samstag. Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, sprechen im wöchentlichen Wechsel mit Kolleginnen und Kollegen aus ihrem Team über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade am meisten umtreibt. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Weitere Links zur Folge: Hamburger Senat: Ciao, bis 2030 dann! Hamburger Mietenspiegel: Warum diese zweifelhafte Rechnung? Hamburger Hafen: Der blinde Fleck Neuauflage der Regierung: SPD und Grüne unterzeichnen Koalitionsvertrag [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Hamburgs Kreuzfahrtboom – Fluch oder Segen?
Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff – das scheint gerade für viele Menschen verlockend zu sein. Im vergangenen Jahr kamen auf diese Weise 1,3 Millionen Passagiere nach Hamburg, ein neuer Rekord. Die Stadt hat den größten Hafen für Kreuzfahrtschiffe in Deutschland, fast wöchentlich bieten große Reedereien wie MSC Cruises und AIDA von hier aus Trips an, nach Norwegen zum Beispiel oder an die Ostsee. Knapp 300 Schiffsanläufe sollen 2025 stattfinden. Die Tourismusbranche jubelt – doch Klimaschützer sind besorgt. Was also bedeutet der Boom für die Stadt tatsächlich? In der neuen Folge des Hamburg-Podcasts Elbvertiefung sprechen der Host Maria Rossbauer und die Wirtschaftsautorin der ZEIT:Hamburg, Kristina Läsker, über den Kreuzfahrt-Hype. Kristina Läsker erzählt, warum Kreuzfahrtschiffe allzu oft auch im Hafen noch ihre Motoren laufen lassen, und was das für die Luft der Menschen, die nah an den Terminals leben, bedeutet. Sie berichtet außerdem, was die neuen Landstromanlagen in Hamburg bringen, was die Reedereien selbst unternehmen, um klimafreundlicher zu werden – und warum die Suche nach dem richtigen Treibstoff der Zukunft so herausfordernd ist. Außerdem berichtet Kristina Läsker, wie es auf Kreuzfahrtschiffen so zugeht, sie erzählt von ihren Recherchen an Bord – und schließlich hat sie einen Tipp dabei für alle, die gerne einmal ein Kreuzfahrtschiff besuchen, aber nicht darauf Urlaub machen wollen würden. Der Podcast Elbvertiefung erscheint immer samstags. Abwechselnd sprechen die beiden Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, in jeder Folge mit einem ihrer Kolleginnen und Kollegen über eine Frage, die die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade umtreibt: mal ernst, mal locker, immer persönlich und pointiert – und nie länger als eine halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Oberbillwerder: Wohne so, dass die CDU etwas dagegen hätte
Im Osten Hamburgs, zwischen Neuallermöhe und den Boberger Dünen, soll bald Hamburgs neuester Stadtteil entstehen: Oberbillwerder. "Etwas sehr, sehr Vorbildliches und sehr Attraktives" solle dieser neue Stadtteil haben, schwärmte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) im Jahr 2019, als er die Pläne für Oberbillwerder vorstellte. Eine "gigantische Fehlplanung" nennt hingegen der CDU-Mann Dennis Gladiator das Projekt. Wer hat recht? Im Moment ist das noch schwer zu sagen, denn aktuell ist Oberbillwerder nicht viel mehr als ein Acker. Und eine Vision, gegossen in einen Bebauungsplan. Sowie Gegenstand eines Streits, der seit Jahren auf mehreren politischen Ebenen und gleichzeitig in der Bevölkerung schwelt – und manchmal auch tobt. Wer da mit wem streitet und ob es dabei eher um politische Winkelzüge geht oder tatsächlich um stichhaltige Gründe – darüber spricht Florian Zinnecker, Ressortleiter der ZEIT:Hamburg, mit Christoph Twickel, der die Planungen in Oberbillwerder sowie die damit verbundenen Schwierigkeiten seit Jahren begleitet. Im Podcast erklärt Christoph Twickel, wie Oberbillwerder eines Tages aussehen könnte, wie die Chancen stehen, dass das Stadtviertel tatsächlich gebaut wird, und wer dies – mit welchen Argumenten – noch verhindern oder jedenfalls verzögern könnte. Diskutiert wird außerdem, was sich aus dem bisherigen Projektverlauf lernen lässt: für den nächsten Stadtteil, der in Hamburg gebaut wird. Der Hamburg-Hack dreht sich in dieser Folge um den Mietenmelder der Behörde für Stadtentwicklung, den Sie unter diesem Link finden. Und hier gelangen Sie zur Podcast-Studie der ZEIT, von der in der Folge ebenfalls die Rede ist. Der Hamburg-Podcast "Elbvertiefung" erscheint immer samstags. Abwechselnd sprechen die beiden Hamburg-Ressortleiter Maria Rossbauer und Florian Zinnecker in jeder Folge mit den Kolleginnen und Kollegen aus ihrem Team über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade bewegt – pointiert, persönlich und nie länger als eine knappe halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Und was, wenn der HSV doch aufsteigt?
Einst galt der Hamburger Sport-Verein als Dino in der Ersten Bundesliga – kein anderer Fußballclub verblieb dort so lange (55 Jahre) wie der Hamburger Traditionsverein. Dann kam das Jahr 2018, der HSV stieg ab und schaffte es seither nicht wieder zurück. Mitte Mai nun endet diese Bundesligasaison, es sind also nur noch fünf Spieltage – und trotz des 2:4 am Freitagabend gegen Eintracht Braunschweig stehen die Chancen sehr gut. Der HSV ist nach wie vor auf dem ersten Platz der Zweiten Liga. Was also, wenn der HSV es diesmal tatsächlich schafft? Was würde das für den Verein bedeuten, was passiert dann mit der Mannschaft, mit dem zusätzlich eingenommenen Geld – und den Ticketpreisen? In der neuen Folge des Hamburg-Podcasts Elbvertiefung spricht der Host Maria Rossbauer mit dem ZEIT-Hamburg-Autor Daniel Jovanov über diese spannende Zeit im Profifußball. Jovanov erzählt, warum er glaubt, dass in diesen Wochen die steigende Nervosität der größte Faktor ist. Er erklärt, warum er davon überzeugt ist, dass ein Aufstieg des HSV die Bundesliga insgesamt attraktiver machen würde und wieso der Verein dann einige neue Spieler verpflichten müsste. Und er verrät, wie man vielleicht auch in der nächsten Saison, wenn Hamburg dann womöglich als einzige deutsche Stadt mit dem FC St. Pauli zwei Vereine in der Ersten Bundesliga hat, noch Tickets für die Spiele ergattern könnte. Der Podcast Elbvertiefung erscheint immer samstags. Abwechselnd sprechen darin die beiden Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, in jeder Folge mit einem ihrer Kolleginnen und Kollegen über eine Frage, die die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade umtreibt: mal ernst, mal locker, immer persönlich und pointiert – und nie länger als eine halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Das Überseequartier: Warum genau braucht Hamburg ein neues Shopping-Viertel?
Die einen nennen es Einkaufszentrum, die anderen ein komplett neues Stadtviertel: Anfang April eröffnet in der Hamburger HafenCity – direkt an der Elbe – ein Quartier mit einem Einkaufszentrum, das 170 Geschäfte beherbergt, dazu 10 Kinosäle, 40 Gastronomiebetriebe, 3 Hotels, 580 Luxuswohnungen, noch mehr Büroarbeitsplätze und ein eigenes Kreuzfahrtterminal. 400.000 Quadratmeter ist das Ganze groß, 1,6 Milliarden Euro hat es gekostet, und nachdem 2.000 Arbeiter über viele Jahre hinweg geschuftet haben, ist das Westfield Hamburg-Überseequartier auch tatsächlich (mehr oder weniger) fertig – und soll nun über 16 Millionen Besucher im Jahr empfangen. Aber warum überhaupt bekommt Hamburg nun dieses riesige Shopping-Viertel? Wen soll es anlocken – und was bedeutet das für die schon vorhandenen Einkaufsstraßen Hamburgs, etwa der Innenstadt? In der neuen Folge des Hamburg-Podcasts Elbvertiefung unterhält sich der Host Maria Rossbauer mit Christoph Heinemann und Christoph Twickel aus dem Hamburg-Ressort der ZEIT über das Überseequartier. Die beiden erzählen, was dort alles geplant ist, wie es überhaupt zu dem Projekt kam – und was Olaf Scholz damit zu tun hat. Es geht auch um die dramatischen Zustände, die ihren Recherchen zufolge bisweilen auf der Großbaustelle herrschten. Und schließlich diskutieren die drei, für welche Verschiebungen das Überseequartier wohl in Zukunft in der Stadt sorgt – und was sich in dem neuen Stadtviertel lohnt anzuschauen. Der Podcast Elbvertiefung erscheint immer samstags. Abwechselnd sprechen die beiden Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, in jeder Folge mit einem ihrer Kolleginnen und Kollegen über eine Frage, die die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade umtreibt: mal ernst, mal locker, immer persönlich und pointiert – und nie länger als eine halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Rassismus in Chats: Wie tickt die Hamburger Polizei?
Die Hamburger Polizei hat gerade eine ziemlich große Affäre aufzuklären. Aktuell wird gegen 15 Beamte ermittelt, die antisemitische und naziverherrlichende Nachrichten bei WhatsApp ausgetauscht haben sollen. Hat die Hamburger Polizei ein Problem mit Rechtsextremen? „Auf jeden Fall gibt es Anzeichen dafür“, sagt ZEIT:Hamburg.Redakteur Christoph Heinemann. In der aktuellen Folge des Hamburg-Podcasts "Elbvertiefung" sprechen Host Maria Rossbauer und Christoph Heinemann über die Zustände in der Hamburger Polizei. Heinemann erzählt, was Forscherinnen und Forscher dazu herausgefunden haben, wo menschenabwertende Gedanken unter Beamten herkommen, was das mit ihrem Arbeitsalltag, einem Gefühl von mangelndem Respekt und auch mit sogenannter toxischer Männlichkeit zu tun hat. Außerdem berichtet er, was die Hamburger Polizei unternimmt – und was er selbst auf seinen Recherchen, unterwegs mit Hamburger Beamten, erlebt hat. Der Podcast "Elbvertiefung" erscheint immer samstags. Abwechselnd sprechen die beiden Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, in jeder Folge mit einem ihrer Kolleginnen und Kollegen über eine Frage, die die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade umtreibt: Mal ernst, mal locker, immer persönlich und pointiert – und nie länger als eine halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Auf den Spuren von Hamburgs Meisterdieb
Einer seiner größten Einbrüche war der im Postamt 6 in der Hamburger Susannenstraße. Das war im September 1920. Julius Adolf Petersen und seine Leute hatten das Objekt lange ausgekundschaftet, sie wussten, wann die Tresore gefüllt waren mit den auszuzahlenden Löhnen und den Renten. In der Dunkelheit überfielen sie den Nachtwächter, sperrten ihn in einen Schrank, räumten die Tresore aus und verschwanden. Die Beute: eine halbe Million Mark und etliche Briefmarken. Julius Adolf Petersen war so etwas wie ein Meisterdieb und Einbrecherkönig in Hamburg. Vor hundert Jahren waren er und seine Bande verantwortlich für unzählige Raubzüge im gesamten Stadtgebiet und auch über die Grenzen hinaus. ZEIT-Hamburg-Autor Söhnke Callsen hat vieles über das spektakuläre Leben des "Lord von Barmbeck" herausgefunden. In der neuen Folge des Podcasts "Elbvertiefung" erzählt Callsen dem Host Maria Rossbauer, warum Petersen schon zu Lebzeiten ein Promi in Hamburg war, sodass selbst die Polizei ihn und seine Leute ehrfürchtig "Barmbecker Verbrechergesellschaft" nannte. Es geht um ein System namens "kalte Methode", mit dem Petersen die Geldschränke knackte, und darum, wie ein junger Mann aus einem Hamburger Arbeiterviertel in eine Unterwelt gerutscht war, in der die Leute Lockenfitsche, Rabenmax oder Hunderobert hießen. Und natürlich verrät Callsen auch, warum man Petersen den "Lord" nannte – und wie es Polizisten am Ende doch gelang, ihn zu Fall zu bringen. Der Podcast "Elbvertiefung" erscheint immer samstags. Abwechselnd sprechen die beiden Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, in jeder Folge mit einem ihrer Kolleginnen und Kollegen über eine Frage, die die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade umtreibt – mal ernst, mal locker, immer persönlich und pointiert – und nie länger als eine halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Skiferien! Muss das sein?
Ganz Deutschland freut sich auf die Osterferien. Ganz Deutschland? Nein: In Hamburg haben Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und dementsprechend auch viele Familien bereits jetzt frei; statt Osterferien gibt es in Hamburg Anfang März die sogenannten Skiferien. Bei Menschen, die mit den Hamburger Eigenheiten nicht vertraut sind, löst dieser Name häufig Irritation aus: Skiferien in Norddeutschland, ganz ohne Berge? Aber ja: Ab Hamburg verkehrt ein Sonderzug, der seine Passagiere direkt in die Skigebiete nach Österreich bringt. Vorher kann man sich in einem der zahlreichen Hamburger Ski-Clubs fit machen. Ist auf den österreichischen Skipisten spürbar, dass gerade besonders viele Hamburgerinnen und Hamburger dort herumfahren? Diese Frage stellt ZEIT:Hamburg-Ressortleiter Florian Zinnecker in der aktuellen Folge des Podcasts "Elbvertiefung" seinem Kollegen Florian Gasser, der die Österreich-Seiten der ZEIT verantwortet und das ZEIT-Landesbüro in Wien leitet. Die beiden diskutieren über die Frage, was so viele Deutsche Jahr für Jahr zum Skifahren in die Berge zieht, wer den Sport erfunden hat, was ihn in den Augen vieler so faszinierend macht – und wie die auffällige Liebe vieler Hamburgerinnen und Hamburger zu Österreich zu erklären ist. Außerdem sprechen die beiden darüber, ob Skiurlaube heute ökologisch noch tragbar sind – und wer von den Hamburger Skiferien am meisten profitiert. Der Podcast "Elbvertiefung" erscheint immer samstags. Die beiden ZEIT:Hamburg-Ressortleiter Maria Rossbauer und Florian Zinnecker sprechen jede Woche abwechselnd mit Kolleginnen und Kollegen (nicht nur) aus dem Hamburg-Ressort über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade besonders bewegt. Immer persönlich, pointiert und selten länger als eine knappe halbe Stunde. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Hamburg nach der Wahl: Wer künftig im Rathaus entscheidet (und wer nicht)
Eine Woche nach der Bundestagswahl waren die Menschen in Hamburg noch einmal zur Wahl aufgerufen: um die Abgeordneten der Bürgerschaft zu bestimmen, wie das Parlament des Stadtstaats heißt. Die SPD gewann die Wahl mit 33,5 Prozent, so viel steht fest. Offen ist hingegen, ob die Partei, die in Hamburg seit 2011 den Ersten Bürgermeister stellt, die Koalition mit den Grünen fortsetzt oder doch ein Bündnis mit der CDU eingeht, die sich seit der letzten Wahl von 11,2 Prozent auf 19,8 Prozent steigern konnte. Welche Folgen – und welche Vorteile – hätte eine Koalition mit der CDU für Hamburg? Wie wahrscheinlich ist ein solches Bündnis? Und was spricht für eine Fortsetzung der rot-grünen Koalition? Darüber spricht Florian Zinnecker, Ressortleiter von ZEIT:Hamburg, in der aktuellen Folge des Podcasts "Elbvertiefung" mit vier Kolleginnen und Kollegen: Kristina Läsker, Annika Lasarzik, Frank Drieschner und Christoph Twickel. Diskutiert wird auch die Liste der künftigen Abgeordneten: Wer ist dabei, vielleicht entgegen den Erwartungen – und wer hat es, anders als gedacht, diesmal nicht geschafft? Zusammen analysieren die ZEIT-Journalisten außerdem die Wahlergebnisse der anderen Parteien: Wie ist es zu erklären, dass die AfD bei der Bundestagswahl mehr Stimmen aus Hamburg bekam als bei der Bürgerschaftswahl? Warum landete die FDP, einst eine stolze Fraktion in der Bürgerschaft, bei zwei Prozent? Und wie nachhaltig ist der Boom der Linken? Der ZEIT-Podcast "Elbvertiefung" erscheint immer samstags. Die beiden Hosts, Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, sprechen jeweils wechselnd mit Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands in der jeweiligen Woche am meisten bewegt. Immer persönlich, prägnant und pointiert – und von der kommenden Woche an wie gewohnt kürzer als eine halbe Stunde. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Ist Hamburg politisch ein eigener Planet?
Noch nie haben bei einer Bundestagswahl so wenige Menschen für die SPD gestimmt wie am vergangenen Sonntag – auch in Hamburg. Gleichzeitig war das Ergebnis für die Partei in Hamburg immer noch hoch genug, um stärkste Kraft zu bleiben. Wie wirkt sich dieses Ergebnis auf die Hamburg-Wahl am kommenden Sonntag aus? Was bedeutet der überraschende Boom der Linken für SPD und Grüne, die – angesichts einer bislang stabilen Mehrheit in den Umfragen – ihre Koalition in Bürgerschaft und Senat eigentlich fortsetzen wollten, nun aber um den Stimmenvorsprung bangen müssen? Und: Kann die Hamburger CDU, in den Umfragen zur Bürgerschaftswahl weit abgeschlagen, vom Erfolg der Partei auf Bundesebene profitieren? Um diese und eine Reihe weiterer Fragen dreht sich in der Woche zwischen den beiden Wahlterminen die aktuelle Folge des Hamburg-Podcasts "Elbvertiefung". Anders als sonst gibt es nicht nur einen Studiogast, sondern vier: ZEIT-Hamburg-Ressortleiter Florian Zinnecker diskutiert mit Kristina Läsker, Christoph Twickel, Frank Drieschner und Christoph Heinemann, alle ZEIT-Redakteure oder -Autoren, die die Hamburger Politik seit Jahren journalistisch beobachten. Die fünf nehmen auch die politischen Folgen der Bundestagswahl für Hamburg insgesamt in den Blick: Endet mit der Kanzlerschaft von Olaf Scholz, einst Erster Bürgermeister Hamburgs, eine Art von privilegierter Partnerschaft der Hansestadt mit Berlin? Was bedeutet eine CDU-geführte Bundesregierung für die Hamburger Wirtschaft, den Hafen und wichtige Infrastrukturprojekte? Und was ist von einem AfD-Ergebnis zu halten, das zwar nur rund halb so hoch ist wie im Bundesschnitt, aber dennoch doppelt so hoch wie bei der vorigen Wahl? Der Hamburg-Podcast "Elbvertiefung" der ZEIT erscheint immer samstags. Abwechselnd sprechen die beiden Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker jede Woche mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Hamburg-Ressort über eine Frage, die die Menschen in der Stadt gerade bewegt – immer persönlich, pointiert und möglichst nie länger als eine knappe halbe Stunde (diesmal aber schon). [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Werden die Mieten in Hamburg jemals wieder sinken?
Wie kann Wohnen in Hamburg wieder bezahlbar werden? Laut einer Wahlumfrage des Instituts Trend Research im Auftrag von ZEIT:Hamburg und Radio Hamburg ist dieses Thema für 60 Prozent der Wählerinnen und Wähler das relevanteste für die Bürgerschaftswahl am 2. März. Gleichzeitig ist das Vertrauen in den Einfluss der Hamburger Politik nicht besonders stark ausgeprägt: Die Mehrheit der Befragten, rund 30 Prozent, traut keiner Partei zu, das Problem lösen zu können. Ist dieser Vorbehalt berechtigt? Wie gut sind die Konzepte der Parteien wirklich? Welche Ideen gibt es überhaupt, und worin unterscheiden sie sich? Darüber spricht ZEIT:Hamburg-Ressortleiter Florian Zinnecker in der aktuellen Folge des Hamburg-Podcasts Elbvertiefung mit dem ZEIT-Autor Christoph Twickel. Der gibt auch eine Einschätzung zu der Frage ab, ob die Mieten in Hamburg jemals wieder sinken werden – und verrät einen Geheimtipp, wie er selbst eine bezahlbare Wohnung gefunden hat. Der Podcast Elbvertiefung erscheint immer samstags. Die beiden Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker sprechen darin abwechselnd mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Hamburg-Ressort der ZEIT in jeder Folge über ein Thema, das die Menschen in Hamburg gerade besonders bewegt. Immer prägnant, pointiert und persönlich – und nie länger als eine knappe halbe Stunde. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Warum noch mal braucht Hamburg eine neue Oper?
Klaus-Michael Kühne ist Erbe des Logistikriesen Kühne + Nagel und Großaktionär der Reederei Hapag-Lloyd sowie der Lufthansa. Der Multimilliardär lebt zwar in der Schweiz, wurde aber in Hamburg geboren und sorgt sich immer noch um das Wohl dieser Stadt. Und er ist, so sagte es der Erste Bürgermeister Hamburgs neulich, "Kenner und Liebhaber der Opernkunst" – doch die Hamburger Staatsoper mag er nicht so. Darum hat der 87-Jährige nun beschlossen, der Stadt Hamburg ein Opernhaus zu schenken. Am Baakenhöft in der HafenCity will er eine "neue Oper von Weltrang" auf seine Kosten bauen lassen, und diese dann nach Fertigstellung der Stadt übergeben. Bis zu eine Milliarde Euro würde er dafür ausgeben. Die Verträge dazu sind gemacht, nun muss nur noch die Hamburgische Bürgerschaft zustimmen. Was aber steckt hinter diesem Geschenk? Und braucht es wirklich eine neue Oper in Hamburg? In der neuen Folge des Podcasts "Elbvertiefung" spricht Host Maria Rossbauer mit Florian Zinnecker über die neue Oper. Zinnecker, der diesen Podcast im Wechsel mit Rossbauer auch moderiert, erklärt, was Kühne und die Stadt genau vorhaben, warum es ein ziemlich lukrativer Deal für Hamburg ist und warum es trotzdem Kritik hagelt. Außerdem geht es darum, warum die Hamburgische Staatsoper in Kühnes Augen zu wenig „Strahlkraft“ hat – und wieso er damit vielleicht gar nicht unrecht hat. Jede Woche unterhalten sich entweder Maria Rossbauer oder Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, mit einer Kollegin oder einem Kollegen über eine Frage, die die Bewohnerinnen und Bewohner der zweitgrößten Stadt Deutschlands umtreibt – mal ernst, mal locker, immer prägnant und persönlich. Und nie länger als 30 Minuten. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Zum gleichnamigen Newsletter geht es hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Wie Hamburg gerade das Heizen revolutioniert
Es gibt da diesen nigelnagelneuen Tunnel mitten in Hamburg. 120 Millionen Euro hat der Bau gekostet, er führt tief unter der Elbe hindurch und ist nur 3,50 Meter breit – Autos also könnten nicht fahren, nicht einmal Menschen durchspazieren, aber das sollen sie auch nicht: Der Tunnel wird einmal Wasser zum Heizen vom Süden in den Norden der Stadt bringen. Hamburg ist nämlich gerade im Begriff, das Fernwärmenetz massiv auszubauen. Damit soll die Stadt klimafreundlicher werden. Das ist auch nötig: Die Hansestadt stößt aktuell 15 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid im Jahr aus. Rund 40 Prozent davon entstehen beim Beheizen der Gebäude, denn das geschieht im Moment vor allem mithilfe von Gas, Öl und Strom. Mit dem Ausbau der Fernwärme soll das nun besser werden. Doch bisher wird auch die Fernwärme in Hamburg überwiegend mit Kohle erzeugt. Wie kann es also gelingen, sie klimafreundlicher zu machen? In der neuen Folge des Podcasts Elbvertiefung spricht Maria Rossbauer über den Umbau des Hamburger Fernwärmenetzes mit Kristina Läsker. Die Wirtschaftsautorin der ZEIT:Hamburg erzählt, wie es sich in dem neuen Tunnel tief unter der Elbe anfühlt, welche Herausforderungen der riesige Bohrkopf namens Hermine zu bewältigen hatte, und wofür genau der Tunnel letztlich geschaffen wurde. Sie erklärt, wie eine riesige Thermoskanne und Abwärme aus einem Stahlwerk das Wasser künftig erhitzen sollen – und wo bei all diesen Vorhaben die Probleme liegen. Und natürlich verrät sie auch, wie man herausfindet, ob das eigene Haus oder die Wohnung auch einmal Fernwärme bekommen könnte. Jede Woche unterhalten sich entweder Maria Rossbauer oder Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, mit einer Kollegin oder einem Kollegen über eine Frage, die die Bewohnerinnen und Bewohner der zweitgrößten Stadt Deutschlands umtreibt – mal ernst, mal locker, immer prägnant und persönlich. Und nie länger als 30 Minuten. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Wer könnte in Hamburg statt des Bürgermeisters Bürgermeister werden?
Seit März 2018 ist Peter Tschentscher (SPD) Erster Bürgermeister Hamburgs. Und wenn am 2. März dieses Jahres in der Hansestadt ein neues Parlament gewählt wird, stehen – zumindest nach den aktuellsten Umfragen – Tschentschers Chancen nicht schlecht, sich nach der Wahl mit einer stabilen Mehrheit im Amt bestätigen lassen zu können. Es könnte aber auch anders kommen. Denn zwar hat Tschentscher angekündigt, nach der Wahl gerne weiterhin mit den Grünen koalieren zu wollen. Die Grünen allerdings treten mit einer eigenen Spitzenkandidatin an: Katharina Fegebank, amtierende Wissenschaftssenatorin und Zweite Bürgermeisterin. Und auch in der größten Oppositionspartei, der CDU, bewirbt sich jemand für das Bürgermeisteramt: Dennis Thering, CDU-Landesvorsitzender und Fraktionschef in der Bürgerschaft. Wofür stehen Fegebank und Thering? Worin unterscheiden sie sich von Tschentscher? Was wäre zu erwarten, wenn sie tatsächlich die Stadt regieren – und wie gut stehen ihre Chancen wirklich? Darüber spricht ZEIT:Hamburg-Ressortleiter Florian Zinnecker in der aktuellen Folge der „Elbvertiefung“ mit Annika Lasarzik, die Katharina Fegebank für ein Porträt einige Zeit lang begleitet hat, und Frank Drieschner, der Dennis Thering gut kennt. Und natürlich diskutieren die drei auch über die wohl spannendste Frage: Wie wahrscheinlich – und wie aussichtsreich – wäre ein Bündnis der CDU mit den Grünen? Am Dienstag, 4. Februar, treffen die drei Bürgermeister-Kandidaten im Übrigen beim Rathaus-Triell von ZEIT:Hamburg in Kooperation mit Radio Hamburg aufeinander. Die Veranstaltung wird hier live übertragen, wer Fragen an die Kandidaten hat, kann sie unter diesem Link vorab einreichen. Der ZEIT-Podcast „Elbvertiefung“ erscheint immer samstags. Die beiden Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker sprechen darin im Wechsel mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus dem Hamburg-Ressort der ZEIT über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade bewegt – persönlich, pointiert und nie länger als eine knappe halbe Stunde. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Kriminelle Kunst: Wer hat da heimlich die Hamburger Paketautos bemalt?
Das Thema der neuesten Folge des Hamburg-Podcasts Elbvertiefung könnte eine Polizeimeldung sein, oder ein schwärmerisches Stück aus dem Feuilleton: Über viele Wochen, wahrscheinlich Monate, haben Unbekannte mehr als 500 Lieferwagen des Paket-Dienstleisters DHL bemalt – oder, je nach Sichtweise, beschmiert. Um die Graffiti anzubringen, müssen sich die Sprüher wiederholt auf den Parkplatz des Logistikunternehmens geschlichen haben. Tatsächlich unbekannt sind die Urheber der Bemalung aber doch nicht – einige jedenfalls gehören zu den Promis der Hamburger Graffiti-Szene. Wer die Menschen sind, die in tage- oder nächtelanger Arbeit Hunderte Lieferwagen besprühen, wie dieses Phänomen einzuordnen ist und wer sich daran stört – darüber spricht Maria Rossbauer, Ressortleiterin von ZEIT:Hamburg, im Podcast mit Oskar Piegsa und Christoph Heinemann. Die beiden ZEIT-Redakteure sind dem Fall in einer Recherche auf den Grund gegangen. Im Podcast erklären sie auch, warum häufig nur die linke Wagenseite bemalt ist, führen einmal durch die Geschichte der Hamburger Graffiti-Szene und erklären, was eigentlich die Polizei dazu sagt. Und sie werfen eine bekannte, aber ungelöste und immer noch höchst kontroverse Frage auf: Handelt es sich bei der Aktion nur um Sachbeschädigung – oder auch um Kunst? Der Podcast Elbvertiefung erscheint immer samstags. Abwechselnd sprechen die beiden Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker in jeder Folge mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus dem Hamburg-Ressort der ZEIT über eine Frage, die die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade umtreibt – mal ernst, mal locker, immer persönlich und pointiert – und nie länger als eine knappe halbe Stunde. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Berufe auf den Stimmzetteln: Wie manche Hamburger Politiker dabei tricksen
"Mit dem richtigen Beruf überholen Kandidaten bis zu zehn andere Kandidierende, die vor ihnen auf einer Liste stehen", sagt Mario Mechtel. Er ist Professor an der Leuphana-Universität in Lüneburg und hat 2014 die Ergebnisse einer baden-württembergischen Kommunalwahl analysiert. Bäcker und Metzger katapultierte ihr Beruf bei der Wahl um durchschnittlich elf Listenplätze nach oben, Landwirte um zehn, Polizisten um neun und Krankenpfleger um sieben. Dass die richtige Berufsangabe Stimmen bringen kann, ist natürlich auch vielen Politikern bewusst. Am 2. März wählen die Hamburgerinnen und Hamburger eine neue Bürgerschaft. 815 Menschen treten dafür an. Auch hier werden viele Menschen, die Direktstimmen vergeben, auf die Berufe der Kandidatinnen und Kandidaten achten. Darum haben Tom Kroll und Christoph Heinemann von ZEIT:Hamburg die Berufsangaben der vielversprechendsten Parteien – also von SPD, CDU, Grüne, Linke, AfD, FDP, Volt und BSW – überprüft. Und fanden so einige Flunkereien. Ein Kandidat etwa machte sein Hobby zum Beruf, ein anderer sein Ehrenamt. Manche gaben statt ihrer aktuellen Tätigkeit an, was sie vor vielen Jahren einmal studiert hatten. Und sie fanden sogar einen Fall, der strafrechtlich relevant sein könnte. Im der aktuellen Folge des Podcasts Elbvertiefung sprechen Host Maria Rossbauer und ZEIT:Hamburg-Autor Tom Kroll über die Recherche zu den Berufsangaben auf den Stimmzetteln. Kroll erklärt etwa, wie sie all die irreführenden oder gar falschen Angaben ausfindig gemacht haben. Er erzählt von den spannendsten und lustigsten Flunkereien – und wie die Kandidatinnen und Kandidaten auf die Nachfragen der Reporter reagierten. Jede Woche unterhalten sich entweder Maria Rossbauer oder Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, mit einer Kollegin oder einem Kollegen über eine Frage, die die Bewohnerinnen und Bewohner der zweitgrößten Stadt Deutschlands umtreibt – mal ernst, mal locker, immer prägnant und persönlich. Und nie länger als 30 Minuten. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Elefanten, Affen, Streithähne: Was ist los bei den Hagenbecks?
Bis zu zwei Millionen Menschen besuchen den Tierpark Hagenbeck jährlich. Der Name der Familie, die den Hamburger Zoo seit Generationen betreibt, ist berühmt – auch außerhalb Norddeutschlands. Allerdings nicht nur wegen der Elefanten, Eisbären, Fische, Löwen, Pinguine und Flamingos, die in dem 19 Hektar großen Park in Hamburg-Lokstedt leben. Sondern auch wegen eines Familienstreits, der immer wieder neu eskaliert – und längst nicht nur die Familie selbst betrifft. Worum geht es dabei? Christoph Heinemann beobachtet die familiären Auseinandersetzungen seit Jahren – und gibt die Antwort in der aktuellen Folge des ZEIT-Podcasts »Elbvertiefung«. Mit ZEIT:Hamburg-Ressortleiter Florian Zinnecker spricht er darüber, wer da mit wem streitet und wer mit wem gar nicht mehr spricht, was der Auslöser war – und woran man selbst als normaler Tierpark-Besucherin oder -Besucher merkt, dass bei den Eigentümern nicht alles reibungslos läuft. Der Hamburg-Podcast »Elbvertiefung« erscheint immer samstags. Die beiden Hamburg-Ressortleiter Maria Rossbauer und Florian Zinnecker sprechen abwechselnd in jeder Folge mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus ihrem Team über eine Frage, die die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade umtreibt – pointiert, persönlich und nie länger als eine knappe halbe Stunde. Den Hamburg-Newsletter »Elbvertiefung« können Sie hier abonnieren. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Der große Jahresrückblick: Das ganze Jahr in einer Folge
Woche für Woche sprechen Maria Rossbauer und Florian Zinnecker im Podcast "Elbvertiefung" abwechselnd mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus dem Hamburg-Ressort der ZEIT über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands besonders umtreibt. Diesmal ist das anders: In der letzten Folge des Jahres 2024 moderieren die beiden zusammen – und sie haben nicht einen Gast eingeladen, sondern das ganze Hamburg-Team im Studio versammelt. Mit Frank Drieschner, Viola Diem, Annika Lasarzik, Christoph Heinemann, Yannick Ramsel und Oskar Piegsa sowie den drei ZEIT-Autoren Tom Kroll, Kristina Läsker und Christoph Twickel sprechen Maria Rossbauer und Florian Zinnecker über ihre Themen des Jahres. Dazu gehören: die Zukunft des Hafens und des Elbtowers, das Leben in der HafenCity, die Debatte um die Köhlbrandbrücke, die Gefährdung von Fahrradfahrern im Straßenverkehr, aber auch die Schließung des Islamischen Zentrums und das wachsende Problem der Stadt mit Kokain. Was hat sich in diesem Jahr dazu neu ergeben, was hat sich seit unseren großen Recherchen getan, wie geht es weiter? Das sind die Fragen, die sich wie ein roter Faden durch den Jahresrückblick ziehen. Und natürlich verraten Maria Rossbauer und Florian Zinnecker auch, welche Themen für sie die wichtigsten – oder jedenfalls: die prägendsten – in diesem Jahr gewesen sind. In einer knappen halben Stunde, der üblichen Dauer jeder "Elbvertiefung"-Folge, ist das natürlich nicht zu machen. Deshalb ist der Jahresrückblick mit rund anderthalb Stunden nicht nur die letzte, sondern auch die mit Abstand längste Folge des Jahres. Mit dem Jahresrückblick geht der Podcast in eine Weihnachtspause, die nächste Folge erscheint – dann wieder in gewohnter Länge und Besetzung – am 11. Januar. Das Hamburg-Ressort wünscht frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zum gleichnamigen täglichen Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Mit Pauken, Trompeten und Bling-Bling
Das "Weihnachtsoratorium" von Johann Sebastian Bach umfasst sechs Kantaten, dauert mehrere Stunden und wurde 1734 zum ersten Mal aufgeführt – nicht in Hamburg, sondern in Leipzig. Dennoch ist das Werk in der Hansestadt heute so beliebt wie kaum ein zweites – und wird, mit Ausnahme von Leipzig, im Advent in keiner anderen Stadt so häufig aufgeführt. Woran liegt das? Was macht das Weihnachtsoratorium so einzigartig? Was muss man wissen, bevor man eine Aufführung besucht, und wie nähert man sich dem Werk am besten, wenn man noch nie davon gehört hat? Darüber spricht in der aktuellen Folge des Hamburg-Podcasts "Elbvertiefung" der ZEIT:Hamburg-Ressortleiter Florian Zinnecker mit Christina Rietz. Sie ist Redakteurin im Glaubensressort Christ&Welt, schreibt regelmäßig über Musik und gehört zu den Bach-Experten in der ZEIT-Redaktion. Im Podcast gibt Christina Rietz einen Einblick in die besondere Entstehungsgeschichte und den großen Hamburgbezug des Werks, sie spricht über ihre Lieblingsstellen, und sie erzählt, welche Aufführungen des "Weihnachtsoratoriums" ihr besonders im Kopf geblieben sind. Außerdem verrät sie, mit welchen Äußerungen man sich im Anschluss an die Aufführung als echter Experte ausweisen kann, und sie gibt einen Überblick über die besten Aufnahmen des Werks. Der Podcast "Elbvertiefung" erscheint immer samstags. Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, sprechen als Hosts immer abwechselnd mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus ihrem Team oder anderen ZEIT-Ressorts über das Thema, das die Menschen in Hamburg gerade am meisten bewegt. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zum gleichnamigen täglichen Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Wie tickt Hamburgs Bürgermeister?
Am 2. März wählt Hamburg eine neue Bürgerschaft – so heißt in der Hansestadt das Parlament. Und die wählt wiederum den Ersten Bürgermeister oder die Erste Bürgermeisterin. Die aussichtsreichsten Bewerber für dieses Amt sind Katharina Fegebank (Grüne), Dennis Thering (CDU) – und der amtierende Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), der die Stadt bereits seit 2018 regiert, als Nachfolger des derzeitigen Bundeskanzlers Olaf Scholz. Tschentschers SPD führt in den Umfragen aktuell mit rund zehn Prozentpunkten Abstand zu Grünen und CDU. Aber wie stehen die Chancen tatsächlich, dass Tschentscher im Amt bleibt? Wäre das eine gute Nachricht für die Stadt? Ist er ein guter Bürgermeister, wo liegen seine Stärken und Schwächen? In der neuesten Folge des Hamburg-Podcasts "Elbvertiefung" diskutieren darüber der ZEIT-Redakteur Christoph Heinemann, der Tschentscher nicht erst bei den Recherchen zu einem großen Porträt für die gedruckte Ausgabe der ZEIT aus nächster Nähe kennengelernt hat, und Podcast-Host Florian Zinnecker, Ressortleiter der ZEIT Hamburg. Die beiden sprechen über Tschentschers Regierungsstil, seine Erfolge und die Dinge, die in seiner bisherigen Amtszeit weniger gut gelaufen sind. Wie sehen ihn seine Kritiker, wie seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welchen Stand hat er in der eigenen Partei? Wie steht Hamburg nach bald sieben Tschentscher-Jahren insgesamt da? Und könnte es sein, dass ihm der Slogan aus dem vorigen Wahlkampf, "Die ganze Stadt im Blick", jetzt auf die Füße fällt? Der ZEIT-Podcast "Elbvertiefung" erscheint immer samstags. Die beiden Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker sprechen abwechselnd mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Hamburg-Ressort der ZEIT über die Themen, die die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands aktuell bewegen. Immer persönlich, prägnant und pointiert – und nie länger als eine knappe halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zum gleichnamigen täglichen Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Die Star-Schmiede: Hinter den Kulissen des Popkurs Hamburg
Wer als junger Musiker zum erfolgreichen Popstar werden will, der wird sich bestimmt irgendwann einmal darum bemühen, einen Platz im Popkurs Hamburg zu bekommen. Hier lernen viele Talente, ihren eigenen Sound zu finden. Den Kurs an der Hochschule für Musik und Theater gibt es schon seit 40 Jahren, er hat Bands wie Wir sind Helden, Seed, Revolverheld, Gisbert zu Knyphausen und Frida Gold hervorgebracht. Was also geschieht dort? Franziska Herrmann ist Journalistin und Autorin der ZEIT:Hamburg, aber sie hat einst selbst den Popkurs mitgemacht. Vor Kurzem kehrte sie für einen Artikel dorthin zurück, über viele Wochen hinweg begleitete sie den aktuellen Jahrgang. Im Podcast unterhalten sich Franziska Herrmann und der Host Florian Zinnecker über den Popkurs. Es geht darum, wie man sich dafür überhaupt bewirbt (und wer angenommen wird), wie die Treffen dort ablaufen, die Musiksessions – und was man dort (von wem) lernt. Und es geht darum, warum die Stimmung dort "süchtig macht", wie Franziska Herrmann das sagt. Jede Woche unterhalten sich entweder Maria Rossbauer oder Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, mit einer Kollegin oder einem Kollegen über eine Frage, die die Bewohnerinnen und Bewohner der zweitgrößten Stadt Deutschlands umtreibt – mal ernst, mal locker, immer prägnant und persönlich. Und nie länger als 30 Minuten. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Zwei Wahlen in der Stadt: Was auf Hamburg jetzt zukommt
In knapp drei Monaten wird gewählt – nicht nur ein neuer Bundestag. In Hamburg wählen die Menschen bald auch ein neues Landesparlament, die Hamburgische Bürgerschaft. Bislang war die Bürgerschaftswahl für den 2. März 2025 angesetzt. Die Diskussionen darüber, ob man sie vorziehen könnte – vor allem aus organisatorischen Gründen – sind derzeit jedoch groß. So oder so: In Hamburg werden sehr bald Plakate sowohl für die Bundestagswahl als auch für die Bürgerschaftswahl hängen – und die hiesigen Parteien müssen eine Art Doppelwahlkampf betreiben. Was also bedeuten zwei so eng aneinander liegende Wahlen für Hamburg? Was macht das mit dem Wahlverhalten der Menschen – und wie könnte das langfristig die Stadt verändern? In der neuen Folge des Elbvertiefung-Podcasts diskutiert Frank Drieschner, der Politikredakteur der ZEIT:Hamburg, mit dem Host Maria Rossbauer über die bevorstehenden Bundestags- und Bürgerschaftswahlen in Hamburg. Die beiden sprechen über die Auswirkungen der Wahlen auf das politische Hamburg, darüber, welche Strategien die verschiedenen Hamburger Parteien nun verfolgen. Und es geht auch darum, was überhaupt dagegen spräche, beide Wahlen am selben Tag abzuhalten. Jede Woche unterhalten sich entweder Maria Rossbauer oder Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, mit einer Kollegin oder einem Kollegen über eine Frage, die die Bewohnerinnen und Bewohner der zweitgrößten Stadt Deutschlands umtreibt – mal ernst, mal locker, immer prägnant und persönlich. Und nie länger als 30 Minuten. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Muss Radfahren in Hamburg echt so gefährlich sein?
Zehn Menschen sind in diesem Jahr in Hamburg beim Radfahren gestorben. 2023 kamen neun ums Leben. Die meisten Unglücke verliefen ähnlich: Häufig wurden sie von Autos oder Lastwagen erfasst, oftmals beim Abbiegen. Auf jeden Unfall folgten Mahnwachen, Beileidsbekundungen und Debatten, die anfangs hitzig waren, inzwischen aber klingen sie eher resigniert. Aber muss man so viele Fahrradtote in einer Großstadt wirklich hinnehmen? In der neuen Folge des "Elbvertiefung"-Podcasts unterhält sich Host Maria Rossbauer mit ZEIT-Hamburg-Redakteurin Annika Lasarzik, die sich oft mit dem Thema Fahrradfahren in Hamburg beschäftigt, über diese Frage. Die beiden sprechen darüber, was "fehlerverzeihende Infrastruktur" ist, und was sie in einer Stadt wie Hamburg bewirken könnte. Es geht darum, welche Maßnahmen schon umgesetzt werden, warum sich aber trotz des Wunschs, eine "Fahrradstadt" zu werden, in Hamburg oftmals Dinge nur schleppend ändern. Und Annika Lasarzik erklärt, was geschehen müsste, damit sich die Lage für die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer in Hamburg ändert. Jede Woche unterhalten sich entweder Maria Rossbauer oder Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, mit einer Kollegin oder einem Kollegen über eine Frage, die die Bewohnerinnen und Bewohner der zweitgrößten Stadt Deutschlands umtreibt – mal ernst, mal locker, immer prägnant und persönlich. Und nie länger als 30 Minuten. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Der FC St. Pauli ist jetzt eine Genossenschaft – warum noch mal?
Wenn ein Profi-Fußballverein bisher Geld brauchte, holte er sich einen oder mehrere große Investoren, und verkaufte ihnen ein paar Anteile. Der Milliardär Klaus-Michael Kühne zum Beispiel hält über seine Kühne Holding AG gut 13 Prozent an der Fußball AG des Hamburger Sport-Vereins. Theoretisch könnte also auch der FC St. Pauli seine Profiabteilung ausgliedern und Großinvestoren beteiligen. Doch für den Verein galt diese Variante als ausgeschlossen (sie fürchteten zu viel externen Einfluss) – aber Geld brauchte man dennoch dringend. Also hat man sich für einen ziemlich ungewöhnlichen Schritt entschieden: Der FC St. Pauli gründete eine Genossenschaft. Vom 10. November an kann nun jeder, der möchte, für einige Hundert Euro einen Teil des Erstligaclubs erwerben. Aber was ist eigentlich nochmal gleich eine Genossenschaft? Und warum war das bisher so unvorstellbar für einen Profi-Fußballverein? In der neuen Folge des Elbvertiefungs-Podcasts unterhält sich Host Maria Rossbauer mit der Wirtschaftsexpertin der ZEIT:Hamburg, Kristina Läsker, über diesen weltweit einmaligen Schritt. Sie sprechen darüber, was St. Pauli mit den 30 Millionen Euro, die der Verein einnehmen will, anfangen will, was der Verein damit eigentlich erreichen will – und wer nun schon dabei ist, diese Idee nachzumachen. Und natürlich geht es auch darum, ob sich ein Genossenschaftsanteil beim FC St. Pauli als Geldanlage lohnt. Jede Woche unterhalten sich entweder Maria Rossbauer oder Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, mit einer Kollegin oder einem Kollegen über eine Frage, die die Bewohnerinnen und Bewohner der zweitgrößten Stadt Deutschlands umtreibt – mal ernst, mal locker, immer prägnant und persönlich. Und nie länger als 30 Minuten. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Die Elbe kann mehr, als nur Schiffe zu tragen
Die Elbe, die Alster, die vielen Fleete und Kanäle, dazu die Bille – keine andere Stadt in Deutschland ist so berühmt für ihre Nähe zum Wasser wie Hamburg. Aber das Verhältnis der Menschen in der Stadt zum Wasser ist meist eher distanziert. Vielleicht, weil die Fluten für die Stadt allzu oft bedrohlich waren. Vielleicht auch, weil Hamburg die Elbe jahrhundertelang rein kaufmännisch nutzte – für die Schifffahrt. Andere Städte denken da längst weiter – und nutzen ihren Zugang zum Wasser nicht nur zum Geldverdienen, sondern auch zum Vergnügen. Ausgedehnte Ufer-Flaniermeilen mit Gastronomie, Surfwellen, Schwimmen im Fluss: Wäre das nicht auch in Hamburg möglich? Welche Ideen gäbe es, und welche Hürden? Was sagen die Behörden? Und wer ist daran interessiert, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind? Darüber spricht Florian Zinnecker, Host des Podcasts "Elbvertiefung", in dieser Podcastfolge mit der ZEIT-Redakteurin Viola Diem. Zu den Projekten, von denen sie erzählt, gehören schwimmende Saunen in Oslo, die eine sehr ungewöhnliche Entstehungsgeschichte haben – die Frage, wie Hamburg seine Gewässer nutzt, ist also keineswegs auf die warmen Jahreszeiten beschränkt. Der Hamburg-Podcast "Elbvertiefung" erscheint immer samstags. Die beiden ZEIT:Hamburg-Ressortleiter Maria Rossbauer und Florian Zinnecker sprechen immer abwechselnd mit Kolleginnen und Kollegen aus ihrem Team über eine Frage, die die Menschen in der Stadt umtreibt – persönlich, pointiert und nie länger als eine knappe halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Der Elfjährige, der in Hunderte Wohnungen einstieg und verschwand
Wie geht man mit einem Jungen um, dem niemand je beigebracht hat, was richtig ist und was falsch? Um diese Frage kreist die neue Folge des Hamburg-Podcasts „Elbvertiefung“. Die Rede ist von Amir S., der unter ungeklärten Umständen in Marokko aufwuchs und monatelang die Menschen in Hamburg in Atem hielt: weil er in der Stadt einen Einbruch nach dem anderen verübte, meist allein; weil er zu jung ist, um strafmündig zu sein – und weil er aus der Jugendhilfe-Einrichtung, in die ihn die Polizei brachte, immer wieder türmte. Meist nur, um neue Einbrüche zu verüben. Welche Möglichkeiten hat die Polizei in einem solchen Fall? Wie reagierten die Betroffenen, deren Wohnungen von Amir S. ausgeraubt worden sind? Aus welchen Motiven könnte der Junge gehandelt haben? Kann man Kindern wie ihm wirksam helfen, und wenn ja, wie? Und woran liegt es, dass die Behörden und Hilfssysteme in Hamburg in diesem Fall derart überfordert wirken? Darüber spricht Florian Zinnecker, Leiter des Hamburg-Ressorts und Host dieses Podcasts, mit Christoph Heinemann, der den Fall von Amir S. über Monate hin recherchiert hat. Und sie diskutieren auch, mit welchen Maßnahmen man sich vor Einbrüchen schützen kann. Der Podcast „Elbvertiefung“ erscheint immer samstags, jede Folge – abwechselnd moderiert von den beiden Hamburg-Ressortleitern Maria Rossbauer und Florian Zinnecker – konzentriert sich auf ein Thema, das die Menschen in Hamburg gerade besonders bewegt. Kennen Sie schon unseren Hamburg-Newsletter? Unter zeit.de/elbvertiefung können Sie ihn kostenlos abonnieren. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Bücher, Bücher, Bücher! Neues aus der Hamburger Literaturszene
Auch wenn die Buchmesse in Frankfurt stattfindet, widmen wir uns in der neuesten Folge des Hamburg-Podcasts „Elbvertiefung“ dem Thema Literatur. Denn zuletzt gab es in der Hamburger Szene eine ganze Menge Neuigkeiten. Da wäre etwa der Wechsel an der Spitze des Literaturhauses: Der langjährige Leiter Rainer Moritz geht im Frühjahr in Rente, vor wenigen Tagen wurde verkündet, wer ihm nachfolgen wird. Im Podcast sprechen ZEIT:Hamburg-Ressortleiter Florian Zinnecker und Oskar Piegsa darüber, was diese Entscheidung für die Zukunft des etablierten Hauses bedeutet. Auch das Harbour Front Literaturfestival verkündete vor Kurzem eine Spitzenpersonalie – verbunden mit der Nachricht, dass die Zukunft des Festivals vorerst gesichert sei. Ist das so? Was genau war der Grund, dass das Festival in diesem Jahr aussetzte? Und welche Erwartungen verknüpfen sich mit der neuen Leitung? Auch über diese Punkte diskutieren Florian Zinnecker und Oskar Piegsa im Podcast. Und über eine weitere Frage, die beim Thema Literatur fast noch spannender ist: Welche Bücher von Hamburger Autorinnen und Autoren lohnen sich zurzeit besonders? Der ZEIT-Podcast „Elbvertiefung“ erscheint immer samstags. Im Wechsel sprechen Florian Zinnecker und Maria Rossbauer, beide Leiter des Hamburg-Ressorts der ZEIT, mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Team über eine Frage, die die Menschen in der Stadt gerade besonders bewegt – prägnant, persönlich und nie länger als eine knappe halbe Stunde. Kennen Sie schon unseren Hamburg-Newsletter? Unter zeit.de/elbvertiefung können Sie ihn kostenlos abonnieren. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Die geheime Welt der Hamburger Selfstorage-Lager
56 Euro Miete für eine lichtlose Kammer, zwei Quadratmeter groß, in der zweiten Etage eines alten Fabrikgebäudes: Auf den ersten Blick mag das nach unnötigen Kosten klingen. Für viele Großstädter jedoch versprechen diese zwei Quadratmeter unendlich Wertvolles – für jene nämlich, deren Wohnungen keinen Keller oder Speicher haben. ZEIT:Hamburg-Ressortleiter Florian Zinnecker ist einer dieser Großstädter. Er mietete über Jahre hinweg eine Self Storage Box in Hamburg – und lagerte dort alle Dinge, die er nicht wegwerfen, aber auch nicht in der Wohnung haben wollte. Nun muss er die Box räumen und steht vor der Frage: Warum hebt man eigentlich so viel Zeug auf? Im Hamburg-Podcast Elbvertiefung unterhalten sich Florian Zinnecker und Maria Rossbauer, Host dieser Folge, über den Boom der Self Storage Lager in Großstädten. Es geht darum, was diese Lager für den Familienfrieden von Großstädtern bedeuten können, aber auch, welche Auswirkungen der Boom auf die Stadtstruktur hat. Die beiden sprechen darüber, woher das Konzept überhaupt kommt – und natürlich verrät Florian Zinnecker, wie man einen zwei Quadratmeter großen Raum bestmöglich nutzt. Jede Woche unterhalten sich Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus der ZEIT über eine Frage, die die Bewohnerinnen und Bewohner der zweitgrößten Stadt Deutschlands umtreibt – mal ernst, mal locker, immer prägnant und persönlich. Und nie länger als 30 Minuten. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Der Stuhl, der Hamburg das Chillen beibrachte
Der Adirondack-Chair ist aus Holz gebaut, wiegt stolze 18 Kilogramm, ist weiß oder braun lackiert – und sehr gemütlich. Er fordert einen geradezu dazu auf, sich hineinzufläzen und die Füße ins Gras zu stecken. ZEIT:Hamburg-Autor Christoph Twickel ist davon überzeugt: Dieses Möbelstück hat vielen Menschen das Chillen überhaupt erst beigebracht – besonders den Hamburgerinnen und Hamburgern. In Hamburg nämlich stehen Hunderte der Strahlensessel, wie sie auch genannt werden, herum, im Park Planten un Blomen zum Beispiel und auf den Alsterwiesen. Dabei ist der Adirondack-Chair eine US-amerikanische Erfindung, das Patent für den Stuhl erlangte ein Tischler namens Harry C. Bunnell schon im Jahr 1905. Wie also kam der Adirondack-Chair überhaupt nach Hamburg? Warum galt er lange als heilungsfördernd für Tuberkuloseerkrankte? Und weshalb sagte 1953 Hamburgs Erster Bürgermeister Max Brauer, der Stuhl sei "einer der schönsten und überzeugendsten Beweise für die Rückkehr unseres Volkes in die Familie der freien Völker"? In der neuen Folge des Hamburg-Podcasts "Elbvertiefung" unterhalten sich Christoph Twickel und Host Maria Rossbauer über die spannende Geschichte des Adirondack-Chairs. Und natürlich geht es auch darum, an welchen besonders schönen Orten in der Stadt man ihn finden kann. Jede Woche unterhalten sich Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus der ZEIT über eine Frage, die die Bewohnerinnen und Bewohner der zweitgrößten Stadt Deutschlands umtreibt – mal ernst, mal locker, immer prägnant und persönlich. Und nie länger als 30 Minuten. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Frischer Fisch! Aus einem Hamburger Labor
Fischprodukte sind gesund, sie liefern wertvolle Nährstoffe wie Proteine und Omega-3-Fettsäuren. Doch schon heute gelten 90 Prozent der weltweiten Fischbestände als überfischt oder maximal befischt – und die Weltbevölkerung wächst weiter. Wäre es da nicht fantastisch, man müsste Lachse nicht mehr im Meer fangen, um sie später zu braten – sondern könnte allein das Fischfleisch züchten? Diesen zunächst utopisch klingenden Traum verfolgen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Bluu Seafood tatsächlich. In einer alten Fabrik im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld betreiben sie "zelluläre Agrikultur" – sie versuchen, Fischfleisch aus Stammzellen im Labor zu züchten. Ihre Hoffnung ist, auf diese Weise eines Tages Fischstäbchen und Lachsfilets in großen Mengen zu produzieren. Yannick Ramsel, Redakteur bei ZEIT:Hamburg, war bei Bluu Seafood in Bahrenfeld, er hat die Labore besucht und sich mit zellulärer Agrikultur auseinandergesetzt. Im Hamburg-Podcast Elbvertiefung erzählt er Host Maria Rossbauer nun vom großen Traum eines Meeresbiologen, mit dieser Technik die Überfischung der Ozeane zu stoppen, von den Tücken bei der Verwirklichung – und natürlich sprechen die beiden auch darüber, wie so ein Labor-Fischstäbchen schmeckt. Und darüber, wann und wo es Fische aus dem Labor wohl tatsächlich einmal zu kaufen geben könnte. Jede Woche unterhalten sich Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus der ZEIT über eine Frage, die die Bewohnerinnen und Bewohner der zweitgrößten Stadt Deutschlands umtreibt – mal ernst, mal locker, immer prägnant und persönlich. Und nie länger als 30 Minuten. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht’s hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Eine Stadt, zwei Keller, 139 Leichen
Vor über 100 Jahren begaben sich deutsche Forschungsreisende nach Kamerun, nach Papua-Neuguinea, Samoa, Tansania und in viele andere Länder. Sie wollten Gebeine von Menschen nach Hamburg holen, Schädel etwa, um ihren Umfang und ihr Volumen zu vermessen, um so dann Thesen über die Unterschiede zwischen Europäern und "Naturvölkern" zu formulieren – Thesen, die inzwischen als wissenschaftlich überholt gelten. Damals nannte man sie Rassenkunde, heute Rassismus, schreibt Oskar Piegsa in seinem Artikel "Leichen im Keller". Heute gibt es derartige Untersuchungen und die dazugehörigen Reisen zum Glück längst nicht mehr. Aber noch immer befinden sich einige sogenannte "human remains" aus dieser Zeit in Hamburger Kellern. Was also tun mit den Schädeln und Knochen? Zurückbringen? Aber wo genau ist "zurück"? In der aktuellen Folge des Hamburg-Podcasts "Elbvertiefung" unterhalten sich Maria Rossbauer und Oskar Piegsa über 139 Gebeine, die in Hamburg in zwei Kellern liegen – und Oskar Piegsa erzählt auch, warum bis heute nur ein einziger Schädel von Hamburg aus in sein Herkunftsland zurückgebracht wurde. Jeden Samstag unterhalten sich Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus ihrem Team über eine Frage, die die Menschen der zweitgrößten Stadt Deutschlands umtreibt – mal ernst, mal locker, immer prägnant und persönlich. Und nie länger als 30 Minuten. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Was schützt vor illegalen Straßenrennen?
An einem Montag Ende August ereignete sich in Hamburg-Billstedt eine Tragödie, die wohl vermeidbar gewesen wäre – die Frage ist nur, wie. In den Abendstunden rasen ein 22-Jähriger am Steuer eines Tesla und ein 24-jähriger Mercedesfahrer in einen Familienvan, in dem eine 40-jährige Frau mit ihren Zwillingen sitzt. Ein zweijähriger Junge stirbt später im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Gegen die beiden Männer ermittelt nun die Mordkommission. Sie stehen im Verdacht, sich ein illegales Rennen geliefert zu haben. In den Tagen danach war ZEIT-Autor Tom Kroll an der Unfallstelle in Billstedt und sprach nicht nur mit der Polizei, sondern auch mit den Anwohnern. Alle sagen: Diese Rennen gebe es dort ständig. Was müsste geschehen, um die Rennen zu verhindern? Warum ist es nicht längst passiert? Und wer sind die Menschen, die sich zu den Rennen hinreißen lassen? Darüber diskutieren Tom Kroll und Florian Zinnecker, Ressortleiter der ZEIT:Hamburg, in der neuen Folge des Hamburg-Podcasts Elbvertiefung. Auch die Rechtslage ist Thema – und die Frage, ob schon weitere Blitzer helfen, Unfälle wie jenen im August zu verhindern. Der ZEIT-Podcast Elbvertiefung erscheint immer samstags. Im wöchentlichen Wechsel sprechen die beiden Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, darin mit Kolleginnen und Kollegen aus ihrem Team über eine Frage, die die Menschen in Hamburg gerade bewegt. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Das Ende eines Traums: Warum das New Institute schließt
Die Idee klingt attraktiv: In einem Ensemble aus neun eigens renovierten Gründerzeitvillen an der Alster wollte der Hamburger Unternehmer und Mäzen Erck Rickmers die weltbesten Denkerinnen und Denker versammeln – und sie mit Praktikern aus Wirtschaft, Politik und Kultur zusammenbringen. Gemeinsam sollten sie dort Lösungsansätze für die großen Krisen der Gegenwart entwickeln: die gesellschaftliche Spaltung, die Klimakatastrophe, die Rettung der Demokratie. "The New Institute" nannte Rickmers diesen Ort. Ein "säkulares Kloster" sollte hier entstehen, eine Stätte, an der die Bewohnerinnen und Bewohner ohne die Zwänge des Alltags und des Erwerbslebens forschen, denken, schreiben und sich austauschen können, alles auf Rickmers' Kosten. Auf mindestens zehn Jahre war das Projekt angelegt. Noch nicht einmal die Hälfte davon ist vergangen, als Rickmers im August das Aus des New Institute ankündigte. Zwar werde das Institut nicht direkt abgewickelt, aber von der ursprünglichen Idee solle wenig fortbestehen. Was sind die Gründe für das Scheitern des Projekts? Ist es überhaupt gescheitert oder sind einige der Ziele doch erreicht worden? Was bedeutet das Ende für Hamburg als Stadt und Wissenschaftsstandort – und was lässt sich für künftige Projekte daraus lernen? Um diese Fragen dreht sich diese Folge der Elbvertiefung, dem Hamburg-Podcast der ZEIT. Florian Zinnecker, der das Hamburg-Ressort der ZEIT leitet, diskutiert mit Oskar Piegsa, der sich im Ressort mit Wissenschafts- und Bildungsthemen beschäftigt und ausführlich zum New Institute recherchiert hat, über die Entstehung, das Konzept und das überraschende Ende des Instituts. Und auch darüber, was Rickmers überhaupt zur Gründung motiviert hat, welche Fehler er möglicherweise gemacht hat – und was nun aus seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird. Der ZEIT-Podcast Elbvertiefung erscheint immer samstags. Im wöchentlichen Wechsel sprechen die beiden Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, darin mit Kolleginnen und Kollegen aus ihrem Team über eine Frage, die die Menschen in Hamburg gerade bewegt. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Wie gefährlich sind Hamburgs Islamisten?
Ein Mann ersticht auf einem Stadtfest drei Menschen, verletzt acht weitere – und versetzt ein ganzes Land in Schock. Der 26-jährige mutmaßliche Täter von Solingen war ein Islamist, seinen Anschlag verübte er im Namen der Terrorgruppe "Islamischer Staat". Seit Solingen wird in Deutschland viel diskutiert, über Waffengesetze und Migrationspolitik – aber auch darüber, welche Gefahr von Islamisten ausgeht. In Hamburg ist die islamistische Szene groß, erst im Mai trafen sich 2.300 junge Männer mitten in der Stadt, viele von ihnen forderten die Herrschaft unter einem islamischen Führer und dem Gesetz der Scharia, ein Kalifat. 1.800 Hamburger aus diesem Spektrum beobachtet der Verfassungsschutz. Wie gefährlich sind sie? Und wie kommt man gegen ihre Ideologien an? In der aktuellen Folge des Podcasts Elbvertiefung gibt Christoph Heinemann dem Host Maria Rossbauer einen Einblick in die Szene. Heinemann hat zusammen mit Tom Kroll aus dem Hamburg-Ressort der ZEIT gerade intensiv in der Szene recherchiert. Er erzählt von allabendlichen Treffen in Mümmelmannsberg, von Männern in dicken Karren, die junge Muslime mit Erfolg und Glamour beeindrucken wollen. Er erklärt, wie der Anführer einer der bekanntesten Netzwerke junger Islamisten, Muslim Interaktiv, junge Menschen in seinen Bann zieht – und er berichtet von einer aufreibenden Recherche, in der er und Tom Kroll letztlich Menschen gefunden – und getroffen – haben, die mutmaßlich einer verbotenen islamistischen Organisation angehören. Schließlich berichtet Christoph Heinemann auch von Organisationen in Hamburg, die junge Muslime, die in Gefahr geraten, extremistisch zu werden, auffangen – und er sagt, was in Hamburg noch getan werden müsste, um dem wachsenden Islamismus zu begegnen. Jeden Samstag unterhalten sich Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus ihrem Team über eine Frage, die die Bewohnerinnen und Bewohner der zweitgrößten Stadt Deutschlands umtreibt – mal ernst, mal locker, immer prägnant und persönlich. Und nie länger als 30 Minuten. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Die Schattenseiten des Hamburger Sommers
29 Grad, Schwimmbad, Eisdiele – was für viele Menschen nach einem traumhaften Sommertag klingt, ist für andere eine Belastung. Gerade Menschen mit Vorerkrankungen an Herz und Lunge, Schwangere, Obdachlose und Ältere leiden, wenn es mehrere Tage in Folge sehr heiß ist. Denn die Hitze erhöht zum Beispiel das Risiko für Gefäßerkrankungen im Gehirn und am Herzen und ebenso die Belastung der Lunge und der Nieren, sagt die Medizinerin Andrea Nakoinz von der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Durch den Klimawandel aber werden die heißen Sommertage in Zukunft häufiger, auch im Norden. Was also bedeutet das für die Hamburgerinnen und Hamburger? Und wie bereitet sich die Stadt darauf vor? Darüber sprechen in der aktuellen Folge des Podcasts "Elbvertiefung" der Hamburg-Ressortleiter der ZEIT, Florian Zinnecker, und ZEIT-Hamburg-Autor Tom Kroll, der gerade intensiv zu dem Thema recherchiert hat. Jeden Samstag unterhalten sich Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus ihrem Team über eine Frage, die die Bewohnerinnen und Bewohner der zweitgrößten Stadt Deutschlands umtreibt – mal ernst, mal locker, immer prägnant und persönlich. Und nie länger als 30 Minuten. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Wie kaputt ist die Bahn?
Rund 30.000 Menschen sind Tag für Tag mit dem Zug zwischen Hamburg und Berlin unterwegs. Wegen unaufschiebbarer Reparaturen ist die Strecke von dieser Woche an bis Jahresende gesperrt, die Fahrzeit verlängert sich um etwa 45 Minuten. Die Sperrung der für Hamburg so wichtigen Strecke mag unausweichlich sein, aber ist sie vertretbar? Hätte es einen Weg gegeben, sie zu vermeiden – und wenn ja, wer trägt die Verantwortung dafür, dass diese Chance nicht ergriffen wurde? Über diese Fragen diskutieren in der neuen Folge des Hamburg-Podcasts Elbvertiefung Florian Zinnecker als Podcasthost mit Eva Lautsch, die als ZEIT-Redakteurin mehrmals pro Woche zwischen Hamburg und Berlin pendelt, und mit Frank Drieschner, der im Hamburg-Ressort regelmäßig zu Verkehrs- und Infrastrukturfragen recherchiert – und der eine überraschende Antwort auf die Frage gibt, wie sich Bahnreisende am besten auf die Umwege und Verzögerungen der kommenden Monate einstellen können. Im Hamburg-Podcast Elbvertiefung, der immer samstags erscheint, sprechen die ZEIT:Hamburg-Ressortleiter Florian Zinnecker und Maria Rossbauer mit den Kolleginnen und Kollegen aus ihrem Ressort über Fragen, die die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade umtreiben. Immer persönlich und prägnant – und nie länger als eine knappe halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Bordell zu verkaufen: Was ist los in der Herbertstraße?
Die Herbertstraße auf St. Pauli ist weltberühmt – wofür, muss man eigentlich gar nicht weiter ausführen. Die Straße, die parallel zur Reeperbahn verläuft, "ist ein fast mythischer Ort" – so formulierte es unlängst der ZEIT-Redakteur Christoph Heinemann. "Hier schlägt seit mehr als hundert Jahren das Herz des Rotlichtgewerbes auf St. Pauli. Frauen haben keinen Zutritt, Kiezgrößen wurden hier reich." Und ein junger Lüneburger Makler versucht seit anderthalb Jahren vergeblich, ein Haus zu verkaufen. Die Adresse: Herbertstraße 14. Die Verkäufer haben das Anwesen geerbt, das Haus ist verpachtet: als Bordell. Zunächst sei der Andrang groß gewesen und die Aufmerksamkeit enorm, berichtet Christoph Heinemann in der aktuellen Folge des Hamburg-Podcasts „Elbvertiefung“. Aber kaufen wollte dann doch niemand. Was sagt das über den Hamburger Kiez? Über das Rotlichtgewerbe? Und was reizt einen jungen Immobilienmakler aus Lüneburg am Umfeld der Reeperbahn als Geschäftsgebiet? Im Podcast, den diese Woche die ZEIT:Hamburg-Ressortleiterin Maria Rossbauer moderiert, berichtet Christoph Heinemann über seine Recherche. Er hat versucht herauszufinden, wer die Verkäufer des Objekts sind, wie alt das Haus eigentlich ist – und wo die Schwierigkeiten bei diesem Immobilien-Deal liegen. Und Heinemann erklärt auch, wie sich die Herbertstraße über die Jahrzehnte entwickelt hat – und ob es ratsam ist, dem Straßenzug aus reiner Neugierde einen Besuch abzustatten. Der ZEIT-Podcast Elbvertiefung erscheint immer samstags. Abwechselnd diskutieren die beiden Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Hamburg-Ressort der ZEIT über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade bewegt. Jede Folge ist prägnant, persönlich und dauert keinesfalls länger als eine knappe halbe Stunde. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Diesen Stadtteil erreicht man nur per Schiff und Kutsche
Hamburg hat Sommerferien. Eine gute Gelegenheit, um einen Blick auf den kleinsten und entlegensten Teil der Stadt zu werfen: die Insel Neuwerk, gelegen in der Helgoländer Bucht im Wattenmeer, rund 120 Kilometer von allen anderen Hamburger Stadtteilen entfernt. Neuwerk ist drei Quadratkilometer groß, ein Ringdeich schützt das Land vor der Flut, die wichtigste – und einzige – Sehenswürdigkeit: der Leuchtturm der Insel. Historisch war Neuwerk ein strategisch wichtiger Posten, weil die Schiffe auf dem Weg in und aus dem Hamburger Hafen dort vorbeikommen. Heute ist die Insel vor allem bei Urlaubern und Vogelkundlern beliebt. Es gibt aber auch Menschen, die dauerhaft hier leben: Die Zahl der Bewohnerinnen und Bewohnern Neuwerks beträgt 21 – noch. Denn Neuwerk hat ein Nachwuchsproblem. Davon erzählt in der aktuellen Podcastfolge der Elbvertiefung die ZEIT-Redakteurin Annika Lasarzik. Sie verbrachte für die ZEIT eine Woche auf der Insel und erlebte dabei hautnah, was es bedeutet, den Alltag auf der Insel zu bestreiten. Im Gespräch mit dem Podcast-Host Florian Zinnecker, Leiter des Hamburg-Ressorts, berichtet Annika Lasarzik von den Sorgen der Inselbewohner, ihrem Blick in die Zukunft und auch sehr dringlichen Fragen. Etwa: Was, wenn es auf der Insel brennt? Und: Sie gibt Tipps, was man auf der Insel unbedingt erlebt haben sollte. Im Hamburg-Podcast Elbvertiefung, der immer samstags erscheint, sprechen die ZEIT:Hamburg-Ressortleiter Florian Zinnecker und Maria Rossbauer mit den Kolleginnen und Kollegen aus ihrem Ressort über Fragen, die die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade umtreiben. Immer persönlich und prägnant – und nie länger als eine knappe halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Hamburgs einsamste Insel
Wer in Hamburg am Falkensteiner Ufer steht und über die Elbe zum anderen Ufer schaut, der hat in Wahrheit nicht das andere Elbufer vor Augen – sondern die Insel Neßsand. Sie ist so groß wie 203 Fußballfelder, vergleichbar mit dem Hamburger Stadtpark. Neßsand wird bevölkert von Dachsen, Rehen, Hermelinen, sehr vielen Vögeln und einer Rotte Wildschweine. Und von Uwe Florin, der aufpasst, dass außer ihm keine anderen Menschen die Insel betreten. Denn das ist verboten – den Vögeln zuliebe. Weil Neßsand wirklich idyllisch ist und auch sehr einladend aussieht, stößt das allerdings häufig auf Unverständnis. Wer die Menschen sind, die sich über das Verbot hinweggesetzt haben und mit welchen Methoden, wie Neßsand überhaupt entstanden ist – und welche alternativen Ausflugsziele es gibt: Darüber spricht Florian Zinnecker in dieser Folge des Hamburg-Podcasts Elbvertiefung mit seiner Kollegin Viola Diem, die auch selbst schon auf Neßsand war – ganz legal. Auch davon berichtet sie im Podcast – und sie verrät, wie die Wildschweine auf die Insel gekommen sind. Der Podcast Elbvertiefung erscheint immer samstags. Die beiden ZEIT:Hamburg-Ressortleiter Maria Rossbauer und Florian Zinnecker sprechen abwechselnd mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus dem Ressort über ein Thema, das die Stadt gerade bewegt – persönlich, prägnant und nie länger als eine halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Es gibt Eis!
Augustin Lancelot de Quatre Barbes musste einiges dafür tun, damit er in Hamburg 1799 eine Eisdiele betreiben durfte. Er musste in seinem Pavillon an der Alster das Karten- und Würfelspiel verbieten, musste regelmäßig den Jungfernstieg wässern, damit er nicht zu staubig werde, und vieles mehr. Möglicherweise fühlte er sich gegängelt, denn schon zwei Jahre später gab er seinen Pavillon wieder auf. Auch einige Jahrzehnte später noch waren in Hamburg die Vorbehalte gegenüber Menschen, die "Gefrorenes" verkauften groß – eine Zeitung schrieb sogar von einer "Eis-Pest", man hatte regelrecht Angst davor. Warum das so war? Und wie sich die Eisdielen trotzdem durchsetzten? Das können Sie in der neuen Folge des Hamburg-Podcasts Elbvertiefung hören. Maria Rossbauer unterhält sich darin mit ZEIT:Hamburg Redakteur Yannick Ramsel. Er hat so einiges zu Eis recherchiert, zum Beispiel, wie und wann es überhaupt nach Hamburg kam. Im Podcast erzählt Yannick auch, was man in den ersten Eisdielen Hamburgs so zu schlecken bekam, wie das Eis damals hergestellt wurde – und was ein perfektes Spaghetti-Eis ausmacht. Jeden Samstag unterhalten sich Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus ihrem Team über eine Frage, die die Bewohnerinnen und Bewohner der zweitgrößten Stadt Deutschlands umtreibt – mal ernst, mal locker, immer prägnant und persönlich. Und nie länger als 30 Minuten. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Hamburg liegt in Brasilien!
11.000 Kilometer von der Elbe entfernt, im Süden Brasiliens, existiert ein Ort namens Novo Hamburgo. 227.000 Menschen leben dort, im Zentrum der Stadt reihen sich, wie in annähernd jeder größeren Stadt der Welt, Geschäfte, Bürotürme und Restaurants aneinander. Doch in der Altstadt finden sich auch einige Fachwerkhäuser, die so auch in der deutschen Provinz stehen könnten. Novo Hamburgo feiert in diesem Jahr seinen zweihundertsten Geburtstag, 1824 kamen die ersten Auswanderer aus Deutschland in diesem Gebiet an. Sie bauten sich Hütten aus Lehm mit Bananenblätterdach, quadratische Räume ohne Fenster, schlugen in der subtropischen Hitze mit Macheten und Äxten den Wald weg, um Ackerfläche zu schaffen. Was zog die Auswanderer damals nach Brasilien? Und was hat unser Hamburg mit alledem zu tun? Darüber unterhält sich Maria Rossbauer in der aktuellen Folge des Hamburg-Podcasts Elbvertiefung mit ZEIT:Hamburg Redakteurin Viola Diem. Sie war erst vor Kurzem in Novo Hamburgo, um Antworten auf all diese Fragen und noch viele mehr zu finden. Im Podcast erzählt Viola, wie es dazu kam, dass der Ort heute den Spitznamen "Hauptstadt des Schuhs" trägt, von den Menschen, die sie dort getroffen hat, wie dem 36-jährigen Filipe Kuhn Braun, der in jahrelanger Forschungsarbeit vieles über die Geschichte des Orts herausgefunden hat. Natürlich verrät Viola letztlich auch, warum Novo Hamburgo wohl so heißt, wie es heißt. Außerdem erzählt Viola, welchen Reiz es hat, all den Hamburgs in der Welt nachzureisen – denn sie hat nicht nur jenes in Brasilien besucht. Einmal pro Woche unterhalten sich Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus der ZEIT über eine Frage, die die Bewohnerinnen und Bewohner der zweitgrößten Stadt Deutschlands umtreibt – mal ernst, mal locker, immer prägnant und persönlich. Und nie länger als 30 Minuten. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Grüner Bunker: wenn wilde Ideen wahr werden
Viele Jahrzehnte lang stand der Hochbunker im Hamburger Stadtteil St. Pauli wie ein kolossales Mahnmal mitten in der Stadt. Groß und grau und unzerstörbar erinnerte er daran, zu welchen Grausamkeiten Menschen fähig sind. KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter mussten den Flakturm am Heiligengeistfeld 1942 in nur 300 Tagen errichten. Seit Juli dieses Jahres jedoch ist der Bunker ein grüner, ein sichtbar lebendiger Ort: 10.000 Pflanzen wachsen auf ihm hoch in den Himmel empor, ein Wanderpfad schlängelt sich dem Gebäude entlang nach oben. 60 Millionen Euro kosteten Planung und Umbau des Bunkers, er wurde auf 58 Meter erhöht, enthält heute außer einem großen Dachgarten ein Hotel, Bars, ein Restaurant und eine Sport- und Konzerthalle. Wie gelang es, einen zunächst verrückt klingenden Plan tatsächlich umzusetzen? Was ist gelungen am Grünen Bunker – und was nicht? Darüber unterhalten sich in der neuen Folge des Hamburg-Podcasts Elbvertiefung Maria Rossbauer und Hanno Rauterberg aus dem Feuilleton der ZEIT, der sich architektonisch mit dem Grünen Bunker beschäftigt hat. Im Podcast erzählt Hanno Rauterberg von der fast schon größenwahnsinnigen Ursprungsidee eines Mannes, der in der Nachbarschaft des Bunkers wohnte, darüber, wie die Veränderung des Bunkers auch unser Nachdenken über die Kriegszeit beeinflussen könnte – und wie es sich anfühlt, den neuen "Bergpfad" hinaufzulaufen. Und welche Gedanken sich dabei auftun. Einmal pro Woche unterhalten sich Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus der ZEIT über eine Frage, die die Bewohnerinnen und Bewohner der zweitgrößten Stadt Deutschlands umtreibt – mal ernst, mal locker, immer prägnant und persönlich. Und nie länger als 30 Minuten. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Wie Hamburg Fahrrad fahren lernt
Es ist eine unscheinbare Zahl, die da im Koalitionsvertrag des Hamburger Senats steht: Bis zum Jahr 2030 sollen die Hamburgerinnen und Hamburg rund ein Drittel ihrer täglichen Wege per Fahrrad zurücklegen. Aktuell liegt die Quote bei 22 Prozent. Um die Differenz aufzuholen, müsste sich Hamburg erkennbar verwandeln – und sich von der Autostadt, die sie noch immer ist, binnen wenigen Jahren zur Fahrradstadt mausern. Kann das gelingen? Ist das Ziel, ein Drittel, überzogen oder viel zu unambitioniert? In der neuen Folge des Hamburg-Podcasts Elbvertiefung diskutiert Florian Zinnecker darüber mit Annika Lasarzik, Redakteurin im Hamburg-Ressort, Expertin für Verkehrspolitik und passionierte Fahrradfahrerin. Die beiden sprechen über Radwege, die im Nichts enden, über tödliche Unfälle durch rechtsabbiegende Lastwagen – und ein einfaches und wirkungsvolles, aber bislang nicht mehrheitsfähiges Mittel dagegen. Und sie ziehen eine Bilanz: Hat Hamburg das Zeug zur Fahrradstadt? Was wäre schnell und effizient zu tun, um das Ziel – ein Drittel bis 2030 – zu erreichen? Und welche Tricks gibt es, um schon heute entspannt und sicher durch Hamburg zu radeln? Zur Recherche war Annika Lasarzik einige Tage in Paris – einer Stadt, die Hamburg bei der Verwandlung zur Fahrradstadt voraus ist. Was ließe sich von Paris lernen? Jeden Samstag sprechen die beiden Hamburg-Ressortleiter Maria Rossbauer und Florian Zinnecker abwechselnd mit Kolleginnen und Kollegen aus ihrem Ressort über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade bewegt – persönlich und prägnant, aber nie länger als eine knappe halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Dann zieh doch ins Büro
Die Stadt Hamburg ist weltberühmt für ihre Gewerbeflächen. Das mag zunächst schräg klingen, ist aber die Wahrheit: die Kontorhäuser, die Speicherstadt, die imposante Innenstadt-Architektur, auch die Skyline an der Binnenalster – alles Gewerbeflächen. Aber braucht Hamburg tatsächlich so viele Flächen? Aktuell stehen in der Stadt rund 600.000 Quadratmeter Gewerbeimmobilien leer. Gleichzeitig fehlt in der Stadt eine große Zahl an Wohnungen – es gibt zu wenige, und es werden zu wenige neu gebaut. Gäbe es einen Weg, die leeren Gewerbeflächen zu Wohnraum umzubauen? Darüber spricht Florian Zinnecker in dieser Folge des Hamburg-Podcasts »Elbvertiefung« mit dem ZEIT-ONLINE-Wirtschaftsredakteur Zacharias Zacharakis. Der hat in New York einen Unternehmer getroffen, der ein plausibles und sehr lukratives Geschäftsmodell entwickelt hat, um dieses Problem zu lösen: Er baut leere Wolkenkratzer zu Wohnungen um. Könnte das auch in Hamburg funktionieren? Ja, sagt Zacharakis. Und er erklärt im Podcast, wie genau das funktionieren könnte, und warum es nicht längst schon im großen Stil gemacht wird. Außerdem verrät er, wie realistisch der Traum vieler Großstädter ist, in einer urbanen Fabriketage zu wohnen. Der Podcast »Elbvertiefung« erscheint jeden Samstag. Immer abwechselnd diskutieren die beiden Leiter des Hamburg-Ressorts der ZEIT, Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, mit Kolleginnen und Kollegen aus ihrem Team über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade umtreibt: persönlich und pointiert, und nie länger als eine knappe halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Was die Wahlergebnisse in Hamburg verändern werden
Die Stimmen der Europawahl sind ausgezählt – und in Hamburg auch jene der Bezirkswahl, denn hier wurde am 9. Juni auch die Zusammensetzung der Bezirksparlamente neu gewählt. Seither schauen alle auf diese Ergebnisse. Was aber bedeuten sie tatsächlich für die Zukunft Hamburgs? Fast zehn Prozent haben etwa die Grünen bei der Europawahl verloren, sie liegen noch bei 21,2 Prozent. 28,5 Prozent holte die SPD bei der Bezirkswahl in Mitte, 14,4 Prozent die AfD in Bergedorf. Und ganze sechs Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger wählten bei der Europawahl diese Partei namens Volt. Was macht das etwa mit der täglichen politischen Arbeit in der Stadt? Darüber sprechen Maria Rossbauer und Frank Drieschner aus dem Hamburg-Ressort der ZEIT in der aktuellen Folge des Elbvertiefung-Podcasts. Frank Drieschner hat die Hamburger Wahlen analysiert. Im Podcast erzählt er nun davon, was die Ergebnisse wohl in Hinblick auf die Bürgerschaftswahlen im März 2025 aussagen, welche Menschen die Partei Volt prägen, was ihr Ziel ist – und die beiden sprechen darüber, warum auf mehrere Hamburger Bezirke nun wohl turbulente Zeiten zukommen. Jeden Samstag unterhalten sich Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus ihrem Team über eine Frage, die die Bewohnerinnen und Bewohner der zweitgrößten Stadt Deutschlands umtreibt – mal ernst, mal locker, immer prägnant und persönlich. Und nie länger als 30 Minuten. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Luna Luna
Im Jahr 1987 war die Hamburger Moorweide für kurze Zeit ein sehr bunter, sehr aufregender Ort. Da nämlich gastierte dort ein besonderer Vergnügungspark, einer, in dem Besucherinnen und Besucher in verschiedene Kunstwerke hineinwandern konnten – oder auf ihnen reiten oder mit ihnen in die Luft abheben. Künstler wie Friedensreich Hundertwasser, Salvador Dalí und Keith Haring hatten dafür Karussells, ein Riesenrad und Schießbuden gestaltet. Der Park hieß Luna Luna, und die Idee dahinter stammte von André Heller, dem österreichischen Künstler und Kulturmanager. Rund 250.000 Menschen besuchten ihn zwischen dem 5. Juni und 31. August 1987, danach wollte Heller mit Luna Luna auf Welttournee gehen, doch dazu kam es nie. Stattdessen wurde die Kirmes in Container verpackt und blieb 35 Jahre lang verschollen – bis jetzt. Vor Kurzem wurde der Park in Los Angeles wieder aufgebaut. Was ist geschehen? Wie wurde Luna Luna wiederentdeckt – und was hat einer der berühmtesten Rapper der Welt mit alledem zu tun? Darüber spricht Maria Rossbauer in der neuen Folge des Podcasts Elbvertiefung mit Oskar Piegsa. Oskar erzählt von Kunstfurzern auf der Kirmes, von den vielen Millionen Euro, die die Werke heute wert sein dürften – und davon, wie es mit Luna Luna nun weitergeht. Und natürlich geht es auch um die Geschichte mit dem Rapper. Jeden Samstag unterhalten sich Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus ihrem Team über eine Frage, die die Bewohnerinnen und Bewohner der zweitgrößten Stadt Deutschlands umtreibt – mal ernst, mal locker, immer prägnant und persönlich. Und nie länger als 30 Minuten. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Geheimgeschäft: Was der MSC-Deal dem Hamburger Hafen wirklich bringt
Ist es eine gute Idee, den Hamburger Hafen zur Hälfte an die größte Reederei der Welt zu verkaufen? Für Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher, Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard und Finanzsenator Andreas Dressel (alle SPD) scheint es nicht den leisesten Zweifel daran zu geben. Fast im Alleingang haben die drei im vergangenen Jahr den Einstieg der Schweizer Reederei MSC bei der Hamburger Hafenbetriebsgesellschaft HHLA verhandelt. Als sie ihre Pläne im September öffentlich machten, waren selbst Insider erkennbar überrascht – ebenso wie einige Entscheidungsträger, die nicht eingebunden waren. Und längst nicht alle sind so überzeugt wie Tschentscher, Leonhard und Dressel. Für den früheren wirtschaftspolitischen Sprecher der Sozialdemokraten in der Bürgerschaft, Joachim Seeler, ist der MSC-Deal ein "historischer Fehler". In dieser Woche haben zwei wichtige Bürgerschaftsausschüsse dem Einstieg von MSC zugestimmt – obwohl die Abgeordneten offenbar gar nicht alle relevanten Informationen zur Verfügung hatten, wie die ZEIT-Autorin und Hafenexpertin Kristina Läsker im Hamburg-Podcast Elbvertiefung berichtet. Seitdem der Deal bekannt wurde, recherchiert sie intensiv zu den Hintergründen. Im Gespräch mit Hamburg-Ressortleiter Florian Zinnecker spricht Kristina Läsker darüber, was sich die Reederei MSC vom Einstieg in Hamburg verspricht, wer in der Reederei eigentlich das Sagen hat, wie das Geschäft zustande kam und welche Folgen für den Hamburger Hafen absehbar sind. Der Podcast Elbvertiefung erscheint immer samstags. Immer abwechselnd sprechen die beiden Hosts Florian Zinnecker und Maria Rossbauer mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Hamburg-Ressort der ZEIT über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands bewegt. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Die Musik in der Elbphilharmonie klingt ja nicht schlecht, aber …
Zwischen 800.000 und 900.000 Menschen besuchen pro Saison ein Konzert in der Elbphilharmonie. Rein rechnerisch müsste also jeder der 1,9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner Hamburgs schon mindestens zwei- bis dreimal im Konzerthaus im Hamburger Hafen gewesen sein – und gerade hat der Vorverkauf für die nächste Saison begonnen. Eine große Gruppe Menschen war aber noch kein einziges Mal da – sei es, weil die Karten für sie zu teuer sind, oder auch, weil sie sich von dem, was die Elbphilharmonie zu bieten hat, nicht angesprochen und gemeint fühlen. In der aktuellen Folge des Hamburg-Podcasts Elbvertiefung spricht ZEIT-Ressortleiterin Maria Rossbauer mit Florian Zinnecker darüber, woran das liegt – und wie die Elbphilharmonie noch publikumsfreundlicher werden könnte. Florian Zinnecker leitet zusammen mit Maria Rossbauer das Hamburg-Ressort und schreibt als Journalist selbst häufig über Kulturthemen und klassische Musik. Im Gespräch erklärt er, was die Elbphilharmonie weltweit einzigartig macht und wie man an Karten kommt – aber auch, warum das Publikum dort bislang nicht die zentrale Rolle spielt und warum es sich lohnen würde, das zu ändern. Den Podcast Elbvertiefung moderieren Maria Rossbauer und Florian Zinnecker im Wechsel. Immer samstags sprechen sie mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus dem Hamburg-Ressort der ZEIT über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade bewegt. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Passt der Kiezclub in die Bundesliga?
In der nächsten Saison wird der FC St. Pauli in der Bundesliga spielen, das ist seit dem 3:1-Sieg gegen den VfL Osnabrück am vergangenen Wochenende sicher. Im Podcast "Elbvertiefung" spricht ZEIT:Hamburg-Ressortleiterin Maria Rossbauer darüber mit Urs Willmann, Redakteur im Ressort Wissen, der nicht nur ausgewiesener St.-Pauli-Kenner und seit Jahrzehnten Fan ist, sondern sogar Vereinsmitglied. Der FC St. Pauli pflegt sein Image als Underdog, seine Fans sind eher linksalternativ und sehen die Kommerzkultur des modernen Fußballs kritisch. Wie passt ein solcher Verein in die durchkommerzialisierte Bundesliga? Welche finanziellen Folgen hat der plötzliche Erfolg für den Verein? Und wie sehen die Fans die Veränderungen, die ihrem Club nun bevorstehen? Mit Urs Willmann spricht Maria Rossbauer auch über die Anfänge des Vereins, die Rolle der politisch-gesellschaftlichen Positionierung im Vereinsleben, die Gründe, warum der FC St. Pauli den HSV als ewigen Rivalen überholen konnte, und die Frage nach dem richtigen Bier im Stadion. Der ZEIT-Podcast "Elbvertiefung" erscheint immer samstags. Die beiden Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker sprechen immer abwechselnd mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus der Redaktion über ein Thema, das die Menschen Hamburg gerade bewegt – prägnant, persönlich und nie länger als eine knappe halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Geheime Macht: Die Hells Angels in Hamburg
Stimmt es, dass halb St. Pauli den Hells Angels gehört? In Hamburg erzählt man sich diese Geschichte seit über 50 Jahren – es ist eine Geschichte voller Mythen und Legenden über mächtige Rocker und Freigeister auf dem Motorrad. Wie viel Wahrheit darin steckt und wie viel Macht die motorradfahrenden Rocker in Hamburg tatsächlich haben: Darüber diskutiert ZEIT:Hamburg-Ressortleiterin Maria Rossbauer in der neuesten Folge des Hamburg-Podcasts Elbvertiefung mit Christoph Heinemann. Er hat über Monate hin intensiv über die Verstrickungen der Hells Angels in der zweitgrößten Stadt Deutschlands recherchiert – und musste sich dazu auch eine Weile lang in einschlägigen Etablissements herumschlagen. Im Podcast sprechen Rossbauer und Heinemann darüber, wie der Motorradclub nach Hamburg kam, mit welchen kriminellen Geschäften seine Mitglieder Geld verdienen und wie der "Rockerkrieg" vor neun Jahren immer noch die Stadt und die Szene beeinflusst. Und Christoph Heinemann verrät, woran man erkennt, ob man auf St. Pauli vielleicht unwissentlich in einer Hells-Angels-Kneipe gelandet ist. Der Podcast Elbvertiefung erscheint immer samstags. Maria Rossbauer und ihr Ressortleiter-Kollege Florian Zinnecker sprechen immer abwechselnd mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus dem Hamburg-Ressort der ZEIT über ein Thema, das die Stadt gerade umtreibt: persönlich, prägnant und nie länger als eine halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Ist Hamburg noch linksradikal?
Hamburg im Jahr 2017: Staats- und Regierungschefs der Welt treffen sich mitten in der Stadt zum G20-Gipfel, im Schanzenviertel versammeln sich Tausende Menschen zum Protest. Bald schon gehen Bilder von brennenden Autos und Barrikaden in die ganze Welt. Sie zahlten auf Hamburgs Image als Hochburg der linken und linksradikalen Szene ein. Ein Image, das die Szene in der Stadt seit den Hausbesetzungen in der Hafenstraße pflegte – und Jahr für Jahr mit kleineren und größeren Krawallen zum 1. Mai erneuerte. Zuletzt aber schien es stiller geworden zu sein in der Szene. Der 1. Mai verlief in diesem Jahr in Hamburg fast ohne Zwischenfälle, die Polizei sah sich sogar zu einem Lob für das Verantwortungsbewusstsein der Demonstranten veranlasst. Was ist passiert? Darüber spricht Florian Zinnecker in der aktuellen Folge des Hamburg-Podcasts Elbvertiefung mit Tom Kroll, Autor und Reporter der ZEIT:Hamburg. Er hat in den vergangenen Monaten intensiv zur Lage der linken Szene recherchiert und war auch in diesem Jahr am 1. Mai bei den Demonstrationen unterwegs. Im Podcast berichtet Tom Kroll von seinen Begegnungen mit Autonomen und Kommunisten, er erklärt, wie die linke Szene in die Krise geriet, warum gerade der G20-Gipfel dazu beigetragen hat – und wer an ihre Stelle getreten ist. Und er wirft einen Blick in die Zukunft. Der Podcast Elbvertiefung erscheint immer samstags. Abwechselnd sprechen die beiden Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus ihrem Team über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade bewegt. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Zwischen Überseequartier und Elbtower: Was wird aus der HafenCity?
Noch vor wenigen Jahrzehnten war die Hamburger HafenCity nichts weiter als eine ambitionierte Idee: Wie wäre es, auf dem Gelände des Freihafens einen neuen Stadtteil zu bauen? Heute sind die Pläne längst Realität – und die HafenCity, nur eine U-Bahn-Station von der Innenstadt entfernt, gehört zu den gefragtesten Lagen Hamburgs. Wie das Bauprojekt finanziert wurde, welche raffinierten Grundstücksdeals damit zusammenhängen und wer von dem Bau am meisten profitiert hat, erzählt ZEIT-Stadtentwicklungsexperte Christoph Twickel im Gespräch mit Florian Zinnecker im Hamburg-Podcast "Elbvertiefung". In der HafenCity befinden sich auch zwei der größten Probleme der Stadt; es sind im besten Sinn des Wortes riesige Baustellen. Da ist zum einen der Elbtower, die – nach der Pleite des Immobilieninvestors René Benko und seines Firmenimperiums – prominenteste Bauruine des Landes. Und da ist auch das Überseequartier, ein großes Shoppingcenter, dessen Eröffnung gerade kurzfristig um mehrere Monate verschoben wurde. Die Innenstadthändler sehen der Eröffnung mit großer Sorge entgegen, weil sie um ihre Kunden fürchten. Wird das Überseequartier die schon jetzt darbende Innenstadt endgültig untergehen lassen? Oder wird künftig die HafenCity die neue Innenstadt sein? Und wie und wann könnte es auf der Elbtower-Baustelle weitergehen? Auch diese Fragen diskutieren Christoph Twickel und Florian Zinnecker im Podcast. Der Podcast "Elbvertiefung" erscheint immer samstags. Abwechselnd sprechen die beiden Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus dem Hamburg-Ressort der ZEIT über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands gerade bewegt. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Was geschieht in der Blauen Moschee?
Mitten in Hamburg gibt es ein Haus, über das gerade viele Menschen deutschlandweit diskutieren: die Blaue Moschee an der Außenalster. Den Verein, der sie betreibt – das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) –, hält das Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz für einen "weisungsgebundenen Außenposten Teherans". Mithilfe des IZH, so schreibt der Verfassungsschutz in einem Bericht, soll ein in der iranischen Verfassung verankerter Auftrag umgesetzt werden, nämlich der des weltweiten Exports der "Islamischen Revolution". Jetzt, nach dem Raketenangriff des Iran auf Israel, fordern wieder verstärkt Politikerinnen und Politiker aller Parteien, das IZH zu verbieten. Warum eben das aber gar nicht so einfach ist, darüber spricht Host Maria Rossbauer in der aktuellen Folge des "Elbvertiefung"-Podcasts mit dem ZEIT-Hamburg-Autor Tom Kroll, der schon einige Artikel zum IZH verfasst hat. Im Podcast erzählt er von einer riesigen Razzia mit 800 Polizeibeamtinnen und -beamten, von Lastwagen voller Bargeld, Mobiltelefonen, Schriftstücken und Flugblättern, von interessanten Karrieren, die die Leiter des IZH im Anschluss an ihre Tätigkeit in Hamburg in der Regel machen – und davon, was eine Schließung des IZH für die rund 180.000 Muslime Hamburgs bedeuten würde. Und es geht um Hamburger Kaufleute iranischer Abstammung, die Mitte der Sechzigerjahre ebenjene Moschee gebaut haben, die heute zu den schönsten Europas zählt. Jeden Samstag unterhalten sich Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus ihrem Team über eine Frage, die die Bewohnerinnen und Bewohner der zweitgrößten Stadt Deutschlands umtreibt – mal ernst, mal locker, immer prägnant und persönlich. Und immer nur um die 20 Minuten. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Mama, ich muss mal
Hamburg hat wunderschöne Spielplätze. Mit steilen Rutschen für die mutigen Kinder, mit hohen Kletterbäumen für die gelenkigen, mit feinem Sand und Eimeraufzügen für die kreativen. "Doch ab einem gewissen Punkt wird ein Spielplatzbesuch in dieser Stadt immer zum Problem", schrieb ZEIT:Hamburg-Ressortleiterin Maria Rossbauer vor einigen Wochen in der ZEIT. "Dann nämlich, wenn jemand auf die Toilette muss." Von den 772 öffentlichen Spielplätzen Hamburgs verfügen nach Angaben der dafür zuständigen Umweltbehörde gerade einmal elf über eine angeschlossene WC-Anlage. Im Gespräch mit Florian Zinnecker erzählt Maria Rossbauer, die als Mutter von drei Kindern mit der Problematik bestens vertraut ist, von der Argumentation der Behörde, warum ein Toilettenausbau auf öffentlichen Spielplätzen nicht für notwendig sei. Sie berichtet auch von einer besonderen Lösung aus der Stadt Zürich – und sie kennt einen Trick, wie sich das Notdurftproblem zumindest in manchen Fällen lösen lässt, ohne dass alle sofort nach Hause aufbrechen müssen. Und natürlich verraten Maria Rossbauer und Florian Zinnecker auch, wo die schönsten Spielplätze Hamburgs sind. Jeden Samstag sprechen Maria Rossbauer und Florian Zinnecker im Hamburg-Podcast "Elbvertiefung" über ein Thema, das die Menschen in der zweitgrößten Stadt in Deutschland umtreibt – immer persönlich, pointiert und prägnant und nie länger als eine knappe halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

1.000 Mal probiert
Der Küchenchef des mutmaßlich besten Restaurants der Welt, der eigens für den Gastrokritiker alle zehn Minuten ein Lieblingsgericht kocht. Ein Weinglas, das nie leer zu werden scheint und Maden auf dem Dessert – Michael Allmaier erlebte schon so manche skurrile und spannende Dinge in seinem Job. Seit zehn Jahren testet Allmaier Restaurants für die ZEIT:Hamburg. Er schreibt darüber in der Kolumne "Mahlzeit", die freitags im Elbvertiefungs-Newsletter erscheint und für die gedruckte ZEIT oder für ZEIT ONLINE. In der neuen Folge des "Elbvertiefung"-Podcasts spricht Maria Rossbauer mit Michael Allmaier darüber, was er bei seinen Recherchen alles erlebt. Dabei verrät Allmaier auch einige Tricks, etwa, wie man an der Speisekarte im Fenster eines Restaurants ablesen kann, ob sich ein Besuch lohnt – sind etwa mehr Gerichte auf der Karte als Plätze in der Gaststube, würde er dort nicht essen gehen. Und natürlich empfiehlt der Gastrokritiker auch einige Restaurants in Hamburg, die einen Besuch lohnen. Jeden Samstag unterhalten sich Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus ihrem Team über eine Frage, die die Bewohnerinnen und Bewohner der zweitgrößten Stadt Deutschlands umtreibt – mal ernst, mal locker, immer prägnant und persönlich. Und immer nur um die 20 Minuten. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Wie Hamburgs Superreiche die Stadt prägen
In Hamburg gilt ein ungeschriebenes Gesetz: Wer Geld hat, protzt nicht damit. Das klappt erstaunlich gut, wenn man bedenkt, dass allein rund 1.200 Einkommensmillionärinnen und -millionäre in der Stadt leben – also Menschen mit einem mindestens siebenstelligen Jahreseinkommen. Dazu kommen all jene, die unabhängig von ihrem Einkommen ein großes Vermögen aufgebaut oder geerbt haben; ihre Zahl ist schwer zu ermitteln. Einige tauchen allerdings auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt auf: etwa Klaus-Michael Kühne, der zwar in der Schweiz lebt, in seiner Geburtsstadt Hamburg aber sehr präsent und vielfach investiert ist. Oder die Unternehmer Michael und Alexander Otto sowie Wolfgang und Michael Herz, die Erben des Tchibo-Imperiums – sie alle sind mehrfache Milliardäre. Warum so viele sehr reiche Menschen in Hamburg leben und wie das die Stadt verändert – darüber spricht Florian Zinnecker, Leiter des Hamburg-Ressorts der ZEIT, in einer neuen Folge des Hamburg-Podcasts "Elbvertiefung" mit der ZEIT-Autorin und Wirtschaftsexpertin Kristina Läsker. Im Podcast sprechen die beiden auch über den typischen Hamburger Weg, öffentlichkeitswirksam mit Reichtum umzugehen, ohne sich der Angeberei verdächtig zu machen: indem man einen Teil seines Vermögens zum Wohl der Allgemeinheit einsetzt – über Spenden, mäzenatisches Engagement oder mit einer Stiftung. Auch davon gibt es in Hamburg so viele wie in keiner anderen Stadt in Deutschland. Vieles, was Hamburg heute ausmacht, wäre ohne das Geld der Millionäre und Milliardäre der Stadt nicht denkbar. Wer sind diese Spender, Stifter und Mäzene, wie prägen sie Hamburg, welche Ziele verfolgen sie? Und kann man ihnen trauen, wenn sie sagen, sie wollen nur das Beste? Im Podcast "Elbvertiefung" sprechen die beiden Leiter des Hamburg-Ressorts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker jeden Samstag abwechselnd mit einer Kollegin oder einem Kollegen über ein Thema, das die Stadt umtreibt. Immer prägnant, persönlich und pointiert – und nie länger als eine knappe halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Wie ein Schulstreit vor 500 Jahren die Stadt veränderte
Vor 500 Jahren war Hamburg eine kleine Stadt. Nur 14.000 Menschen lebten hier, sie wohnten in gedrungenen Fachwerk- und Backsteinhäusern, über ihnen ragten die Kirchen auf, St. Petri, St. Jacobi, die Katharinenkirche, die Nikolaikirche und der Dom. Die Stadt war mehrheitlich katholisch – doch das sollte sich bald ändern. Denn die Eltern Hamburgs waren wütend. Ihr Zorn richtete sich gegen die für Bildung zuständige katholische Kirche. In einem Brief an den Stadtrat beschwerten sie sich: Die Lehrer seien faul, die Kinder würden vernachlässigt. "In einer Ratssitzung bezeichneten Eltern die Lehrer, die von der Geistlichkeit ausgesucht worden sind, als "Ideoten"", erzählt ZEIT-Hamburg-Autor Tom Kroll in der aktuellen Folge des Hamburg-Podcasts "Elbvertiefung". Zwei Jahre hätten sich die Eltern mit der Kirche gestritten, bis sie schließlich ihre Forderungen durchsetzten. Was sie damals noch nicht ahnten: Mit ihrem Streit brachten die Eltern eine Bewegung ins Rollen – eine, die in der Hamburger Reformation gipfelte. Tom Kroll hat zur Hamburger Reformation recherchiert. In der neuen Folge geht es um einen Mann namens Heinrich Banscow, der das Schulgeld stetig erhöhte und damit Zorn auf sich zog, um eine elfstündige Verhandlung im Rathaus und fünf katholische Prediger, die sofort im Anschluss die Stadt verlassen mussten – und es geht um die plattdeutsche Sprache, und warum sie damals den Prozess entscheidend prägte. Jeden Samstag unterhalten sich Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus ihrem Team über eine Frage, die die Bewohnerinnen und Bewohner der zweitgrößten Stadt Deutschlands umtreibt – mal ernst, mal locker, immer prägnant und persönlich. Und immer nur um die 20 Minuten. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Kommt die neue Superbrücke wirklich?
Die Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen ist 3,6 Kilometer lang, 53 Meter hoch – und deutlich zu klein sowie zu marode, um sie langfristig erhalten zu können. Diese Position vertrat die Hamburger Wirtschaftsbehörde seit Jahren. Offen war nur noch, wann genau der Abriss erfolgen sollte – und auf welchem Weg die Autos und Lastwagen dann die Elbe zwischen Wilhelmsburg im Osten und der A 7 im Westen überqueren: per Tunnel? Oder über eine neue Brücke? In dieser Woche gab es in dieser Sache Neuigkeiten: Die alte Köhlbrandbrücke, die längst als Hamburger Wahrzeichen gilt, soll offenbar nach Plänen des Senats mit einer neuen, ähnlich aussehenden Brücke ersetzt werden. Die geplante Fertigstellung: im Jahr 2046. Warum dauert das so lange? Und was bedeutet das für die bestehende Brücke – die von der Hafenbehörde immer wieder als unrettbaren Sanierungsfall bezeichnet wurde, nun aber noch mehr als 20 Jahre in Betrieb bleiben soll? Darüber spricht Florian Zinnecker, Hamburg-Ressortleiter der ZEIT, in der aktuellen Folge des Podcasts "Elbvertiefung" mit seinem Kollegen Frank Drieschner, der sich mit dem Schicksal der Brücke, ihrem Zustand und ihren möglichen Alternativen intensiv beschäftigt und zuletzt zu den gescheiterten Plänen der Behörde für eine Tunnel-Lösung recherchiert hat. Im Podcast sprechen die beiden auch über die Wahrscheinlichkeit, dass die neue Brücke nie gebaut werden könnte – dafür gibt es aus Frank Drieschners Sicht schon jetzt plausible Hinweise. Im Podcast "Elbvertiefung" sprechen die beiden Hamburg-Ressortleiter Maria Rossbauer und Florian Zinnecker abwechselnd mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus dem Team über ein Thema, das die Stadt gerade bewegt – immer samstags, immer prägnant und persönlich und nie länger als eine knappe halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Wie geht es Hamburg seit dem Amoklauf?
"So etwas hat Hamburg noch nicht gesehen", sagte Polizeisprecher Holger Vehren am 9. März 2023. Er stand damals spätnachts vor einem dreistöckigen Gebäude im Hamburger Stadtteil Alsterdorf. Ein Mann hatte darin gerade sieben Menschen erschossen, elf verletzt, viele weitere für ihr Leben traumatisiert und anschließend sich selbst getötet. Der Schütze war Philipp F., ein damals 35-jähriger Mann und ehemaliges Gemeindemitglied. Ein eingetragener Sportschütze, der seine Waffe legal besaß, obwohl es schon lange Hinweise darauf gegeben hatte, dass er wahnhaft war und zunehmend aggressiv auftrat. Im Anschluss an diese Tat, die Hamburgs Innensenator Andy Grote als die schlimmste in Hamburgs jüngerer Geschichte bezeichnete, wurde darum viel diskutiert. Darüber, ob die Arbeit der Hamburger Waffenbehörde gut genug ist, ob das Gesetz, das ermöglichen sollte, gefährliche Menschen zu entwaffnen, ausreicht – und ob man genug darüber weiß, was in den Schützenclubs der Stadt vor sich geht. In der neuen Folge des "Elbvertiefung"-Podcasts spricht Host Maria Rossbauer mit ZEIT:Hamburg-Redakteur Christoph Heinemann über eine schwarze Nacht für Hamburg, über ein Waffengesetz mit großen Lücken, behördliches Versagen – aber auch darüber, was sich seit dem Amoklauf tatsächlich verändert hat. Und er erzählt von seinen Erlebnissen im Hanseatic Gun Club, dem Schützenverein, über den Philipp F. die Tatwaffe bekam. Im Podcast "Elbvertiefung" sprechen die beiden Hamburg-Ressortleiter Maria Rossbauer und Florian Zinnecker abwechselnd mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus dem Team über ein Thema, das die Stadt gerade bewegt – immer samstags, immer prägnant und persönlich und nie länger als eine knappe halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Die ganze Wahrheit über den Hamburger SV
Für die Fans des Hamburger SV ist klar: Eines Tages wird ihre Mannschaft, die seit sechs Jahren in der Zweiten Liga spielt, in die Bundesliga zurückkehren; vielleicht sogar schon am Ende der Saison. Damit das gelingt, müssten sich allerdings ein paar entscheidende Dinge ändern, sagt Daniel Jovanov, HSV-Experte und ZEIT-Autor. Denn dass sich im HSV eine Krise an die nächste reiht, ist aus Jovanovs Sicht eindeutig ein strukturelles Problem. Und um Fußball geht es dabei nur am Rande. Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im März will die Führung des Hamburger SV die Umwandlung der Unternehmensform von einer Aktien- zu einer Kommanditgesellschaft durchsetzen. Was bedeutet das? Wie könnte der Schritt dazu beitragen, die Dauerkrise des Proficlubs zu beenden? Und: Welche Rolle spielt dabei Klaus-Michael Kühne, der mächtigste Anteilseigner und Finanzier des Vereins? Außerdem sprechen die beiden darüber, was den HSV mit dem FC Bayern München verbindet, welches Spiel im Aufstiegskampf besonders spannend werden dürfte – und welche Plätze im Volksparkstadion die besten sind. Der Hamburg-Podcast der ZEIT erscheint immer samstags. Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, sprechen abwechselnd mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus dem Team über ein Thema, das die Stadt gerade umtreibt – prägnant, persönlich und nie länger als eine halbe Stunde. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Die Tricks von Hamburgs Drogenmafia
Der Hamburger Hafen gilt als Einfallstor für internationale Drogenbanden. Immer wieder kommt es hier zu spektakulären Drogenfunden. Erst Ende 2023 entdeckten Zollfahnder auf einem Frachter 500 Kilogramm Kokain, Straßenverkaufswert: 35 Millionen Euro. Tatsächlich aber gehen Ermittler davon aus, dass sie höchstens zehn Prozent des geschmuggelten Rauschgifts entdecken. Welche Drogen kommen hier schließlich an, und wie wirkt sich die Flut auf die Stadt aus? Darüber spricht Maria Rossbauer in der neuen Folge des "Elbvertiefungs"-Podcasts mit ZEIT-Hamburg-Redakteur Christoph Heinemann. Er recherchiert zur Drogenkriminalität in Hamburg und erzählt von Verstecken in Bananenkisten, zerlegten Kühlaggregaten und Bergungsteams, die den Stoff aus den Containern herauszufischen versuchen. Davon, wo die Grenzen der Ermittler sind – und wen man in Hamburg um Hilfe bitten kann, wenn man selbst oder ein geliebter Mensch in den Drogenstrudel gerät. Jeden Samstag unterhalten sich Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus ihrem Team über eine Frage, die die Bewohnerinnen und Bewohner der zweitgrößten Stadt Deutschlands umtreibt – mal ernst, mal locker, immer prägnant und persönlich. Und nie länger als 30 Minuten. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht’s hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Wie Autofahrer glücklich werden können
Laut einer Studie des ADAC sind die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer in Hamburg überdurchschnittlich unzufrieden – egal, ob sie mit dem Auto, dem Fahrrad, öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß unterwegs sind. Das empfundene Unglück der Hamburger Autofahrerinnen und -fahrer ist jedoch mit Abstand am größten. In der aktuellen Folge des Hamburg-Podcasts "Elbvertiefung" nennt ZEIT-Redakteur Frank Drieschner dafür gleich mehrere Gründe. In Hamburg gebe es schlichtweg nicht genug Platz für die 800.000 Autos, die in der Stadt zugelassen sind – "Städte sind nicht für Autos gemacht", sagt Drieschner, "und jeder Autofahrer ist grundsätzlich jedem anderen im Weg." Dazu komme ein zweiter Grund: "In Hamburg wird auf eine verrückte Weise über den Straßenverkehr diskutiert." Worin diese Verrücktheit liegt, welche Rolle dabei der Hamburger Verkehrssenator spielt und warum die Baustellen auf den Straßen der Stadt ein viel kleineres Problem darstellen als oft vermutet – darüber spricht Frank Drieschner im Podcast mit ZEIT-Hamburg-Ressortleiter Florian Zinnecker. Und natürlich auch darüber, wie die Ursachen der Unzufriedenheit zu lösen und zu beheben wären. Der Podcast »Elbvertiefung« erscheint immer samstags. In jeder Folge diskutieren die beiden Hosts Maria Rossbauer und Florian Zinnecker abwechselnd mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus dem Hamburg-Ressort der ZEIT über ein Thema, das die Stadt gerade bewegt – mal ernst, mal locker, immer prägnant und persönlich. Und nie länger als 30 Minuten. Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und zu unserem Newsletter geht's hier lang. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Hamburgs bankrottes Wahrzeichen
Direkt neben den Elbbrücken, am östlichen Eingang der HafenCity, soll im Jahr 2025 Hamburgs höchstes Gebäude eröffnet werden: der Elbtower, 245 Meter hoch, nach einem Entwurf des Star-Architekten David Chipperfield. Aber daraus wird wohl nichts: Die Bauarbeiten sind gestoppt, der Investor, die Unternehmensgruppe Signa, ist insolvent, Hamburgs prominenteste Baustelle liegt brach. Wann, wie und ob es hier weitergeht, weiß niemand. Warum war Hamburg auf diesen Fall nicht besser vorbereitet? Wie konnte es zu einer so folgenreichen Pleite überhaupt kommen? Und was lässt sich aus der Sache für künftige Großprojekte lernen? Darüber spricht Florian Zinnecker, Leiter des Hamburg-Ressorts der ZEIT, in der ersten Folge des Podcasts "Elbvertiefung" mit ZEIT-Autor Christoph Twickel, der mit seinen Recherchen das Projekt von Anfang an begleitet. Die "Elbvertiefung" ist der neue Hamburg-Podcast der ZEIT. Maria Rossbauer und Florian Zinnecker, die zusammen das Hamburg-Ressort der ZEIT leiten, sprechen künftig immer samstags abwechselnd mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus ihrem Team über eine Frage, die die Menschen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands umtreibt – mal ernst, mal locker, immer prägnant und persönlich. Und nie länger als 30 Minuten. "Elbvertiefung" heißt auch der Newsletter, den das Hamburg-Ressort werktags um sechs Uhr morgens an mehr als 100.000 Leserinnen und Leser versendet. Als Podcast gibt es die "Elbvertiefung" von nun an auch am Wochenende, alle Abonnentinnen und Abonnenten unseres Newsletters bekommen den Link zu jeder neuen Folge immer samstags um sechs Uhr ins Postfach. Weitere Links zu den Themen der Folge: - Elbtower: Die Luftnummer - Immobilienbranche: Hochgestapelt, reingefallen Für Lob, Kritik oder Anregungen schreiben Sie gern an hamburg@zeit.de. Und unseren Newsletter können Sie hier lesen und abonnieren: https://www.zeit.de/serie/elbvertiefung. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcastabo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.