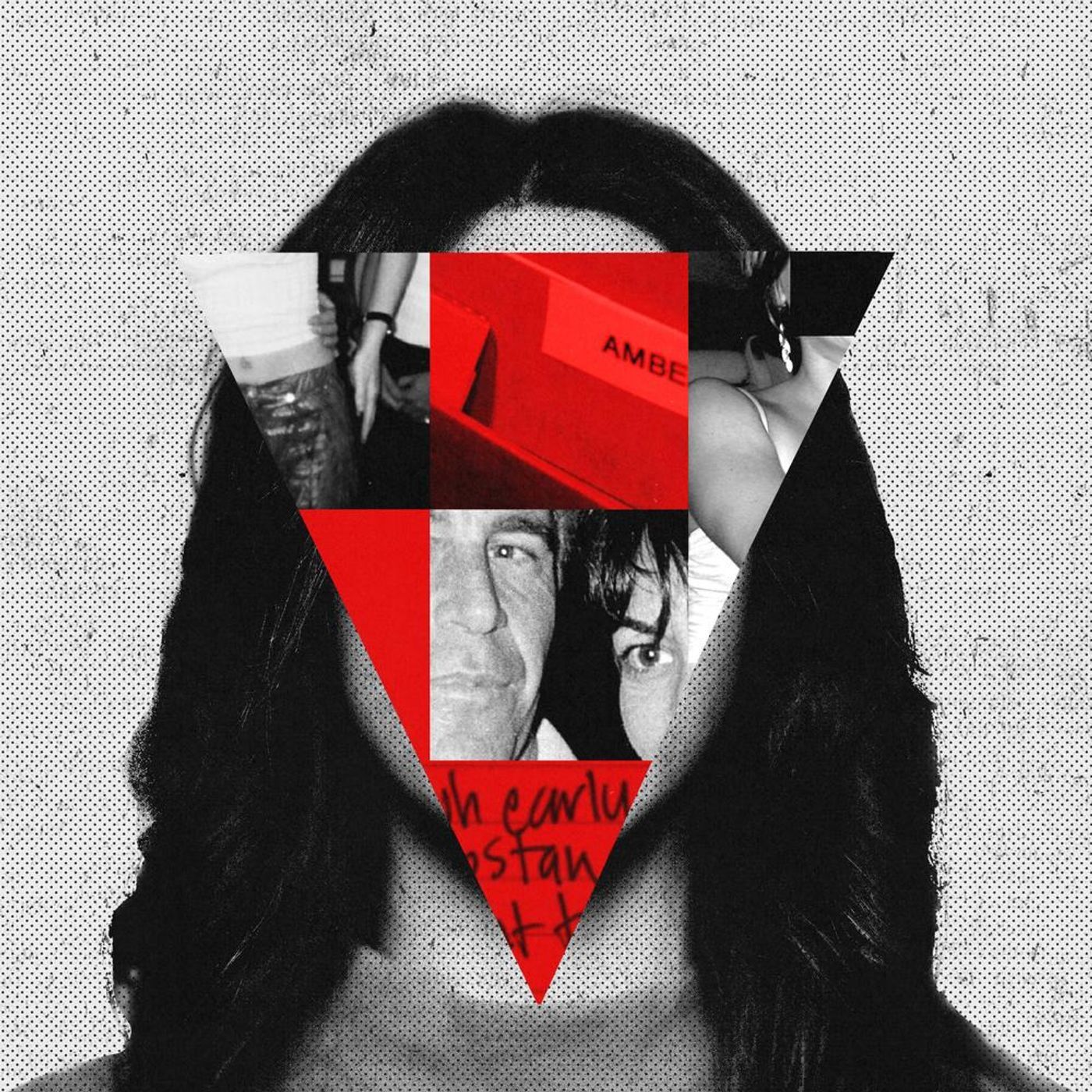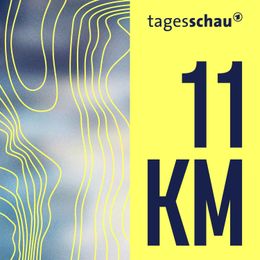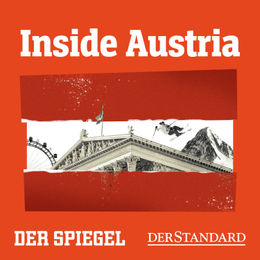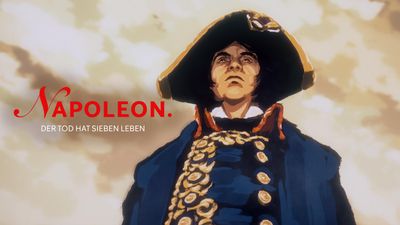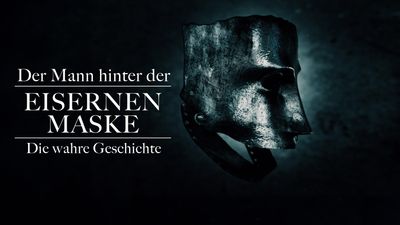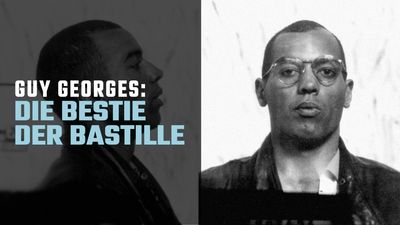„Was jetzt?“: Podcast für Wissbegierige
Aktuelle Nachrichten mit Hintergrundberichten, zweimal täglich, sieben Tage die Woche. Mit dem „Was jetzt?“-Podcast greift ZEIT ONLINE wichtige Themen auf, lässt Expertinnen und Experten kommentieren und scheut sich auch nicht, das politische Tagesgeschehen mal etwas humorvoller zu betrachten.
Worum geht es im ZEIT-Podcast „Was jetzt?“?
Der ZEIT-Podcast „Was jetzt?“ informiert zweimal täglich, jeweils um 6 Uhr und 17 Uhr, über aktuelle Ereignisse, liefert in kompakter Form spannende Fakten und Hintergrundberichte. Ob Klimakrise, Naturphänomene, die die Welt bewegen, oder politische Debatten: In rund zehn Minuten beleuchten die wechselnden Journalistinnen und Journalisten aus der ZEIT ONLINE-Redaktion nationale sowie internationale News und ordnen das Geschehen für das Publikum ein. O-Töne ergänzen die Analysen.
Zusätzlich zum täglichen „Was jetzt“-Nachrichtenpodcast behandelt die Redaktion samstags ein ausgewähltes Thema ausführlich. In den Spezialfolgen blickt sie mit Interviews, Reportagen und User-Kommentaren hinter die Kulissen. „Was jetzt? – Spezial“ ist damit ein Muss für alle, die sich über ein News-Thema in allen Facetten informieren möchten.
Wer ist an der Entstehung von „Was jetzt?“ beteiligt?
Ein Team von derzeit 16 festen und freien ZEIT-Redakteurinnen und -Redakteuren und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kümmert sich um die Inhalte des „Was jetzt?“-Podcasts. Unter anderem an Bord ist Jannis Carmesin. Der studierte Journalist ist nach Stationen bei der Deutschen Welle und dem TV-Magazin Monitor seit 2021 einer der Hosts des News-Podcasts von ZEIT ONLINE.
Podcast-News-Redakteurin Elise Landschek wurde 1982 in Berlin geboren und studierte Politikwissenschaft. Sie arbeitete unter anderem als Reporterin und Feature-Autorin für NDR Info sowie den Deutschlandfunk. 2019 gewann sie den „Alternativen Medienpreis“ für ihr multimediales Projekt zur Extremismusprävention. Seit 2020 ist sie Autorin und Podcastmoderatorin bei ZEIT ONLINE.
Als freie Autorin schreibt Azadê Peşmen seit 2017 regelmäßig für den Podcast „Was jetzt?“. Sie wurde in Berlin geboren, studierte Politik in Potsdam und São Paulo und Historische Urbanistik in Berlin. Sie gibt Workshops zu Themen wie Tokenismus, Podcasting und Öffentlichkeitsarbeit für Künstlerinnen und schreibt für das „Missy Magazine“.
Mounia Meiborg, stellvertretende Ressortleiterin Podcasts, wurde 1984 in Frankreich geboren und wuchs in Marokko und Deutschland auf. Sie studierte Kulturwissenschaften mit den Fächern Theater, Musik und Literatur und absolvierte anschließend eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München. Seit 2013 arbeitet sie am Newsdesk der ZEIT ONLINE.
Wer sollte den „Was jetzt“-Nachrichten-Podcast hören?
Gut informiert in den Tag starten und auch am Nachmittag nichts verpassen: Der „Was jetzt?“-Podcast richtet sich an alle, die in aller Kürze mehr über die aktuelle Nachrichtenlage wissen möchten, nach Expertenmeinungen und Einordnungen suchen.
„Was jetzt?“ – der Podcast auf einen Blick
Erstveröffentlichung
- 12.09.2017
Erscheinungsweise
- Zweimal täglich
Länge der Episoden
- ca. 10 bis 15 Minuten
Ähnliche Podcasts und Formate auf RTL+
- „Jetzt mal ehrlich …“
- „F.A.Z. Frühdenker – Die Nachrichten am Morgen“
- „STERN nachgefragt“
Tägliche fundierte Infos zum Weltgeschehen: Hör dir jeden Tag neue Folgen des „Was jetzt?“-Podcasts auf RTL+ an!