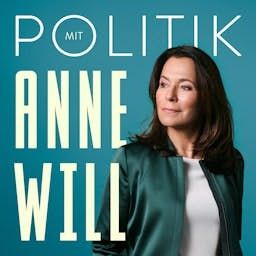Politik mit Anne Will: Der Podcast zu politischen Themen
Im Podcast „Politik mit Anne Will“ taucht die erfahrene Journalistin und Moderatorin Anne Will jede Woche tief in aktuelle politische Themen ein. Mit ihrem kritischen und präzisen Interviewstil spricht sie sowohl mit Expertinnen und Experten als auch mit Politikerinnen und Politikern, die direkt in Verantwortung stehen. Der Podcast bietet wöchentlich spannende Einblicke, fundierte Analysen und eine verständliche Aufbereitung komplexer Themen.
„Politik mit Anne Will“: Wer ist die Gastgeberin?
Die Podcasterin Anne Will ist eine bekannte deutsche Fernsehmoderatorin und Journalistin. Von September 2007 bis Dezember 2023 war sie in der politischen Talkshow Anne Will zu sehen, die zuletzt am Sonntagabend im Ersten ausgestrahlt wurde. Davor moderierte sie von 2001 bis 2007 die Tagesthemen im Ersten. Anne Will studierte Politikwissenschaft und Anglistik und begann ihre journalistische Karriere schon während des Studiums. Zu dieser Zeit war sie als Journalistin bei der Kölnischen Rundschau und dem Spandauer Volksblatt tätig. Bekanntheit erlangte Anne Will unter anderem auch durch die Präsentation der Sportschau im Ersten. Ihr Volontariat in Hörfunk und Fernsehen absolvierte sie von 1991 bis 1992 beim Sender Freies Berlin. Seit 2024 führt sie mit „Politik mit Anne Will“ ihren eigenen Podcast und bringt spannende politische Themen direkt zu den Hörerinnen und Hörern.
Worum geht es im Podcast „Politik mit Anne Will“ und wer sind die Gäste?
Im Podcast „Politik mit Anne Will“ spricht Anne Will jede Woche über ein aktuelles politisches Thema und liefert tiefgehende Analysen und fundierte Fakten. Sie interviewt Politikerinnen und Politiker und ordnet mit ihren Gästen politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Geschehnisse in Deutschland und der Welt ein. Die Gäste variieren je nach Thema und bringen unterschiedliche Perspektiven mit. Zu den bisherigen Gästen zählen zum Beispiel Ricarda Lang zur Zukunft der Grünen, Salwa Houmsi über Feminismus in der Generation Z, und Thorsten Frei zur Migrationspolitik. Der Podcast „Politik mit Anne Will“ bietet ein breites Spektrum an Themen wie Wahlen, Verteidigungspolitik, und soziale Fragen. Anne Wills kritischer Interviewstil und die Expertise der Gäste machen den Podcast besonders informativ und spannend für alle, die sich für Politik interessieren und komplexe Themen besser verstehen möchten.
„Politik mit Anne Will“: Weitere Informationen zum Podcast
Erstveröffentlichung
- 18. April 2024
Erscheinungsweise
- Wöchentlich, immer am Donnerstag
Länge der Episoden
- Zwischen 30 Minuten und 1 Stunde und 30 Minuten
Genre
- Politik
Ähnliche Podcasts
Dazu passende Serien und Filme
- KT Guttenberg – Auf den Spuren der Macht
- Angela Merkel – Frau Bundeskanzlerin
- Endlich Klartext! – Der große RTLZWEI-Politiker-Check 2021
Du interessierst dich für aktuelle Themen aus der Politik und möchtest dir dazu eine Meinung bilden? Dann höre dir jetzt den Podcast „Politik mit Anne Will“ an! Noch mehr Unterhaltung? Dann erlebe weiteres Entertainment wie Shows, Serien und Filme, aber auch Musik und Hörspiele auf RTL+.