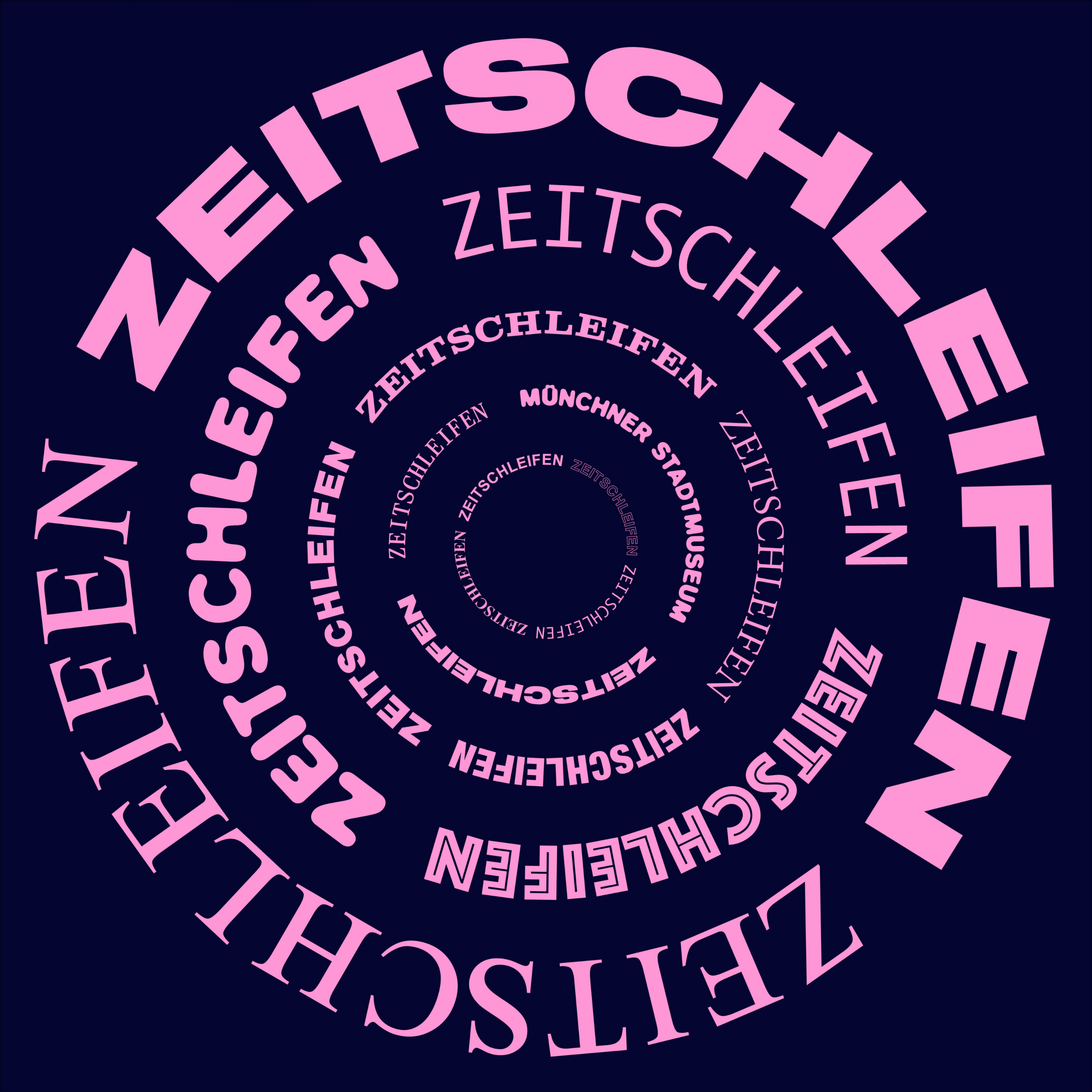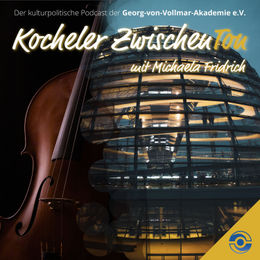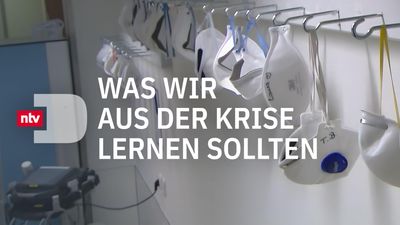Staffel 2: Tradition oder Mythos? In unserer neuen Staffel "Zeitschleifen. Wiesn rewind" tauchen wir mit euch ein in über 200 Jahre Oktoberfestgeschichte – mit zahlreichen Überraschungen, Wendungen und unbekannten Geschichten. Seit über 200 Jahren feiert München im Spätsommer das größte Volksfest der Welt: die Wiesn. Mit Millionen Besucher*innen, Tracht, Bier, Brathendl – und dem Gefühl, Teil einer bayerischen Tradition zu sein. Aber Moment mal: War das Oktoberfest wirklich schon immer so, wie wir es heute kennen? Oder steckt hinter der angeblich uralten Tradition ein ganz anderer Anfang? Die Antworten findet ihr in der neuen Staffel von "Zeitschleifen. Wiesn rewind", dem Podcast des Münchner Stadtmuseums. Staffel 1: Die Inflation treibt die Preise durch die Decke, auf den Straßen marschieren wieder Nazis, Frauen müssen um ihre Rechte kämpfen, Menschen sind erschöpft und voller Sorge, dass Maschinen ihre Arbeitsplätze wegnehmen, parallele Krisen verlangen uns alles ab. Gab es das nicht alles schon mal? Der Autor Mark Twain soll einmal gesagt haben, "Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich". Während sich also Orte, Menschen und Details ändern, würde doch immer wieder Ähnliches passieren. Was lässt sich lernen von Menschen, die zu anderen Zeiten an ähnlichen Punkten standen? Darum geht es in der ersten Staffel von "Zeitschleifen", dem Podcast des Münchner Stadtmuseums. Relevant, relatable und mit erstaunlichen Parallelen – in sechs Folgen bekommt ihr kompaktes Wissen und eine historische Einordnung zu Themen, die uns als Gesellschaft gerade (wieder) bewegen.
Alle Folgen
Trailer: Zeitschleifen. Geschichte fast forward
Die Inflation treibt die Preise durch die Decke, auf den Straßen marschieren wieder Nazis, Frauen müssen um ihre Rechte kämpfen, Menschen sind erschöpft und voller Sorge, dass Maschinen ihre Arbeitsplätze wegnehmen, parallele Krisen verlangen uns alles ab. Gab es das nicht alles schon mal? Der Autor Mark Twain soll einmal gesagt haben, "Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich". Während sich also Orte, Menschen und Details ändern, würde doch immer wieder Ähnliches passieren. Was lässt sich lernen von Menschen, die zu anderen Zeiten an ähnlichen Punkten standen? Darum geht es in der ersten Staffel von "Zeitschleifen", dem Podcast des Münchner Stadtmuseums. Relevant, relatable und mit erstaunlichen Parallelen – in sechs Folgen bekommt ihr kompaktes Wissen und eine historische Einordnung zu Themen, die uns als Gesellschaft gerade (wieder) bewegen.

Realitätsflucht oder Selbstfürsorge? Rückzug in turbulenten Zeiten
Sport, Binge-Watching, Meditation – kurz: Rückzug. Sind das wirklich die besten Antworten auf den Dauerkrisenmodus, in dem wir uns befinden? An belastenden Nachrichten mangelt es zurzeit nicht: Klimakrise, Kriege oder Inflation sind nur einige Beispiele. Viele von uns strugglen damit, sich täglich neuen katastrophalen Meldungen auszusetzen. Wie finden wir einen gesunden Umgang damit, ohne uns zu überfordern oder uns aus der Realität zu verabschieden? Bei der Suche nach Lösungen hilft ein Blick in die Geschichte. Gemeinsam mit Kunsthistoriker Dr. Nico Kirchberger, dem Leiter der Sammlung Grafik und Gemälde des Münchner Stadtmuseums, werfen wir einen Blick auf das Ende des 19. Jahrhunderts – eine Zeit, in der die Industrialisierung Städte schnell wachsen ließ und die Menschen sich mit den vielen technischen Neuerungen oft stark überfordert fühlten. Der Maler Karl Wilhelm Diefenbach wandte sich vom hektischen Stadtleben ab und suchte eine neue Lebensweise in der Natur. Diefenbachs Abkehr von der Gesellschaft brachte aber auch Probleme mit sich. Sozialpsychologe Dr. Fabian Hess von der Universität Jena erklärt, wie Krisen unsere Gemeinschaft auch stärken können.

Ein Schritt vorwärts, drei zurück? Feminismus und Geschlechterrollen
Bei vielen Trends würde man sich wünschen, dass sie nie mehr wiederkehrten, darunter: Hüfthosen, Korsette – und ganz grundsätzlich die Diskriminierung von Frauen. Doch es scheint so, als würde die Gesellschaft derzeit bei letzterem wieder Rückschritte machen. Dr. Isabella Belting, Leitung der Sammlung Mode / Textilien des Münchner Stadtmuseums, gibt Einblicke in die Zeit um 1900, als sich die Frauen gerade (wieder einmal) des Korsetts entledigt hatten: Lose Reformkleider erlaubten es, sich frei zu bewegen. Sie waren aber gleichzeitig auch ein Akt der Rebellion, was nicht alle Menschen gut fanden. Bereits zu dieser Zeit entwickelte sich der Antifeminismus, der auch gegenwärtig wieder zunimmt. Prof. Annette Henninger von der Philips-Universität Marburg erläutert, wo dieser Backlash seinen Ursprung nahm, warum aktuelle Phänomene wie der Trad-Wive-Trend problematisch sind und wie sich dagegen ankämpfen lässt.

Neue Möglichkeiten, neue Ängste? Von Dampfmaschinen und KI
Künstliche Intelligenz erleichtert das Leben in vielen Bereichen: ob schnelle Recherche, ein Gedicht schreiben oder Übersetzungshilfe – ihr Wissen scheint grenzenlos. Aber was bedeutet das eigentlich für die Arbeitswelt, wenn es nun etwas gibt, das schneller, effizienter und pausenlos arbeitet? Werden viele Arbeitsplätze dadurch nicht überflüssig? Antonia Voit, Leitung der Sammlung Angewandte Kunst des Münchner Stadtmuseums, nimmt uns mit in eine Zeit, in der die Gesellschaft schon einmal vor einem ähnlichen Problem stand. Die Erfindung der Dampfmaschine nahm dem Menschen viel der körperlichen Arbeit ab und erlaubte es, beispielsweise Möbel günstiger zu produzieren und auch Einkommensschwächeren zur Verfügung zu stellen. Doch der Schub durch die Industrialisierung brachte auch beängstigende Seiten mit sich und verunsicherte viele. Der Wirtschafts- und Industriesoziologe Dr. Hartmut Hirsch-Kreinsen sieht Parallelen zur derzeitigen Entwicklung der Künstlichen Intelligenz.

Gleiches Recht für alle? Queerness im Wandel der Zeit
Was ist die Norm, wer bestimmt sie und wie wird sie verschoben? Queerness ist heute ein selbstverständlicher Teil der Popkultur, seit 2017 ist in Deutschland die Ehe unter gleichgeschlechtlichen Paaren möglich und 2024 ist das Selbstbestimmungsgesetz für eine vereinfachte Änderung des Geschlechtseintrags in Kraft getreten: also alles auf einem guten Weg hinsichtlich der Rechte und Sichtbarkeit queerer Menschen? Nicht ganz. Pia Singer, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Sammlung Stadtkultur des Münchner Stadtmuseums, gibt einen Einblick in die Situation queerer Menschen um 1900. Wie offen konnte damals geliebt und gelebt werden? Zwei Frauen in München stechen zu dieser Zeit besonders hervor: Anita Augspurg und Sophia Goudstikker lebten als lesbisches Paar zusammen, betrieben ein eigenes Fotostudio und waren damit sehr erfolgreich! Doch sie waren eher eine Ausnahmeerscheinung, denn nicht für alle Menschen galten dieselben Regeln. Dr. Esto Mader von der Humboldt Universität Berlin erklärt, was die Aspekte Teilhabe, Sichtbarkeit und Sicherheit auch heute damit zu tun haben und wie vielfältige Krisen bisherige Fortschritte bedrohen.

Greller, lauter, bissiger? Von Plakaten zum Puppy-Content
Wehe, der Algorithmus streikt: Sobald unsere eigene, sorgfältig aufgebaute Social-Media-Bubble durch andere Sichtweisen zu platzen droht, platzt auch schnell die Hutschnur. Haben Menschen schon immer so emotional auf Dinge reagiert, die plötzlich in ihrem Sichtfeld auftauchen? Mit Henning Rader, Leiter der Sammlung Reklamekunst des Münchner Stadtmuseums, erkunden wir den Ursprung von Bildern als Kommunikationsmedium. Noch lange bevor es Social Media und Memes gab, machte das Plakat Bilder zum zentralen Kommunikationsmittel – und das schon vor 1900. Mit einer neuen, reduzierten Bildsprache und wenig Text entwickelten sich Plakate sehr schnell zu einem neuen Massenmedium. Ihre emotionale, oft "laute" Bildsprache war effektiv, aber auch verknappt – und hat damit starke Reaktionen provoziert. Professorin Anna Kümpel erklärt, wie das Prinzip auch in der heutigen digitalen Welt noch weiterwirkt und warum gerade online die Emotionen so schnell hochkochen.

Gierig auf Neues? Von Fernweh und Fremdenhass
Avocados, Kaffee, Tee, Zimt – Produkte aus fernen Ländern gehören längst zum deutschen Alltag. Doch wenn es darum geht, dass Menschen aus anderen Kulturen hierherkommen, gibt es häufig Vorbehalte. Ein Widerspruch, der spätestens seit der letzten Bundestagswahl nicht zu übersehen ist. Wie lässt sich dieser Spagat in der Haltung erklären? Gemeinsam mit Susanne Glasl, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Sammlung Grafik/Gemälde des Münchner Stadtmuseums, reisen wir zurück in die Anfangszeit der Globalisierung. Als der Ausbau der Handelsrouten den Import von Waren aus dem sogenannten Orient massiv vorantrieb, wurden exotische Produkte, Reiseberichte sowie Fotografien und Illustrationen fremder Länder auch für das Bürgertum zugänglich. Die Sehnsucht nach der Ferne wuchs – und sie wurde von einem kolonialistischen Weltbild geprägt: Europäer betrachteten sich als überlegen gegenüber den Völkern ihrer Kolonien. Diese Denkweise hat tiefe Spuren hinterlassen, die bis heute nachwirken – wie der Historiker und Kolonialforscher Dr. Tim Todzi von der Universität Hamburg erklärt.

Trailer: Zeitschleifen. Wiesn rewind
Tradition oder Mythos? In unserer neuen Staffel "Zeitschleifen. Wiesn rewind" tauchen wir mit euch ein in über 200 Jahre Oktoberfestgeschichte – mit zahlreichen Überraschungen, Wendungen und unbekannten Geschichten. "Zeitschleifen. Wiesn rewind" -- überall, wo es Podcasts gibt. Seit über 200 Jahren feiert München im Spätsommer das größte Volksfest der Welt: die Wiesn. Mit Millionen Besucher*innen, Tracht, Bier, Brathendl – und dem Gefühl, Teil einer bayerischen Tradition zu sein. Aber Moment mal: War das Oktoberfest wirklich schon immer so, wie wir es heute kennen? Oder steckt hinter der angeblich uralten Tradition ein ganz anderer Anfang? Die Antworten findet ihr in der neuen Staffel von "Zeitschleifen. Wiesn rewind", dem Podcast des Münchner Stadtmuseums.
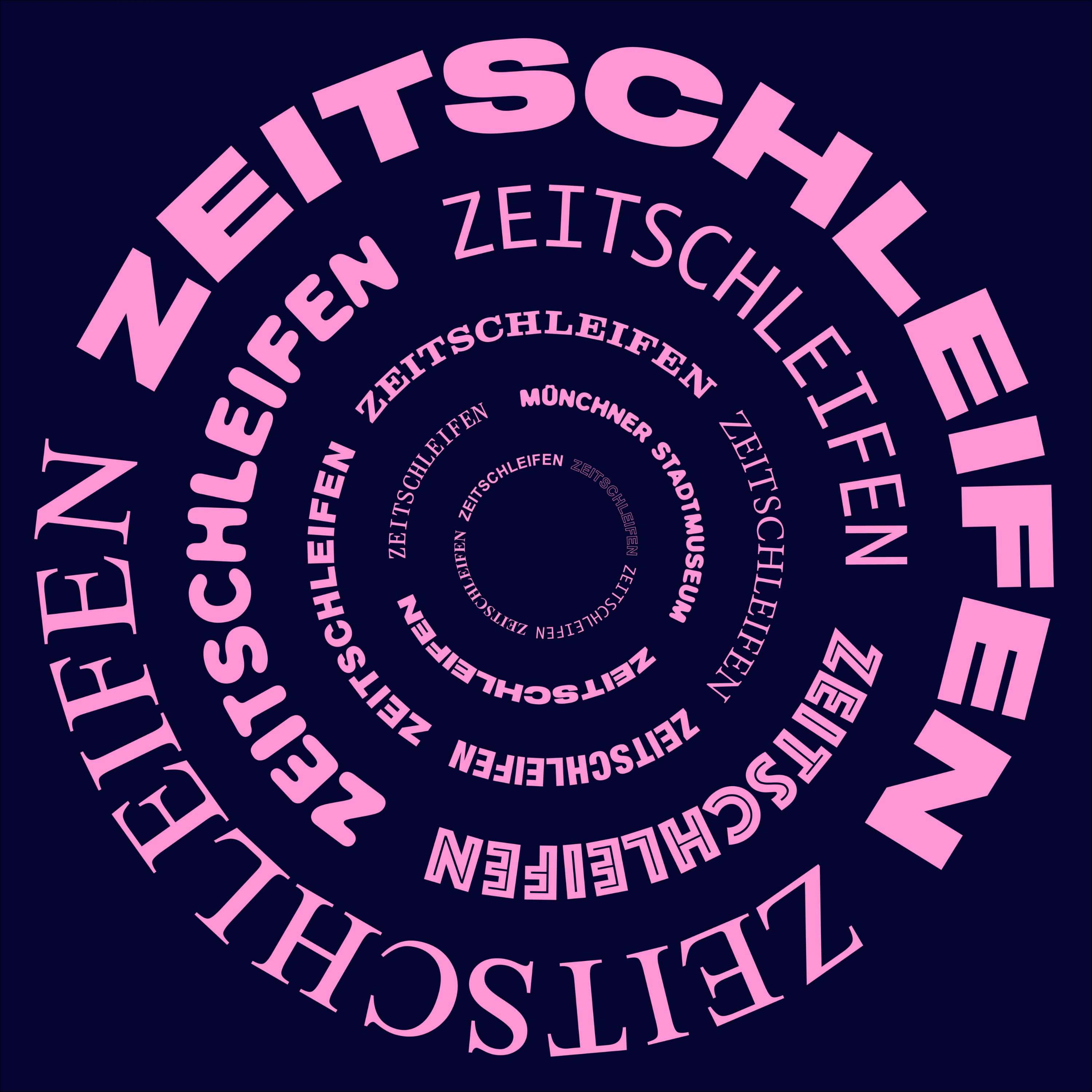
Tradition oder Trend? Tracht auf dem Oktoberfest
Wer heutzutage auf die Wiesn geht, tut das meist in Dirndl oder Lederhosen – so wie fast alle anderen Wiesnbesucher*innen. Denn Oktoberfest und Tracht, das sind zwei Dinge, die traditionell schon immer miteinander verbunden sind. Oder? Die Tracht erlebt derzeit ein Revival, aber so allgegenwärtig wie heutzutage war sie noch nie. Zusammen mit Dr. Isabella Belting, Leitung der Sammlung Mode/Textilien des Münchner Stadtmuseums, finden wir heraus, wer die Tracht auf die Wiesn gebracht hat, warum sie lange Zeit verpönt war, was die Jugend stattdessen getragen hat und welches Großevent dazu beigetragen hat, das Dirndl wieder salonfähig zu machen. Kulturwissenschaftlerin Dr. Simone Egger erklärt, was Tracht mit Heimatverbundenheit zu tun hat und ob sie auf der Wiesn jede*r tragen darf.
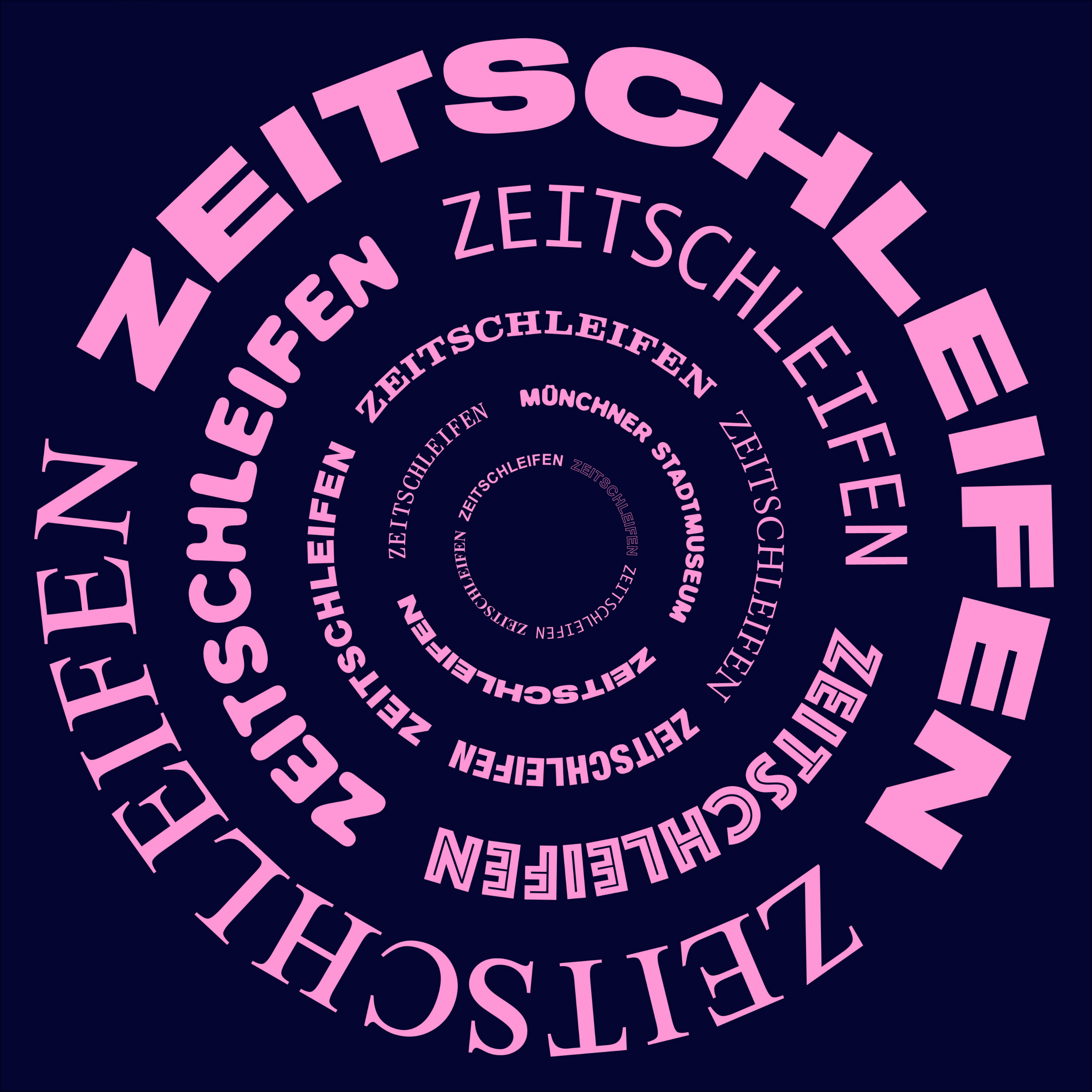
Witzig! Spaß, Humor und der kontrollierte Kontrollverlust auf dem Oktoberfest
Ob Geisterbahn fahren, Zuckerwatte essen oder im Bierzelt tanzen – die Wiesn soll vor allen Dingen Spaß machen. Das war früher so und ist es auch heute noch. Aber was bringt uns eigentlich zum Lachen – und ist das für alle das Gleiche? Zusammen mit Mascha Erbelding, Leitung der Sammlung Puppentheater/Schaustellerei, tauchen wir ein in die faszinierende Welt der historischen Wiesn-Attraktionen – vom legendären Schichtl-Zaubertheater über das rasante Teufelsrad bis hin zu originellen Scherzfotografien, die schon im 19. Jahrhundert für Lacher sorgten. Die Folge beleuchtet, wie sich Attraktionen und Unterhaltung in der langen Geschichte des Oktoberfestes verändert haben – aber auch, welche Traditionen bis heute geblieben sind. Dabei kommt die Frage auf: Was ist witzig und wo hört der Spaß auf? Prof. Dr. Uwe Wirth erklärt, wie Humor funktioniert und warum auf der Wiesn andere Regeln gelten als im Alltag.
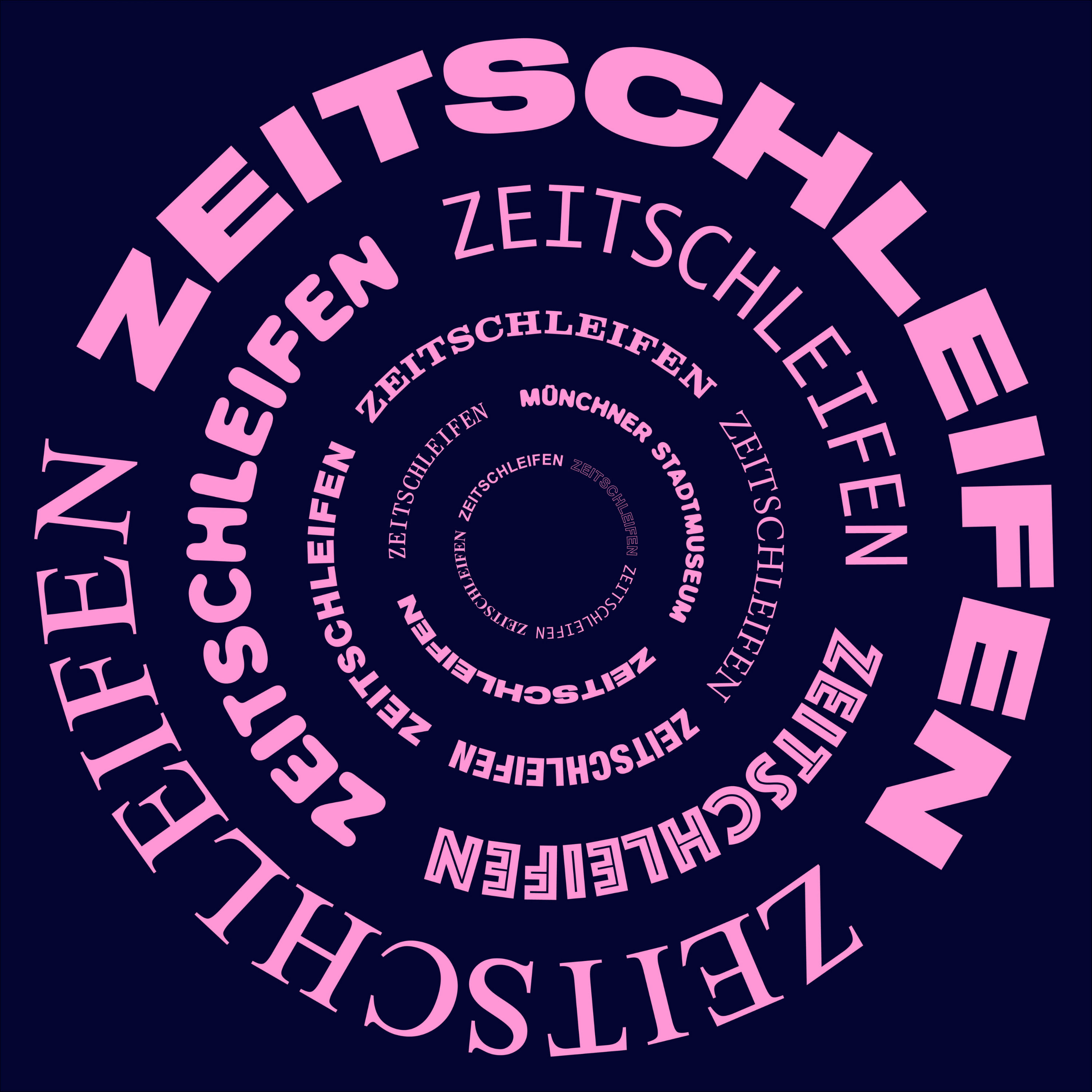
Wer feiert mit? Die Welt zu Gast auf dem Oktoberfest
"Auf eine friedliche Wiesn!" – das sind jedes Jahr die Worte des Münchner Oberbürgermeisters, wenn er das Oktoberfest durch das Anstechen des ersten Bierfasses eröffnet. Jeden Herbst strömen Millionen Menschen aus der ganzen Welt auf die Festwiese in München. Aber wie weltoffen kann ein Fest, das sich Tradition auf die Fahnen schreibt, wirklich sein – und gibt es auch Schattenseiten? Dr. Simon Goeke, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Sammlung Stadtkultur des Münchner Stadtmuseums, gibt Einblick in die Entstehungszeit des Oktoberfests, in der viele unterschiedliche Bevölkerungsgruppen geeint werden sollten. Schafft aber die Identifizierung mit einer Gruppe automatisch auch "das Andere"? Wir blicken zurück in eine Zeit, in der das „Andere“ auf dem Oktoberfest präsentiert wurde – und die auch noch gar nicht so lange vergangen ist, wie man glauben könnte. Kulturwissenschaftlerin Dr. Simone Egger erklärt, weshalb das Oktoberfest und bayerische Tradition auch international so anschlussfähig sind.
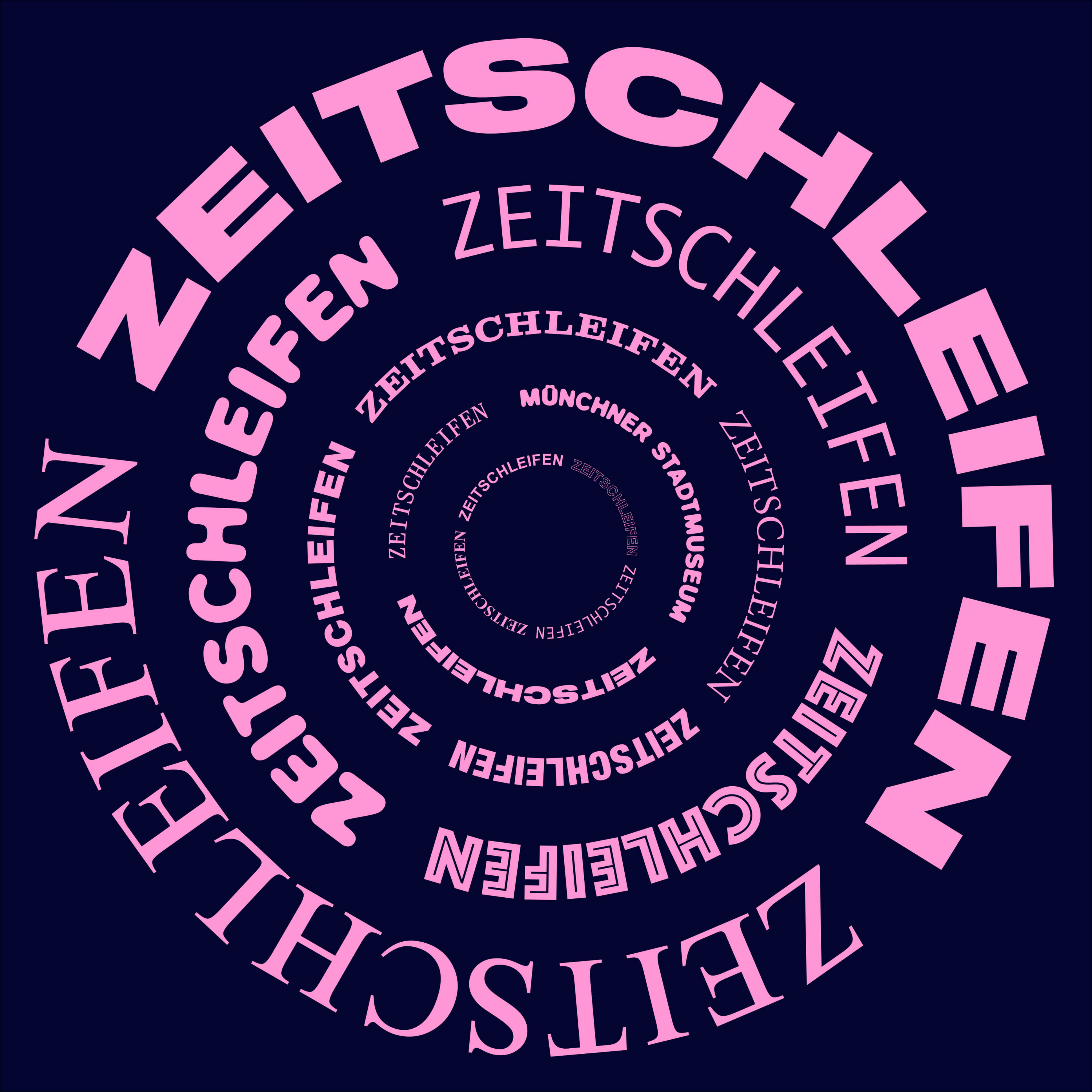
Erstaunlich! Innovation und Tradition auf dem Oktoberfest
Um die neusten Wunder der Technik zu bestaunen und sich weiterzubilden in Themen wie Anatomie, Geografie und Biologie geht man … aufs Oktoberfest? Was uns heute absurd vorkommt, war früher Realität. Die Wiesn hat über die Jahrhunderte viele ihrer Attraktionen bewahrt, aber einige davon sind in Vergessenheit geraten. Dr. Kathrin Schönegg, Leitung der Sammlung Fotografie des Münchner Stadtmuseums, erklärt, welche Funktion Jahrmärkte früher hatten: In einer Zeit, in denen Bildung, Reisen und neue Technik einer reichen Oberschicht vorbehalten waren, waren Jahrmärkte wie das Oktoberfest ein wichtiges Informationsmedium für die breite Masse. Die Präsentation war sogar so aktuell, dass Nutzen oder Gefahren bestimmter Erfindungen noch gar nicht bekannt waren. Weshalb das Konzept der Tradition mittlerweile die größere Rolle spielt und ob wir es hier nicht vielleicht auch mit einer Erfindung zu tun haben, beantwortet Literaturwissenschaftler Dr. Philip Reich von der Universität Heidelberg.
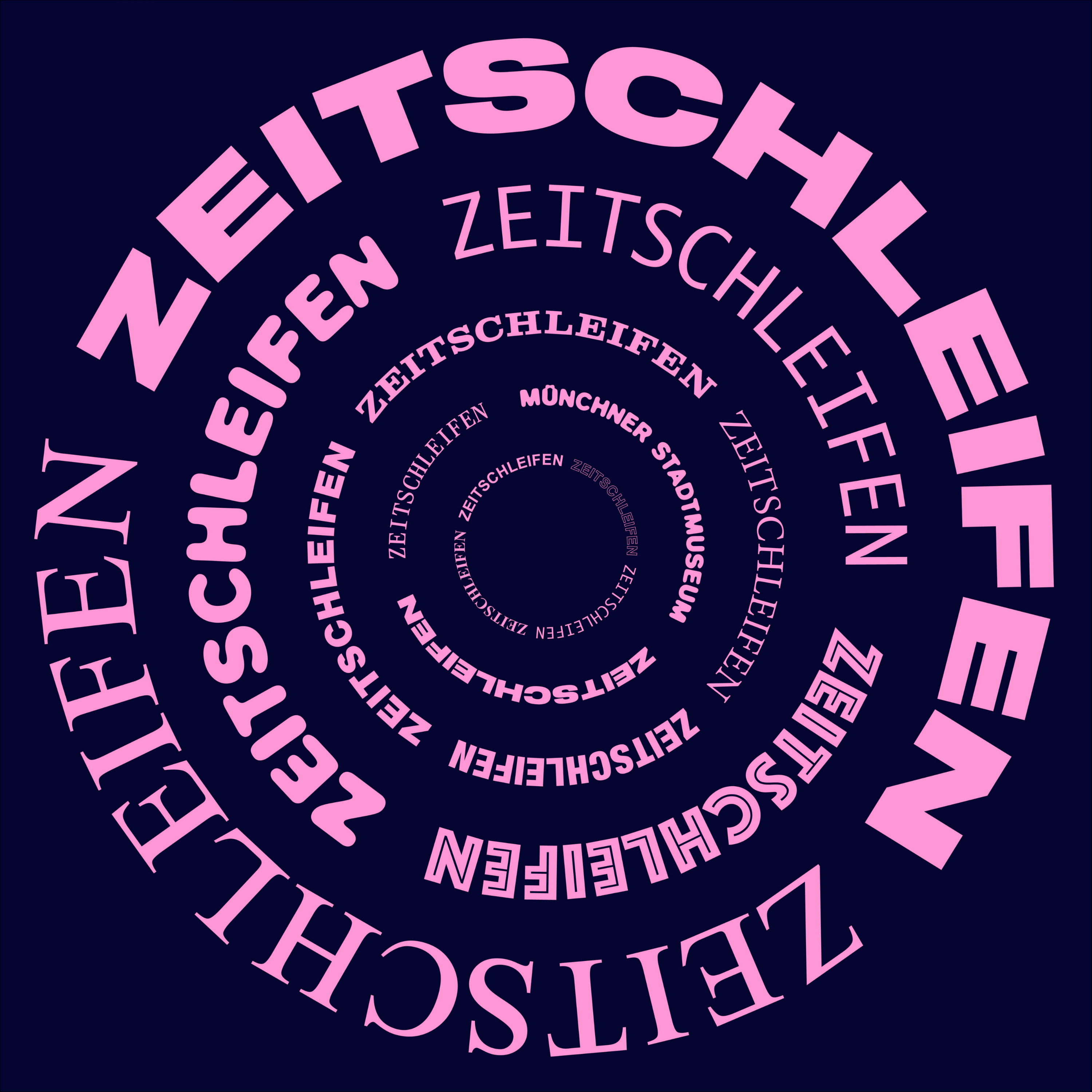
Grüße vom Oktoberfest! Von der Postkarte zum Social Media-Post
Jedes Jahr im Spätsommer ist das Oktoberfest in aller Munde und flutet sämtliche Social Media-Feeds. Dabei war nur, wer auch dazu postet. Kann es sein, dass das auch um 1900 schon galt, als es zwar noch keine Posts gab, dafür aber – ganz klassisch – Post? Dr. Marius Wittke, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Münchner Stadtmuseums, gibt einen Einblick in die Zeit, als die Post- und Grußkarte ein simples, günstiges und vor allem schnelles Mittel der Kommunikation war. Denn in ihrer Blütezeit wurde die Post in München täglich bis zu neun Mal zugestellt! Wie hat sich das Oktoberfest das neue Massenmedium zu Nutze gemacht, welche Motive erfreuten sich der größten Beliebtheit und wie groß ist der Unterschied zur heutigen Zeit wirklich? Im Gespräch mit der Humangeografin Dr. Elisabeth Sommerlad geht es um die mediale Inszenierung der Wiesn, sei es durch die Jahrmarktsfotografie um 1900 oder den heutigen "Instagram Gaze". Und formt Social Media, wie wir das Oktoberfest wahrnehmen und feiern?
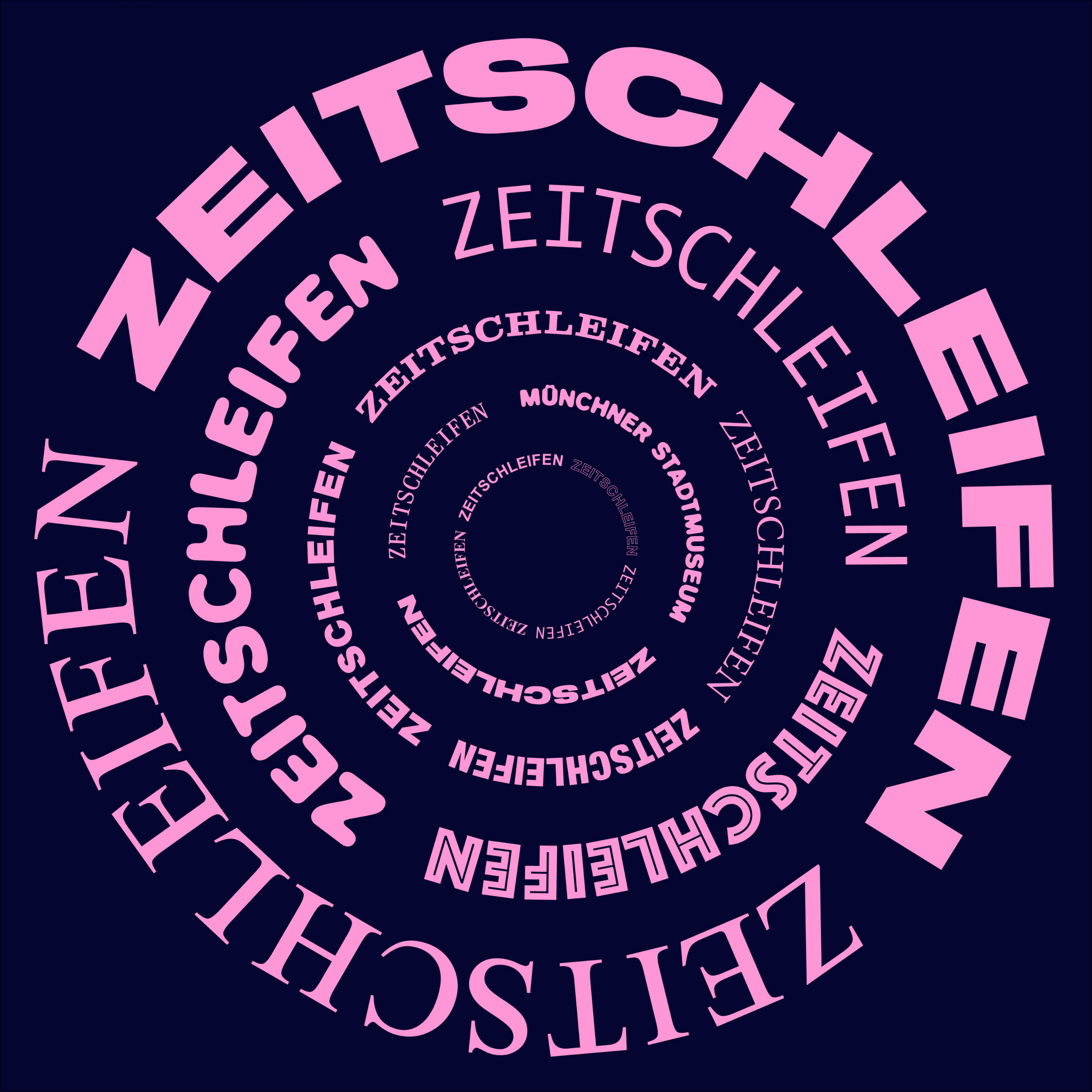
Feiern als gäbe es kein Morgen? Nachhaltigkeit und das Oktoberfest
Das Oktoberfest ist ein Fest der Superlative: fast sieben Millionen Besucher*innen, sieben Millionen ausgeschenkte Maß Bier, Tonnen an verzehrten Brathendln – und damit auch Haufen an Müll und ein enorm hoher Energieverbrauch. Doch 16 Tage Feiern und Spaß sind kein Freifahrtschein, um alle guten Vorsätze in Sachen Nachhaltigkeit über Bord zu werfen. Wie nachhaltig könnte das größte Volksfest der Welt eigentlich sein und werden? Und wo sind die Stellschrauben? Dr. Nana Koschnick, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Sammlung Stadtkultur des Münchner Stadtmuseums, bringt das Thema auf den Punkt: Das Oktoberfest ist wie ein Brennglas für die Stadt, denn hier werden gesellschaftliche Entwicklungen besonders sichtbar. Sie zeigt, wie sich die Wiesn in den letzten Jahrhunderten entwickelt hat. Während Besucher*innen im 19. Jahrhundert eigene Bierkrüge dabei hatten, stehen wir heute vor Bergen von Glasbruch und der Frage: Wie kann die Wiesn bis 2028 klimaneutral werden?