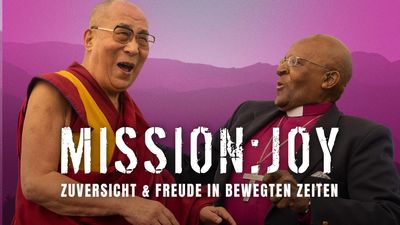Himmel & Erdung: Spirituell leben in der Netzzeit (RefLab)
Der Podcast für eine Spiritualität, die Himmel und Erde in Berührung bringt; Host: Johanna Di Blasi. Ich spreche mit meinen Gästen darüber, wie wir in der digitalen Gegenwart spirituell leben können – zeitgemäss, Offline wie auch Online.
Alle Folgen
Wozu freie Rituale? Jürg Fassbind
Ich bin Jürg Fassbind in einem spirituellen Zentrum begegnet. Wir stellten fest, dass uns das Interesse an Meditation, neuen spirituellen Formen und die Aufgeschlossenheit gegenüber christlicher Mystik verbindet. Das aktuelle Buch «Rituale in Teams und Organisationen. Innehalten – Verbinden – Transformieren» des Organisationsberaters und Ritualfachmanns nahm ich als Anlass für ein Gespräch, das ihr hier als Podcast nachhören könnt. Jürg Fassbind stellt fest, dass heute viele Menschen, aber auch Organisationen von Veränderung zu Veränderung stolpern: «Die Menschen arbeiten in virtuellen Räumen, sind eigentlich gar nicht mehr im Alltag fix miteinander in Kontakt. Und das kann wirklich dazu führen, dass man sich nicht mehr wirklich orientieren kann im Alltag. Und dass man vor lauter Veränderung gar nicht mehr weiss, wo man steht.» Freie Rituale sind ein neues kreatives Feld. Ein Höhepunkt des Austausches für mich war, als mir der Ritualexperte erklärt, welche Rituale Kirchen helfen könnten. Kirchen und Glaubensgemeinschaften sehen sich traditionell als Begleiter von Trauerprozessen. Angesichts von Mitgliederschwund brauchen sie aber selbst Trost. Der freie Ritualexperte meint, Kirchen müssten vielleicht eine Weile die Leere aushalten, anstatt sie mit Aktivismus und Innovationen zu füllen. Fünf Himmel und Erdung Einsichten aus dem Gespräch mit Jürg Fassbind: 1. Rituale sind bewusste Übergänge – keine Automatismen. Ein Ritual braucht Aufmerksamkeit. Es hebt das Alltägliche für einen Moment heraus. So wird das Fensteröffnen zur Begrüssung des Tages. 2. Freie Rituale entstehen, wenn alte Formen verblassen. Sie holen das Heilige ins Leben von Menschen ohne festen Glaubensbezug. Manchmal sind sie aber auch der Anfang von Glauben, wenn man darunter tiefes Vertrauen versteht. 3. Innehalten ist eine soziale Technik. Rituale lassen nicht aus dem Alltag flüchten, sie unterbrechen ihn. Sie schaffen Orientierung, holen das Ich zurück ins Wir, machen Wandel spürbar und Zeit erfahrbar. In Organisationen sind sie ein Gegengewicht zur Dauerbeschleunigung. 4. Wachstum verläuft zyklisch. Das Lebensrad symbolisiert: Auf Frühling und Sommer folgen Herbst und Winter. Nur wer loslässt, kann neu beginnen. Rituale helfen, dieses Werden und Vergehen zu würdigen – im Leben wie bei der Arbeit. 5. Rituale erfordern Verantwortung. Sie können verbinden oder ausschliessen, heilen oder vereinnahmen. Ein achtsames Ritual öffnet, statt zu kontrollieren. Seine Kraft liegt in der Haltung, nicht in der Form. Zu meinem Gast: Jürg Fassbind ist systemischer Organisationsberater, Coach und Ritualfachmann mit eigener Praxis in Bern, Schweiz. Sein Arbeitsschwerpunkt liegt in der Begleitung von Menschen und Organisationen in Veränderungsprozessen und Übergängen. Er ist Lehrbeauftragter an der Berner Fachhochschule für Soziale Arbeit und Dozent an der Fachschule für Rituale.

Niklaus Brantschen: Um Himmels willen Schamanismus (Podcast-Festival)
«Himmel & Erdung» Ein Relaunch war fällig! Zum Auftakt ein Gespräch mit Niklaus Brantschen über Schamanismus und darüber, wie wir den Himmel als Erde unter die Fingernägel bekommen. Das Gespräch mit Niklaus Brantschen über sein neues Buch «Du bist die Welt. Schamanischer Weisheit auf der Spur» bildet den Auftakt meines Podcasts «Himmel & Erdung». Die Aufnahme, die ihr nun hören könnt, ist ergänzt um Bonusmaterial; Informationen, die in der Dynamik der Live-Veranstaltung im Rahmen des zweiten RefLab-Podcastfestivals im Theater Millers in Zürich keinen Raum hatten. In «Himmel & Erdung» möchte ich mit meinen Gästen herausfinden, wie wir in der digitalen Gegenwart spirituell leben können, zeitgemäss, Off- wie auch Online. Die «TheoLounge»-Folgen mit Gästen wie Peter Sloterdijk, Linda Woodhead oder Anselm Grün bleiben in meinem Kanal erhalten. Niklaus Brantschen sagte während unserer Live-Veranstaltung spontan einen Satz, den ich als Leitsatz für meinen Podcast «Himmel & Erdung» mitnehme: 🍀 «Wenn du es schaffst, den Himmel unter die Fingernägel zu bekommen, als Erde, als dreckige Erde, dann ist es gut.» Fünf Himmel-und-Erdung-Einsichten aus dem Gespräch mit Niklaus Brantschen. 1. Den Himmel unter die Fingernägel bekommen Spiritualität ohne Erde bleibt eine Luftnummer. Erst wenn Spiritualität den Alltag durchdringt, wird’s echt. 2. Vorreligiöse Wurzeln statt Etikettenkrieg Schamanisch ist weniger Kostüm als Grundhaltung: Verbundenheit, Respekt, Achtsamkeit. Keine Pose, sondern Praxis. 3. Weisheit schmeckt Wahrheit erweist sich auch im Sinnlichen. Fasten, Atmen, Schmecken, Riechen – Erkenntnis wird auch gekaut und verdaut. 4. Heilen als Prüfstein Religion, die nicht heilt, macht sich überflüssig. Mitgefühl ist kein Bonus, sondern der Test. 5. Ökologie als Mit-Leid Mein Schrei und der Schrei der Erde sind eins. Ökologie heisst: Mitleiden, Rituale neu deuten, Zukunft anders einrichten.

Franziska Bark Hagen: Pilger dich glücklich!
Kaum etwas stellt eine grössere Unterbrechung vom Alltag dar, als loszulaufen und sich auf Pilgerschaft zu begeben. Wer es extrem möchte, lässt sogar das Smartphone daheim. In dieser Episode des Podcast «Himmel und Erde – Spirituell leben in der Jetztzeit» (vormals «TheoLounge») trifft Johanna Di Blasi aus dem RefLab Franziska Bark Hagen, Pilger-Pfarrerin in Zürich. Es geht um die Frage, was Pilgern heute bedeutet, warum es Menschen so tief bewegt und wie es sich von blossem Wandern unterscheidet. Ob schweigend im Regen, in einer Pilgergemeinschaft oder sogar in einer digitalen Form: Pilgern lädt ein, die Schöpfung tiefer zu erleben und das Leben als spirituelle Reise zu verstehen. Vielleicht ist es gerade das, was Pilgern so aktuell macht: Es verbindet Himmel und Erde, Spiritualität und Alltag, Bewegung und innere Wandlung. Wer schon länger nicht mehr gepilgert ist oder sich neu interessiert, wird zudem feststellen, dass Pilgern ein erstaunlich innovatives Feld ist. Es gibt Stadtpilgern, Sternenwanderungen und sogar Wohnzimmerpilgern oder Cyber Pilgrimage. Fast immer stellen Menschen fest, dass sie beim Pilgern mehr finden als sie gesucht haben. Das Pilgerzentrum St. Jakob in Zürich leistete übrigens Pionierarbeit. Kommendes Jahr feiert es 30-jähriges Bestehen! Fünf Himmel-und-Erdung-Einsichten aus dem Gespräch mit der Pilgerpfarrerin Franziska Bark Hagen 1. Schweigen ist ein entscheidender Faktor beim Pilgern. Baue an Pilgertagen zumindest kleinere Stilleeinheiten ein (je 20-30 Minuten). 2. Auch Regentage sind Pilgertage. Es kann sogar besonders schön sein, sich in einer Regenhülle durch die Natur zu bewegen. 3. Man muss nicht topfit sein. Im Gegenteil: Selbst Menschen mit Krebsdiagnose profitieren vom gemeinschaftlichen Pilgern. 4. Es kommt nicht auf die Länge des Weges an, sondern auf die innere Haltung. 5. Auch unser Leben ist eine Pilgerreise - und die Bibel eine Art Road-Movie. Und die Wüste, durch die wir manchmal ziehen, wirkt karg, aber ist gleichzeitig ein faszinierender Möglichkeitsraum.
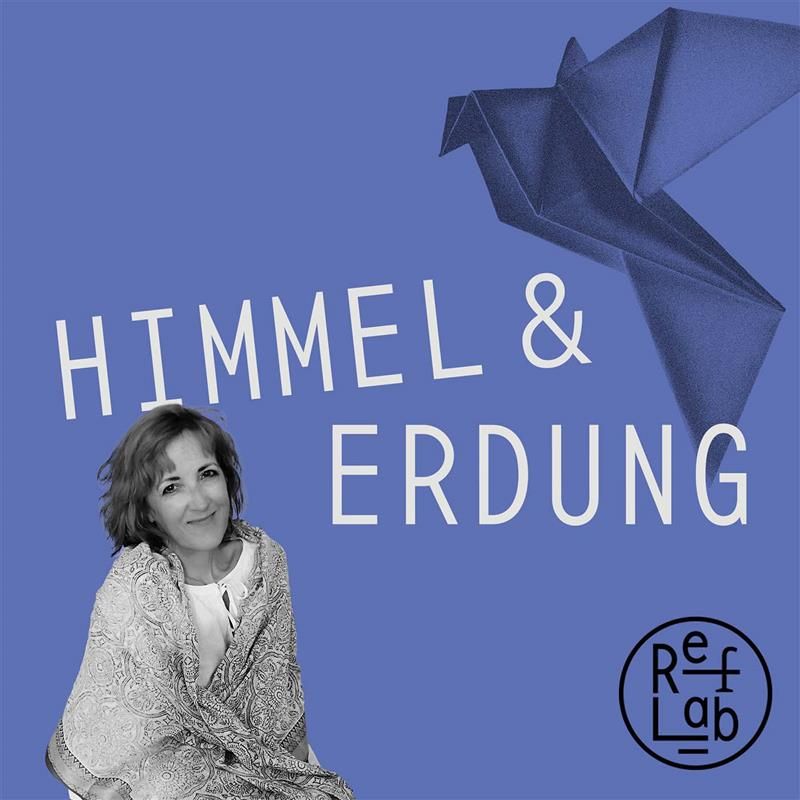
Wolfgang M. Schmitt: Apokalypse auf Repeat (Podcast-Festival)
Apokalyptische Filme und Serien sind längst kein Nischenphänomen mehr – die Leinwand liebt den Untergang. Manuel Schmid und Wolfgang M. Schmitt sprechen in dieser Sonderfolge der «TheoLounge» über Katastrophenkino, neoliberale Heldenmythen und die Frage, ob die biblische Apokalypse nicht viel hoffnungsvoller ist als Netflix & Co. Von Klimakatastrophe bis Zombievirus: Das 21. Jahrhundert bringt eine wahre Flut apokalyptischer Bilder hervor – ob The Day After Tomorrow, Mad Max: Fury Road, The Last of Us oder Don’t Look Up. Wolfgang M. Schmitt und Manuel Schmid diskutieren in dieser Live-Aufnahme vom RefLab-Podcast-Festival, warum wir uns immer wieder freiwillig den Untergang anschauen – und dabei fast erleichtert sind, dass es im Kino oder auf Netflix passiert. Sie sprechen über den Reiz, Ängste in sicherer Umgebung durchzuspielen, und über die trügerische Beruhigung, die viele Endzeit-Erzählungen bieten: Am Ende gibt’s fast immer eine Arche, eine Rettung, einen Neuanfang. Doch zugleich verweisen die Filme auf verdrängte Realitäten – vom Klimawandel bis zu politischen Abgründen – und verschieben Schuldfragen geschickt auf individuelle Heldenfiguren, während systemische Ursachen ausgeblendet bleiben. Manuel bringt die biblische Perspektive ein: In der Offenbarung des Johannes geht es nicht um Eskapismus, sondern um das Entlarven zerstörerischer Mächte und die Hoffnung, dass Gottes Gerechtigkeit und Liebe das letzte Wort behalten. Wolfgang kontert mit seiner Skepsis gegenüber «grosser Hoffnung» – und beide fragen: Was bleibt, wenn Apokalypse in der Popkultur zum Dauerzustand geworden ist? Eine Folge über Popcornkino und Prophetie, über mediale Muster und messianische Motive – und darüber, warum der Weltuntergang auf Repeat läuft, wir aber immer noch auf ein Happy End hoffen... Zum Gesprächsgast: Wolfgang M. Schmitt: Der wohl schickste Podcaster Deutschlands analysiert die Welt mit einer Mischung aus messerscharfer Gesellschaftskritik und einer Vorliebe für Hochkultur, die selbst Thomas Mann erröten liesse. Bekannt wurde er mit seinem YouTube-Kanal und Podcast «Die Filmanalyse», wo er Blockbuster zerlegt und cineastische Glücksfunde würdigt. Doch Schmitt kann mehr als nur Filme dekodieren. Mit Ole Nymoen betreibt er den Podcast «Wohlstand für alle», in dem sie den Kapitalismus in all seinen absurden Facetten sezieren – und dabei oft genug erklären, warum der Markt eben doch nicht alles regelt (ausser vielleicht die Profite der Grosskonzerne). Und weil das 21. Jahrhundert auch sonst genügend Widersprüche und Unübersichtlichkeiten bietet, beleuchtet er im Podcastformat «Die neuen Zwanziger» mit einem ironisch geschulten Blick unsere Gegenwart und Zukunft.

Linda Woodhead: Wie Spiritualität Mainstream wurde – und Christsein erklärungsbedürftig
Willkommen bei einer weiteren Episode des Podcasts TheoLounge. Dieser wird im Herbst übrigens unter dem Namen «Himmel und Erdung» weiterlaufen: mit Ausrichtung auf Neue Mystik, spirituelle Innovation und Interspiritualität. Das folgende Gespräch mit der spannenden britischen Spiritualitätsforscherin Linda Woodhead ist eine Übernahme aus dem von Luca Di Blasi geleiteten Postsecular Lab der Universität Bern. Hier nehmen Studierende mit Expert:innen Podcasts zu Fragen des Postsäkularismus auf (die dritte Staffel beschäftigt sich mit Israel und Palästina aus postsäkularer Perspektive). Ich danke Lisa Bey und Laura Kuhn. Der Podcast ist ausnahmsweise auf Englisch. The following conversation with Linda Woodhead is taken from the Postsecular Lab. Woodhead explains how spirituality has evolved from a marginalized position to become mainstream in today’s Western world - and how this development is now challenging Christianity.
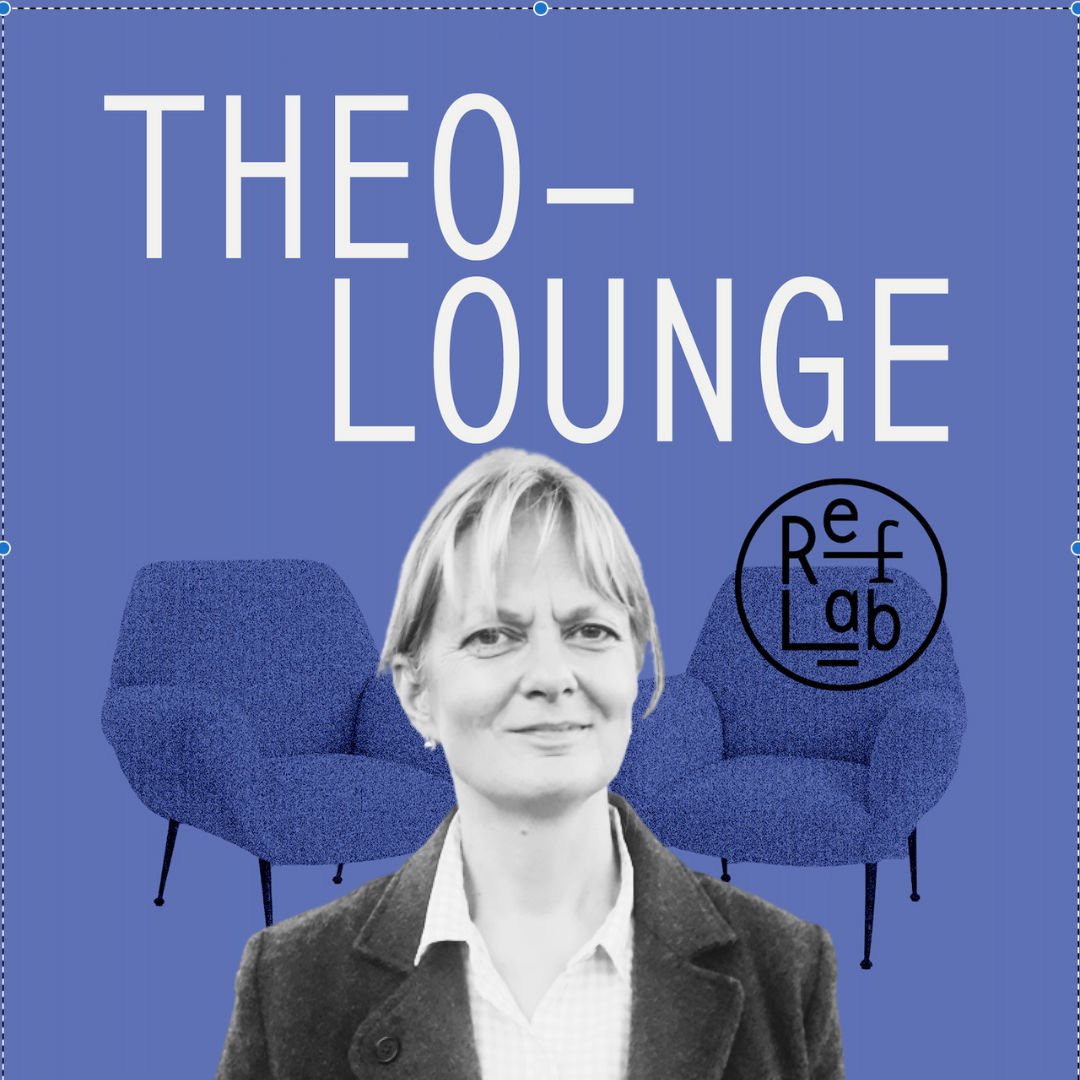
Schweizer und Sufi: Im Gespräch mit Imam Peter Cunz
«Jenseits der Vorstellungen von richtig und falsch liegt ein Ort, dort werde ich dich treffen.» Diesen vielschichtigen Satz aus einem Gedicht des Mystikers Dschalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī – kurz Rumi – habe ich bei meinem Eintritt ins RefLab als Leitspruch gewählt. Nun habe ich die Gelegenheit ergriffen, einen Sufi und Imam zu Rumi zu befragen: Peter Hüseyin Cunz. Cunz ist Scheich des Sufi-Ordens Mevlana. Seit 1999 trägt er diesen Ehrentitel, der ihn als Lehrbevollmächtigter des Ordens ausweist, der auf Rumi zurückgeht. Cunz lebte den Sufismus auch in seinem beruflichen Alltag: nicht indem er davon redete, sondern in einer Praxis der Menschenfreundlichkeit. Sitzungen lassen sich für alle angenehmer gestalten, wenn ein nachsichtig-liebevoller Geist herrscht. Als an der ETH Zürich ausgebildeter Elektroingenieur war Cunz vor seiner Pensionierung als Experte für Internationales beim schweizerischen Bundesamt für Energie tätig – und kam in dieser Funktion viel in der Welt herum. Von Schweizer Medien wird er angefragt, wenn es um Stellungnahmen zum Islam geht, auch zum Islamismus. Oder aber wenn über den spektakulären Drehtanz der Derwische berichtet wird. Cunz praktiziert diese anspruchsvolle Meditationsform bis heute. Als spiritueller Lehrer weist er andere in die islamische Mystik ein. Im Podcastgespräch gibt er Einblicke in seine überaus spannende Biografie und erzählt auch von der Herausforderung als Schweizer und Muslim, der den Islam verteidigt, nicht aber den Fundamentalismus. Übrigens: Beim 2. RefLab-Podcastfestival «Alles wird gut» am 6. und 7. September 2025 in Zürich, mit vielen tollen Gästen (von den Pfarrerstöchtern über Olivia Röllin bis zu Wolfgang M. Schmitt), kannst du an geführten Meditationen des Netzklosters teilnehmen. Mein Gast beim Festival ist der Jesuit, Zen-Meister und Bestsellerautor Niklaus Brantschen. Wir unterhalten uns über sein jüngstes Buch: «Du bist die Welt. Schamanischer Weisheit auf der Spur» Sichere dir Karten! Mein Podcast «TheoLounge» wird ab Herbst mit neuem Namen weiterlaufen: «Himmel und Erdung. Spirituell leben in der NetzZeit». Musik im Podcast, Ottoman Taksim Music, Pixabay

Digitales Kloster, geht das? – Einblicke ins Netzkloster
«Ich hole noch schnell mein Netzkabel!». Das Netzkloster ist eine Erfahrung der anderen Art. Es braucht nicht viel: Eine geeignete Sitzunterlage, eine Kerze, Earbuds, eine Zoom-Verbindung und Freude an Kontemplation. Gerahmt von kurzen Sätzen aus der mystischen und spirituellen Literatur gehen im Netzkloster meditionsfreudige Menschen – Junge und Ältere – gemeinsam in die Stille. Nur einen Klick entfernt: 30 Minuten dauern allmorgendliche, mittägliche und abendliche Zusammenkünfte (Silene, Sext, Vigilia, die täglich abgehalten werden. 25 Minuten davon werden in kompletter Stille mit meist geschlossenen Augen verbracht. Wieso machen Menschen das? Und was macht es mit ihnen? Im Podcast-Gespräch mit Johanna Di Blasi geben der Netzabt Simon Weinrich (Zürich) und die Netzäbtissin Sarah Dochhan (Bremen) Einblicke in ein besonderes und einzigartiges Kloster Projekt. Klosterleben 100 Prozent digital. Oder fast 100 Prozent. Einmal pro Jahr treffen sich die Netzschwester und -Brüder im analogen Raum. Sarah Dochhan ist Netz-Äbtissin, Theologin, Soziologin und Lehrerin für Meditation, Körperarbeit und Yoga. Sie lebt in Bremen. Simon Weinreich ist Netz-Abt und hauptberuflich reformierter Pfarrer. Im Netzkloster wird eine integrale Spiritualität gepflegt – christliche Gebete finden ebenso Raum wie Elemente asiatischer Spiritualität (Yoga, Klangschale). Motto: «gemeinsam.online.meditieren»

Macht KI uns alle zu Künstlern? – Adrian Notz
Stehen wir am Anfang einer neuen künstlerischen Revolution? Oder am Ende der Kreativität, wie wir sie kennen? Möglicherweise trifft beides zu. Künstliche Intelligenz verändert jedenfalls grundlegend, wie Kunst geschaffen und erlebt wird. Sie verändert auch die Art und Weise, wie wir uns selbst sehen. Durch generative KI-Anwendungen wie ChatGPT, Midjourney oder DALL-E können heute viel mehr Menschen mit kreativen Prozessen experimentieren, neue Bildsprachen entwickeln und bislang unvorstellbare Formen der Kreativität erschliessen. Partner oder Konkurrent? KI-Tools agieren dabei nicht nur als Werkzeuge, sondern zunehmend als Partner in kreativen Prozessen. Sie ermöglichen «Artificial Augmented Creativity», wie Adrian Notz es ausdrückt, also eine künstlich erweiterte und intensivierte Kreativität. Adrian Notz widmete sich den aktuellen Umbrüchen und daraus erwachsenden künstlerischen und gesellschaftlichen Fragen als Kurator KI + Kunst am AI Center der ETH Zürich. (Hier ein spannender Beitrag von ihm im Zukunftsblog der ETH). Im Podcast-Gespräch mit RefLab erinnert der frühere Direktor des Cabaret Voltaire in Zürich daran, dass die Debatte nicht neu ist. Schon die Avantgarde des frühen 20. Jahrhunderts sah sich mit einer umwälzenden Technologie konfrontiert: der Fotografie. Neue Götter Realistisches Abbilden übernahm die Fotografie, während sich die Kunst damals neue Felder erschloss, beispielsweise die Abstraktion. Es wird spannend zu beobachten sein, in welche Richtung sich die Kunst in näherer Zukunft entwickelt. Welche neuen Felder wird sie sich erschliessen, wenn textgenerierende und bildgebende Verfahren auf immer effizientere KI-Werkzeuge ausgelagert werden? Es ist nicht nur mit ästhetischen Umwälzungen zu rechnen. Der schöpferischen KI sprechen manche spirituelle Qualitäten zu und dem für User:innen undurchschauberen Wirkweisen der Algorithmen Gottähnlichkeit. Konzeptkunst 2.0 Adrian Notz betont, dass es gegenwärtig zwar eine Demokratisierung der Kreativität gibt, die Bedeutung der künstlerischen Autorschaft aber eher zunimmt: Die Idee, das Konzept und die bewusste Auswahl der Mittel werden wichtiger, während das handwerkliche Können weiter in den Hintergrund tritt. Die blosse Nutzung von KI mache noch niemanden automatisch zur Künstlerin oder zum Künstler – entscheidend bleibe die kreative Intention und der kritische Umgang mit den neuen Möglichkeiten. Dazu gehört auch ein Bewusstsein um die erheblichen sozialen und ökologischen Kosten neuer Technologien – und daraus resultierend ein sinn- und massvoller Einsatz Künstlicher Intelligenz. Adrian Notz ist freischaffender Kurator an der Schnittstelle von Kunst, Wissenschaft & Aktivismus. Von 2007 bis 2019 war er Direktor des Cabaret Voltaire in Zürich. Bis vor kurzem war er Kurator KI + Kunst am AI Center der ETH. AI Center der ETH Zürich: Die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich ist eine der weltweit führenden Techno-Avantgardeschmieden. Es wird auch vom MIT Europas gesprochen. Mit dem AI Center steht die Hochschule an vorderster Front, wenn es darum geht, Schnittmengen zwischen Technologien und Disziplinen auszuloten. Im Podcastgespräch erwähnte Bücher: • Atlas of Anomalous AI, hg. von Ben Vickers und Kenric McDowell, 2021 • Masahiro Mori, The Buddha in the Robot, 1989 Musik im Podcast: dreamytech, penguinmusic, pixabay; Werbeeinspieler: Sweep Sound Effect und Mystical Wind Chimes von Pixabay Foto: JOE Planas bei Unsplash

Traumata schreien sich an! Jürg Bräker über Friedensarbeit (Teil 2)
Vor 80 Jahren endete der Zweiter Weltkrieg und ebenfalls vor 80 Jahren wurden die Atombomben abgeworfen. Um das Thema Pazifismus aber ist es merkwürdig still geworden, sogar in vielen Kirchen. Ergibt sich aus meinem Christinsein und spirituell sein nicht sogar zwangsläufig eine pazifistische Grundhaltung? (Mit dem Bergprediger als Leitbild!) Was ändert sich, wenn sich die Bedrohungslage ändert? Und was kann ich vorbringen, wenn mein Pazifismus als vermeintliche Naivität hingestellt wird? Auf diese Fragen habe ich Antworten gesucht und bin dabei auf Jürg Bräker gestossen. Der mennonitische Theologe gehört einer Kirche mit einer 500-jährigen pazifistischen Tradition an. Was er zu vereutlichen versucht: Neben dem derzeit dominierenden Thema der Aufrüstung gibt es ein sehr breites Spekrum an Möglichkeiten der Friedensarbeit: von diplomatischen Mitteln über Strategien der Deeskalation bis hin zu Traumarbeit, um künftigen Eskalationen entgegenzuwirken. Bräker spricht über die Herausforderungen und die Aktualität christlicher Friedensarbeit – insbesondere in einer Zeit, in der Pazifismus kaum noch öffentlich diskutiert wird. Gewaltfreiheit, aber nicht Martyrium Im Zentrum steht die Erfahrung, dass Frieden nicht einfach gehalten, sondern immer wieder neu gesucht und geschaffen werden muss, erklärt er. Friedensarbeit bedeutet, sich mutig zwischen die Fronten zu stellen, zuzuhören, Schuld anzuerkennen und aktiv an Gerechtigkeit zu arbeiten – auch wenn dies zunächst Konflikte verschärfen kann. «Wenn wir über Frieden reden, müssen wir über Gerechtigkeit reden», betont Bräker. Über Frieden zu reden, heisst auch, über Gerechtigkeit und die tieferen Ursachen von Gewalt zu sprechen. Täuferisches Friedenswissen setzt auf gewaltfreie Konfliktbearbeitung und die Bereitschaft, Schuld und Unrecht – etwa aus kolonialem Erbe – zu benennen. Bräker ruft dazu auf, zivilen Widerstand und internationale Konfliktforschung zu stärken sowie Menschlichkeit auch im Ernstfall zu bewahren. Jürg Bräker ist Europavertreter der Mennonitischen Weltkonferenz und theologischer Mitarbeiter bei der Evangelischen Mennoniten-Gemeinde Bern. Die Mennoniten, hervorgegangen aus der vor genau 500 Jahren in Zürich entstandenen Täuferbewegung, bekennen sich weiterhin zu gewaltfreiem Widerstand. Auch angesichts neuer Kriege wie in der Ukraine oder in anderen Weltregionen. Die Bewegung ringt weltweit mit der Frage, wie Frieden inmitten von Gewalt und Polarisierung praktisch gelebt werden kann. Ihr christliches Friedensengagement ist vorbildlich. Jubiläum 500 Jahre Täufer «Verfolgt, vertrieben, vergessen – 500 Jahre Täufertum im Kanton Zürich» – ist eine Ausstellung in der Zentralbibliothek Zürich, Predigerplatz 33 – noch bis Mitte Juni 2024! Roman über Zürcher Täufer von P. Kamber Der Zürcher Historiker Peter Kamber, bekannt geworden mit der Studie «Reformation als bäuerliche Reformation» hat einen Roman zu den Anfängen der Täufer in Zürich verfasst: «Die himmlischen Versuchungen des Conrad Grebel», Limmat Verlag, Mai 2025. Mit Peter Kamber erschien im Vorjahr eine Episode der TheoLounge: Die Bauern und die Äbtissin. Was geschah vor 500 Jahren in Zürich? Welche Bedeutung kommt der letzten Äbtissin des Fraumünster zu, die 2024 gross gefeiert wird? Und wie war das mit der Täuferbewegung? Music im Podcast: Bass Background Emotin Sounds, NCPrime, Pixabay; Werbeeinspieler: Sweep Sound Effect und Mystical Wind Chimes von Pixabay

Traumata schreien sich an! Jürg Bräker über Friedensarbeit (Teil 1)
Vor 80 Jahren endete der Zweiter Weltkrieg und ebenfalls vor 80 Jahren wurden die Atombomben abgeworfen. Um das Thema Pazifismus aber ist es merkwürdig still geworden, sogar in vielen Kirchen. Ergibt sich aus meinem Christinsein und spirituell sein nicht sogar zwangsläufig eine pazifistische Grundhaltung? (Mit dem Bergprediger als Leitbild!) Was ändert sich, wenn sich die Bedrohungslage ändert? Und was kann ich vorbringen, wenn mein Pazifismus als vermeintliche Naivität hingestellt wird? Auf diese Fragen habe ich Antworten gesucht und bin dabei auf Jürgen Bräker gestossen. Der mennonitische Theologe gehört einer Kirche mit einer 500-jährigen pazifistischen Tradition an. Was er zu vereutlichen versucht: Neben dem derzeit dominierenden Thema der Aufrüstung gibt es ein sehr breites Spekrum an Möglichkeiten der Friedensarbeit: von diplomatischen Mitteln über Strategien der Deeskalation bis hin zu Traumarbeit, um künftigen Eskalationen entgegenzuwirken. Bräker spricht über die Herausforderungen und die Aktualität christlicher Friedensarbeit – insbesondere in einer Zeit, in der Pazifismus kaum noch öffentlich diskutiert wird. Gewaltfreiheit, aber nicht Martyrium Im Zentrum steht die Erfahrung, dass Frieden nicht einfach gehalten, sondern immer wieder neu gesucht und geschaffen werden muss, erklärt er. Friedensarbeit bedeutet, sich mutig zwischen die Fronten zu stellen, zuzuhören, Schuld anzuerkennen und aktiv an Gerechtigkeit zu arbeiten – auch wenn dies zunächst Konflikte verschärfen kann. «Wenn wir über Frieden reden, müssen wir über Gerechtigkeit reden», betont Bräker. Über Frieden zu reden, heisst auch, über Gerechtigkeit und die tieferen Ursachen von Gewalt zu sprechen. Täuferisches Friedenswissen setzt auf gewaltfreie Konfliktbearbeitung und die Bereitschaft, Schuld und Unrecht – etwa aus kolonialem Erbe – zu benennen. Bräker ruft dazu auf, zivilen Widerstand und internationale Konfliktforschung zu stärken sowie Menschlichkeit auch im Ernstfall zu bewahren. Jürg Bräker ist Europavertreter der Mennonitischen Weltkonferenz und theologischer Mitarbeiter bei der Evangelischen Mennoniten-Gemeinde Bern. Die Mennoniten, hervorgegangen aus der vor genau 500 Jahren in Zürich entstandenen Täuferbewegung, bekennen sich weiterhin zu gewaltfreiem Widerstand. Auch angesichts neuer Kriege wie in der Ukraine oder in anderen Weltregionen. Die Bewegung ringt weltweit mit der Frage, wie Frieden inmitten von Gewalt und Polarisierung praktisch gelebt werden kann. Ihr christliches Friedensengagement ist vorbildlich. Jubiläum 500 Jahre Täufer «Verfolgt, vertrieben, vergessen – 500 Jahre Täufertum im Kanton Zürich» – ist eine Ausstellung in der Zentralbibliothek Zürich, Predigerplatz 33 – noch bis Mitte Juni 2024! Roman über Zürcher Täufer von P. Kamber Der Zürcher Historiker Peter Kamber, bekannt geworden mit der Studie «Reformation als bäuerliche Reformation» hat einen Roman zu den Anfängen der Täufer in Zürich verfasst: «Die himmlischen Versuchungen des Conrad Grebel», Limmat Verlag, Mai 2025. Mit Peter Kamber erschien im Vorjahr eine Episode der TheoLounge: Die Bauern und die Äbtissin. Was geschah vor 500 Jahren in Zürich? Welche Bedeutung kommt der letzten Äbtissin des Fraumünster zu, die 2024 gross gefeiert wird? Und wie war das mit der Täuferbewegung? Music im Podcast: Bass Background Emotin Sounds, NCPrime, Pixabay; Werbeeinspieler: Sweep Sound Effect und Mystical Wind Chimes von Pixabay

Wieso nicht eine weibliche Jesus? Marie-Therese Mäder
SRF Palmsonntag 2025 «Jesus goes to Holywood» von Norbert Busè: SRF, Sonntag, 13. März, 10 Uhr; ab diesem Termin in der Mediathek. Vom antiimperialistischen Widerstandskämpfer über den Hippie-Jesus bis zum Social-Media-Influencer: Die Filmwelt erfindet Jesus immer wieder neu. Best-of Jesus Wie spielgelt sich in Jesusfiguren und wechselnden Interpretationen seiner Biografie der jeweilige Zeitgeist? Und wieso erfindet jede Epoche ihren eigenen Jesus? Dieser Frage geht eine sehenswerte Arte-Dokumentation nach, die zu Ostern vom SRF (Ausstrahlung bei den «Sternstunden» am Palmsonntag, 13. April) übernommen wird: «Jesus goes to Hollywood» Keine andere Biografie ist so häufig verfilmt worden, wie die von Jesus Christus. Durch das Aufkommen des Films verlor die Kirche ihre Monopolstellung bei der Deutung des Bildes von Jesus. Eine These der Dokumentation des prominenten Regisseurs Norbert Busè lautet: Durch das Kino wurde Jesus erst so richtig Mensch! Hippie oder Fundamentalist? Die Zürcher Religions- und Medienwissenschaftlerin Marie-Therese Mäder hat bei der Dokumentation «Jesus goes to Hollywood» mitgewirkt. Im Podcast-Gespräch mit Johanna Di Blasi (RefLab) blickt sie auf die einflussreichsten Jesus-Filme der letzten Jahrzehnte: von Pier Paolo Passolinis neorealistischer Evangeliumsverfilmung mit einem spanischen Aktivisten in der Hauptrolle über «Jesus Christ Superstar» und «Das Leben des Brian» bis zu jüngsten Interpretationen wie der Netflix-Serie «Messiah». Die Filmexpertin verrät auch, was ihre Lieblingsfilme sind - und wie es mit der Jesus-Figur weitergehen könnte. Was für Jesuse - oder Jesi - kommen als nächstes? Music by I Love Jesus Christ from Pixabay Werbeeinspieler: Sweep Sound Effect und Mystical Wind Chimes von Pixabay

Kleiner, feiner Gott – Andreas Nufer über Alltagsspiritualität
Das Thema dieser Ausgabe der TheoLounge liegt buchstäblich auf der Strasse – und ist doch leicht zu übersehen. Vor allem, wenn wir dicht gefüllte Terminkalender haben oder uns sonst etwas ablenkt. Nämlich: Spiritualität im Alltag. Wie geht das: Spirituell leben? Welche Haltung ist die Voraussetzung? Ich habe mir das gemeinsam mit dem reformierten Theologen Andreas Nufer kulturenvergleichend angesehen. Bis heute prägen Erfahrungen in Argentiniens Armenvierteln sein Wirken und Handeln zutiefst. Brasilien, Bern, Kappel Als Pfarrer an der Heiliggeistkirche in Bern setzte sich Andreas Nufer, wie die «Berner Zeitung» kürzlich würdigte, «für Benachteiligte ein und exponiert sich damit». Er engagiert sich besonders für Geflüchtete und gründete das Solidaritätsnetz Ostschweiz. Geprägt ist er von der Befreiuungstheologie, die ihre Wurzeln in Lateinamerika hat. Als Student verbrachte er ein Jahr lang in einem Armenviertel in Argentinien. Sieben Jahre lang wirkte er in Brasilien und 13 Jahre lang in der Heiliggeistkirche beim Bahnhof Bern. Als neuer Leiter will er den reformierten Begegnungsort Kloster Kappel, ein ehemaliges Zisterzienserkloster aus dem 12. Jahrhundert, mit neuem Leben und Geist erfüllen. Veranstaltungen im April/Mai sind u.a. Die Mitte finden Kräuterheilkunde im Klostergarten Zen – sitzen, atmen und schweigen Gefühlsklar – Mit Meditation Emotionen stärken Oder die Klostertage zu Ostern. In der TheoLounge erklärt Andreas Nufer, dass Spiritualität im Grunde etwas so Alltägliches sei, dass man eigentlich gar nicht nicht-spirituell sein könne. Wenn einem übrigens der grosse allmächtige Gott ein wenig zu gross ist, kann man auch zum kleinen feinen Gott beten – und das geht so: Kleiner feiner Gott Kleiner feiner Gott, der du hier bist, mitten unter uns und in uns. Wir bitten dich für unsere Welt, für alles Leben, für alles, was kommt und geht für alles, was da ist, für alles, was kommen möchte. Segne uns, und durchflute alles, mit deiner Liebe, damit wir sie erfahren und weitertragen. So beten wir im Namen dessen, der aufsteht und mit uns kommt. Amen. ClosterCast – Inspiration aus Kappel Kaum in Kappel angekommen, startete Andreas Nufer einen Podcast: «KlosterCast – Inspiration aus Kappel». In Episode eins geht es um das Abhängen der Bilder durch die Mönche vor genau 500 Jahren. Und darum, welche Bilder und Denkmuster wir heute ablegen wollen und woran wir weiter festhalten.

Nähkästchengeplauder mit Magdalene Frettlöh
Es war ein Experiment: Würde es gelingen, beim gemeinsamen Stricken dennoch den Gesprächsfaden nicht zu verwirren? Würden wir uns trotz laufender Podcastaufnahme in die tiefe Vertrautheit hineinstricken, die häufig aufkommt, wenn gemeinsam gehandarbeitet wird? Und würde es gelingen, die Kabel nicht mitzustricken? Die kurz vor ihrer Emeritierung stehende Theologieprofessorin Magdalene Frettlöh (Universität Bern) und mich, Johanna Di Blasi, verbindet neben einer mehrjährigen Freundschaft die Leidenschaft für Stricken und Häkeln. An einem Sonntagnachmittag haben wir uns in Magdalenes Wohnzimmer zum Handarbeiten gesetzt. Wir haben Gesprächsfäden aufgenommen und wieder fallen lassen. Wir kamen auch auf die strickende Poetin Christine Lavant zu sprechen, die wir beide lieben. Und auf Analogien zwischen Stricken «mit Maschen» und Stricken «mit Worten». Vor allem aber ist es ein Gespräch über Zeit geworden und darüber, wie sie sich bei manchen Tätigkeiten wundersam verdichtet: Man investiert in sie Zeit und hat am Ende das Gefühl, Zeit geschenkt bekommen zu haben. Nähkästchengeplauder ist unsere Antwort auf Mansplaining in Podcasts! Foto von Midory Pho auf Pexels Musik im Podcast: "Crinoline Dreams" Kevin MacLeod (incompetech.com), Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 License, http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Bild dir was ein! Johann Hinrich Claussen über «Gottes Bilder»
Johann Hinrich Claussen hat rechtzeitig für die Advents- und Weihnachtszeit ein spannendes Buch mit dem Titel «Gottes Bilder» vorgelegt. Darin setzt er sich mit unterschiedlichen Gottesbildern aus 2000 Jahren christlicher Kunst- und Frömmigkeitsgeschichte auseinander: von magischen Amuletten über die himmlisch schönen Madonnen-Darstellungen der Renaissance bis hin zu krassen sozialrevolutionären Gottesbildern. Das Buch füllt eine Lücke. Es gibt zwar schier endlos Literatur über christliche Kunst, aber kaum kompakte und gut lesbare Überblicksdarstellungen. Und selten beziehen Darstellungen auch den aussereuropäischen Raum ein. Die Klappenempfehlung hat kein anderer als der frühere Direktor des British Musum verfasst. Neil MacGregor schreibt über Claussens Buch: «Eine brillante Geschichte des Christentums in sorgfältig ausgewählten, kenntnisreich und kurzweilig erklärten Bildern.» In dieser Crossover-Folge von TheoLounge und Draussen mit Claussen befragt die Kunsthistorikerin Johanna Di Blasi den in Hamburg lebenden Theologien, Autor und EKD-Kulturbeauftragten Johann Hinrich Claussen auch über dessen persönliches Gottesbild. «Gottes Bilder. Eine Geschichte der christlichen Kunst», C. H. Beck-Verlag. Bild: Andrea Delitio, Der heilige Lukas malt die Madonna, Fresko in der Kathedrale Santa Maria Assunta in Atri, Italien, um 1477. Quelle: Internet. Musik im Podcast: "Shadowlands 3 - Machine" Kevin MacLeod (incompetech.com), Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 License, http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Religion vermitteln – aber wie? Rafaela Estermann
Wie können Eltern ihren Kindern Religion vermitteln? Und wie sieht es in Schulen aus? Viele Lehrerinnen und Lehrer halten im religionsbezogenen Unterricht offenbar das Prinzip der Neutralität hoch. Das Prinzip der Neutralität Im TheoLounge-Gespräch mit Johanna Di Blasi kärt die junge Religionswissenschaftlerin Rafaela Estermann über verbreitete Missverständnisse in der Religionsvermittlung auf. Dazu gehört die Vorstellung, wer nicht religiös sei, könne neutral über Religion urteilen. Säkularismus aber sei keineswegs neutral, erklärt Estermann, sondern es handle sich vielfach um eine Ideologie. Mit Säkularismus gingen nämlich häufig starke Wertungen einher. Fünf, sechs oder sieben Säulen? Viele Lehrer seien ausserdem der Ansicht, andere Religionen mit klaren Kategorien beschreiben zu können – etwa den Fünf Säulen des Islam. Doch die Fünf Säulen des Islams sind nicht die «wahre Essenz» dieser Religion, sondern eine bestimmte Art, sie zu strukturieren. Nicht-Religiösität wie auch Säkularismus sind spannende, aber bislang in der Schweiz kaum erforschte Felder. Rafaela Estermann ist Doktorandin an der Theologischen und Religionswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich. Sie ist ausserdem Stellvertretende Geschäftsführerin bei IRAS COTIS und Redaktionsleiterin bei religion.ch. (Forschungs-)Literatur Rafaela Estermann: «Was ist Religion? Eine Idee für den Interreligiösen Dialog» auf www.religion.ch. Rafaela Estermann: «Über Gott und die Welt – einmal bei euch nachgefragt», Ebd. Zu Nicht-Religiosität und Multiple Secularaties Johannes Quack, Cora Schuh, Susanne Kind, The Diversity of Nonreligion. Normativities and Contested Relations, 2019 Johannes Quack and Mascha Schulz. Who Counts as ‘None’? Jörg Stolz, Judith Könemann, et.al., Religion und Spiritualität in der Ich-Gesellschaft. Vier Gestalten des (Un-)Glaubens (Kapitel 8 zur Schweiz) Lois Lee, Recognizing the Non-religious. Reimagining the Secular Talal Asad. Ordnungen des Säkularen. Christentum, Islam, Moderne Charles Taylor, Ein säkulares Zeitalter Lena Salaymeh «The Eurocentrism of Secularism»; nach er palästinensischen Forscherin ist Säklarismus eine moderne Ideologie - und Religion eine moderne und säkulare Kategorie. Und ein regelmässiges Update: NSRN Blog: Nonreligion and Secularity Research Network Podcasts Hier geht es zu den Podcasts des Postsecular Lab der Uni Bern. Hier eine TheoLounge zur Frage: «Leben wir noch im säkularen Zeitalter?» In einer vorangegangenen TheoLounge sprach Rafaela Estermann über das spannende Thema der Glaubensvielfalt am Wohnzimmertisch - und verriet, wie es in ihrer religiös höchst diversen Familie zugeht. Foto von Emiliano Vittoriosi auf Unsplash Musik im Podcast: Lightless Dawn Kevin MacLeod (incompetech.com), Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License Werbeeinspieler: Sweep Sound Effect und Mystical Wind Chimes von Pixabay

Glaubensdifferenzen im Wohnzimmer: Rafaela Estermann
Die meisten werden das kennen: Glaubensvielfalt am Wohnzimmertisch. Die Religionswissenschaftlerin Rafaela Estermann hat in ihrer eigenen Familie Feldforschung betrieben und auf www.religion.ch einen spannenden Blogbeitrag dazu geschrieben: «Glaubensvielfalt im Wohnzimmer – Familienchronik und Mikro-Ethnographie» In diesem TheoLounge-Gespräch unterhält sich die österreichische Kulturjournalistin Johanna Di Blasi mit der Schweizer Religionswissenschaftlerin über den spannenden und oftmals auch spannungsreichen Mikrokosmos der eigenen Familie. Von fromm bis atheistisch Wie kann es gelingen, miteinander im Gespräch zu bleiben, selbst wenn Weltanschauungen und religiöse Ansichten diametral verschieden sind? Wie kann ich für mein Gegenüber offen bleiben, aber mich gleichzeitig abgrenzen, wo ich anders denke und fühle? Tipps der Religionswissenschaftlerin Mit Neugier und möglichst ohne vorgefertigte Bilder auf Andersdenkende zugehen und wirklich verstehen wollen, weshalb das Gegenüber so denkt oder fühlt. Eigene religiöse oder politische Haltungen unmissverständlich artikulieren. Sollte im Austausch Stress aufkommen, sich primär selbst fragen: Wieso stresst mich das? Ich kann ja immer sagen: «Nein, ich sehe das anders als du. Aber wir sollten das jetzt so stehen lassen!» Unterschiede dürfen sein Mit der Globalisierung und Migration haben Herausforderungen zugenommen. Im Familienfeld lassen sich Umgangsweisen einüben, die auch gesamtgesellschaftlich notwendig sind, ist die Forscherin überzeugt. Rafaela Estermann ist stellverstretende Geschäftsführerin von IRAS COTIS, der Interreligiösen Arbeitsgemeinschaft Schweiz. Sie ist zudem Redaktionsleiterin bei religion.ch und wissenschaftliche Mitarbeiterin in der theologischen und religionswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich. Dort forscht sie über den interreligiösen Dialog in der Schweiz und insbesondere die Kommunikation über Islam an Schulen. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Säkularismus, Nicht-Religion, Säkularisierung, Diskursforschung, Islam im öffentlichen Diskurs, Religion im öffentlichen Raum. William James' Typisierung religiösen Erlebens, die im Podcast angesprochen werden, finden sich gut in diesem Beitrag von Thorsten Dietz (Fokus Theologie) zusammengefasst: «Religion und Erfahrung: William James und die Vielfalt des Religiössen». Musik: In the Cave, music_for_video, Pixabay

Mariano Delgado: «Das Meerschweinchen Gottes»
Wieso verkannten christliche Missionare häufig die Religion und Kultur der anderen? Insbesondere wenn Tänze, Traumdeutung und halluzinogene Pflanzen im Mittelpunkt standen? In welchem Verhältnis stehen die christliche Religion und sogenannte schamanistische Religionen heute? Und was kann das Christentum insgesamt von christlichen Formen lernen, die indigene Völker entwickelten? Darum dreht sich diese XL-Ausgabe der TheoLounge. Johanna Di Blasi unterhielt sich etwas mehr als eine Stunde mit dem bekannten Kirchenhistoriker und Missiongeschichtler Mariano Delgado. Kaum ein Forscher benennt so klar und direkt, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist, wie der kurz vor seiner Emeritierung stehende Professor der Université de Fribourg und Autor zahlreicher Bücher. Und kaum einer kennt die bunte Religionsvielfalt so gut wie er, die aus Kulturbegegnungen erwuchs. Der Forschungsschwerpunkt des gebürtigen Spaniers liegt auf dem indigenen Christentum Lateinamerikas. Religiöse Mischformen, die aus Kulturkontakten entstehen, betrachtet er nicht als Mischmasch oder schlechten Synkretismus, sondern als interessante Forschungsthemen und Formen, die die christliche Vielfalt bereichern. Über indigenes Christentum sagt Mariano Delgado: «Sie betrachten das Christentum heute als etwas, das wesentlich zu ihrer eigenen Kultur gehört.» Mariano Delgado, 1955 in Berrueces in der Provinz Valladolid geboren, ist ein spanischer römisch-katholischer Theologe, Kirchenhistoriker und Missionswissenschaftler. Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher Schriften. Gemeinsam mit dem evangelischen Theologen Volker Leppin gibt Delgado die Reihe «Studien zur christlichen Religions- und Kulturgeschichte» heraus: mit Monografien, Quellensammlungen und Sammelbänden zu religions- und kulturhistorisch Themen aus Christentumsgeschichte, Politik, Mystik und Theologie bis hin zur Begegnung mit anderen Religionen. Ende 2023 erschien in der Reihe «Globales Christentum Transformationen, Denkformen, Perspektiven». Mariano Delgado, 1955 in Berrueces in der Provinz Valladolid geboren ist ein spanischer römisch-katholischer Theologe, Kirchenhistoriker und Missionswissenschaftler.

Johann Hinrich Claussen: Über geraubte Kunst und menschliche Gebeine
Hat sich das Problem mit der Rückgabe geraubter Kulturgüter und verschleppter «Human Remains», also menschlicher Überreste erledigt? Können wir danach einen Haken hinter den europäischen Kolonialismus und die christliche Missionierung der Welt machen? Oder bleibt man dennoch in einer Konfliktgeschichte verbunden? In dieser Crossover-Folge der TheoLounge mit dem RefLab-Podcast «Draussen mit Claussen» unterhalten sich Johann Hinrich Claussen (Theologe, EKD-Kulturbeauftragter) und Johanna Di Blasi (Kulturjournalistin, Kunsthistorikerin) über ihre Erfahrungen mit Restitution und Repatriierung (Rückführung menschlicher Überreste). Johann war in Rückführungsprozesse von Ahnengebeinen nach Afrika involviert und hat Einblick in die Geschichtsaufarbeitung von Missionsmuseen, Johanna hat das Thema Restitution und Repatriierung als Kulturjournalistin bearbeitet.

Balts Nill: Das Tao ist das Do
Der bekannten Musiker und Autor Ueli Balsiger alias Balts Nill (ehemals «Stiller Has») über das chinesische Weisheitsbuch Tao Te King und das Aufwachsen in einem Pfarrhaus. Der Schweizer Musiker und Autor Balts Nill spricht mit Johanna Di Blasi über seine Erfahrungen mit Laotse und über vorreligiöse Religiosität. Eigentlich dachte er, das Tao Te King sei unübersetzbar. Dann hat es ihn aber nicht mehr losgelassen. 2020 kam von ihm die Übertragung ins Bärndütsch heraus: «vo wäge DO». Das fast 2500 Jahre alte Weisheitsbuch in Berner Mundart. Dann bekam der Bestsellerautor und spirituelle Lehrer David Steindl-Rast «vo wäge DO» in die Hände und Lust, es vom Bürndütsch ins Deutsche zu übertragen. Kürzlich erschien «Der Fließweg» von David Steindl-Rast und Balts Nill. Der Untertitel lautet: «Gedanken des Daodejing von Laozi». Bals Nill verrät ausserdem, ob er es bereut hat, bei «Stiller Has» ausgestiegen zu sein. Er gründete die legendäre Mundart-Band zusammen mit dem Singer-Songwriter Endo Anaconda. Musik in dem Podcast: «Geist&Rüssel», zur Verfügung gestellt von Balts Nill. Aussprache der chinesischen Worte: der Literaturübersetzer Johannes Fiederling.

Tut Kunst Kirche gut? Matthias Berger im Gespräch
Seit den kalkulierten Schockwellen der Avantgarden streben Künstschaffende radikale Autonomie an. Dennoch brach das Verhältnis mit Kirche, ihrem Auftraggeber über Jahrtausende, nie vollkommen ab. Heute schätzen Künstler:innen die spirituelle Atmosphäre und geschichtliche Dichte von Kirchenräumen – und schaffen mit Licht, Klang, Malerei oder Skpturen ortsspezifische Installationen. Die Offenheit der Kunst passt, wie es scheint, zu einer Kirche der Öffnung, in der immer mehr Platz findet, sogar das Säkulare. In dieser Ausgabe des Podcasts TheoLounge vertiefen Matthias Berger (Präsident der Schweizerischen Lukasgesellschaft) und Johanna Di Blasi (RefLab) die wechselvolle Beziehung von Kunst, Kirche, Religion und Spiritualität am Beispiel der ökumenischen Schweizerischen Lukasgesellschaft. Das Netzwerk aus Künstler:innen, Architekt:innen und Theolog:innen existiert seit genau hundert Jahren. Seine Mission seit ihren Anfängen ist es, gegenwärtig zu sein. 100 Jahre Schweizerische Lukasgesellschaft für Kunst und Kirche Im Jubiläumsjahr lädt die Lukasgesellschaft in der zweiten Jahreshälfte zu Veranstaltungen und Interventionen in Kirchenräumen ein. Das Programm findet sich hier. Eine Jubiläumstagung am 31. August in Köniz (BE). Das Hauptreferat mit dem Titel «Gibt es eine jüdische Kunst?» hält Naomi Lubrich, Direktorin des Jüdischen Museums der Schweiz Das Jahrbuch Kunst + Kirche trägt den Titel «GEWAGT! 100 Jahre gegenwärtig». Matthias Berger ist reformierter Theologe, Seelsorger in der Bahnhofkirche in Zürich und Bereichsleiter Pfarrämter mit gemischter Trägerschaft. Ausserdem ist er im Team von «Kunst und Religion im Dialog» im Kunsthaus Zürich. 2011 bis 2013 Masterstudium Bildwissenschaft mit Schwerpunkt New Media und Fotografie. 2016/17 Schreibwerkstatt für szenisches Schreiben Dramenprozessor in Zürich. Freischaffender Autor. Seit 2014 im Vorstand der Lukasgesellschaft, seit 2019 deren Präsident. Bei RefLab erschien von ihm eine Reihe von Gedichten, darunter «immer siehst du mich».

Sabine Bobert: Was ist neue Mystik?
Wir sind raum- und zeitlose göttliche Wesen, «die mit uns selbst blinde Kuh spielen», statt uns schwerelos durch himmlische Energiefelder zu googeln, sagt Sabine Bobert: evangelischen Theologieprofessorin, YouTuberin und Mystikerin. Ein Gespräch über hochgetaktete Hirnfrequenzen, kreative Traumabewältigung und die anarchische Power der Mystik. Die Fragen stellt Johanna Di Blasi. In interspirituellen Gesprächen der TheoLounge geht es darum, jenseits von Glaube oder Unglaube Verbindendes zu erkennen. Wir versuchen, hinter Abstraktionen zu gelangen und nicht über Kultur oder über Religion zu reden, sondern aus den jeweils prägenden kulturellen und spirituellen Erfahrungen heraus. Die Devise der interspirituellen Gespräche: Lust auf Fremdes, Neugier auf Verbindendes, keine Tabus! Boberts lesenswerter Essay «Mystik als Gegenstand nichttheologischer Wissenschaften» findet sich in der spirituellen Bibliothek des reformierten Netzwerks RefDate. Auf ihrem Youtube-Kanal spricht sie über die Bibel, PSI-Phänomene, Geister oder Barfussleben. Musik: Organic Grunge, Kevin MacLeod (incompetech.com), Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 License

Johanna Di Blasi: Brave Mädchen und böse Gebete
Eine dreiteilige Blogserie mit der Überschrift «Böse beten», die ich geschrieben habe, war Anstoss für unser Podcastgepräch. Ich erzähle davon, wie sogenannte Feindpsalmen der Bibel helfen können, Gefühlen der Enttäuschung und Wut Ausdruck zu verleihen – und aus Ohnmacht und Selbstmitleid herauszufinden. «Zerbrich ihnen die Zähne im Maul», «Giess deine Ungnade über sie aus», «Ihre Augen sollen finster werden» … so haben verletzte und zornige Menschen vor mir gebetet. So haben Menschen vor mir gefühlt. Und diese Gebete und Emotionen haben Platz in der Bibel! Darüberhinaus tauschen wir uns über asiatische Meditationsformen aus: Feindmandalas und «Feeding Your Demons» von Lama Tsultrim Allione. Musik im Podcast: Pixabay, Ambient Music (01), https://pixabay.com/music/meditationspiritual-ambient-music-part-01-205485/

Anselm Grün: Was machen Missionsbenediktiner?
Kaum ein Verfasser religiöser Schriften hat international grössere Auflagen als Pater Anselm. Auch im Internet kommt er an – und kann sich zu den Influencern zählen. Der sagenhafte Erfolg ist dem Benediktinermönch und Bestsellerautor offenbar nicht zu Kopf gestiegen. Er ist ein ausgesprochen liebenswerter Zeitgenosse mit einem bescheidenen Lebenswandel. In der Abtei Münsterschwarzach traf ich auf diverse Schnitzwerke aus Afrika. Die Afrika-Mission ist seit langer Zeit ein Schwerpunkt der Missionsbenediktiner. Deswegen habe ich Pater Anselm danach gefragt ... Pater Anselm schien etwas überracht. Aber hört selber. In interspirituellen Gesprächen der TheoLounge geht es darum, jenseits von Glaube oder Unglaube Trennendes anzusprechen und Verbindendes zu erkennen. Wir versuchen, hinter Abstraktionen zu gelangen und nicht über Kultur oder über Religion zu reden, sondern ausgehend von den jeweils prägenden kulturellen und spirituellen Erfahrungen. Die Devise der interspirituellen Gespräche: Lust auf Fremdes, Neugier auf Verbindendes, keine Tabus! Musik im Podcast: «Rites», Kevin MacLeod (incompetech.com). Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 License http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ sowie Pixabay, Ambient Music (01), https://pixabay.com/music/meditationspiritual-ambient-music-part-01-205485/

Niklaus Brantschen: Christ und Buddhist – passt das zusammen?

Niklaus Brantschen: Mystik ist menschenmöglich
Viele Menschen möchten meditieren, aber haben Schwierigkeiten mit Gott. Welche Botschaft könnte da befreiender sein, als den Gott, an den wir nicht glauben können, einfach loszulassen? Johanna Di Blasi hat mit dem Autor des Bestsellers «Gottlos beten», Niklaus Brantschen, im Lassalle-Haus darüber gesprochen. In interspirituellen Gesprächen der TheoLounge geht es darum, jenseits von Glaube oder Unglaube Trennendes anzusprechen und Verbindendes zu erkennen. Wir versuchen, hinter Abstraktionen zu gelangen und nicht über Kultur oder über Religion zu reden, sondern ausgehend von den jeweils prägenden kulturellen und spirituellen Erfahrungen. Die Devise der interspirituellen Gespräche: Lust auf Fremdes, Neugier auf Verbindendes, keine Tabus! Musik im Podcast: Pixabay, Ambient Music (01), https://pixabay.com/music/meditationspiritual-ambient-music-part-01-205485/

Frank Kretzschmar: Becoming a Tribe
Der Psychologe und Unternehmensberater Frank Kretzschmar (Stepwise Management) hat vor 20 Jahren zu seiner Überraschung entdeckt, welch' enormes Potenzial in Afrika schlummert. Er war inzwischen unzählige Male dort, wurde rituell in die Gemeinschaft der Massai aufgenommen und ist tief überzeugt, dass wir von afrikanischen Kulturen und Religionen lernen können, die in Europa schmerzlicherweise immer noch chronisch unterschätzt oder schlechtgeredet werden. Und mehr noch: Das Wissen des afrikanischen Kontinents kann helfen, die Resilienz zu entwickeln, die in einer Welt disruptiver Veränderungen überlebensnotwendig ist. In dem Gespräch mit Johanna Di Blasi fasst Frank Kretzschmar zentrale Learnings aus Afrika zusammen, streicht die Bedeutung des Gemeinschaftssinns (Ubuntu) heraus und schwingt den Rungu: eine Waffe für den Kampf gegen Löwen wie auch Zeichen der Würde und Weisheit. Zu Frank Kretzschmars Projekten gehört die Maasai Master Class. Hier verbinden sich traditionelle Leadership und zeitgenössisches Managementwissen. Musik im Podcast: traditionelles Morgenlied (dawn song) der Massai-Frauen der Maasai Master Class: hier gehts zum Video. Sängerinnen: Sianto Ene Rankei und Lydia Naishorua Kirrinkai.

Mansour Ciss: Wann kommen die United States of Africa?
Von Afrika lernen (1): Mansour Ciss gehört zu den bekanntesten Künstlern des Senegal. Man kann ihn in grossen Museen zwischen Berlin und Peking, Paris und Dakar erleben. Ich habe ihn aber auch schon auf belebten Plätzen getroffen. Da steht er mit einer kleinen mobilen Wechselstube und bietet Afros zu einem guten Wechselkurs an. Afro ist die erste afrikanische Einheitswährung. Die Währung der United States of Africa. Gibt es sie wirklich? Was ist die Villa Gottfried? Worum geht es im Laboratoire de Deberlinisation? Und wie geht das zusammen: zeitgenössische Kunst und rituelle afrikanische Heilungsrituale? Hört rein und erfahrt, was man euch über die Situation im heutigen Afrika häufig vorenthält. Villa Gottfried Die Villa Gottfried, gegründet und erbaut von Mansour Ciss, liegt etwa 70 Kilomenter von der senegalesischen Hauptstadt Dakar entfernt am Meer. Sie ist ein Treffpunkt für internationale Künstler:innen und Poeten. Auf halben Weg dorthin erstreckt sich ein kilometerlanger Müllberg am Strand. Dort verrottet unser Elektroschrott. Ich besuchte die Villa 2018 und sass mit Mansour Ciss im Garten unter dem Mangobaum.

Loten Dahortsang: Buddhafiguren sind eine westliche Erfindung
In interspirituellen Gesprächen zeigt sich Verschiedenheit. WESENTLICH aber ist das Verbindende. Hier setzt die TheoLounge an: mit Lust auf Fremdes, Neugier auf Verbindendes und ohne Tabus! In dieser Folge verbinde ich mich - und euch, wenn ihr mögt - mit einem faszinierenden buddhistischen Mönch und Lehrer: Loten Dahortsang. Loten versucht, den Augenblick zu leben. Er forscht nach dem Glück in der Tiefe. Er hat mir Tee angeboten. Ich durfte ihn alles fragen – und er ist keiner Frage ausgewichen. Als die Klosterglocke bimmelte, um das Mittagessen anzukündigen, blieb er sitzen, weil ich weitere Fragen hatte. Wir haben über religionsunabhängige Spiritualität geredet, über Gebet als aus der Mode gekommene Übung und über die Bedeutung der Sangha: der buddhistischen Gemeinschaft. Was ist Sangha? Die Versammlung der Mönche? Oder die Gemeinschaft der Mönche und der buddhistischen Laien? Aus meiner Sicht deutet die Trennung von spirituellen Profis (im Katholizismus: Priester) und Laien auf Religionsförmigkeit hin. Loten aber sieht das anders. Ich merke als Christin immer wieder, dass ich in der echten Begegnung mit dem Fremden immer auch etwas über das Eigene lerne. Diese Erfahrung wünsche ich auch euch! Und freu mich über Kommentare. Von Loten Dahortsang gibt es auf YouTube auch Meditationsvideos. Music: Tibet, by Sergei Chetvertnykh from Pixabay

RefLab Festival: Lesung von Birgit Mattausch
«Das Bleiben. Das Gehen. Ununterscheidbar, wo es beginnt, wo es endet.» «Ein Hochhaus am Waldrand ist das Zuhause von Nanush und ihrer Urgrossmutter Babulya. Einst hat die Urgrossmutter ihre Urenkelin von Sibirien nach Deutschland getragen, nun deckt Nanush die alte Frau abends mit einer Steppdecke zu.» Beim Podcast-Festival «Expedition WIRklichkeit» des RefLab las Birgit Mattausch aus ihrem berührenden und ungewöhnlichen Roman «Bis wir Wald werden». Ein Buch über die paradoxe Rückkehr in eine fremde Heimat und über intergenerationale Wunden, die nur langsam heilen. Einschlägige Podcasts: Steppenkinder. Der Aussiedler Podcast von Wedwin Markentin und Ira Peter X3 Podcast. Der erste RD+ und PostOst Podcast

Peter Kamber: Die Bauern und die Äbtissin
Schon vor 500 Jahren erlebten die Menschen multiple Krisen. Und in kaum einer Gegend waren die Spannungen und revolutionären Energien grösser als im damaligen Zürich und im Zürcher Umland. Im Gespräch mit dem Zürcher Reformationshistoriker und Romanautor Peter Kamber («Reformation als bäuerliche Revolution») geht es in dieser TheoLounge um die Umbruchszeit, in der sich das feudalzeitliche Zürich in einen Hort der Reformation verwandelte. Kaum ein Forscher hat sich so tief und umfassend mit den komplexen Ereignissen im damaligen Zürich auseinandergesetzt wie Kamber. Ausserdem hat er einen Roman geschrieben, der kurz vor der Veröffentlichung steht. Protagonist ist mit Conrad Grebel ein Zürcher Ratsherrensohn und Mitbegründer der Täuferbewegung. Manches, was damals in Zürich aufkeimte und aufbrach, strahlte in alle Welt aus. Vieles wirkt bis heute nach. Eine Schlüsselrolle in einem brenzligen Geschichtsmoment spielte mit Katharina von Zimmern eine mächtige, den Frieden, aber auch einen Söldnerführer liebende Frau. Die Äbtissin des Fraumünster stand einem Kloster vor, das aufgrund immenser Zehnteinnahmen das mächtigste Kloster auf dem Gebiet der heutigen Schweiz war. Die hochadelige klösterliche Feudalherrin war praktisch die Herrscherin von Zürich. Ende 2024 jährt sich zum 500. Mal die legendäre Schlüsselübergabe der letzten Äbtissin des Zürcher Fraumünster, Katharina von Zimmern. Ihr zu Ehren stehen vor allem in der zweiten Jahreshälfte in Zürich eine Reihe von Veranstaltungen ins Haus: Ausstellungen, Stadtführungen, Konzerte, Diskussionen. Das Programm zum Katharina-Gedenkjahr 2024 findet sich hier. Im Juli 2024 jährt sich ausserdem zum 500. Mal der Ittinger Sturm, die erste grosse Klosterbesetzung und -zerstörung im Zürcher Umland. Im Mai 2025 findet in Zürich die Mennonitische Weltkonferenz statt. Gefeiert wird der Beginn der Täuferbewegung vor 500 Jahren in Zürich. Musik im Podcast: Agnus Dei X Kevin MacLeod (incompetech.com), Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License, http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Seelenflunkern mit Johanna Haberer
Die Theologin Johanna Haberer nimmt seit 2019 gemeinsam mit ihrer Schwester, der ZEIT-Redakteurin Sabine Rückert, den beliebten Bibelpodcast «Unter Pfarrerstöchtern» auf. Die beiden haben einem Massenpublikum die biblischen Geschichten aufgeschlossen. Mit ihrem heiteren und lockeren Erzählstil und ihrem profunden Bibelwissen. Johanna Haberer ist zudem Autorin des Buches «Seele. Versuch einer Reanimation». In dieser TheoLounge diskutiert die Theologin mit Johanna Di Blasi und Andy Loos aus dem RefLab über Seele. «Seelenflunkern» mit Johanna Haberer war Teil des ersten Podcastfesstivals des RefLab «Expedition Wirklichkeit» Anfang März 2024 in Zürich. Hier geht es zu einer aktuellen Blogserie zum Thema Seele von Johanna Di Blasi.

Leben wir noch im säkularen Zeitalter?
In den vergangenen Jahrhunderten galten grosse Teile der Bevölkerungen Europas als religiös, während Philosophen häufig religionskritisch waren. Heute scheint es fast umgekehrt zu sein: Volkskirchen erleben eine beispielslose Krise, Kirchenmitgliedschaftsstudien erkennen einen ungebremsten Trend Richtung Säkularisierung. Gleichzeitig aber stehen wichtige philosophische Vordenker seit einigen Jahrzehnten den Religionen immer aufgeschlossener gegenüber und manche sagen, dass wir in einer postsäkularen Zeit leben. Der Religionsphilosoph Luca Di Blasi hat sich vor einer Woche in einem Blogbeitrag für RefLab mit der Frage auseinander gesetzt: «Was ändert sich, wenn Religionen bleiben?»Im vorliegenden Podcast vertieft er im Gespräch mit Christoph Kerwien das Thema des Postsäkularen und seine Aktualität. Nebenbei erfährt man auch etwas über die Gnosis, und was sie mit Verschwörungstheorien verbindet. Ihr findet den Podcast auch auf der Homepage des von Luca Di Blasi an die Universität Bern ins Leben gerufenen Postsecular Lab.

Schwimm dich frei! Good Life Talk mit Andy Loos
Explore what the good life means to you, and connect with others doing the same! Im zweiten Good Life Talk ist Andy Loos vom Theologie-Podcast «Geist.Zeit» Gast von Johanna Di Blasi. Andy wuchs im idyllischen Siegerland auf, in einem streng pietistischen Umfeld. Dort war vieles verboten, was gemeinhin Spass macht: Tanzen, Kinobesuche oder Popmusik hören. Er habe seiner Herkunft viel zu verdanken, aber sich gleichzeitig auch «freischwimmen» müssen, sagt der Theologe. Andy und Johanna tauschen sich in dem adventlichen Podcastgespräch über die Kraft der Imagination aus, den Manifesting-Trend, Ähnlichkeiten und Unterschiede zu christlichem Gebet und zwei verschiedene Arten von Zukunft: futurum und adventum.

Ist Selbstsorge egoistisch? Good Life Talk mit Thorsten Dietz
Zum Auftakt einer TheoLounge-Reihe zu gutem Leben ist mit Thorsten Dietz einer der erfolgreichsten Theologie-Podcaster im deutschsprachigen Raum Gast von Johanna Di Blasi. Er macht mit bei «Worthaus», «Karte und Gebiet« sowie dem neuen Podcast «Geist.Zeit». Der Schweizer Rundfunk titulierte Dietz als «Theologie-Verklickerer». Er ist auch Bestseller-Autor. Buchtitel lauten «Sünde. Was Menschen heute von Gott trennt» oder «Gott in Game of Thrones. Was rettet uns, wenn der Winter naht?». In der TheoLounge spricht Thorsten über seine persönliche Frömmigkeit, über Dankbarkeit als interessantes und keineswegs universales Konzept, aber auch über verkorkste Frömmigkeitsformen, wo das Danken zwanghaften Charakter annimmt. «Es gibt Menschen, die das danken müssen gleich wieder als innerer Verpflichtung empfinden und aus dem dankbar sein müssen eine Art Generator für Schuldgefühle machen, so dass es ihnen schadet, dankbar sein zu sollen.» Zum Thema des guten Lebens sagt Thorsten: «Gutes Leben kann man sich nicht auf Vokalbelkärtchen schreiben. Am Ende ist es ein Tun, ein Sein, eine Performance.» In die TheoLounge ist der Podcaster trotzdem mit ein paar Stichworten gekommen, die er aber bald zur Seite legte. Musik: Valse Gymnopedie Kevin MacLeod (incompetech.com), Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License, http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Von Engelshand gehalten! Good Life Talk mit Christoph Sigrist
«Niemand hat Boden unter seinen Füssen», ist Sigrist überzeugt. Deswegen sei es so schön, sich von Engelshand gehalten zu wissen und dabei auch noch die Hände frei zu haben, um andere zu halten. Ganz anders der Versuch, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Dabei ist bisher noch jeder untergegangen. Christoph Sigrist ist ein Schweizer Theologe und Diakoniewissenschafter. Nach fast 20 Jahren als Pfarrer am Zürcher Grossmünster hat er für 2024 überraschend seinen Rückzug angekündigt. In dem Podcast verrät Sigrist, dass er sich künftig stärker der Arbeit mit Studierenden und dem Hilfswerk Sachham in Nepal verschreiben möchte.

Replika im Religionsunterricht? Ein Gespräch mit Marcel Scholz
Religion und KI (3): Verändert Künstliche Intelligenz die Religion? Und können umgekehrt religiöse und theologische Einsichten die KI-Entwicklung beeinflussen? Das wollen wir in einem vierteiligen Themenschwerpunkt des Podcasts TheoLounge herausfinden. Nach einem Gespräch mit dem Religionsphänomenologen Jonas Simmerlein über KI-Gottesdienste, ChatGPT und Hassmails und mit der Theologin und Technikanthropologin Anna Puzio über religiöse Roboter geht es weiter mit dem Religionspädagogen Marcel Scholz und der Frage: Was sollen junge Menschen in der digitalen Ära im Religionsunterricht eigentlich lernen? Marcel Scholz ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Praktische Theologie/Religionspädagogik der Universität Mainz und gehört dem jungen Forscher:innen-Netz Religion and AI an. Er studierte an der Technischen Universität Dortmund Kunst und Evangelische Theologie für das Lehramt.

Hören KI-Unternehmer auf Kirche? Ein Gespräch mit Thomas Hausheer
Religion und KI (4): Der Grossraum Zürich ist unter den weltweit führenden Zentren für Roboter- und Drohnenentwicklung. Das angrenzende Zug wird auch Bitcoin-Valley genannt. Johanna Di Blasi aus dem RefLab unterhält sich in dieser Ausgabe des Podcasts TheoLounge mit Thomas Hausheer, dem Leiter des Forums Kirche und Wirtschaft im Schweizerischen Konzernhotspot Zug: über digitale Ethik in der Schweizer Wirtschaft und darüber, was Kirche zur Wahrung, Einhaltung und Verbesserung unternehmensethischer Standards beitragen kann.

Brauchen wir Religiöse Roboter? Ein Gespräch mit Anna Puzio
Religion und KI (2): Verändert Künstliche Intelligenz die Religion? Und können umgekehrt religiöse und theologische Einsichten die KI-Entwicklung beeinflussen? Das wollen wir in einem vierteiligen Themenschwerpunkt des Podcasts TheoLounge herausfinden. Nach einem Gespräch mit Jonas Simmerlein über KI-Gottesdienste, ChatGPT und Hassmails geht es mit der Theologin und Technikanthropologin Anna Puzio weiter. Das Gespräch dreht sich um Religiöse Roboter. Wo kommen Religiöse Roboter heute schon zum Einsatz? Welche Entwicklungen sozialer und religiöser Roboter zeichnen sich ab? Und wie wirken intelligente Maschinen aber das menschliche Selbstverständnis zurück? Schon heute kommen Roboter im Bereich Social Care zum Einsatz. Mitunter falle es sogar leichter, sich einem Roboter anzuvertrauten. «Vor Robotern brauchen wir uns nicht schämen.»

Wie gut predigt KI? Ein Gespräch mit Jonas Simmerlein
Religion und KI (1): Verändert Künstliche Intelligenz die Religion? Und können umgekehrt religiöse und theologische Einsichten die KI-Entwicklung beeinflussen? Das wollen wir in einem vierteiligen Themenschwerpunkt herausfinden. Den Auftakt bildet ein Gespräch mit dem Theologen und Religionsphänomenologen Jonas Simmerlein. Er ist der Mann hinter dem KI Gottesdienst, der im Juni auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg für Aufsehen und viel mediale Resonanz sorgte. In dem Gespräch mit Johanna Di Blasi legt der Theologe auch dar, weshalb sich die Angstlustfrage, ob KI menschenähnliches Bewusstsein erlangen könne, mit einem klaren Nein beantworten lässt.

Tom Segev: In Israel kommen wir aus 100 Ländern und sprechen 70 Sprachen (Jerusalem-Special III)
Für die letzten drei Wochen ihres Israel-Aufenthalts wohnt Sabine Rotach in Jerusalems Regierungsviertel: in der Nähe des Parlaments und entsprechend in der Nähe der Demonstrationen, die seit Monaten gegen die Entdemokratisierung des Landes ankämpfen. Sie ist an zwei grosse Demos gegangen und war beeindruckt von deren Intensität und Friedlichkeit. Sie hat verzweifelte und hoffnungsvolle Stimmen eingefangen und hat, um diesen historischen Moment besser verstehen zu können, Tom Segev zu einem Gespräch getroffen. Tom Segev ist israelischer Journalist und Historiker und hat der Generation der «neuen Historiker» angehört, die die Geschichte des Landes kritisch und faktenbasiert neu aufarbeiteten. Heute arbeitet er vor allem als Buchautor, verfolgt das Zeitgeschehen aber aufmerksam und differenziert wie eh und je.
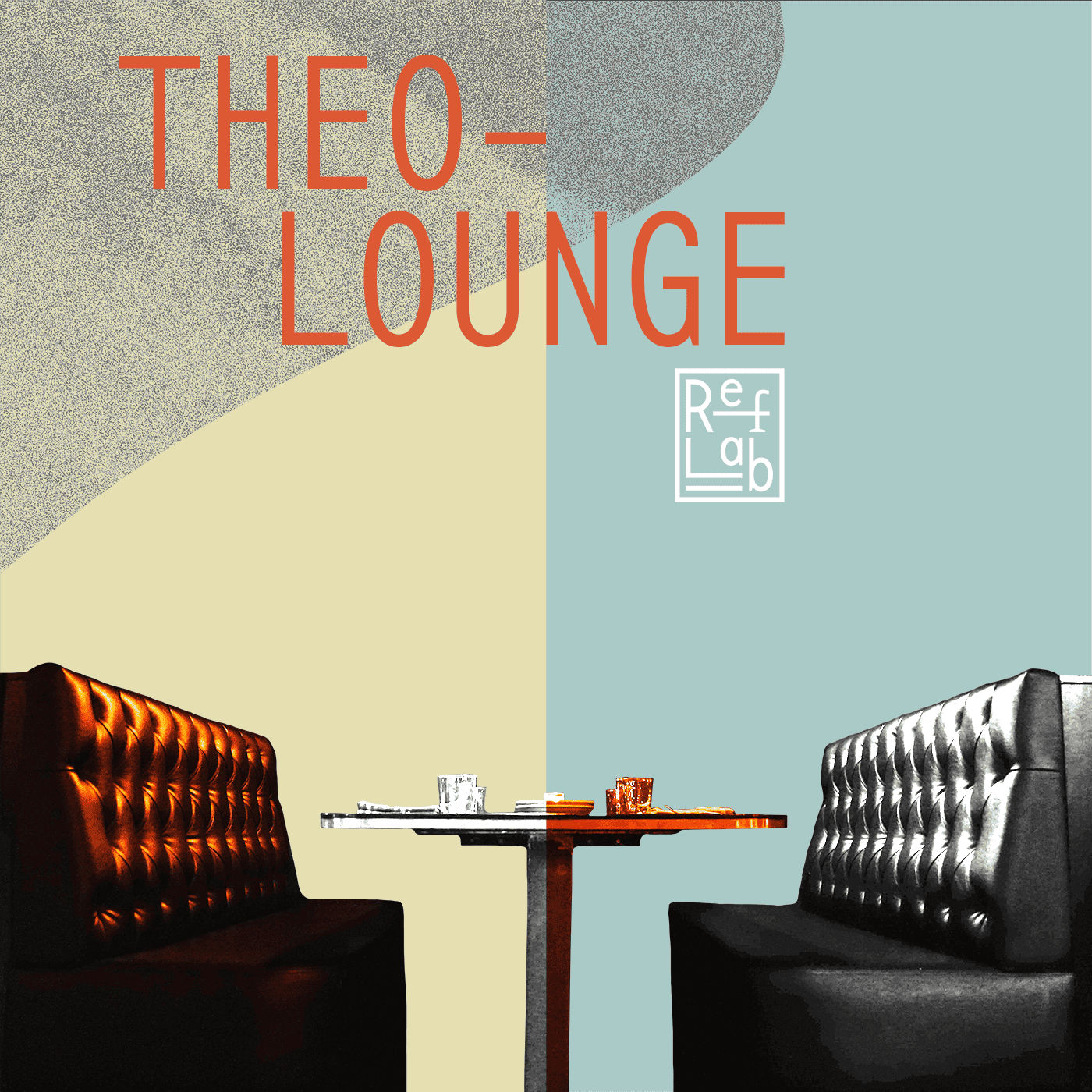
Birgit Mattausch: «Bis wir Wald werden» – ein anderer Blick auf Russlanddeutsche
Birgit Mattausch wohnte als Pfarrerin in Stuttgart in einem Hochhaus mit russlanddeutschen Migrantinnen. Grossmütter und Mütter luden sie in ihre Küchen ein und teilten mit ihr Geschichten von sibirischen Sommern, sowjetischen Gulags und endlosen Wintern und Wäldern. Durch die aktuelle Kriegslage hat der Romanstoff an Brisanz gewonnen, weil alte Vorurteile gegenüber Russlanddeutschen wieder grassieren.

Johanna Haberer: Experiment Grabeskirche (Jerusalem-Special I)
Die Archäologie bestätigt heute, was die Glaubenstradition seit fast zweitausend Jahren überliefert: Es ist wahrscheinlich, dass die Grabeskirche in Jerusalem sich am Ort von Jesu Tod befindet. Die bekannte Theologin und Podcasterin Johanna Haberer macht sich zusammen mit Sabine Rotach auf, den vielgestaltigen Ort mitten in der Jerusalemer Altstadt zu erkunden. Die beiden nutzen dafür das Angebot der Kirche, sich eine Nacht lang einschliessen zu lassen, um die Räume und ihre Bespielung intensiv zu erfahren. Überwiegt Besinnlichkeit oder Baustellenfeeling? Faszination für Liturgie oder für eine leere Zisterne? – Auch Egeria kommt zu Wort, eine Jerusalempilgerin, die im 4. Jahrhundert eines der frühesten Zeugnisse zur Grabeskirche hinterlassen hat. Johanna Haberer ist evangelische Theologin und Journalistin. Sie war Professorin für Christliche Publizistik an der Theologischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Seit 2019 produziert sie zusammen mit ihrer Schwester Sabine Rückert die Podcastserie «Unter Pfarrerstöchtern». Zurzeit arbeitet sie für vier Monate in Jerusalem. Sabine Rotach versucht während zwei Monaten, der faszinierenden Stadt auf die Spur zu kommen. In den drei Folgen ihres Summerspecials nähert sie sich Jerusalem von ganz verschiedenen Seiten. Sabine Rotach war u.a. Moderatorin und Redaktorin bei SRF 2 Kultur und wird ab September in Basel Theologie studieren.

Dieter Vieweger: Archäologie ist (fast) immer politisch (Jerusalem-Special II)
Dieter Vieweger lebt seit 30 Jahren in Jerusalem und überblickt die Geschichte der Stadt wie wenige: Er leitet das DEI (Deutsches Evangelisches Institut) und erforscht als Archäologe, Theologe und Professor für Altes Testament die unglaublich reiche Vergangenheit des Landes. Was hat die Geschichte Jerusalems mit der konfliktreichen Gegenwart zu tun? Wie lässt sich die Stadt lesen? Welche Erkenntnisse können biblische Texte und archäologische Funde liefern? In seinem Büro hoch über der Altstadt berichtet Dieter Vieweger von seiner Arbeit und ihren politischen und theologischen Verflechtungen. Sabine Rotach hat sich für zwei Monate nach Jerusalem aufgemacht, um der faszinierenden Stadt auf die Spur zu kommen. In den drei Folgen ihres Summerspecials nähert sie sich ihr von ganz verschiedenen Seiten. Sabine Rotach war u.a. Moderatorin und Redaktorin bei SRF 2 Kultur und wird ab September in Basel Theologie studieren.

Etty Hillesum: «Wir müssen dir helfen, Gott»
Lange blieben die Tagebücher Etty Hillesum (1914–1943) unveröffentlicht, erst in den 1980er-Jahren erschien zum ersten Mal eine Sammlung von Texten daraus. Etty Hillesum schrieb im von den Nazis belagerten Amsterdam der 1940er-Jahre, später aus dem Arbeitslager Westerbork, in dem sie über ein Jahr lebte, bevor sie nach Auschwitz transportiert und dort ermordet wurde. Ihre Tagebucheinträge und Briefe zeigen eine junge Mystikerin die das Zeitgeschehen klar sieht und reflektiert. Gleichzeitig findet sie im Leben, in ihrer Spiritualität und in sich selbst Ressourcen, um Menschen zu helfen, nicht zu verzweifeln. Trotzig hielt sie daran fest, dass das Leben selbst im Schrecken Momente der Schönheit, vielleicht sogar des Glücks bereithält. «Wir haben dieses Lager singend verlassen», notierte sie auf eine Postkarte, die sie am 7. September 1943 aus dem Zug warf. Gast in der TheoLounge ist der emeritierte Theologieprofessor Pierre Bühler, der soeben die erste deutschsprachige Gesamtausgabe von Etty Hillesums Werk herausgegeben hat. Mit ihm im Gespräch sind Felix Reich, Redaktionsleiter der Zeitschrift «reformiert.», und Evelyne Baumberger vom RefLab. Etty Hillesum: Ich will die Chronistin dieser Zeit werden. Sämtliche Tagebücher und Briefe 1941-1943, C.H. Beck, 2023.

Kathrin Müller: Eine Objektgeschichte des Kreuzes
Diese Ausgabe der TheoLounge ist eine Übernahme einer Folge des RefLab-Podcasts «Draussen mit Claussen» von Johann Hinrich Claussen (Hamburg, Berlin), dem Kulturbeauftragten der EKD. Beide Podcasts behandeln Fragen aus Kultur und Religion. Freunde der TheoLounge könnte auch «Draussen bei Claussen» interessieren.

Boris Previšić: Wir müssen ein gutes Anthropozän schaffen!
Der Kulturwissenschaftler Boris Previšić kennt den sensiblen alpinen Kulturraum wie kaum ein anderer. An den Alpen lassen sich vielfältige klimatische Veränderungen ablesen. «Der Klimawandel schlägt im Gebirge im Moment heftiger zu als in den Niederungen», sagt der Autor von «CO2: Fünf nach zwölf. Wir wir den Klimakollaps verhindern könne» (2020) sowie des neuen Buches «Zeitkollaps. Handeln angesichts des Planeten» (2023). Boris Previšić ist ein häufiger Gast in Medien. In jüngten Statements äusserte er sich zum Bergsturz in Brienz. Wir freuen uns, dass er für die TheoLounge-Aufnahme zu uns ins RefLab gekommen ist.

Anselm Grün: «Die ersten Bücher schrieb ich für mich»
Er wollte «in die weite Welt gehen, in einer anderen Sprache und Kultur die christliche Botschaft verkünden.» In den 1960er-Jahren, vor dem Hintergrund der Dekolonisierungsphase, aber zerbröckelten geschönte Bilder der Überbringung «Froher Botschaft» durch das missionarische Christentum. «Wir merkten, dass die Realität doch anders war, als es in Lichtbildervorträgen über Missionsarbeit dargestellt wurde.» Anselm Grün ging nicht nach Asien, sondern wurde ein Missionar im eigenen Land und in der Welt des Gedruckten. Mit seinen Büchern erreicht er aber auch Leser:innen in anderen Weltgegenden. 50 seiner Bücher sind ins Chinesische übersetzt worden und allein in Brasilien wurden etwa zwei Millionen Bücher von ihm verkauft.

Sabine Bobert: Richtig fette Mystik
Die «neue Mystik» lebe überwiegend ausserhalb der Grosskirchen, ist Sabine Bobert überzeugt. Hirnfrequenzen-basierte Spiritualität und evangelische Theologie fänden kaum zusammen. Wir seien raum- und zeitlose göttliche Wesen, «die mit uns selbst blinde Kuh spielen», statt uns schwerelos durch himmlische Energiefelder zu googeln. Mystik sei «der gesunde Zustand des Menschen oberhalb des Lebenskampfes» und Jesus «doch noch mal was anderes, als die Institution behauptet»… Sabine Bobert entfacht in diesem Podcast ein sprühendes Feuerwerk an Einsichten und Erfahrungen. Sie ist die erste Mystikerin mit Berliner Charme (Schnauze), die Johanna bisher kennenlernte. Letztendlich sind sogar zwei Sabine Boberts Gäste des Podcasts: die evengelische Theologieprofessorin aus Kiel und Sabine Bobert, der Mystikcoach. In «Jesus-Gebet und neue Mystik» hat sie eine Nahtoderfahrung verarbeitet und führt ein in orthodox geprägte christliche Mystik. Auf ihrem Youtube-Kanal spricht sie über die Bibel, PSI-Phänomene, Geister oder Barfussleben. Musik: Organic Grunge, Kevin MacLeod (incompetech.com), Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 License

Matthias Braun: ChatGPT ist unser Ebenbild
Eine neue Generation von Chatbots – künstliche Dialogpartner – hält uns in Atem, seit im November 2022 die Version ChatGPT-3 freigeschalten wurde. GPT steht für Gernerative pre-trained transformer. Inzwischen gibt es bereits ein Update: ChatGPT-4. Einige «Kinderkrankheiten» wurden ausgemerzt, aber viele Fragen bleiben. Wie verändert sich durch Chatbots unser Verhältnis zu gespeichertem Wissen? Wie gehen wir um mit den Wirklichkeitskonstruktionen der Maschinen, die plausible Welten errechnen, aber gleichzeitig realitätsblind sind? Und was bedeutet das für die Philosophie und Theologie? Matthias Braun gehört zu den wenigen Theologen, die gezielt zur Ethik Künstlicher Intelligenz forschen. Er befasst sich mit Fragen der politischen Ethik (Verhältnis von Demokratie, Zivilgesellschaft und Rechtsstaatlichkeit) sowie mit den ethischen und Governance-Herausforderungen neuer Technologien (insbesondere: Big Data, Künstliche Intelligenz und Genome Editing). Einen Auftrag von Christ:innen sieht er darin, sich einzumischen und Lebensformen so zu gestalten, dass sie der «Vielheit und Verletzlichkeit» von Menschen und anderern Wesen gerecht werden. Braun lehrt als Professor für Systematische Theologie/Ethik an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn und ist u.a. Dozent am Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics.

Noa Zenger: An der Quelle verweilen durch Fasten
Thema des Gesprächs mit der spirituellen Lehrerin, reformierten Theologin und Pfarrerin Noa Zenger ist das Fasten als Möglichkeit, in uns hineinzulauschen und eine besondere Form von Fülle, Energie und Klarheit kennenzulernen. «Fasten ist eigentlich etwas ganz Einfaches», sagt Noa Zenger, «weil der Körper seine eigene Weisheit hat. Der Körper kann fasten. Wenn ich dieses Vertrauen habe und gesund bin, brauche ich nur wenige Hinweise und kann es ausprobieren.» Die Fragen stellt Johanna Di Blasi, die angeregt durch das Gespräch tags darauf eine Fastenkur begann. Musik: Incompetech, Kevin MacLeod: Clean Soul

Peter Widmer: Der Glaube an den Phallus
Peter Widmers 1990 erschienenes Buch «Subversion des Begehrens: Jacques Lacan oder Die zweite Revolution der Psychoanalyse» hat vielen den Weg gebahnt zur Psychoanalyse von Jacques Lacan. Widmers Einführung, die eine komplexe Materie erstaunlich verständlich und bündig darlegt, wird immer noch gedruckt. Der Psychoanalytiker ist weit über die Schweiz hinaus bekannt. Ich habe Peter Widmer, der immer noch in Zürich eine psychoanalytische Praxis hat, in seinem Zuhause besucht und mit ihm eine TheoLounge aufgenommen. Der Fokus unseres Gesprächs liegt auf dem Ursprung der menschlichen Aggression und Gewalt. Hierüben handeln auch neue Bücher von ihm: «Jeder geht auf den Tod des Anderen» und «Destruktion des Ichs. Psychoanalytische Annäherungen an den Ursprung menschlicher Aggression», das kurze Zeit vor dem Angriffskrieg Putins herausgekommen ist. Musik: Incompetech, Thunderbird, Kevin MacLeod

Andreas Losch: Hello Aliens!
Wie wahrscheinlich ist extraterrestrisches Leben? Was würde es für den christlichen Glauben bedeuten, sollte es ausserirdisches Leben geben? Wie realistisch ist die Besiedlung des Weltalls? Das sind Fragen, mit denen sich der Theologe Andreas Losch intensiv auseinandersetzt – und um die es in dieser TheoLounge geht. Die Fragen stellen Johanna Di Blasi und Andy Losch. Losch sagt: «Wir Menschen müssen uns auch um den Himmel kümmern» und: Früher oder später müssten wir ins All aufbrechen, weil die Erde endlich sei.

Saida Mirsadri: Allah ist beweglicher als man(n) denkt
Die junge Iranerin, mit der sich Manuel Schmid in der heutigen TheoLounge unterhält, sorgt mit ihrer Geschichte und ihren theologischen Überzeugungen für manche Überraschung: Saida Mirsadri hat an der konservativen Universität in Ghom (Iran) als einzige Frau ihres Jahrgangs in Religionsphilosophie promoviert und sich dabei mit Muhammad Iqbal befasst. Iqbal gehört zu den renommiertesten und schillerndsten Vordenkern eines modernen Islam, der inhaltlich vorwegnimmt, was dann in der sogenannten «Prozesstheologie» Schule macht: Eine Auffassung der Wirklichkeit, die Gott nicht in Gegensatz zur Veränderlichkeit und Entwicklung der Welt setzt, sondern ihn mit den Geschöpfen in einer intimen Wechselwirkung sieht. Saida Mirsadri denkt von hier weiter und ist überzeugt, dass eine Erneuerung der theologischen Grundlagen auch entscheidend ist für die Auseinandersetzung mit den aktuellen Herausforderungen unserer Zeit – namentlich mit der ökologischen Krise und menschenrechtlichen Problemen. Vergangenes Semester hat Saida Mirsadri übrigens als Gastprofessorin für islamische Theologie und Bildung am religionswissenschaftlichen Seminar der Universität Zürich verbracht – wir sind froh, dass sie kurz vor ihrem Umzug nach Paderborn noch Zeit zu diesem Gespräch gefunden hat.

Elke Pahud de Mortanges: Der Körper ist das Zentrum des Christentums
Auch das Denken ist ein körperlicher Vorgang, es gibt uns nicht ohne: Die Professorin für Dogmatik und Dogmengeschichte Elke Pahud de Mortanges, die auch Lehrbeauftragte für Gender Aspects in Religious Studies ist, überrascht mit ihren Aussagen. So sagt sie zum Beispiel: Ein bewusstes im Körper sein, embodiment, beinhaltet unglaubliches Potenzial der Ermächtigung und Unabhängigkeit. Vermittlerrollen fallen weg, seien das Gebäude oder Menschen. Gleichzeitig zeigt sie auch auf, wie nah sich zum Beispiel die so genannten «vestiären Praktiken» von Mönchen im Mittelalter und Konsumverzicht von Jugendlichen heute sind. Wir haben uns zum Gespräch über ihr neustes Buch «Bodies of Memory and Grace – Der Körper in den Erinnerungskulturen des Christentums» getroffen. Dieser Podcast ist zuerst im Format Holy Embodied erschienen. Weil er auch gut zur TheoLounge passt, übernehmen wir ihn. Holy Embodied ist der körperzentrierte Spiritualitätspodcast des RefLab. Musik: „Lightning Flow“ von Richard Houghten vom Album Quantum Flow.

Elisabeth von Samsonow: Technik ist ein Mädchen
Die Wiener Professorin für philosophische Anthropologie der Kunst und Ökofeministin berichtet unter anderem über ihr Forschungsprojekt «Land der Göttinnen». Mit ihrem einflussreichen Buch «Anti-Elektra. Totemismus und Schizogamie» von 2006 zählt Elisabeth von Samsonow zu den Vordenkerinnen eines Blickwechsels auf die Erde als quasi-lebendiges Wesen, als Gaia. Die Philosophin und Künstlerin unternimmt den Versuch, die «präödipale» Welt des Mädchens, welche Sigmund Freud stets rätselhaft geblieben war, in der Fülle ihrer auch kosmischen Implikationen zu verstehen und die in Misskredit geratene Mutter-Tochter-Beziehung zu rehabilitieren. Als Künstlerin erschafft Elisabeth von Samsonow Übergangsfiguren («Transplants») zwischen Mensch, Tier, Pflanze und Geistern, die Töne von sich geben und sich bewegen. Zu ihren Performances und «techno-medialen Operationen» gehören auch Prozessionen. Zu ihren Kunstwerken gehören «The Secrets of Mary Magdalene», «Die Logik der Glücksträne (Animation der Elektra)» oder «La Femme Habitable». Gemeinsam mit Kolleg:innen aus dem Kunst- und Kulturbereich gründete sie 2020 auf vier Hektar Land das «Land der Göttinnen»: ein eco-art-Projekt, das ökologischen und ökofeministischen Aktivismus mit künstlerischer Forschung verbindet.

Niklaus Brantschen: «In der Mystik können wir uns begegnen»
Niklaus Brantschen strahlt eine solche Weite aus. In einer Zeit aufgeladener Identitätsdebatten erinnert der Gründer des interreligiösen Lassalle-Hauses daran, dass die Selbst-Werdung ein Prozess ist und unsere Identität vielschichtig ist und Wandlungen unterliegt. Niklaus Branschen ist als junger Jesuitenpater nach Japan aufgebrochen. In seiner Persönlichkeit haben sich der westlich-christliche und die östlich-buddhistische Weg so eng verbunden, dass der gebürtige Schweizer heute sagt: «Ich bin Christ und gleichzeitig Buddhist.» Musik: Magic Escape Room Kevin MacLeod (incompetech.com). Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Margot Kässmann: «Weihnachten als Provokation»
Ist die Engelsbotschaft vom Frieden auf Erden in kriegerischen Zeiten ein Versprechen oder eine Zumutung? Margot Kässmann spricht in der TheoLounge über die Sehnsucht nach einem wehrhaften Gott und die Provokation von Weihnachten. Die Theologin war Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers, Vorsitzende des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und von April 2012 bis Juni 2018 Botschafterin des Rates der EKD für das Reformationsjubiläum 2017.

Claudia Kohli: Das Spiritual Innovation Lab
Können Spiritualtiät & Mystik eine Aufgabe von zeitgenössischer Kunst & Design sein? Ein aufregender und zunächst einmal kontraintuitiver Gedanke: weil wir Spiritualität vielfach mit Religion und der Wiederbelebung und Aneignung von Traditionen assoziieren; christliche Kontemplation, Sufismus, Kabbala etc. Aber ist es nicht so, dass jede Generation in gewisser Weise die für sie passende Spiritualität selbst erfinden und gestalten muss? Wie geht das? Und welche Spiritualität(en) brauchen wir im 21. Jahrhundert?

Lisl Ponger: Über das Verschwinden der «Indianer» und der Mittelklasse
Die Video-, Foto- und Installationskünstlerin aus Wien untersucht laut Selbstauskunft «Stereotype, Rassismen und Blickkonstruktionen an der Schnittstelle von Kunst, Kunstgeschichte und vor allem Ethnologie». Für diese TheoLounge habe ich mich per Zoom mit der genialen österreichischen Künstlerin verbunden. Ich wollte unter anderem ihre Meinung zur jüngsten Aufregung rund um Winnetou hören. Ponger verbrachte längere Zeit in Lateinamerika und bereiste auch Kanada. Einer ihrer Schwerpunkt ist die Analyse weisser Machtdiskurse («Master Narrative») – und zwar untersuchte sie diese schon lange vor der Woke-Welle.

Andreas Kessler: Im Kopf unseres Slam-Poeten
Seit zweieinhalb Jahren slammt Andreas Kessler auf seine unvergleichlich scharfzüngige, wortgewaltige und tiefsinnige Art für den Podcast «Abgekanzelt». Keine heilige Kuh bleibt hier ungeschlachtet, kein Fettnäpfchen unbetreten. In dieser Folge von «TheoLounge» erleben wir den streitbaren Wortakrobaten im Gespräch mit dem RefLab-Podcaster Manuel Schmid. Sie reden über seinen widerwilligen Katholizismus, über Wissenschaftsfeindlichkeit und Fundamentalismus, über ein Christentum ohne Jenseits – und über die unveräusserliche Würde des Menschen. Dass es dabei zwischendurch auch slam-poetisch wird, versteht sich von selbst…

Francisca Loetz: Wie lebten und liebten frisch Reformierte?
Die Forscherin mit Schwerpunkt Allgemeine Geschichte der Neuzeit hat eine Vielzahl historischer Quellen aus dem Stadtstaat Zürich ausgewertet. Insbesondere Gerichtsakten erlauben spannende Einblicke, wie die Menschen damals gelebt, geliebt, geredet, gelitten, gezürnt und geflucht haben. Und überraschend häufig, wurden theologische Streitereien von Laien aktenkundig.

David Gushee: US-Evangelicals, Culture Wars and… Hope
David Gushee lehrt als Professor an der Mercer University in Georgia, ist Autor und Herausgeber von über 25 Büchern und hat in den letzten Jahren auch als Aktivist für LGBTQ-Inklusion, für den Klimaschutz und gegen die Folter in den USA hohe Wellen geworfen. Manuel Schmid spricht mit ihm über seinen persönlichen theologischen und spirituellen Weg und über die Entwicklung des US-Evangelikalismus, besonders in den Trump-Jahren. Zur Sprache kommt auch das Thema Culture Wars und die Beteiligung von Christen und Kirchen. Wie sieht eine christliche Existenz aus, die sich nicht auf eine Seite der verhärteten politischen Fronten schlägt, sich aber auch nicht in eine apolitische Frömmigkeit zurückzieht? Das Gespräch wurde auf Englisch geführt. Zusätzliche Angaben zu David Gushee finden sich auf seiner Website: https://davidpgushee.com. ________________ Today's guest in TheoLounge is well-traveled: David Gushee is one of the most influential Christian ethicists in the United States. He teaches as a professor at Mercer University in Georgia, is the author and editor of over 25 books, and has also made waves in recent years as an activist for LGBTQ inclusion, for climate protection, and against torture in the US. Manuel Schmid talks with him about his personal theological and spiritual path and about the development of US evangelicalism, especially in the Trump years. The «culture war» and the involvement of Christians and churches are also discussed. What does a Christian existence look like that does not take sides on hardened political fronts, but also does not retreat into apolitical piety? The conversation will be conducted in English. Additional resources by David Gushee can be found on his website: https://davidpgushee.com.

Felix Reich: Warum glaubst du?
Zu seinem letzten TheoLounge-Podcastgespräch durfte Stephan frei einen Gast auswählen. Er musste nicht lange nachdenken: Felix Reich bringt so viele interessante Voraussetzungen mit. Er ist als Pfarrerskind aufgewachsen, arbeitet als Chefredakteur für Reformiert. und begleitet die Reformierte Kirche seit Jahren mit einer wachen, kritischen Loyalität. Was ist ihm am Christentum bedeutend geblieben und was möchte er davon seinen eigenen Kindern mitgeben? Worauf hofft er? Und schliesslich, so ganz nebenbei, erhält Stephan noch einen kleinen Kurs in Interviewtechnik ;-)

Svenja Flasspöhler: Die Rückkehr der Krieger
Die Philosophin Svenja Flasspöhler (Chefredakteurin des «Philosophie Magazin») unterhält sich in dieser Ausgabe der TheoLounge mit Johanna Di Blasi über den jähen Einbruch der Kriegslogik in eine Kultur moderner Empfindsamkeit. Aus dem eben noch «toxischen Mann» ist wieder der heldenhafte Mann geworden, Ideologien der Härte haben plötzlich wieder Hochkonjunktur und ein dritter Weltkrieg ist nicht mehr unrealistisch.

Simon Peng-Keller: Spiritualität, was ist das bitteschön?
Der Theologe Simon Peng-Keller von der Universität Zürich zeichnet im Gespräch mit Johanna Di Blasi wichtige Entwicklungslinien und Bedeutungsverschiebungen eines heute wieder hochaktuellen Begriffs und Konzepts nach.

Gerechte Gewalt?
Kirchliche Verantwortungsträger:innen sprechen sich für oder gegen europäische Waffenlieferungen in die Ukraine aus. Manche wollen die Rede vom «gerechten Krieg» rehabilitieren, andere halten am Bekenntnis zur Gewaltlosigkeit fest. Lukas Amstutz und Roland Portmann diskutieren in dieser Live aufgenommenen Episode der «TheoLounge» über diese Themen. Lukas Amstutz ist Leiter des Bildungszentrums Bienenberg (Liestal), Co-Präsident der Konferenz der Mennoniten und war bis Ende 2021 als Radioprediger auf SRF2 Kultur zu hören. Roland Portmann ist Pfarrer in der Reformierten Kirche Volketswil, Armeeseelsorger und Mitglied der Zürcher Kirchensynode. Die Moderation dieses spannenden Talks führte Fabienne Iff aus dem RefLab-Team.

Gibt es einen Krieg der Kirchen?
Nicht von dieser Welt, oder doch? Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine bringt auch tiefe Spaltungen innerhalb der christlich-orthodoxen Welt ans Licht – und vertieft sie weiter. Kirche und Macht, Glaube und Politik erscheinen schier unentwirrbar verflochten. Der griechisch-orthodoxe Theologe Stefanos Athanasiou über Distanzierungsprobleme von Patriarchen, geteilte Dechristianisierungsängste und spaltende Tendenden nicht nur eines militanten russischen Neoimperialismus, sondern auch eines kirchlichen «Neokolonialismus», etwa in Afrika. Die Fragen stellte Johanna Di Blasi aus dem RefLab.

Glück in Zeiten des Krieges
Selten schien das Glück so zerbrechlich, wie gerade jetzt, wo es auf europäischem Boden wieder einen grossen Krieg gibt: den überraschenden russischen Angriffskrieg auf die gesamte Ukraine, der die Nachkriegsfriedensordnung ins Wanken bringt. Aber selten war das Glück auch so sichtbar wie jetzt, sagt die Philosophin Ariadne von Schirach. In der TheoLounge Live spricht sie mit Johanna Di Blasi (RefLab) über individuelle Glücksversuche, kollektive Verantwortung und Strategien im Umgang mit Unglück, Rückschlägen und Scheitern. Ihr jüngstes Buch ist eine Einladung, mit der Rettung der Welt bei sich selbst zu beginnen. Wie komme ich mir selbst und damit auch dem Glück ein wenig näher? Wie kann ich Freundschaft schliessen mit mir selbst? Wann muss ich streng zu mir sein, wann liebevoll, nachsichtig und vergebend?

Gott loslassen – um Gottes willen!
Mit seinem jüngsten Buch «Gottlos beten» trifft Niklaus Brantschen einen Nerv der Zeit. Binnen weniger Monate ist bereits die vierte Auflage erschienen. Johanna Di Blasi hat den Jesuiten, Zen-Meister und Autor im Lassalle-Haus getroffen.

Was hast du über den Tod & das Sterben gelernt?
Christian ist Pfarrer in Bern. Pro Jahr beerdigt er zwischen 15-25 Menschen. Und er organisiert das Death Café, einen Gesprächsort um sich über das Sterben und den Tod auszutauschen. Helfen ihm diese Aufgaben, selbst ein abgeklärteres oder hoffnungsvolleres Verhältnis zum eigenen Ende zu bekommen? Wie sieht für ihn Sterben im Idealfall aus? Wir haben uns am 9.12. im Studikaffee Hirschli zum Podcast getroffen und danach noch lange mit den anwesenden Gästen diskutiert. Schick uns, wenn du magst, eine Message, wie du mit Sterben und Tod umgehst und welches Ende du dir wünschst. Gerne an contact@reflab.ch

Hans Joas: Säkularisierung entzaubern
Hans Joas ist einer der führenden Religionssoziologen unserer Gegenwart. Er kennt nicht nur den deutschsprachigen Bereich, sondern hat jahrelang in den USA gelebt und gelehrt. In unserem Gespräch beschreibt er seine persönlichen Motive und wissenschaftlichen Anliegen und erklärt, weshalb die Säkularisierungsthese selbst eine grosse Erzählung ist, der wir wenigstens skeptisch begegnen sollten. Gegen Schluss kommen wir zu der Frage, was denn vom Christentum noch bleibt und weshalb es so schwierig ist, diesen Kern mitzuteilen. Wir haben das Gespräch in einem Kaffee geführt, was teilweise im Hintergrund zu hören ist. Wir hoffen, das stört euch nicht. Aber wann sonst spricht man mal so offen über Religion und Glauben in der Öffentlichkeit? Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen, Ideen, kritischen Einwände und Fragen. Gerne an contact@reflab.ch

RefLab bei «Zürich liest»
Die RefLaber stellten «Rückkehr der Delfine» am 29. Oktober 2021 im Rahmen des Literaturfestivals «Zürich liest» vor. Der Podcast enthält persönliche und politische, theologische und poetische Auseinandersetzungen mit einer Welt im epidemologischen Ausnahmezustand.

Hallo Tod, du inspirierst!
Bei der TheoLounge Live am 11.11.2021 im Hirschli in Zürich ging es nicht einfach um den Tod, es ging ums Leben. Denn die Endlichkeit zeigt sich immer im Leben. Zu Gast war die Endlichkeitsforscherin und Podcasterin Viviana Leida Leonhardt. Die 26-jährige Schweizer Konzeptdesignerin sieht sich als «Ausführende Denkerin». Viviana Leida Leonhardt unterhielt sich mit der RefLab-Redakteurin Johanna Di Blasi über den Duft von Grossmutters Nivea Creme, den Tod ihrer Katze, ihre Erfahrungen im Hospiz Aargau und darüber, wie die Beschäftigung mit dem Tod zwar nicht die Angst nimmt, aber die Akzeptanz des Unvermeidlichen vergrössert – und die Gelassenheit.
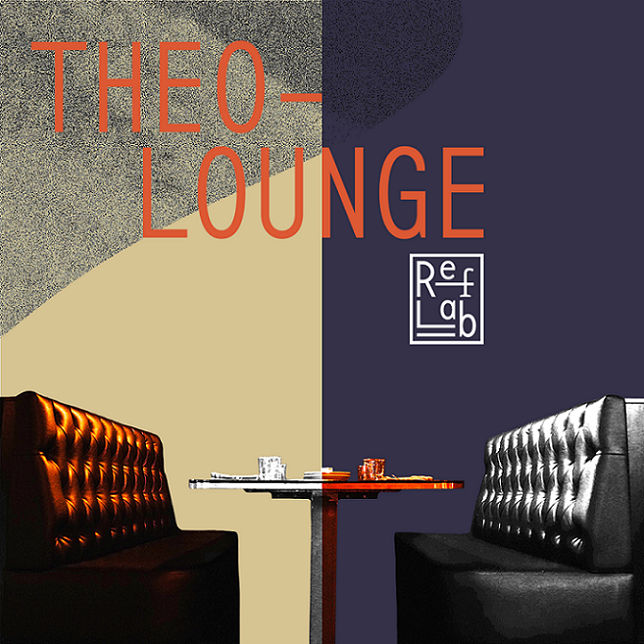
«Hope dies – Action begins»
Sind Klima:aktivistinnen apokalyptische Spinner? Übertreiben Forscher:innen, die ein Horrorszenario in Zeitlupe auf uns zukommen sehen? Brauchen wir mehr Hoffnung oder weniger? Der Philosoph und Theologe Jürgen Manemann ist überzeugt, dass wir nicht Hoffnung brauchen, sondern Mut. In der Reihe «TheoLounge» tauscht sich Johanna Di Blasi mit dem Umweltaktivisten über Apokalypsevergessenheit, zivilen Ungehorsam und sein neues Buch «Revolutionäres Christentum» aus.

"Dieser Text hat mich persönlich angegriffen!"
Was machen wir eigentlich mit Texten in unserem biblischen Erbe, die wir nicht so leicht integrieren können? Und von denen wir unseren säkularen Freund:innen nicht so gerne erzählen? Die 31-jährige Theologin Milena Heussler hat sich in ihrem Buch «War deine Hurerei noch zu wenig?» an einigen besonders sperrigen Stellen bei Ezechiel abgearbeitet. Sie verbindet in ihrer augenöffnenden Studie feministische Exegese, kognitive Metapherntheorie und aktuelle Traumaforschung. Bei der zweiten TheoLounge Live im Zürcher Studentencafé Hirschli sprach sie mit Johanna Di Blasi über die Schockstarre, die sie bei der Lektüre der Prophetenschrift überkam – und darüber, weshalb uns das Buch heute noch angeht.

Zart und genau
Der reformierte Theologe und streitbare Intellektuelle Kurt Marti, Schöpfer einer Vielzahl von Gedichten, legte bei seinen Lektüren umfangreiche Wortlisten an. Er wurde bei Goethe, Hölderlin, Handke oder auch Mayröcker fündig. Der «Wortwarenladen» offenbart eine unbekannte Facette des dichtenden Pfarrers, der auch erotische Gedichte verfasste. Anlässlich der 100. Wiederkehr seines Geburtstags rieselt viel warmer Lorbeerregen auf ihn herab. So predigte etwa die prominente deutsche Schriftstellerin Felicitas Hoppe zu Martis Ehren in der Berner Nydeggkirche. Und das Bakara-Label versammelt Marti-Vertonungen der coolsten Schweizer Rapper. Wir danken für die Erlaubnis, akustische Kostproben von Baze wiederzugeben.

TheoLounge Special mit P. Sloterdijk Teil 2
Teil 2 des zweiteiligen Audiomitschnitts bei einem Studientag am 30. August 2021 in der Universität Zürich zur Theopoesie mit dem Philosophen Peter Sloterdijk. Hier die Podiumsdiskussion im Anschluss an Sloterdijks Vortrag.

TheoLounge Special mit P. Sloterdijk Teil 1
Teil 1 der zweiteiligen Folge der TheoLounge Special zur Aktualität von Theopoesie als einem Begriff, der merkwürdig zwischen Aufklärung und Gegenaufklärung changiert. Hier zum Nachhören die am 30. August 2021 im Rahmen eines Studientags an der Universität Zürich gehaltene Rede des Philosophen Peter Sloterdijk.

OMG! – Religionen als neue Broadcaster
In der ersten TheoLounge nach der Sommerpause geht es um mediale Bilder von Religion, religiöse Selbstdarstellung und Rückkopplungseffekte medialer Bilder auf religiöses Leben. Kaum eine religiöse Gruppierung ist aktiver und erfolgreicher in Social Media unterwegs als die Mormonen. Deswegen blicken wir auf sie als Fallbeispiel effizienter und höchst erfolgreicher Medienarbeit in unserer Gegenwart. Die Schweizer Religions- und Medienwissenschaftlerin Marie-Therese Mäder hat mormonische Traumfabriken in den USA besucht und Medienerzeugnisse von und über Mormonen kritisch unter die Lupe genommen. Sie diskutiert mit Johanna Di Blasi über die Verlagerung der Mission ins Netz, die Instrumentalisierung von Tränen und die Erzeugung von OMG-Effekten.

Das Problem des Anti-Anti-Semitismus
Der Antisemitismusvorwurf, früher gegen Nazis und Rechte vorgebracht, wird mehr auch zur politischen Waffe gegen «links». Dies wurde zuletzt in den bizarren Antisemitismusvorwüfen an Carolin Emcke deutlich. Die Folge: Man redet gar nicht mehr über Juden oder das Jüdische, um nicht in Fettnäpfchen zu tappen. Eine fatale Strategie, meint der Religionsphilosoph und Talmudforscher Elad Lapidot im Gespräch mit der RefLab-Redakteurin Johanna Di Blasi.

Hat Schöpfungstheologie ausgedient?
Christ:innen sehen zunehmend die Notwendigkeit, die eigene Tradition fundamental zu hinterfragen. Vor dem Hintergrund der globalen Klimakrise hat sich die Wahrnehmung verschoben. Was lange als «zivilisiert» und «hochkulturell» galt, erscheint heute als problematisch. Und sogenannte «primitive» Kulturen und Religionen erfahren eine Aufwertung. Das Know-how indigener Völker findet Eingang in internationale Regelwerke zum Umweltschutz. In dieser Ausgabe der TheoLounge spricht Johanna Di Blasi mit dem Bonner Theologen Andreas Krebs darüber, ob Kirchen in Leitfäden statt «Bewahrung der Schöpfung» besser «Kampf um Gaia» schreiben sollten, über Donna Haraways Fadenspiel und Derridas Hund. Andreas Krebs wurde 1976 in Trier geboren. Seit 2015 ist er Professor für Alt-Katholische und Ökumenische Theologie und Direktor des Alt-Katholischen Seminars der Universität Bonn. Davor war er Assistenzprofessor an der Theologischen Fakultät der Universität Bern, wo er sich zum Thema «Gottes Verheißung, Gottes Scheitern» habilitierte.

Unfassbar – Die Gastronomie in der Pandemie
Bernhard Jungen und Tobias Rentsch kennt man von der "Unfassbar". Mit der Unfassbar – einem Cargofahhrad mit Bierbar – sind die beiden an unterschiedlichen Orten präsent und sprechen mit Menschen über Gott und die Welt. Bernhard engagiert sich zudem in Basel als "Gastroseelsorger". Zusammen haben sie in der Pandemie-Zeit mit 25 Beizern, Barbetreiberinnen, Restaurantbesitzern und Clubbetreibern gesprochen. Sie erzählen in diesem Podcast, wie es denen geht, die mindestens eine Zeit lang unsere nationalen Sündenböcke waren. Und was wir von ihnen lernen können.

Rainbow-Church
Podcast mit dem Basler Regenbogenpfarrer Frank Lorenz zu seinen Erfahrungen mit LGBTQI-Seelsorge, dem neuen Zürcher Pfarramt und queerer Befreiungstheologie.

«Ich bin ein Kollege des Johannes von Patmos»
Peter Sloterdijk im RefLab-Gespräch mit Johanna Di Blasi über göttliche Inspiration, höllische Träume und Mythensammler auf dem Meer zerfallener Überlieferungen. Anlass des Gesprächs ist das jüngste Buch des Philosophen: «Den Himmel zum Sprechen bringen: Über Theopoesie», in dem Sloterdijk erstaunlich freundlich auf Religionen und Religiosität blickt. Eine gekürzte Transkription des Gesprächs findet sich hier. Und hier geht’s zum Buch von Peter Sloterdijk. Auf eure Reaktionen freuen wir uns! Wie immer gerne an contact@reflab.ch.

Aus heiterem Himmel
Rolf Probala erzählt Jahr für Jahr eine Weihnachtsgeschichte. 16 Variationen hat er soeben publiziert. Mit Stephan Jütte spricht er darüber, warum ihm Geschichten wichtig sind, was ihm Weihnachten bedeutet und wie er über die Welt, unsere Zeit und die Menschen nachdenkt. Auf eure Reaktionen freuen wir uns! Wie immer gerne an contact@reflab.ch.

Mit Stefan Haupt auf Entdeckungsreise
Stefan Haupt spricht über die Jugendunruhen in den 1980er Jahren, die Ambivalenz der Gegenwart und unsere Zukunft. „Zürcher Tagebuch“ heisst das neuste Filmprojekt des Regisseurs und Filmproduzenten. Darin gibt er Persönliches preis, lässt Freunde und Familienangehörige reden und uns in ein Kaleidoskop aus Erinnerungen, Emotionen und Hoffnungen hineinblicken.

Silvio Flückiger: Stabschef und stv. Leiter der Humanitären Hilfe
Am 4. August 2020 gab es eine riesige Explosion im Hafen von Beirut am Golfe de Saint-Georges. Sie traf die ganze Stadt katastrophal. Ursache war ein Brand, der 2750 Tonnen Ammoniumnitrat in einem Hafenspeicher zur Explosion brachte. Silvio Flückiger hat den Einsatz des Katastrophenhilfscorps von der Schweiz aus koordiniert. Im Podcast erzählt er über die Arbeit des EDA und gibt Einblick in die Stunden nach einer Katastrophe.

Ueli Greminger: "Der letzte Zug"
Stephan Jütte unterhält sich mit Ueli Greminger über dessen neues Buch: "Der letzte Zug". Die biografischen Parallelen zwischen der literarischen Figur "Pfarrer Bodmer" und Ueli Greminger sind augenfällig. Aber teilt Ueli Greminger auch die Gegenwartsdiagnose, die das ganze Buch begleitet? Die Kirche wird ärmer, älter und kleiner. Für den Pfarrer interessiert man sich nur noch an den Lebensrändern und in Extremsituationen. Wie denkt er darüber, wenige Monate vor seiner Pensionierung? Ein Gespräch darüber, warum man Theologie erzählen muss und ob es wehtut, wenn die Kirche verschwindet. Hier geht's zum Buch "Der letzte Zug" https://www.tvz-verlag.ch/buch/der-letzte-zug-9783290183400/?page_id=1

Anti-Darwin und die faszinierende Welt der Mimikri-Wesen
Eine Gesprächsminiatur mit dem Medientheoretiker Peter Berz über die bunte Denkwelt jenseits von Charles Darwin, die Lust der Arten an der Selbstmanifestation und die kopflose Intelligenz der Schleimpilze. Peter Berz selbst gehört der seltenen Spezies der Vertreter einer Biologischen Medientheorie an. Er ist Dozent an der Humboldt Universität in Berlin und lehrt unter anderem auch an der Universität Luzern im Bereich Wissenschaftsforschung.

Businesscoach Birgit Troschel
Birgit Troschel ist Partnerin in einem Consulting-Unternehmen. Als Spezialistin für Persönlichkeitsdiagnose trainiert und coacht sie Leistungsträger im Health-Care-Bereich. Sie ist eine Frau mit aussergewöhnlicher Tatkraft und einer Leidenschaft für eine neue Generation, die ganz neue Impulse und Wertvorstellungen in die Arbeitswelt hineinträgt. Manuel Schmid hat mit ihr gesprochen und sie nach ihren Erfahrungen und Motiven gefragt. Hört in diese Unterhaltung rein – und schreibt euer Feedback an contact@reflab.ch.

Ethik-Professor Markus Huppenbauer
Markus Huppenbauer ist Ethik-Professor an der Uni Zürich. In diesem Semester hat er eine Lehrveranstaltung zum umstrittenen Intellektuellen Jordan Peterson und dessen Buch 12 Rules for Life angeboten. Warum tut er das? Was kann er aus den 12 Rules lernen? Welche Rolle spielen Religion, Glaube und Gott in Petersons Denken? Ist Peterson frauenfeindlich oder rücksichtslos gegenüber Minderheiten? Über diese Fragen diskutieren Markus Huppenbauer und Stephan Jütte.

Regierungsrätin Evi Allemann
Evi Allemann hat sich schon früh für Politik interessiert. Mit 19 Jahren wurde sie in den grossen Rat gewählt. Nur fünf Jahre später wurde sie Nationalrätin. Heute ist sie Regierungsrätin des Kanton Bern. Was begeistert sie an Politik? Wofür lebt sie? Evi Allemann im Salon um Sechs – das sind ansteckende Begeisterung und tiefsinnige Gedanken. Und beides in weniger als 60 Minuten! Euer Feedback gerne an contact@reflab.ch