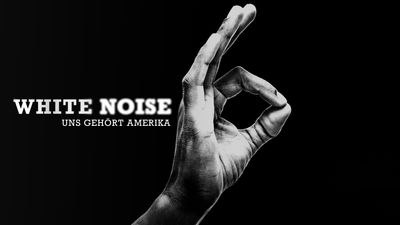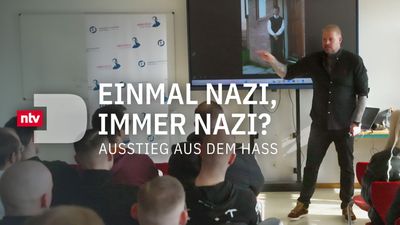Die Kultur der Gegenwart ist voller Religion – ob es einem gefällt oder nicht. Das Gute daran: Es schafft Anlässe, mit ganz unterschiedlichen Menschen Gespräche zu führen. Über überraschende kulturelle Entwicklungen, tolle neue Kunstwerke oder aktuelle Konflikte. Nicht als journalistisches Frage-Antwort-Spiel, sondern als gemeinsames, ernsthaft-unterhaltsames Nachdenken. Alle zwei Wochen mit Johann Hinrich Claussen und immer einem anderen Gast.
Alle Folgen
Klaus Mertes: gut-katholisch oder rechts-katholisch?
In den USA wurde es zuerst beobachtet: Seit einigen Jahren wenden sich junge Menschen (besonders junge, intellektuelle Männer) einer besonderen Spielart des Katholischen zu, nämlich einem entschieden konservativen Katholizismus. Wie ist das zu verstehen? Was zieht junge Menschen, die häufig nicht religiös aufgewachsen oder evangelikal geprägt sind, zur alten lateinischen Messe, zu autoritären Vorstellungen von Ordnung, zu einem christlichen Nationalismus und rechts-religiösen Aktivismus? Pater Klaus Mertes beobachtet diese Tendenz – nicht nur in den USA, sondern auch in Spanien und Frankreich sowie im deutschsprachigen Raum. Pater Mertes hat deutsche Kirchengeschichte mitgeschrieben: Von 2000 bis 2011 war er Rektor des Jesuitengymnasiums Canisius-Kolleg Berlin, dort wirkte er Anfang 2010 maßgeblich an der Aufdeckung sexualisierter Gewalt gegen Schüler mit und brachte damit die Aufarbeitung von Missbrauch in der katholischen Kirche in Gang – mit erheblichen Folgen auch für die evangelische Kirche. Als Theologe und Autor analysiert und kommentiert er theologische und politische Entwicklungen im weltweiten Katholizismus. Genau beobachtet er, was der US-amerikanische Vizepräsident J. D. Vance, der Investor Peter Thiel und rechtskatholische Intellektuelle propagieren. Dem versucht er das entgegenzustellen, was für ihn gute katholische Ressourcen sind: theologisches Nachdenken, politische Wachsamkeit und nicht zuletzt eine lebendige Frömmigkeit.

Stephan Lehnstaedt: Jüdischer Widerstand
Umfassend ist zur Shoa geforscht worden. Doch jetzt ist ein Buch erschienen, das viele überraschen wird. In «Der vergessene Widerstand» erzählt der Berliner Historiker Stephan Lehnstaedt, wie viele jüdische Männer und Frauen sich gegen den NS-Terror gewehrt haben. Auf sehr unterschiedliche Weise: mit Waffen, im KZ, auf der Flucht, in Verstecken, mit geistigen Mitteln, durch Dokumentation des Unrechts. Das widerspricht dem Klischee, wonach die meisten Juden ihr gewaltsames Ende wehrlos erduldet hätten. Lehnstaedt erzählt von großem Mut und überwältigender Menschlichkeit, aber auch von moralischen Dilemmata und tragischer Vergeblichkeit. Er verändert den Blick auf die Geschichte des europäischen Judentums und provoziert viele neue Fragen. Zum Beispiel: Wie hat diese bislang verdrängte Widerstandsgeschichte nach 1948 die Menschen und die Politik in Israel geprägt? Und was sagt sie uns heute?

Julia Voss: Natur zwischen Glaube und Macht
Von «der Natur» ist oft die Rede, ohne dass dabei immer klar wäre, was damit genau gemeint sein soll. Wir leben von ihr, lieben sie, erleben uns selbst in ihr, machen uns Sorgen um sie, sind weit von ihr entfernt. «Natur» hat zudem häufiger, als man gemeinhin denkt, eine religiöse Seite. Wir staunen über die Schöpfung, empfinden Ehrfurcht vor ihrer Größe, sind dankbar für ihre Gaben, fühlen uns verpflichtet, Verantwortung für sie zu übernehmen. Die Kunsthistorikerin Julia Voss hat nun im Deutschen Historischen Museum zu Berlin die sehr sehenswerte Ausstellung «Natur und deutsche Geschichte. Glaube – Biologie – Macht» eingerichtet. Mit ihr spreche ich darüber, wie unser heutiges Verständnis von Natur entstanden ist und sich über die Jahrhunderte entwickelt hat. Wir schauen auf die wechselnden politischen Funktionen «der Natur» und ihre religiösen Bedeutungen. Das ist nicht nur geschichtlich interessant, sondern auch für die Gegenwart bedeutsam, denn wir nur das schützen und bewahren, was wir verstehen. Deutsches Historisches Museum: https://www.dhm.de/

Johanna Haberer: Weihnachten und der leere Stuhl
Über Weihnachten unterhalten sich theologische Fachleute erstaunlich selten. Dabei gibt das beliebteste christliche Fest immer noch viel zu denken. Johanna Haberer – ehemalige Professorin für christliche Publizistik, überaus beliebte Podcasterin («Unter Pfarrerstöchtern») und jetzt auch Pastorin in einer norddeutschen Kleinstadt – hat viel über Weihnachten, seinen Sinn und seine besondere Freude zu erzählen. Wir unterhalten uns darüber, wie und mit wem sie feiert, welche Rolle Kindheitserfahrungen spielen, was von der spätmodernen und zum Teil nachchristlichen Weihnachtsspiritualität zu halten ist und worüber sie in diesem Jahr predigen wird. Weihnachten ist für sie eine «andere Zeit», in der das schlechtgelaunte, faule Krisenklagen eine Pause macht und eine überraschende Freude frei Fahrt bekommt. So erklärt sich, warum Johanna Haberer zu Hause an der langen Tafel einen Stuhl frei lassen und eben diesen unbesetzten Sitzplatz ins Zentrum ihrer Weihnachtspredigt stellen wird.

Martin Fritz: Was ist christlicher Nationalismus?
Die Gefahr von rechts ist höchst real. Allerdings gibt es in diesem Feld viel Bewegung und erhebliche Unterschiede. Deshalb ist es wichtig, genauer hinzusehen und präziser zu beschreiben. Nur so kann man die Urteilssicherheit gewinnen, die die Grundlage für das eigene demokratische Engagement ist. Martin Fritz von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin ist ein Kenner dessen, was man grob als «rechts» oder «rechtsextrem» bezeichnen würde. Aber er gibt sich mit solchen Etikettierungen nicht zufrieden, sondern sucht nach passenden Begriffen und bemüht sich um zielsichere Analysen. Mit ihm sprechen ich über christlichen Nationalismus. Dafür blicken wir auf den Fall von Charles Kirk – seine Person, seine Politik, seine Ermordung und schliesslich deren Instrumentalisierung – zurück. Viel wurde darüber schon geschrieben und gesendet, aber mit etwas Abstand kann man einiges klarer sehen, einordnen und beurteilen. Zum Beispiel die Frage, ob solch ein christlicher Nationalismus auch im deutschsprachigen Raum eine politische und religiöse Chance hat.

Lars Castellucci: #wird gut
Wenn es um Politik geht, treffen gegensätzliche, erregte Meinungen aufeinander. Aber was steht hinter diesen Meinungen? In der Seelsorge fragt man: Was ist das Thema im Thema? Das sollte man auch in der Politik häufiger tun. Dann würde man erkennen, dass unter der Meinungsoberfläche bestimmte Gefühle und Erfahrungen liegen, um die es eigentlich gehen sollte. Zum Beispiel Einsamkeit, Abgehängt-sein, Nicht-gehört-werden, Sich-übergangen-fühlen, Keine-Hoffnung-haben. Daraus kann Wut werden und daraus eine zerstörerische Politik. Der Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci möchte dagegen etwas tun. Deshalb sammelt er Menschen mit unterschiedlicher politischer Ausrichtung und aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, um unter «#wirdgut» Gegenerfahrungen des Gelingens und Fortschreitens zu teilen. Er will das Feld nicht denen überlassen, die schlechte Laune schieben oder den Unmut anderer ausbeuten. Lieber zeigt er Wege aus der Einsamkeit, die eben auch zu einem politischen Problem werden kann. Damit steht er zum Glück nicht allein, wie unsere RefLab-Kollegin Janna Horstmann beweist, die demnächst eine ganze Staffel ihres Psychologie-Podcasts «I Feel You» dem Thema Einsamkeit widmet.

Matthias Glaubrecht: Die Fülle des Lebens schützen, betrachten und achten
Alle (zumindest viele) reden vom Klimawandel, aber viel zu wenige vom Artensterben. Beides hängt miteinander zusammen, ist aber nicht dasselbe. Der Verlust an biologischer Vielfalt wird weniger durch die Erderwärmung verursacht als durch die übermäßige Nutzung von Land und Wasser durch den Menschen. Der Hamburger Biologe und Museumsleiter Matthias Glaubrecht hat darüber ein erhellendes und aufrüttelndes Buch veröffentlicht («Das stille Sterben der Natur. Wie wir die Artenvielfalt und uns selbst retten»). Mit ihm spreche ich über diese Gefahr und mögliche politische und ökologische Antworten. Wir sprechen aber auch darüber, dass es notwendig ist, dass wir Menschen die Welt um uns herum (und uns in ihr) anders betrachten, dass wir den Wert und die Würde anderer Lebewesen erkennen und respektieren. Das ist eine ökologische und politische, sogar juristische Aufgabe («Hat nur der Mensch oder hat auch die Natur Rechte? »). Es ist zudem eine persönliche, künstlerische und auch religiöse Frage. Denn viel hängt davon ab, wie wir die Welt/die Natur/den Kosmos/die Schöpfung betrachten. Was kann man dazu aus der christlichen Tradition oder von indigenen Religionen lernen?

Claudia Jetter: Evangelikale Frauen – einflussreich und unbekannt
Das Bild, das wir uns vom US-amerikanischen Protestantismus machen, ist stark Trump-fixiert. Unter Evangelikalismus verstehen die meisten Europäer heute eine fundamentalistische, frauenfeindliche religiös-politische Massenbewegung. Dabei kann man über den Evangelikalismus auch anderes berichten – zum Beispiel von sehr wirkmächtigen Frauen. Diese Frauen-Geschichten aus den vergangenen 200 Jahren können uns helfen, ein differenziertes Bild von US-amerikanischer Religion zu gewinnen – das hätte auch Folgen für unser Selbstverständnis im europäischen Christentum. Die Amerikanistin und evangelische Theologin Claudia Jetter (Berlin) hat intensiv zu evangelikalen Frauen geforscht und kann erstaunliche, beeindruckende, aber auch zwiespältige Geschichten erzählen. Genannt werden: Phoebe Palmer Sojourner Truth Phyllis Schlafly Beth Moore Jen Hatmaker

Eric Nussbaumer: Als Christ Politik machen – wie geht das? (Podcast-Festival)
Es gibt diese Dauerdebatte in Deutschland wie in der Schweiz: «Soll die Kirche politisch sein?» Meist bleibt dabei unklar, wer hier überhaupt mit «Kirche» oder «Politik» gemeint ist. Viel interessanter ist es, mit einem konkreten Menschen zu sprechen, der beides zugleich ist: Christenmensch und politischer Akteur. Eric Nussbaumer engagiert sich seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Schweizer Politik. 2024 war er Präsident des Nationalrates. Aber seine ersten Impulse, sich für das Gemeinwesen zu engagieren, empfing er in der Jugendarbeit seiner methodistischen Kirchengemeinde. Wie versucht er heute, das Christliche mit dem Politischen zu verbinden? Wo gelingt es ihm? Wo bleiben Widersprüche? Die politische Arbeit ist nicht einfacher geworden, auch in der Schweiz bewegt sich vieles in Richtung «Kampagnen-Demokratie». Nachdenkliche, vermittelnde Stimmen habe es zunehmend schwer. Umso wichtiger sind sie.

Mateo Kries: Design und Religion (was uns die Shaker heute lehren)
Im grandiosen Vitra Museum in Weil am Rhein, mitten im Dreiländereck Schweiz-Deutschland-Frankreich, gibt es noch bis Ende September eine grandiose und ziemlich religiöse Design-Ausstellung zu sehen. Gezeigt werden Alltagsgegenstände und Kunstwerke, die die Shaker vor allem im 19. Jahrhundert geschaffen haben – Design war für sie ein Ausdruck ihres Glaubens, ihrer Lebenshaltung. Warum das Design dieser winzigen (und heute fast ausgestorbenen) evangelischen Freikirche so weltberühmt ist, wer die Shaker überhaupt waren, was für eine Spiritualität sich in ihren Stühlen, Dosen, Besen und Schränken ausdrückt – und nicht zuletzt – was dies für die Kunst der Gestaltung heute bedeutet – darüber spreche ich mit Mateo Kries, dem Direktor des Vitra Museum.

Simon Kuntze: Erfahrungen und Gespräche in der West Bank
Wer sich über die Lage in Israel informieren möchte, hat viele Möglichkeiten. Aber wie ist die Situation zum Beispiel in der West Bank? Was denken und empfinden Palästinenser angesichts des Kriegs im Gaza-Streifen oder über ihre eigenen Konflikte mit der israelischen Regierung und radikalen jüdischen Siedlern? Wie ist überhaupt ihr alltägliches Leben? Davon hört man sehr wenig, aus mehreren Gründen. Zum Glück war mein Kollege Simon Kuntze gerade in der West Bank und hat mit vielen Menschen gesprochen. Er arbeitet im Berliner Missionswerk und ist dort für den Nahen Osten zuständig. Jenseits der üblichen medialen Frontstellungen erzählt er von seinen Erlebnissen und Wahrnehmungen. Das wirft ein anderes Licht auf die Debatten, die wir hier in Europa führen.

Yannic Han Biao Federer: «Ohne meine Trauer wäre ich ärmer»
Der Kölner Autor Yannic Han Biao Federer hat gerade ein sehr berührendes Buch veröffentlicht. In «Für immer seh ich dich wieder» erzählt er von einem großen Unglück, das seine Freundin und ihn getroffen hat: Wegen einer seltenen Komplikation starb ihr erstes Kind im Mutterleib. Da die Schwangerschaft schon sehr weit fortgeschritten war, musste Gustav Tian Ming geboren werden. Den Eltern blieb nur eine sehr kurze gemeinsame Zeit mit ihrem toten Kind. Davon erzählt Federer auf kunstvolle Weise schnörkellos und intensiv. Im Gespräch berichtet er, wie dieses Buch entstanden ist und was es seiner Freundin und ihm bedeutet: Sie waren fassungslos, aber dieses Buch ist der Versuch, für das Erlebte «eine Fassung zu finden». Wir sprechen auch darüber, was sein Buch – hoffentlich – Leserinnen und Lesern gibt – besonders denen, die Ähnliches erlebt haben. Man nimmt bei der Lektüre nicht nur Anteil an einem Unglück, das andere getroffen hat, sondern man erfährt auch, wie man selbst mit einer tiefen Trauer leben kann, was die Gemeinschaft mit anderen bedeutet, wie man einander hilft, wie man sich verwandelt. Besonders interessant fand ich, wie sich Federers Verhältnis zum christlichen Glauben sowie zu den religiösen Traditionen seiner chinesisch-indonesischen Familie in dieser Zeit verändert hat.

Olivia Gnauert: Wie viel Handy ist zu viel?
Alle reden von Handysucht. Aber was ist das eigentlich? Das Phänomen ist neu und entfaltet eine extreme Dynamik. Es stehen machtvolle Kräfte dahinter. Zum Glück haben sich die psychologische Wissenschaft und die Psychotherapie des Themas intensiv angenommen. Hier geht es nicht um schnelle, manchmal überdramatische Urteile. Vielmehr wird versucht, die Begriffe zu klären, die Phänomene genau zu beschreiben, um dann therapeutische Angebote zu entwickeln und einen gesunden Umgang mit neuen Medien zu ermöglichen. Letzteres ist unerlässlich, denn eine Internet-Abstinenz wird es nicht mehr geben. Wie also geht ein zufriedenes Leben mit Handy und Internet. Das erklärt die Psychologin Olivia Gnauert.

Henning Flad: Neue Entwicklungen beim deutschen Rechtsextremismus – ein Update
Mit Henning Flad von der «Arbeitsgemeinschaft Kirche + Rechtsextremismus» hatte ich schon zwei Podcasts aufgenommen, die sehr gut aufgenommen worden sind. Dieses Mal habe ich ihn danach gefragt, welche neue Entwicklungen und Dynamiken er bei den Rechtsradikalen innerhalb und außerhalb der AfD wahrnimmt – und wie sich das im internationalen Vergleich ausnimmt. Überrascht hat mich, dass er eine Wiederbelebung der Neo-Nazi-Szene feststellt. Zugleich analysiert er sehr eindrucksvoll die Radikalisierung der AfD, die sich zwar äußerlich von den alten Neo-Nazis abhebt, inhaltlich aber immer schärfe Töne anschlägt. Das zeigt sich auch einer entschiedenen Kirchenfeindlichkeit. Doch belässt Henning Flad es nicht dabei, gefährliche Dynamiken freizulegen. Er hat auch ein paar Hoffnung spendende Hinweise bereit.

Stephan Jütte: Direkte Demokratie auch für Deutschland?
Es ist ein hochaktuelles politisches (aber nicht tagespolitisches) Thema: Die Demokratie hat ein Repräsentanz-Problem. Das heißt: Zu viele Menschen fühlen sich von den politischen Parteien und Amtsinhabern nicht vertreten. Demokratische Parteien sollen der politischen Meinungsbildung und Entscheidungsfindung dienen, aber immer weniger Menschen engagieren sich in Parteien. Die Folge: Politik und Bevölkerung entfremden sich voneinander. Das ist eine gefährliche Entwicklung. So stellt sich die Frage, ob man die repräsentative Demokratie nicht ergänzen sollte um Formen der direkten Volksbefragung und -entscheidung. Von Deutschland aus blickt man da neugierig, neidisch oder ungläubig auf die Schweiz, wo es all dies schon seit langer Zeit gibt. Stephan Jütte erklärt und diskutiert, wie Volksbeteiligung in der Schweiz funktioniert und was Deutschland sich davon abschauen könnte. Wer regelmäßig bei Reflab zu Gast ist, kennt Stephan. Für die anderen: Stephan ist Theologe, Blogger und Podcaster, früher beim RefLab, heute bei der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz.

Anita Haviv: Ziviles Engagement in Israel
Natürlich kann man einiges über die Lage in Israel und den palästinensischen Gebieten aus den Medien erfahren. Aber es ist doch zu wenig, zu einseitig in der einen oder anderen Richtung. Zugleich sind durch den Krieg Möglichkeiten zur Begegnung abgeschnitten. Aber wie geht es Menschen in Israel – tief verletzt durch das Terrorpogrom der Hamas, schwer verunsichert durch das Versagen von Militär und Sicherheitsorganen, in grosser Sorge um die eigene Sicherheit, viele auch zunehmend kritisch gegenüber der Kriegsführung der eigenen Regierung – was heißt das für das eigene Leben? Und wie schauen sie auf den Antisemitismus in Europa? Darüber spreche ich mit Anita Haviv, die seit 1979 in der Nähe von Tel Aviv lebt und seit vielen Jahrzehnten Begegnungen zwischen Deutschen und Israelis gestaltet. Sie kennt also sehr genau die unterschiedlichsten Positionen und Perspektiven. Jetzt hat sie ein überaus lesenswertes Buch mit dem Titel „Solidarität heißt Handeln“ veröffentlicht, das in 17 Interviews mit sehr unterschiedlichen, ganz normalen Menschen zeigt, wie die israelische Zivilgesellschaft auf das Massaker vom 7. Oktober 2023 reagiert hat. Man kann es sehr günstig bei der Bundeszentrale für politische Bildung beziehen. Es öffnet den Blick für ein anderes Israel als das der Vorurteile und hält einige Inspirationen für das eigene Leben in der Schweiz oder in Deutschland bereit. Nachtrag des RefLab-Teams: In diesem Beitrag bilden wir eine engagierte und kritische Stimme aus Israel ab. Auch das Leid der Bevölkerung in Gaza geht uns nahe und wir werden versuchen, diese andere Seite des Konflikts bald mit einem weiteren Gespräch abzubilden. Hier gibt es auch eine weitere Folge vom RefLab zum Krieg in Nahost. ¨ Für reformiert. schrieb die freie Journalistin Karin A. Wenger zuletzt eine Reportage über eine drusische Familie, die in einem Dorf im Norden von Israel mit der Angst vor Raketenangriffen der Hisbollah-Miliz lebt. Ihre Kollegin Stella Männer besuchte ein christliches Dorf in Libanon, in dem die Raketen der israelischen Armee einschlagen. Hier reinhören: https://www.reflab.ch/von-den-menschen-im-krieg-erzaehlen/ Folge uns gerne auf Instagram: https://www.instagram.com/reflab.ch/

Psychologists for Future: Seelisch gesund in der Klimakrise
Die Klima-Krise ist nicht nur eine politische, technische und wirtschaftliche Großherausforderung, sondern auch eine psychologische. Wie gewinnen wir eine innere Haltung, mit der mir unser Leben und Handeln verändern können? Wie vermeiden wir, dass wir verhärten und gesprächsunfähig werden? Wie schützen wir uns vor Gefühlen der Vergeblichkeit und Sinnlosigkeit? Wie bleiben wir stabil, hoffnungsvoll und lebensfroh, obwohl wir um eine große Bedrohung wissen? Solchen Fragen widmen sich die Psychologists for Future. Eine von ihnen ist Ines Walter, Psychotherapeutin in Berlin.

Christian Kuhnt: Musik für alle – Kultur ohne Arroganz
Kein Mensch lebt ohne Kultur. Aber oft reden wir von «Kultur» so, als sei dies etwas für Leute, die etwas Besseres sind oder sich dafür halten. Immer noch unterscheiden wir zwischen «hoch» und «populär», «Ernst» und «Unterhaltung». Dadurch schließen wir die meisten Menschen von dem aus, was als «Kultur» gelten darf. Christian Kuhnt leitet seit vielen Jahren eines der größten Musikfestivals Europas: das Schleswig-Holstein Musikfestival. Ihm ist es persönlich und in seiner Arbeit ein Anliegen, gute Musik für möglichst viele Menschen erklingen zu lassen. Aber was ist eigentlich «gute Musik»? Nur Mozart oder auch Elton John? Welche Musik berührt und bewegt Menschen? Und wie öffnet man anderen die Ohren für Musik, die sie noch nicht kennen? Wenn Musik Menschen verbinden soll, können Rangordnungen und Abgrenzungen nur schaden. Darin liegt auch eine politische Aufgabe: Kultur kann spalten und die Gesellschaft in Höhere und Niedere einteilen; das ist ein Grund für die Erfolge des Rechtspopulismus auf dem Land und in Kleinstädten – dort fühlt man sich von den Großstädtern nicht gesehen oder verachtet; für die Zukunft der Demokratie kommt es auch darauf an, kulturelle Gräben zu überwinden. Übrigens, das sind Fragen, die auch die Kirchen und ihre Musikkulturen beschäftigen sollten.

Theaterkollektiv Turbo Pascal: Den Glauben spielen – eine Performance
Im vergangenen Oktober habe ich in den Berliner Sophiensälen die Performance «Faith Fiction» des Kollektivs Turbopascal miterlebt. Das war ein einmaliges Erlebnis, das mich immer noch beschäftigt. Den Glauben mitten im vermeintlich säkularen Berlin, in einer interaktiven Theaterperformance zum Thema machen – wie das gelingen kann und was dabei herauskommt, darüber spreche ich mit Angela Löhr und Frank Oberhäußer, der künstlerischen Leitung. Am Anfang der Produktion von «Faith Fiction» stand ein Text, den der Theaterkritiker und Journalist Dirk Pilz 2017 auf der Website «nachtkritik» veröffentlicht hatte. Ihn habe ich sehr geschätzt. Pilz war ein überaus kundiger Theaterfachmann und auf seine Weise ein sehr inspirierender Theologe. 2018 ist er viel zu früh verstorben. Deshalb hier einige Sätze aus einem Text, in dem er sich Gedanken über Religion und Theater gemacht hat – Gedanken, die Turbo Pascal bei der Vorbereitung ihrer Performance inspiriert haben: «Es ist ja nicht so, dass es einen Mangel an Religion auf deutschsprachigen Bühnen gäbe. Religion gehört schließlich nicht erst in der Gegenwart zu den umstrittensten und heikelsten Themen überhaupt. Aber Gläubige treten im deutschsprachigen Theater fast nur als Zerrbild auf, als Mängelwesen und bedauernswerte Tropfe, die den Anschluss an die Welt der Aufklärung und Vernunft verpasst zu haben scheinen… Religion wird durchweg zum diffusen Sammelbegriff für alles, was als irgend fremd, irrational oder überholt gilt, mitunter auch schlicht als Kennzeichen von Konservatismus. Sie wird so als das vorgeführt, was moderne, aufgeklärte Menschen nicht hätten – und auch nicht bräuchten.» Dass es genauso nicht ist, haben die Schauspielerinnen und Schauspieler von Turbo Pascal in ihren Vorarbeiten – langen Rechercheinterviews – und in ihrer Performance herausgefunden: Glaubensfragen bewegen immer noch, nur sind die Antworten inzwischen vielfältiger und vielschichtiger geworden. Wenn man sich über sie austauscht und das gängige Beschweigen von Religion überwindet, dann kann man sich und seine Mitmenschen besser kennenlernen.

Ruth Conrad: Warum wir mit dem Predigen noch lange nicht am Ende sind
Sie gehört zu jedem evangelischen Gottesdienst, aber aus unerfindlichen Gründen war sie noch nie ein Thema in diesem Podcast. Nun gibt es einen guten Anlass, dies zu ändern. Ruth Conrad, Professorin für Praktische Theologie in Berlin, hat gerade ein Kompendium zur Homiletik veröffentlicht. Aber keine Angst, es ist kein kiloschweres Handbuch, sondern ein sehr gut lesbares Essay. Darin zeigt sie, warum die Predigt immer noch wichtig ist, was Menschen von ihr erwarten und was die Bedingungen für ihr Gelingen sind. Als Motto dient ihr ein Satz des ukrainischen Schriftstellers Zhadan: „Das Herz der kleinsten Schwalbe ist stärker als der Nebel. Die Seele des hoffnungslosesten Vogels verdient unsere Sorge.“ Eine Predigt kann wie das Herz einer Schwalbe sein – ohne äußere Macht, aber voller Lebendigkeit, eine Kraft der Hoffnung. Die Predigt als Hoffnungsquelle zu bewahren, zu pflegen und zu lehren, ist für die Kirche unverzichtbar. Aber wie die Reaktion auf die Predigt von Mariann Budde zur Amtseinführung des neuen Präsidenten der USA gezeigt hat, kann sie auch viele Menschen jenseits der Kirchen ansprechen, anrühren, aufrütteln oder auch verärgern. Fast komisch aber ist dieser Widerspruch: Es sind so viele feste und negative Klischees über die Predigt im Umlauf – das war übrigens schon früher so –, aber die tatsächliche Predigtkultur ist kaum erforscht. Die Predigt – ein unbekannter Kontinent? Es lohnt, ihn zu erkunden, um so eine eigene Haltung zum und beim Predigen zu entwickeln. Ruth Conrad gibt dafür wertvolle Denkhinweise.

Olaf Zimmermann: Die Kunstfreiheit verteidigen! Aber gegen wen?
«Die Kunst ist frei. Eine Zensur findet nicht statt.» So oder ähnlich kann man es in allen Verfassungen demokratischer Staaten lesen. Kunstfreiheit ist ein unverzichtbares Menschenrecht. Aber sie ist in Gefahr. In den vergangenen zehn Jahren hat sich vor allem in Deutschland vieles verändert, was Anlass zur Sorge gibt. Olaf Zimmermann ist der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, des Dachverbands aller deutschen Kulturverbände, also so etwas wie Deutschlands oberster Kultur-Lobbyist. Genau beobachtet er, wie die Kunstfreiheit von oben, also von Staat und Politik, aber auch von einigen Medien, eingeschränkt wird (Stichwort «Antisemitismusklausel»). Aber auch von links, zum Beispiel durch den Boykott israelischer Künstlerinnen und Künstler. Oder von rechts, zum Beispiel durch digitale Kampagnen und höchst reale Bedrohungen von Kultur- und Gedenkeinrichtungen. Nun hat Olaf Zimmermann den Band «Kunstfreiheit» herausgegeben, der Artikel zum Thema aus den vergangenen Jahren versammelt, die in «Politik & Kultur», der Zeitung des Kulturrats, erschienen sind. Ein Gespräch über die vielfältigen Angriffe auf die Kunstfreiheit – und wie wir sie verteidigen können.

Thomas Zippert: Terror und Seelsorge
In der Not für die Seele sorgen – das ist zu einer kirchlichen Arbeit geworden, die hohe Anerkennung findet, auch bei nicht-religiösen Menschen. Vor besondere Herausforderungen wird die Notfallseelsorge durch Terroranschläge gestellt. Davon hat es in jüngster Zeit in Deutschland mehrere gegeben. In den Nachrichten heißt es dann regelmäßig: «Die Angehörigen werden seelsorgerlich betreut.» Thomas Zippert ist einer der Begründer der Notfallseelsorge in Deutschland und Herausgeber eines neuen Buchs zum Thema («Das neue Normal. Leben und Umgang mit Katastrophen in der Praxis der Notfallseelsorge»). Er erklärt, was Seelsorgerinnen und Seelsorger in diesem extremen Sonderfall tun oder tun sollten. Es ist eine schwierige Aufgabe. Denn verschiedene Gruppen brauchen Hilfe: die Verletzten, die Augenzeugen, die Ersthelfer, Polizistinnen und Feuerwehrleute, Angehörige, die Öffentlichkeit. All dies geschieht im Scheinwerferlicht. Denn der Einsatz ist von maximaler medialer Aufmerksamkeit begleitet. Zudem wird das Unheil sofort zum Gegenstand des politischen Streits. War der Täter ein Islamist oder ein Rechtsextremist, ein Ausländer oder ein Deutscher, kriminell oder psychisch krank? Verschiedene politische Parteien versuchen sofort, politischen Nutzen aus dem Schrecken zu ziehen. Kirchenvertreter dagegen rufen zu Besonnenheit und Zurückhaltung auf. Aber was täte den Betroffenen eigentlich gut? Was denken und fühlen sie selbst? Erstaunlich ist eine weltanschauliche Verschiebung. Früher wurde nach solch einem Unheil danach gefragt, wie Gott dies zulassen konnte. Heute wird darüber gestritten, warum der Staat es nicht verhindert hat. Hat die Religion also die Aufgabe an den Staat abgegeben, das Unerklärliche zu erklären? Aber wäre das ein Verlust? Die Notfallseelsorge kann sich doch jetzt darauf konzentrieren, die Betroffenen zu begleiten, zu stützen, vielleicht sogar zu trösten. Wie könnte es gelingen?

Markus Zink: Kirchenräume weiter denken, nutzen, gestalten!
Der Umbruch, in dem sich die europäischen Kirchen befinden, hat auch eine architektonische Seite: Was soll aus all den Kirchbauten werden? Diese Frage kann man auch auf säkuläre Kulturbauten anwenden. In Deutschland wird man sich absehbar nicht mehr die vielen Museen, Theater, Opern und Kulturhäuser leisten – und nicht mehr wie bisher nutzen – können. Doch dieser Frage hat sich die Kulturpolitik bisher noch nicht gestellt. Die Kirchen sind da mindestens zwei Schritte weiter und haben inzwischen viel versucht: Kirchen wurden abgegeben, umgebaut, mit neuen Partnern neu genutzt, manchmal aber auch abgebrochen. Dabei ist viel in Bewegung geraten, alte Tabus, was in einer Kirche erlaubt oder verboten sei, aufgebrochen. Neue Möglichkeiten wurden ausprobiert. Aber es gab auch bittere Verluste. Der hessische Theologe Markus Zink hat nun das Praxisbuch «Kirche kann mehr. Kirchenräume weiter denken, nutzen, gestalten» veröffentlicht. Es will Menschen Mut machen, denen ihre Kirchbauten am Herzen liegen, die aber vor schweren Entscheidungen stehen. Zink stellt Beispiele von gelungenen Kirchenumnutzungen vor, die überraschen, irritieren und anregen. Er zeigt, mit welcher Intensität sich Menschen in der Kirche darum bemühen, ihre architektonischen Schätze zu bewahren, indem sie diese für ihr Gemeinwesen neu zugänglich machen. Allerdings kann er auch zeigen, welche negativen Lernerfahrungen bisher gemacht wurden: Allzu oft hat man versäumt, interessierte Menschen vor Ort angemessen zu beteiligen und hat zu schnell und zu teuer umgebaut. Auch ist es ein schwerwiegender Fehler, dass evangelische und katholische Gebäudeplanungen fast nie miteinander abgeglichen werden. Auch hier braucht es mehr Ökumene.

Martin Schäuble und Ina Lambert: Über sexualisierte Gewalt reden
Martin Schäuble ist ein sehr anerkannter Jugendbuchautor, der sich schwierigen Themen stellt. In «Draußen mit Claussen» hat er vor einem Jahr über seinen Roman «Alle Farben grau» gesprochen, in dem er vom Suizid eines Jugendlichen erzählt. In seinem neuen Buch «Warum du schweigst» geht es um sexualisierte Gewalt im Breitensport. Dazu hat er intensiv recherchiert, mit Betroffenen und Fachleuten gesprochen. Viel hat ihm Ina Lambert, Geschäftsführerin von Safe Sport, geholfen. Erzählt wird die Geschichte von Lena. Fußball bedeutet ihr alles. Der neue Trainer bringt endlich Leidenschaft und Erfolg. Aber er fängt auch an, Grenzen zu überschreiten, erst unmerklich, dann immer massiver. Im Rückblick fragt man sich, warum das geschehen konnte, niemand eingeschritten ist oder geholfen hat. Es haben doch alle zumindest etwas gesehen, was sie hätte alarmieren müssen. Aber es fehlten das Interesse und der Mut einzuschreiten. Sensibel und genau erzählt Schäuble eine Geschichte, die sich so oder so ähnlich viel zu oft im Breitensport ereignet. Beim Lesen stellen sich sofort Assoziationen ein zu Grenzüberschreitung und Machtmissbrauch in Kirchengemeinden, Kultureinrichtungen oder Schulen. Es scheinen oft dieselben Dynamiken und Strukturen zu sein, die sexualisierte Gewalt möglich machen. Umso wichtiger ist eine Prävention, die Betroffene, Zeugen und Verantwortungsträger befähigt, sich zu wehren. Ina Lambert erklärt, wie sie gelingen kann. Und dass man die Aufarbeitung nicht vernachlässigen darf.

Gottesbilder – Menschenbilder
Das Verbot, sich Bilder von Gott zu machen und sie zu verehren, hat für das Christentum eine grundsätzliche Bedeutung. Würde man denken, besonders in der reformierten Schweiz. Aber wie ist es zu verstehen, dass in der Christentumsgeschichte so unzählbar viele und verwirrend unterschiedliche Gottesbilder gemalt, gezeichnet, geschnitzt, geformt und gefilmt wurden? Es scheint ein unstillbares Bedürfnis danach zu bestehen, den eigenen Glauben in einem Bild vorzustellen – sich und anderen. Wer also den eigenen Glauben und den seiner Mitmenschen besser verstehen möchte, sollte dessen Bilder betrachten. Nun habe ich gerade eine Geschichte der christlichen Kunst veröffentlicht («Gottes Bilder»). Das war ein guter Anlass, mit meiner Reflab-Kollegin Johanna Di Blasi, die im Unterschied zu mir eine richtige Kunsthistorikerin ist, über dieses unendliche Thema zu sprechen. Wir unterhalten uns über den Glauben und seine Bilder, der «Gebrauchswert» von Gottesbildern, Klassiker und Übersehenes, Uraltes und Hochmodernes.

Berthold Vogel: Einsamkeit und Ressentiment – undemokratische Gefühle?
Warum treffen Menschen politische Entscheidungen, die man selbst so gar nicht nachvollziehen kann? Weil sie böse Menschen sind? Warum sind rechtsextreme Personen und Positionen zurzeit so erfolgreich? Viele der bisherigen Antwortversuche bleiben an der Oberfläche und gehen nicht auf die tieferen – emotionalen, existentiellen – Ursachen ein. Das aber unternimmt die soziologische Studie «Einsamkeit und Ressentiment», die Jens Kersten, Claudia Neu und Berthold Vogel gemeinsam geschrieben haben. Die Studie beobachtet einen Zusammenhang zwischen Ressentiment und Einsamkeit, der zu antidemokratischen Einstellungen führen kann. Ressentiment ist ein Groll, der sich nicht frei entfaltet, um danach aufzuhören, sondern der in wütendem Grummeln dauerhaft am Leben erhalten bleibt. Man fühlt sich verletzt, zurückgesetzt, ausgeschlossen und reagiert darauf mit einer konstanten Schlechtgelauntheit, die zu Rachewünschen und am Ende auch zur Wahl rechtsextremer Parteien führen kann. Forscher sprechen von einer «Verbitterungsstörung». Sie hat aber reale Gründe: Man ist abgehängt. Man ist einsam. Der Göttinger Soziologe Berthold Vogel erklärt, was Einsamkeit mit Ressentiment zu tun hat, wo die realen Ursachen für beides liegen, ab wann es politisch gefährlich wird und was man als demokratische Gesellschaft tun kann.

Petra Bendel: Was die Wissenschaft über Migration sagt
Asyl und Migration sind die großen Erregungsthemen dieser Tage. Dafür gibt es Gründe. Die Verunsicherung ist groß. Sie wird aber auch geschürt. Verstörende Nachrichten, massive Bilder, verwirrende Debatten machen es einem nicht leicht, eine angemessene Haltung und Ausrichtung zu finden. Was zu oft übersehen wird: Es gibt eine inzwischen gut etablierte Migrationsforschung, in der Fachleute aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenarbeiten. Sie erhebt die Zahlen und Fakten, über die es zu sprechen gälte. Zudem erinnert sie an die normativen Grundlagen im deutschen, europäischen und internationalen Recht, die nicht leichtfertig geopfert werden dürfen. Schließlich arbeitet sie der Politik zu, berät und entwickelt eigene Programme, mit deren Hilfe Migration besser gesteuert und Integration möglich gemacht werden kann. Es würde in den aktuellen Diskussionen viel helfen, wenn mehr auf die Migrationsforschung gehört würde. Petra Bendel (Universität Erlangen-Nürnberg) arbeitet seit vielen Jahren in der Migrationsforschung und hat viele Veränderungen begleitet: die Entstehung einer europäischen Migrationspolitik Ende der 1990er Jahre, den Flüchtlingssommer 2015, die Ankunft von Menschen aus der Ukraine 2022 und jetzt der scharfe Gegenwind von rechts. Seriös erklärt sie, worum es heute geht, was zu tun ist und was auf keinen Fall geschehen sollte – engagiert und sachlich. Wer mehr über ihre Forschungen lesen möchte, klicke hier. Interessant ist auch ein Projekt, bei dem sie mitgearbeitet hat: Mit Hilfe eines digitalen Tools sollen Migranten und Zielorte besser aufeinander abgestimmt, gut gematcht werden. Die Zusammenarbeit mit den Kirchen ist Petra Bendel wichtig. Besonders die Bedeutung von Kirchengemeinden bei der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen hebt sie hervor. Sie empfiehlt auch die Lektüre einer Broschüre, die die katholische und evangelische Kirche in Deutschland 2021 veröffentlicht haben: «Migration menschenwürdig gestalten».

Dorothea Weltecke: Wie Religionen auch ohne «Toleranz» zusammenleben können
Die Berliner Historikerin Dorothea Weltecke hat ein aufregendes Buch geschrieben, das viele Vorstellungen von dem umstürzt, was «das» Christentum, «das» Judentum oder «der» Islam sein sollen. Eine ihrer Thesen in «Die drei Ringe. Warum die Religionen erst im Mittelalter entstanden sind» (München 2024) lautet, dass die drei monotheistischen Religionen sich erst in einer langen gemeinsamen Geschichte mit- und gegeneinander entwickelt haben. Dabei lässt sich das, was sie verbunden und unterschieden hat, nicht mit einem heutigen Begriff von «Religion» fassen. Es ging in ihnen weniger um Glauben, Lehre und persönliche Überzeugung, als um ein gemeinsames Tun, rituelle Regeln und Gesetze, Treue zu einer Tradition. (Für viele religiöse Menschen außerhalb Europas ist das immer noch so.) Das Mittelalter war viel bunter und diverser, als wir uns heute vorstellen. Wie gingen die Menschen damals mit der Tatsache um, dass andere Menschen anderen Traditionen folgten? Dazu erzählt Weltecke von den Reiseerlebnissen, die zwei christliche Mönche aus Uigurien, ein muslimischer Pilger und ein reisender Rabbi aus Regensburg im 12. und 13. Jahrhundert gemacht haben. Oder sie sammelt, sortiert und deutet die vielen und erstaunlich unterschiedlichen Varianten der berühmten «Ringparabel», die man sich früher in vielen Kulturen erzählt hat. In diesem Buch geraten beliebte europäische Meinungen ins Wanken. Zum Beispiel die Vorstellung, dass erst die europäische Moderne die Toleranz erfunden habe und die Zeiten vorher nur von Religionshass und -gewalt geprägt gewesen seien. Oder das Klischee, dass es vor der europäischen Aufklärung keine Formen und Strategien des religiösen Zusammenlebens gegeben habe. Oder, dass Absolutheitsansprüche und Kontroverstheologien immer gewaltträchtig seien. Die Irritationen, die Welteckes Buch auslöst, sind gerade heute so wichtig, da die europäische Moderne immer mehr als ein Sonderweg erscheint, den weite Teile der Welt nicht nachvollziehen werden. Kann man vom Mittelalter etwas darüber lernen, wie verschiedene Religionen friedlich miteinander leben können?

Critical Classics: Bachs Johannespassion – diskriminierungsfrei?
Welcher Text und welche Musik sind eigentlich heilig und dürfen nicht verändert werden? Die Initiative Critical Classics hat es vor kurzem gewagt und das Libretto von Mozarts „Zauberflöte“ verändert. Denn einige Stellen wirken heute diskriminierend, frauenfeindlich. Durften sie das – sollten sie es gar? Das hat ein ziemliches Medienecho ausgelöst. Manche stimmten zu, andere schimpften über Cancel Culture. Nun wendet sich diese Initiative einem der wichtigsten Werke der geistlichen Musik zu: der Johannespassion von Johann Sebastian Bach. Sollen nun die Verse, die als judenfeindlich angesehen werden, ersetzt werden? Schon seit vielen Jahren wird in der evangelischen Theologie und Kirchenmusik kritisch über Teile von Bachs Johannespassion diskutiert. Sie wirken nicht erst nach der Shoa judenfeindlich. Wie kann man das heute noch singen und spielen? Viel ist versucht worden an Bildungsarbeit in Gesprächen vor den Aufführungen, in Texten in Programmheften. Aber reicht das? Die Initiative Critical Classics möchte einen Schritt weiter gehen und Vorschläge machen, wie man einige Passagen diskriminierungsfrei gestalten könnte. Aber würde dabei nicht Wesentliches verloren gehen? Wer heute Bachs Johannespassion singt oder hört, denkt unseren historischen (und theologischen) Abstand zu ihr immer mit oder sollte es tun. Das reizt zum Nachdenken, ohne den es den musikalischen Genuss und die geistliche Erbauung nicht geben kann. Doch wie soll man sich auseinandersetzen, wenn das Anstößige ausgeschieden worden ist?

Anselm Schubert: Der diverse Christus
Mit kaum etwas anderem lassen sich Gemüter so verlässlich in Wallung bringen wie mit ungewohnten Verbindungen von Religiösem und Geschlechtlichem. So war es zuletzt wieder nach der Eröffnungsshow der Olympischen Spiele in Paris zu erleben: Rechtskatholiken wollten da einen Drag Queen-Christus erkannt haben. Bei der folgenden, unnötigen Debatte zeigte sich erneut, wie wenig die selbsterklärten Verteidiger des christlichen Abendlandes von ihrer eigenen Tradition wissen. Allerdings würde auch ihren aktivistischen Kontrahenten mehr historische Bildung gut tun. Denn wer einen schwulen Jesus malt, wie zur diesjährigen Semana Santa in Sevilla, oder in einer Predigt «Gott ist queer» ausruft, wie beim letzten Kirchentag, ist weniger innovativ, als er meint, sondern ein spätes Glied einer langen und verwickelten Traditionskette. Wie gut, dass Anselm Schubert, evangelischer Kirchenhistoriker in Erlangen, in seinem neuen Buch mit dem schönen Titel «Christus (m/w/d)» nun für Aufklärung sorgt. Gelehrt, gelassen und gut lesbar führt er die höchst unterschiedlichen Geschlechterkonzepte aus Antike, Mittelalter, früher Neuzeit und Moderne vor, mit denen Gläubige sich ein Bild ihres Christus gemacht haben. So kurios viele seiner Funde anmuten, bemüht er sich doch stets um eine faire Deutung. In den vergangenen Jahrzehnten brachten der feministische und danach der genderpolitische Einspruch gegen die Männlichkeit Christi erheblich Umwälzungen. Aus ihnen folgten Versuche, das Christusbild zu feminisieren oder zu «queeren». Schubert erkennt darin neue Gestalten einer imaginativen Geschlechtertheologie, die eine lange Vorgeschichte hat.

Raubgut zurückgeben
In dieser Folge geht es um ein riesiges Thema. Zum Glück habe ich meine liebe Kollegin Johanna Di Blasi dazu eingeladen, die sich hier richtig auskennt. Wir beiden beschäftigen uns seit einiger Zeit, ganz unabgesprochen und von verschiedenen Seiten, mit den Themen Kolonialismus, Postkolonialismus, Geschichte der christlichen Mission. Das ist ein weites, umkämpftes, aber auch sehr interessantes Feld. Viel ist in den vergangenen Jahren in Bewegung geraten. Will man sich annähern, hilft es, sich mit einem exemplarischen Beispiel von Aufarbeitung der Kolonialgeschichte genauer zu beschäftigen: den Rückgaben von Raubgut. Das können Kult- und Kunstwerke sein, aber auch „human remains“, also menschliche Gebeine. Davon gab und gibt es erschreckend viele in deutschen Museen und Forschungsdepots. Einige kamen nach dem Genozid an den Herero und Nama nach Deutschland, andere im Zuge sogenannter «rassenkundlicher» Forschungen. Das ist ein besonders abstossendes Beispiel von Rassismus. Am Beispiel der Rückgabe von «human remains» oder «ancestral remains» von Deutschland nach Namibia aber zeigt sich, wie kompliziert es werden kann. Denn anders als verabredet, wurden diese Gebeine nicht beigesetzt. Die unterschiedlichen Gruppen in Namibia konnten sich nämlich nicht darüber verständigen, wo und wie dies geschehen sollte. Hier, wie auch bei drei anderen Rückgaben an Namibia, zeigte sich, dass eine Restitution allein die Schuld- und Konfliktgeschichte keineswegs beendet, sondern im «Empfängerland» alte Konflikte neu wachrufen kann. Aber es gibt auch gelungene Beispiele von Restitutionen. Neue Begegnungen werden möglich und münden in echte Partnerschaften. Neue Modelle der Besitzübertragung oder des geteilten Besitzes werden ausprobiert. Für die ethnologischen Museen in Deutschland und ausserhalb ist das eine große Chance, ebenso für die kleineren und doch sehr interessanten Missionsmuseen. Denn die Aufarbeitung des Kolonialismus ist auch eine wichtige Aufgabe für die europäische Christenheit heute. War ihre Mission doch immer auch mit der militärischen und wirtschaftlichen Dominanz Europas verbunden.

Friedrich Kleine: Was macht die Seele im Gefängnis?
Es heißt, dass das Gefängnis ein Spiegel der Gesellschaft sei. Nur, wie kann man in einen Spiegel schauen, wenn man sich nicht vor ihn stellt? Deshalb habe ich einen alten Bekannten aus Vikarszeiten in der Justizvollzugsanstalt Hamburg-Fuhlsbüttel besucht. Friedrich Kleine arbeitet dort als evangelischer Gefängnisseelsorger. Anschaulich erzählt er mir von seinem besonderen Arbeitsalltag. Wie er morgens in sein Büro geht und die Anträge von Häftlingen durchgeht, die mit ihm sprechen möchten, und sich dann auf den Weg durch die große, geschlossene Anlage macht. Er hat es mit sogenannten Langstrafigen zu tun, die mehr als vier Jahre einsitzen müssen, manchmal bis zu lebenslang. Was wollen sie von ihm, und was kann er für sie tun? Gefängnisseelsorger haben einen Vorteil: Sie sind zwar Teil der Gefängniswelt, besitzen aber auch eine pastorale Unabhängigkeit. Was Häftlingen oder Bedienstete ihnen sagen, bleibt bei ihnen. In unserem Gespräch räumt Kleine mit so einigen Klischees auf, die ich mitgebracht hatte. Z.B. dass es im Gefängnis besonders gewalttätig zuginge. Das Hauptproblem seien die Langeweile, die ewig gleichen Routinen, das Abstumpfen und die Vereinsamung. Engagiert spricht Kleine sich dafür aus, an den Prinzipien des humanen Strafvollzugs und der Resozialisierung festzuhalten. Einzelne Sicherheitsverstöße (z.B. geflohene Freigänger) – und deren mediale Skandalisierung – führten zu schnell dazu, dass sinnvolle Lockerungen plötzlich eingeschränkt würden. Ein Schwerpunkt unseres Gesprächs war die Frage, was Seelsorge an Tätern sein kann. Sollte die Kirche sich nicht ausschließlich um die Opfer von Gewalt und Kriminalität kümmern? Wie kann man mit Tätern seelsorgerlich arbeiten, wenn diese sich gar nicht als Täter verstehen, weil sie ihre Schuld noch nicht angenommen haben? Im Laufe unseres Gesprächs darüber ging mir auf, dass diese Fragen, die im Gefängnis natürlich eine besondere Schärfe haben, mir auch draußen, in meiner vermeintlich normalen seelsorgerlichen Arbeit begegnen können. Das Gefängnis ist zwar eine Sonderwelt, aber eben auch ein Spiegel unserer Gesellschaft.

Kristian Fechtner: Mild religiös
Vielleicht gibt es doch mehr Religion hierzulande, als man gemeinhin annimmt. Man müsste sich nur neugieriger und unbefangener umsehen. Dann würde man feststellen, dass erstaunlich viele Menschen gern in Kirchen gehen, um eine Kerze zu entzünden. Oder kleine Bronzeengel verschenken. Oder sich sorgfältig auf Weihnachten vorbereiten. Oder heimlich beten. Oder regelmäßig Konzerte geistlicher Musik besuchen. Oder pilgern. Oder fasten. Oder oder oder. Solche unscheinbaren Formen spätmodern-christlicher Frömmigkeit hat der Praktische Theologe Kristian Fechtner von der Universität Mainz erkundet, ergründet und ein schönes Buch darüber geschrieben («Mild religiös», 2023). Und zwar mit Sympathie. Denn er hält viel von diesen Gestalten eines milden Christentums, die bei Gelegenheit aufleben, dabei aber stets etwas mit dem Leben der Menschen zu tun haben, die sie pflegen. Damit stellt er sich gegen eine alte und immer noch mächtige theologische Tendenz, die den Glauben vor allem normativ begreift – von der dogmatischen Lehre oder der kirchlichen Institution her. Nach ihr ist die Frömmigkeit, die «die Leute» selbständig gestalten, nie gut genug. Fechtner geht menschenfreundlicher, entspannter und konstruktiver mit der Gretchenfrage um und kommt zu positiveren Ergebnissen. «Wie hältst du’s mit der Religion – der Menschen heute?» Da gibt es mehr, was sich wertschätzen und wohlwollend bedenken lässt. Dass es leise, unaufdringlich, leicht zu übersehen, nicht medientauglich ist, spricht nicht dagegen, sondern dafür. Denn diese Frömmigkeit hat ihren Sinn nicht darin, sich über andere zu erheben oder von anderen abzugrenzen, sondern dem eigenen Leben (und dem der Nächsten) zu dienen.

Karin Berkemann: Kirchbauten gehören allen!
In Deutschland hat ein «Kirchenmanifest» für Aufsehen gesorgt. Es will eine öffentliche Debatte um die Zukunft kirchlicher Gebäude anstoßen – die nicht nur für Deutschland, sondern auch für die Schweiz nötig ist. Noch gibt es einen einzigartigen Reichtum an alten und modernen Kirchbauten. Bislang wurde er von den evangelischen und katholischen Kirchenmitgliedern mit ihren Kirchensteuern finanziert (wobei natürlich der staatliche und der zivilgesellschaftliche Denkmalschutz viel mitgeholfen haben). Aber mit dem demographischen Wandel, der nachlassenden Kirchenbindung und der abnehmenden Bereitschaft, Kirchensteuern zu zahlen, wird dies so nicht weitergehen. Viele Kirchengemeinden sind genötigt, sich zu überlegen, welche Finanzmittel sie für welche Gebäude einsetzen. Das führt zu harten Entscheidungen: Sakralbauten werden anders- oder neugenutzt, ab- und aufgegeben oder abgerissen. Hier setzt das «Kirchenmanifest» ein. Es zeigt, dass die Zukunft der Kirchbauten die ganze Gesellschaft angeht. Denn Kirchen sind nie nur Kirchen. Sie sind Kulturorte, in der regionale, nationale und europäische Traditionen aufbewahrt sind. Sie sind Gedächtnisorte, an denen ein Gemeinwesen seiner Geschichte gedenkt. Sie sind Versammlungsorte, an denen auch nicht-kirchliche Nachbarn ein eminentes Interesse haben sollten. Deshalb ruft das «Kirchenmanifest» alle Bürgerinnen und Bürger sowie die politisch Verantwortlichen auf, sich dieser kulturellen und sozialen Zukunftsaufgabe zu stellen. Wer dieses Anliegen unterstützen möchte, kann die Online-Petition unterzeichnen. Bisher stehen dort schon über 17.000 Namen. Einen praktischen Vorschlag gibt es auch: Kirchbauten, die nicht mehr benötigt würden, sollten in eine Stiftung (oder mehrere) überführt werden. Eine Diskussion mit einer Initiatorin des «Kirchenmanifests», der Kunsthistorikerin und Theologin Karin Berkemann.

Wolfgang Kraushaar: Wie man über den Israel-Palästina-Konflikt diskutieren sollte
Das Leben und Leiden der Menschen in Israel wie in Gaza und dem Westjordanland geht uns in Europa an. Leider stehen Sachkenntnis und Meinungsfreude selten in einem angemessenen Verhältnis. Vor allem kommt es zu vielen sprachlichen Entgleisungen und diskursiven Verhetzungen. Der renommierte Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar hat nun ein Buch veröffentlicht, das für dringend benötigte Orientierung sorgt („Israel: Hamas – Gaza – Palästina. Über einen scheinbar unlösbaren Konflikt“, Europäische Verlagsanstalt). In nur drei Wochen hat er es geschrieben, aber es ist alles andere als ein publizistischer Schnellschuss. Was Kraushaars Buch so wertvoll macht – neben einer klaren geschichtlichen Orientierung – ist, dass er einen der aktuellen Kampfbegriffe nach dem anderen untersucht. „Genozid“ – „Apartheid“ – „Kolonialismus“ – „Terroristen“ – „Islamismus“. Mit größtmöglicher Sachlichkeit, und dabei sehr um Fairness bemüht, legt Kraushaar offen, was an diesen Schlagworten dran ist – oder eben auch nicht. Oft genug dienen nämlich die geschichtlichen Gleichsetzungen (nicht Vergleiche) nicht dem Verstehen und der Verständigung, sondern der rhetorischen Erledigung des jeweiligen Feindes.

Serra Tavsanli: Johann Sebastian Bach und seine «Welt-Musik»
Er galt als der fünfte Evangelist des deutschen Protestantismus und ist doch längst ein universaler Komponist. Die Musik von Bach fasziniert heute Menschen in allen Teilen der Erde – egal, ob und wie sie religiös geprägt sind. Ein Beispiel dafür ist die aus der Türkei stammende und heute in Deutschland lebende Pianistin Serra Tavsanli. Schon als Kind begegnete sie in Istanbul Bachs Musik – dies sollte ihrem Leben eine unvorhergesehene Richtung geben. Ein Gespräch über die grenzüberschreitende Kraft geistlicher Musik. Als sie fünf Jahre alt war, schenkten ihr die (armenischen) Nachbarn ein Klavier, und ihre westlich eingestellten Eltern förderten sie bei ihren ersten Schritten in die klassische Musik. Eine Welt öffnete sich. Von entscheidendem Einfluss war Johann Sebastian Bach und ist es bis heute geblieben. Als Serra Tavsanli mit 19 Jahren an die Musikhochschule Hannover kam, lernte sie das weite Repertoire klassischer Klaviermusik kennen, aber Bach blieb für sie die Leitfigur. Inzwischen hat sie ihm drei Alben gewidmet. Das neue trägt den Titel «Inner Spaces». Denn es sind innere Räume, die seine Musik ihr geöffnet hat. So regelgeleitet seine Kompositionen erscheinen mögen, lassen sie der Interpretin doch sehr viel Freiheit, aus ihr etwas unverwechselbar Eigenes zu machen. Vielleicht ist dies das Geheimnis seiner weltweiten Wirkung. Denn so sehr Bach selbst Teil einer bestimmten, nationalen und konfessionellen Geschichte – eben des deutschen Protestantismus des 18. Jahrhunderts – gewesen war, ist er längst ein Welt-Komponist, der heute in Japan, Malaysia, Südafrika oder Südamerika Menschen verzaubert und dazu bringt, seine Werke aufzuführen. Das liegt sicherlich an der unsterblichen Qualität seiner Musik, aber auch an der Freiheit, die sie eröffnet. Das gilt auch für ihren religiösen Gehalt. Bachs geistliche Musik ist nicht auf den engen Bereich eines alten Luthertums beschränkt, sondern kann heute auch Menschen mit ganz anderen religiösen Prägungen. Ein besonders schönes Beispiel dafür ist Serra Tavsanli.

Juliane Stückrad: Die Dorfkirche – ethnologisch betrachtet
Nichts erscheint so vertraut und heimatlich wie die Dorfkirche, auch für Städter. Doch man bekommt einen ganz anderen Sinn für ihre religiöse, kulturelle und soziale Bedeutung, wenn man sie mit den Augen einer Ethnologin betrachtet. Idyllische Projektionen lösen sich dann auf, und es kommt eine überraschend vielfältige Wirklichkeit zum Vorschein. Die Ethnologin Juliane Stückrad hat vor kurzem ein sehr lesenswertes Buch veröffentlicht: «Die Unmutigen und die Mutigen». Darin beschreibt sie mit großer Sensibilität und ethnologischer Kompetenz die Lebenseinstellungen von Menschen in Brandenburg. Irritierend und erhellend ist besonders, was sie über die «Unmutigen» schreibt – Menschen, die sich abgehängt fühlen und darauf mit Wut reagieren. Wer die tieferen Gründe für kommunikative und körperliche Gewalt in politischen Auseinandersetzungen heute verstehen will, sollte dieses Buch lesen. Aber es hat zum Glück auch einen zweiten Teil. Darin widmet Stückrad sich den «Mutigen» – Menschen, die sich nicht unterkriegen lassen, sondern gemeinsam etwas auf die Beine stelle. Das muss gar nichts Großartiges sein. Es geht ihr nicht um spektakuläre Erfolgsgeschichten, sondern um schlichtes soziales Engagement und gelebte Humanität. Beispielhaft steht dafür der Einsatz vieler Menschen in den ländlichen Gebieten Ostdeutschlands für ihre Dorfkirchen. Selbst Menschen, die von sich sagen, dass sie «mit der Kirche nichts am Hut haben», zeigen hier einen erstaunlichen Einsatz. Was in und um Dorfkirchen heute geschehen kann – an kulturellem Leben und demokratischem Engagement –, das erkundet Stückrad als Ethnologin im eigenen Land, und zwar so, dass man als Theologe viel Neues erfährt. Zum Beispiel, was Dorfkirchen mit Ahnenkult und menschenfreundlicher Magie zu tun haben.

Jörg Herrmann: Wie eine Pracht-Straße «arisch» wurde
Der Neue Wall ist eine der teuersten Straßen Hamburgs. Ein Luxusgeschäft reiht sich ans andere. Doch wem gehören die prächtigen Häuser heute, und wem haben sie früher gehört? Während der NS-Diktatur wurden hier viele jüdische Menschen ihres Eigentums beraubt. Ein Projekt der Evangelischen Akademie der Nordkirche hat diese Geschichte nun erforscht – Haus für Haus. Warum und wie sie dies getan hat, erzählt Jörg Herrmann, der Akademiedirektor. Ein Gespräch über ein Stück Hamburger Lokalgeschichte, das beispielhaft ist für ganz Deutschland.

Jörg Lüer: Die Ukraine besuchen (nicht nur einmal)
An diesen Krieg kann man sich nicht gewöhnen. Aber die mediale Berichterstattung stumpft auch ab. Deshalb ist es wichtig, wenn Menschen die Ukraine besuchen und wir ihnen zuhören. Dr. Jörg Lüer, Geschäftsführer des katholischen think tanks «Justicia et Pax», war gerade – zum wiederholten Mal – dort und kann aus erster Hand berichten.

Nicola Kuhn: Koloniale Erbstücke – bei uns zu Hause
Kolonialismus ist nach langem Schweigen wieder ein öffentliches Thema. Es gibt heftige Debatten über Unrecht, Wiedergutmachung, Rückgabe von Beutestücken. Aber was heisst das für einen selbst? Wo finden wir in unserer Familiengeschichte, in unseren eigenen vier Wänden koloniale Erbstücke, die uns zu einer persönlichen Aufarbeitung bewegen? Die Kulturjournalistin Nicola Kuhn (Tagesspiegel) hat darüber das sehr lesenswerte Buch, «Der chinesische Paravent. Wie der Kolonialismus in deutsche Wohnzimmer kam» geschrieben.

Alte Kunst neu sehen
Es ist gar nicht so leicht, Menschen heute den Sinn und die Schönheit alter christlicher Kunst nahezubringen. Im Berliner Bode-Museum aber lässt man sich dafür viel Überraschendes und Augenöffnendes einfallen. Ein Gespräch mit der Kuratorin Maria Lopez-Fanjul y Diez del Corral.

Warum ist die AfD in Ostdeutschland so erfolgreich (und nicht nur dort)?
Drei Landtagswahlen sowie Kommunalwahlen in Ostdeutschland könnten in diesem Jahr der in großen Teilen rechtsextremen AfD hohe Gewinne bringen. Wie ist das zu erklären, und was bedeutet es für die Demokratie? Erklärungsversuche eines der besten Kenner des ostdeutschen Rechtsextremismus, David Begrich (Miteinander e.V.).

Mit jungen Muslimen in Deutschland über den Nahost-Konflikt sprechen
Der Krieg zwischen Israel und der Hamas hat viele Opfer. Auch in Europa treibt er die Menschen um und verschärft Konflikte zwischen Gruppen, die sich im Alltag zu selten direkt begegnen. Wie denken und empfinden junge Muslime in Deutschland darüber? Wie kann man mit ihnen argumentieren? Ein Gespräch mit Imam Scharjil Ahmad Khalid von der Khadija-Moschee in Berlin-Pankow.

Bilder zum Sich-Aufschwingen
Caspar David Friedrich fasziniert, nicht nur in diesem Jubiläumsjahr. Aber worin besteht diese Faszination genau? Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Helfen kann zum Glück die Kunsthistorikerin Dr. Birte Frenssen vom Pommerschen Landesmuseum Greifswald, Friedrichs Heimatstadt. Sie erklärt, was seine Landschaftsbilder so bedeutsam macht, wo sie einen religiösen Sinn in sich tragen und Menschen einen Anstoß geben, sich „aufzuschwingen“, und wie sie unsere Wahrnehmung der Natur vertiefen können.

Die dunkle Seite der Emanzipation
Die „Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche“ (HuK) setzt sich seit langem für Gleichberechtigung ein. In den deutschen Kirchen hat sie viel bewirkt. Nun aber hat sie einen verstörenden Aspekt ihrer Geschichte aufarbeiten lassen: ihre fehlende Abgrenzung von Pädosexuellen.

Haben die Menschenrechte einen christlichen Ursprung?
Nicht wenige Zeitgenossen meinen, Christentum und Menschenrechte wären Gegensätze. Dabei gibt es auch christliche Begründungen einer Rechtskultur der Glaubensfreiheit und Toleranz. Eine berühmte Forschungsthese behauptet sogar: Die Menschenrechte hätten einen religiösen Ursprung. In ihrer preisgekrönten Dissertation hat die Rechtswissenschaftlerin Annabelle Meier sie überprüft. Ihre Arbeit ist wichtig für das historische Verständnis, aber auch für das heutige Engagement für Menschenrechte.

Jazz und Spiritualität
Musik kann, so heisst es, eine Art Gottesdienst sein. Oder religiöse Erfahrungen eröffnen. Besonders häufig wird das über den Jazz gesagt. Aber wie genau ist das zu verstehen, zu spielen und zu hören? Ein Gespräch mit dem Saxophonisten und Autor Uwe Steinmetz.

Bruder Franz – über ein radikales und frohes Leben
Kein Heiliger wurde so verehrt. Aber in protestantischen Gegenden kennt man ihn kaum. In säkularen Zeiten gerät er ins Vergessen. Der Jugendbuchautor Alois Prinz hat jetzt das Leben des Franz von Assisi so erzählt, dass er plötzlich wieder interessant und gegenwärtig wird.

Irina Rastorgujewa: Diktaturen verstehen – mit Hilfe der Literatur
Diktaturen sind Staatsmaschinen, die Menschen verschlingen. Um ihre Mechanik zu verstehen, kann die Literatur helfen. Nun hat die aus Russland stammende Autorin Irina Rastorgujewa eine große, bisher unbekannte Erzählung über den stalinistischen Terror ins Deutsche übersetzt (Georgi Demidows «Fone Kwas»). Was lehrt sie uns heute?

Sabine Dreßler: Christlich für Menschenrechte eintreten
Gerade ist der sehr lesenswerte 3. Ökumenischer Bericht zur Religionsfreiheit erschienen. Am Beispiel des Menschenrechts auf Religions-, Gedanken- und Gewissensfreiheit schaut er auf Grundfragen und verschiedene Länder in der Ferne – und damit auch auf die Menschenrechtslage bei uns. Ein Gespräch mit Sabine Dressler, die als Geschäftsführerin für die Fertigstellung dieses wichtigen Textes gesorgt hat.
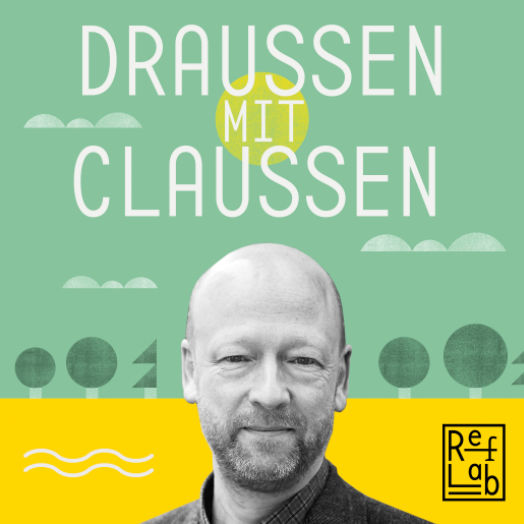
Klima und Kirche
«Protestantismus» hatte von Beginn an auch mit «Protest» zu tun. Das gilt auch für die Gegenwart der ökologischen Krisen und Konflikte. Wie soll die evangelische Kirche hier Stellung beziehen? Was kann sie für mehr Klimaschutz und Klimagerechtigkeit tun? Was wäre ihr unverwechselbarer Beitrag? Ein Gespräch mit Anna-Nicole Heinrich, der Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland.

Dorothee Sölle – was bleibt von dieser protestantischen Ikone?
Sie war die erste prominente Theologin in Deutschland. Vor zwanzig Jahren ist sie verstorben. Was bleibt von ihrem Werk und ihrem Engagement? Ein Gespräch mit dem Theologen und Journalisten Konstantin Sacher. Er hat zum Gedenktag das Buch „Dorothee Sölle auf der Spur. Annäherung an eine Ikone des Protestantismus“ geschrieben.

Neu nachdenken über Prostitution: Sexkauf verbieten?
Elke Mack hat vor kurzem eine rechtliche und rechtsethische Studie mit dem Titel „Sexkauf“ veröffentlicht, die in Deutschland für großes Aufsehen in Politik und Medien gesorgt hat.

Suizid – worüber wir reden sollten
Über Suizide, vor allem von jungen Menschen, wird wenig gesprochen. Zum einen, weil es unfassbar ist. Zum anderen, weil man Nachahmung befürchtet. Der Jugendbuchautor Martin Schäuble aber hat es versucht. Basierend auf einer wirklichen Geschichte, hat er einen Roman über den Suizid eines 16-jährigen Jungen geschrieben („Alle Farben grau“).

Weniger werden
Die evangelische Kirche in Deutschland verliert Mitglieder – in epochalem Ausmaß. Zugleich herrscht in der Kirche eine seltsame Sprachlosigkeit. Viele scheinen zu verstummen. Wie kann man die aktuelle Entwicklung verstehen, wie mit ihr umgehen? Ein Gespräch mit Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutsche Kulturrats und streitbarer Protestant.

Himmlische Verse aus dem «Irrenhaus»
In Italien gilt Alda Merini als eine der größten Dichterinnen der Moderne. Ihre Verse bezeugen ein beispielloses Leben aus Schmerz, Krankheit, Gewalt, Glaube, Liebe und Freude. Die Theologiestudentin Magdalena Bredendiek hat sie jetzt für den deutschsprachigen Raum entdeckt.

Das Wenige ist das Wesentliche
Wie kann ich mich auf das konzentrieren, was ich wirklich brauche? Wie kann ich mich befreien aus der Spirale des Konsums und der Selbstentfremdung im Digitalen? Der Schriftsteller und Dramaturg John von Düffel hat darüber ein bemerkenswertes Buch geschrieben.

Ein anderer Blick auf Äthiopien
Vor wenigen Wochen sprach ich über den äthiopischen Bürgerkrieg mit einer Frau, die aus Tigray stammt. Heute nehme ich das Thema wieder mit einer anderen Perspektive auf den Konflikt. Ich spreche mit Sebastian Brandis, der die Stiftung „Menschen für Menschen“ leitet und gerade aus Äthiopien zurückgekehrt ist. Er hat Interessantes über dieses Land zu erzählen, auch über seinen eigenen Lebensweg.

Anton G. Leitner: «Ein Leben für die Poesie»
Wie kaum ein anderer hat sich Anton G. Leitner als Autor und Verleger der Poesie verschrieben. Seine wunderbare Zeitschrift „Das Gedicht“ feiert deshalb gerade groß ihren 30. Geburtstag. Einen besonderen Sinn hat Leitner für religiöse Spuren in der zeitgenössischen Lyrik. Aber wann kann man sagen, dass ein Gedicht religiös sei?

Wie können wir über Missbrauch sprechen – miteinander?
Sexualisierte Grenzüberschreitung und Gewalt sind endlich ein öffentliches Thema. Aber haben wir schon eine richtige Form gefunden, ehrlich und persönlich darüber zu sprechen? Und zwar nicht nur „darüber“, sondern miteinander? Ein Gespräch mit dem katholischen Theologen und Familientherapeuten Justinus Jakobs (Kinder- und Jugendheim der Caritas, Rheine).

Die Vertreibung christlicher Gemeinschaften aus dem Nahen Osten
Die europäische Christenheit hält sich immer noch für den Nabel der Welt. Zurzeit kreist sie am liebsten um die eigene Krise. Hilfreich wäre ein Perspektivwechsel. Claudia Rammelt könnte dabei helfen. Sie forscht seit vielen Jahren an der Universität Bochum über die Lage christlicher Gemeinschaften im Nahen Osten. Zugleich engagiert sie sich im Netzwerk „Migrationskirchen vor Ort“. Denn beides hängt miteinander zusammen: Die Situation der Christen dort und hier.

Albrecht Philipps: Ein Besuch im Ost-Kongo
Im Osten Kongos wüten immer noch grausame Unruhen. Aber hierzulande scheint sich niemand mehr dafür zu interessieren. Albrecht Philipps hat diese Region kürzlich mit einer Delegation der evangelischen Landeskirche von Westfalen besucht. Er hat Erschütterndes erlebt und versucht, seine Eindrücke zu sortieren.

Vom Leben erzählen, von der Liebe, dem Altern und vom Sterben
Helga Schubert ist eine wunderbare Schriftstellerin. Wunderbar ist auch die Geschichte ihres Schreibens. Vor über fünfzig Jahren fing sie an, damals noch in DDR, dann war es lange still um sie. 2020 aber gewann sie wie aus dem Nichts den Bachmann-Preis, und das Buch dazu – „Vom Aufstehen“ – wurde ein großer Erfolg. Jetzt ist das neue Buch der 83-Jährigen erschienen: „Der heutige Tag. Ein Stundenbuch der Liebe“. Ein Gespräch über Bücher, die zum Leben und beim Sterben helfen, sowie über die Schönheit des Einfachen.

Äthiopien: ein vergessener Bürgerkrieg
Tigray ist uns näher, als wir vielleicht meinen. Der dortige Bürgerkrieg stellt grundsätzliche Fragen, auch über die Bedeutung christlicher Kultur und über die Rolle der Kirchen in diesem Konflikt. Ein Gespräch mit der ursprünglich aus Tigray stammenden Wissenschaftlerin Aster Gebrekirstos.

Wolfgang Kraushaar: Wie verteidigt man die Demokratie?
Es heißt, die Demokratie sei in Gefahr. Radikalisiert sich die Klimabewegung? Oder ist rechter Terror die eigentliche Bedrohung? Ein Gespräch mit Wolfgang Kraushaar, einem der besten Kenner und Analytiker von Protestbewegungen und extremistischem Terror.

Nur Ben Shalom: Lebensmelodien – Musik im Angesicht der Shoah
„Berlin ist für mich wie ein offenes Grab“, sagt der jüdische Klarinettist Nur Ben Shalom. Gerade deshalb hat er sein einzigartiges Musik-Projekt „Lebensmelodien“ genannt. Auch zwischen 1933 und 1945 haben jüdische Musikerinnen und Musiker komponiert und musiziert, einfache jüdische Menschen haben gesungen. Unter Verfolgung, in Ghettos und Lager, angesichts des nahenden Todes haben sie mit ihrer Kunst Zeugnis abgelegt, ihre Würde verteidigt, zu trösten versucht. Zum Glück konnten einige dieser Werke gerettet werden. Nun hat es sich Ben Shalom zur Aufgabe gemacht, sie wieder zu Gehör zu bringen. Was hat ihn dazu bewegt? Was erlebt er dabei?

Ach, das Kreuz!
Man kann den Eindruck bekommen, dass über das Kreuz nur noch erbittert gestritten wird. Der Sinn und die Sinnabgründe des wichtigsten christlichen Symbols geraten da meist aus dem Blick. Zum Glück hat Kathrin Müller gerade ein wunderbares Buch über die „Objektgeschichte“ des Kreuzes geschrieben, das die Höhen und Tiefen dieses Symbols ausmisst. Sie zeigt, was am Kreuz bleibend faszinierend und anstößig ist.

Der Pfarrer als Abrüstungsminister
Reiner Eppelmann war ein widerständiger Pfarrer und Politiker. Legendär sind seine Ost-Berliner Blues-Gottesdienste in den 1980er Jahren, mit denen er Jugendliche begeisterte und in der DDR kirchliche Freiräume schuf: Kirche als Schule der Demokratie. Als Bürgerrechtler gestaltete er die Friedliche Revolution mit. Als letzter Verteidigungsminister der DDR leistete er einen großen Beitrag zur Abrüstung. Nach der Wiedervereinigung zog er in den Bundestag ein. Heute setzt er sich für die Aufarbeitung des DDR-Unrechts ein.
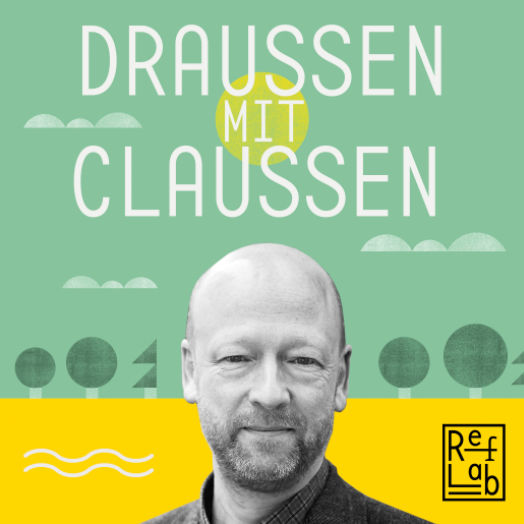
Daniela Sepehri: «Frauen Leben Freiheit»
Seit drei Monaten leisten Menschen Widerstand gegen die islamistische Diktatur. Viele sind dafür ermordet oder verschleppt worden. Dennoch haben sie schon jetzt das Land von Grund auf verändert. Doch wie kann es weitergehen? Und wie können wir die Menschen im Iran von Europa aus unterstützen? Die Deutsch-Iranerin Daniela Sepehri nutzt soziale Netzwerke, um Informationen und Solidarität zu verbreiten.

Sarah Vecera: «Wie ist Jesus weiß geworden?»
Ein Gespräch mit der Theologin und Autorin Sarah Vecera über Rassismus und darüber, wie eine Kirche ohne ihn möglich wäre.

Albert Frey: Lieder für den ganz Anderen
„Lobpreis“ ist eine Form christlicher Popularmusik, an der sich manche Geister scheiden. Aber es ist auch nur ein Etikett. Interessanter ist es, sich diese Lieder, ihre Frömmigkeit und die Menschen anzuschauen, die sich machen. Und da ist vieles in Bewegung, wie der christliche Singer-Songwriter Albert Frey berichten kann.

Matthias Matschke: «Falschgeld»
Matthias Matschke ist sehr bekannt als Schauspieler und Comedian. Nun hat er einen wunderschönen Roman geschrieben. In «Falschgeld» erzählt er über die Kindheit und Jugend von «Matthias Matschke». Was daran Wahrheit oder Erfindung oder erfundene Wahrheit ist und warum der Protestantismus darin solch eine überraschend große Rolle spielt, spreche ich mit dem Autor Matthias Matschke.

Jaana Espenlaub: Arbeiterkind – wohin?
Die soziale Frage ist endlich wieder im Fokus. Aber schon vor dem russischen Angriffskrieg und dem drohenden kalten Winter ist soziale Ungerechtigkeit ein drängendes Problem gewesen. Dazu kam Statistiken studieren oder – noch besser – sich individuelle Lebensgeschichten anhören. Was heißt es heute, ein „Arbeiterkind“ zu sein, also aus einem nicht-akademischen Haushalt zu stammen? Welche Schwellen muss man überwinden, um die eigenen Begabungen zu entfalten? Jaana Espenlaub (eine studierte Theologin) arbeitet bei „arbeiterkind.de“ und unterstützt junge Menschen, die als erste in ihren Familien ein Studium antreten möchten.

Imam Scharjil Ahmad Khalid: Missionarischer Islam
Sie waren die ersten, die das Bild des Islam in Deutschland geprägt haben. Immer noch ist die Ahmadiyya-Bewegung sehr aktiv, auch wenn sie vom Mehrheitsislam abgelehnt wird. Interessant ist sie, weil sie in besonderer Weise für einen missionarischen Islam steht. Ein Gespräch mit dem Imam Scharjil Ahmad Khalid aus Berlin.

Die Zukunft der Arbeit! Die Zukunft der Kirche?
Technische Innovationen, immense Strukturveränderungen – wohin führt das? Zu mehr Vereinzelung und Einsamkeit oder zu neuen gemeinsamen Aufbrüchen? Und was bedeutet das für das Christentum? Ein Gespräch mit dem Wirtschaftsjournalisten und Zukunftsforscher Erik Händeler, der keinen Grund für Kulturpessimismus sieht.

Reinhard Flogaus: Patriarch Kirill
Der Berliner Theologe Reinhard Flogaus betreibt ein aufregendes Forschungsvorhaben. Der Ostkirchen-Experte sammelt und analysiert Reden, Predigten und Medienerklärungen des russischen Patriarchen Kirill, in denen dieser seine nationalreligiöse Ideologie verbreitet. Dadurch kann Flogaus die tieferen Gründe der russischen Aggression und die Verstrickung der russischen Orthodoxie sichtbar machen.

Olaf Zimmermann: Wie weiter mit der Documenta?
Diese Documenta wurde zum Skandal. Es gibt Experten, die vom größten Antisemitismusskandal nach 1945 sprechen. Die Medien berichten ohne Unterlass über den tiefen Fall der einst wichtigsten Kunstausstellung der Welt. Aber was geschieht hier eigentlich? Wer macht was? Keiner kann einen so guten Blick hinter die Kulissen der Empörung eröffnen wie Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, dem Dachverband aller deutschen Kulturverbände.

Ellen Ueberschär: Ein Weltkirchenrat und eine Welt voller Krisen
Im September trifft sich der Weltkirchenrat – eine Art UNO der Christenheit – in Karlsruhe. Ursprünglich war dies eine Anlass zur Freude. Inzwischen wächst die Sorge, dass es wegen zwei Themen zu massiven Konflikten kommt. Strittig ist der Umgang mit der Russisch-Orthodoxen Kirche sowie mit dem palästinensisch-israelischen Konflikt. Mit einem Offenen Brief hat Ellen Ueberschär versucht, eine Debatte zu eröffnen. Sie war Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags, dann im Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung und ist jetzt Mitglied im Vorstand der Stephanus-Stiftung, einem großen diakonischen Träger in Berlin.

Jesus spielen
Der Faszination der Oberammergauer Passionsspiele kann man sich nicht entziehen – auch wenn man protestantisch geprägt ist oder unreligiös. Aber was bedeutet es, in diesem traditionsreichen und gründlich modernisierten Theaterstück der ganz anderen Art den Jesus zu geben? Davon erzählt Rochus Rückel, einer der beiden Jesusdarsteller der diesjährigen Passionsspiele.

Bernhard Fischer-Appelt: Neu über Zukunft nachdenken
Wenn das Stichwort „Zukunft“ fällt, löst dies bei vielen vor allem Ängste aus. Vorbei sind die Zeiten, als „Zukunft“ nach „Fortschritt“ oder „Verheißung“ schmeckte. Aber ob wir es wollen oder nicht, die Zukunft wird kommen. Also müssen wir ein konstruktives Verhältnis zu ihr gewinnen und uns aus Lähmungen lösen. Wir müssen uns darüber verständigen, welche Zukunft wir schaffen wollen und welche Rolle den guten Erbstücken aus der Vergangenheit dabei zukommt. Der Hamburger Unternehmer und Zukunftsforscher Bernhard Fischer-Appelt hat zu diesen Fragen in Harvard geforscht und gerade das Buch „Zukunftslärm“ dazu veröffentlicht. Ein Gespräch über die „Zukünfte“, die uns drohen oder die wir gestalten wollen. Wir entschuldigen uns für die nicht optimale Audio-Qualität des Beitrags.
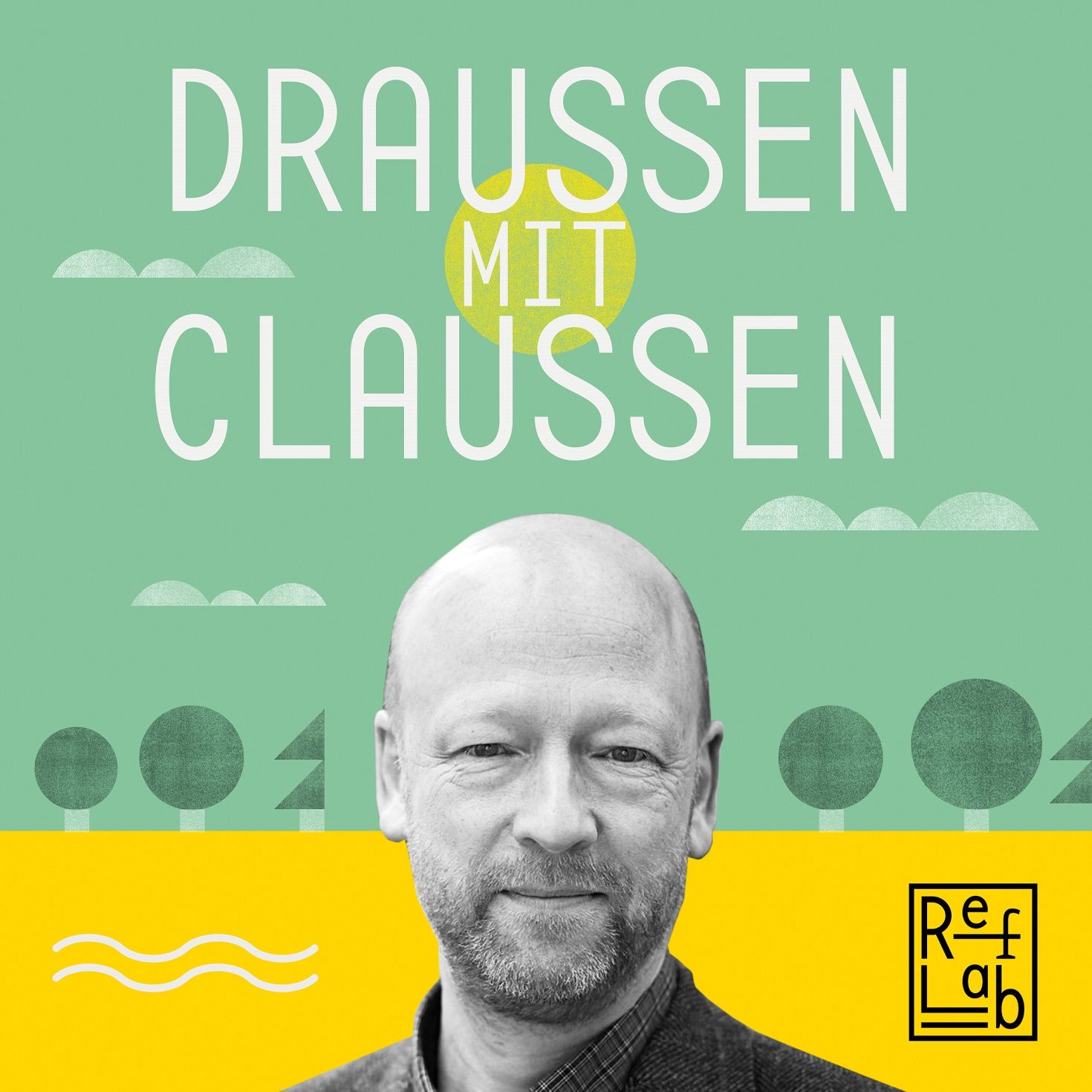
Der Krieg in der Ukraine und das Ende der Neutralität
Die deutsche Schriftstellerin Dorothea Grünzweig lebt seit vielen Jahren in Finnland. Genau beobachtet sie, wie sich die Stimmung in ihrer Wahl-Heimat seit dem russischen Angriff auf die Ukraine verändert hat. Es ist so wichtig, dass wir in Deutschland und der Schweiz Stimmen wie ihrer zuhören. Das hilft uns, aus der Selbstbezüglichkeit unserer Sorgen und Debatten herauszukommen. Dorothea Grünzweig (* 1952) zählt zu den bedeutendsten deutschen Lyrikerinnen der Gegenwart. In Gedichtbänden wie „Kaamos Kosmos“ (2014) oder „Plötzlich alles da“ (2020) finden sich feine Naturerfahrungen, familiäre Tiefenbohrungen, inspirierende Verbindungen zwischen dem Deutschen und dem Finnischen, aber auch eine überraschende Präsenz christlicher Sprachbilder.

Wie alles anfing – der Fortschritt, die Kriege, der Klimawandel, die Religion – vor 7.500 Jahren
„Die Erfindung der Götter“ heißt eine Augen öffnende Ausstellung im Niedersächsischen Landesmuseum Hannover. Sie erzählt von der großen Revolution der Jungsteinzeit, in deren Schatten wir immer noch leben. Denn damals schon begann das Anthropozän. Die Landwirtschaft wurde erfunden, das Rad, soziale Unterschiede, aber auch neue Religionen. Zum ersten Mal kam es zu Kriegen. Zugezogene Siedler verdrängten die alteingesessenen Sammler und Jäger. Angesichts aktueller Krisen ist es gut, einmal Abstand zu nehmen und die eigene Gegenwart aus einer größeren, menschheitsgeschichtlichen Perspektive zu betrachten. Dazu kam man Yuval Harari lesen oder eben diese Ausstellung in Hannover besuchen.

Der Krieg – von Riga aus gesehen
Man mag das Wort kaum aussprechen, aber in den „Frontstaaten“ wird der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine anders erlebt und beurteilt als in Deutschland oder der Schweiz. Stefan Meissner, der seit vielen Jahren in Riga lebt und sich dort in der evangelischen Kirche engagiert, berichtet von seinen Erfahrungen.

Gottesdienst – der unbekannte Kontinent
Zum Wesen des Gottesdienstes gehört es, dass schlecht über ihn gesprochen wird. Zum Teil mit Gründen, zum Teil aus Unwissenheit. Denn seltsamerweise ist viel zu wenig darüber bekannt, wie, wo und von wem er tatsächlich gefeiert wird. Wie also sieht es wirklich in den weiten Landschaften evangelischer Gottesdienste aus? Was entwickelt sich neu? Was ist längst abgestorben? Was könnte helfen? Ein Gespräch mit der Hamburger Pastorin Katharina Gralla, die einen besonders guten Ein- und Überblick über die neue Vielfalt des gottesdienstlichen Lebens besitzt.

Friedensethik in Zeiten des Krieges?
Es ist Krieg in Europa. Plötzlich stellen sich grundsätzliche Fragen neu, alte Gewissheiten sind wie weggewischt. Was gibt jetzt ethische Orientierung? Braucht eine neue Lehre vom „Gerechten Krieg“ und hat der Pazifismus ausgedient? Ein Gespräch mit dem evangelischen Militärdekan Roger Mielke.

Was ist gut – in der Wirtschaft und in der Kunst?
Ein Gespräch mit dem Unternehmer, Sammler und Kunstberater Thomas Rusche. Rusche treibt die Frage an, wie man auf verantwortungsvolle Weise erfolgreich sein kann. Unter anderem hat er an der Universität Fribourg studiert und dort gelernt über Ökonomie, Philosophie und Theologie an deren Schnittstellen nachzudenken.

Gego – wie man eine große Künstlerin entdeckt und ausstellt
Wie eine Frau nach Verfolgung und Flucht zu einer großen Künstlerin werden konnte... Es ist eine unglaubliche Lebens- und Kunstgeschichte: Sie floh aus der NS-Diktatur und wurde im fernen Venezuela eine der bedeutendsten Künstlerinnen der Moderne. Nun erhält sie endlich in Deutschland die gebührende Aufmerksamkeit. Ein Gespräch über Gego mit der Kunsthistorikerin und Kuratorin Stefanie Reisinger anlässlich einer wunderbaren Ausstellung im Stuttgarter Kunstmuseum.

Die Macht der Barmherzigkeit
Es wird heftig diskutiert über Macht und Machtmissbrauch in Diakonie und Caritas. Viele alte Vorstellungen und Regeln scheinen überholt zu sein. Ein Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Michael Wunder (Evangelischen Stiftung Alsterdorf, Hamburg) hilft hoffentlich bei der Klärung politischer, sozialer und grundsätzlich theologischer Fragen.

Jugendkulturen archivieren
Es klingt wie ein Widerspruch in sich und ist doch eine unglaubliche Schatzkiste: Das Berliner Archiv der Jugendkulturen. Seit fast 25 Jahren sammelt es Dokumente, die davon zeugen, wie Jugendliche sich eigene und jeweils sehr unterschiedliche Kulturen geschaffen haben. Was es hier zu entdecken gibt und was sich bis heute verändert hat, darüber spreche ich mit Gabi Rohmann und Daniel Schneider.

Zauberei als Aufklärung
Es mag seltsam klingen, aber die magische Kunst ist ein hervorragendes Mittel gegen Aberglauben aller Art, sogar gegen Verschwörungsmythen. Niemand kann das so kundig erklären wie der Hamburger Notar Peter Rawert, der eine beeindruckende Sammlung von Zauber-Literatur zusammengetragen hat.

Antisemitismus gegen Israel
Der gegenwärtige Antisemitismus hat viele Gestalten: rechts, links, christlich, muslimisch, sogar antirassistisch. Wie man ihn erkennt und versteht, wie man den heutigen Antisemitismus gegen Israel von einer berechtigten Kritik israelischer Politik unterscheidet, erklärt in diesem Gespräch der Antisemitismus-Experte Klaus Holz.

Engel, Krippe, Bergmann und eine Künstlerin in Berlin
Wer es leid ist, nur die Kommerzialisierung des Festes zu beklagen, kann sich von der Berliner Künstlerin Christina Doll inspirieren lassen. Denn sie gestaltet aus traditionellen weihnachtlichen Motiven Bildwerke für die Gegenwart.

Was bedeutet Einsamkeit – zum Beispiel für Obdachlose?
Wir wissen viel zu wenig, was sie für andere Menschen bedeutet. Ein Gespräch mit der Diakonin und Sozialarbeiterin Anna-Sofie Gerth von der City-Station Berlin über die Einsamkeit obdachloser Menschen.

Wie ist es gerade anderswo in der Welt?
Von wegen Globalisierung – unsere Wahrnehmung wird immer provinzieller. Wen interessiert schon, wie es Menschen zum Beispiel in Südamerika mit Corona-Pandemie und Klimawandel geht? Und wer weiß, dass es in einer besonders schönen argentinischen Provinz noch richtig deutsche und Schweizer Gemeinschaften gibt? Ein Gespräch mit Karla Steilmann und Guillermo Berrin, evangelischen Theologen aus Misiones.
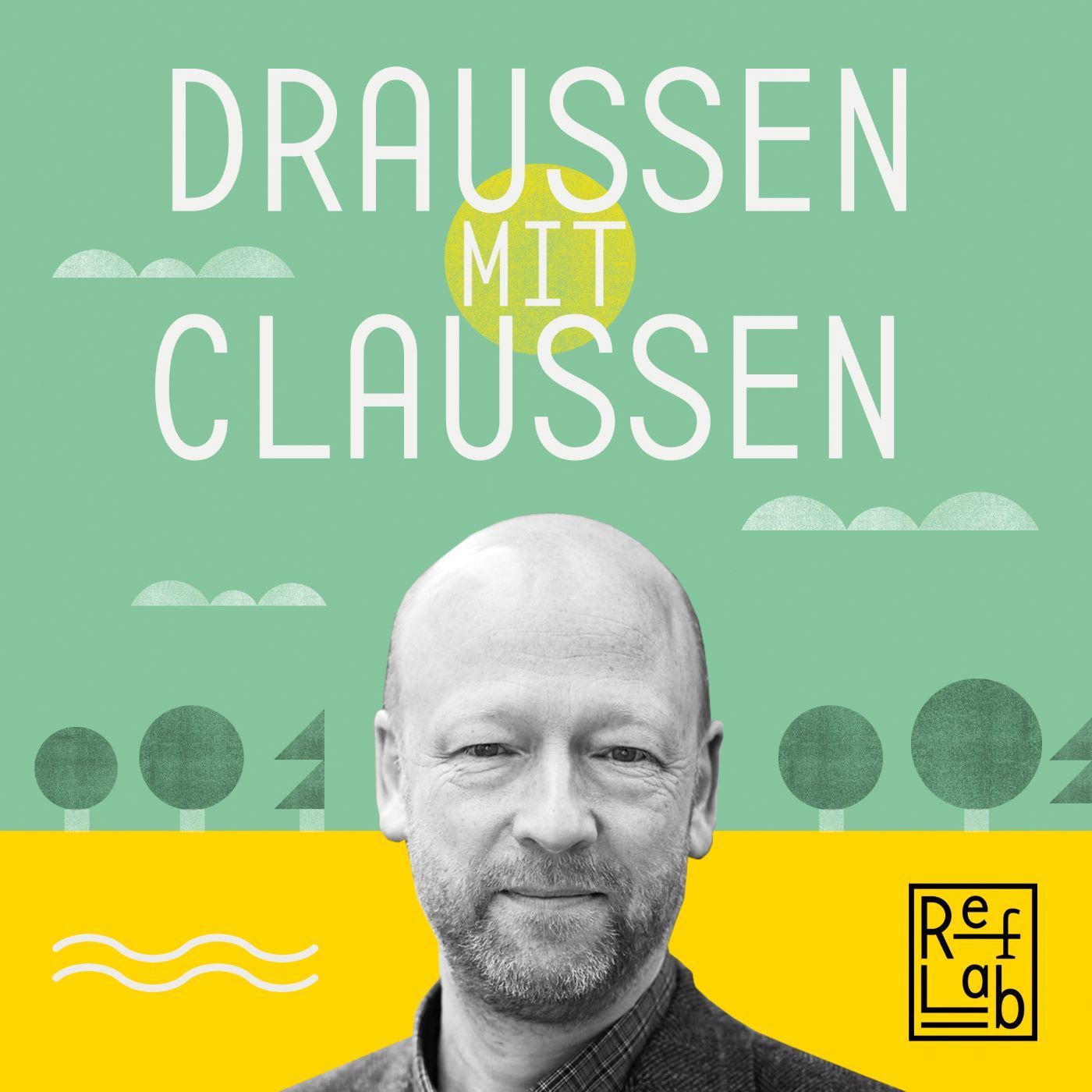
Die Kultur der Rechten
Ein Gespräch mit dem Rechtsextremismus-Experten David Begrich über Intellektuelle von rechts. „Das Entscheidende ist, ob es den rechten Intellektuellen gelingt, den Diskurs zu bestimmen.“ (David Begrich, Arbeitsstelle Rechtsextremismus bei Miteinander e.V.)

Pest!
Die Corona-Pandemie hat die Erinnerung an Seuchen früherer Zeiten wachgerufen. Ihre Geschichte gibt heute neu zu denken. In Wittenberg kann man dies in einer eindrucksvollen Ausstellung erleben. Ein Gespräch mit Stefan Rhein, dem Direktor der Luther-Gedenkstätten.

Pantherzeit
Auch wenn viele das Wort „Corona“ nicht mehr hören können – der Schriftstellerin Marica Bodrožić ist das Kunststück gelungen, ein Buch über ihre Pandemie-Erfahrungen zu schreiben, das einen neu ins Nachdenken bringt. Und das ist dringend nötig.

Die Sprache des Machtmissbrauchs
An ihrer Sprache sollt ihr sie erkennen: die Menschen, die Macht missbrauchen und anderen Menschen Schaden zufügen. Die Schriftstellerin Petra Morsbach hat die Sprache des Machtmissbrauchs analysiert und gibt Hilfestellung, wie man ihr standhalten kann.

Im Garten ist jeder Mensch ein König/eine Königin
Ein Besuch bei der königlichen Gartenakademie zu Berlin und ein Gespräch mit Gabriella Pape über das Glück und die Arbeit des Gärtnerns. Und darüber, was sich durch Corona und Klimawandel geändert hat.

Sklaverei – ihre Geschichte und ihre Gegenwart
Der Mensch ist ein Wesen, das seine Artgenosse versklavt. Diesen Eindruck bekommt man, wenn man die ebenso kurze wie eindrucksvolle „Geschichte der Sklaverei“ von Andreas Eckert liest. Das ist Anlass genug, mit dem Berliner Historiker über eine dunkle Seite der Menschheit zu sprechen.

Streit auf dem höchsten Berg der Erde
Einer der interessantesten Religionskonflikte findet gerade auf Hawaii statt: Astronomen möchten dort das grösste Teleskop aller Zeiten aufbauen, doch für viele Hawaiianer ist dies „heiliges Land“. Ein Gespräch mit Nikolas Claussen.