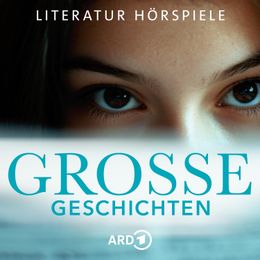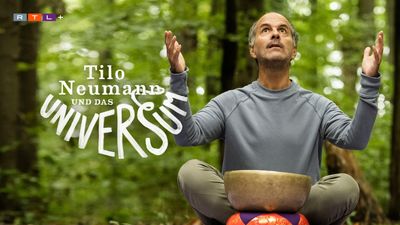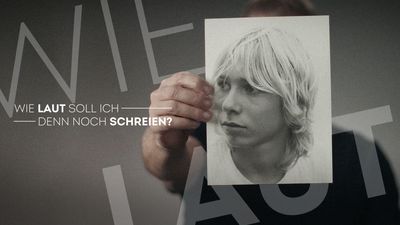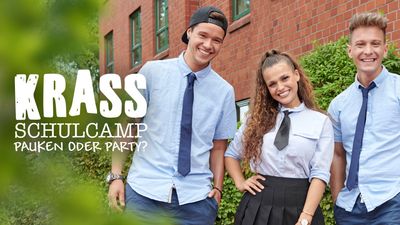Große Werke und neue Entdeckungen: Die besten Geschichten gelesen von bekannten Stimmen. Hier finden Sie alle radio3 Lesungen als Podcast. Aktuelles Highlight bei uns ist die Neuproduktion der "Buddenbrooks" von Thomas Mann, eingesprochen vom stimmgewaltigen Schauspieler Thomas Sarbacher. Sehr hörenswert auch Volker Weidermanns Buch "Wenn ich eine Wolke wäre - Mascha Kaléko und die Reise ihres Lebens" mit den Stimmen von Maria Schrader und Ulrich Matthes. Und Theodor Fontanes großer Roman "Der Stechlin" in einer legendären Aufnahme mit dem Schauspieler Hans Paetsch.
Alle Folgen
Thomas Mann: Buddenbrooks (71/71)
Nach einem langen Schultag sitzt Hanno Buddenbrook am Klavier und improvisiert. Er beginnt unruhig suchend, steigert sich in Melodie und Akkorden, wird immer stürmischer, verzweifelter. Hanno durchlebt in seiner Musik ganze Welten: er tötet Drachen, erklimmt Felsen, durchschwimmt Ströme und durchschreitet Flammen. Es sind Schreie, die eine überwältigende Sehnsucht ausdrücken, eine Begierde… Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (70/71)
Der Autor schildert einen Tag im Leben von Hanno Buddenbrook – inspiriert von seinen eigenen verstörenden Schulerlebnissen. Im Lateinunterreicht bei Doktor Mantelsack hat Hanno Glück, ein Mitschüler rettet ihn beim Aufsagen des Ovid. Jeder der Lehrer setzt auf autoritäre Methoden. Am gefürchtetsten ist Direktor Wulicke, genannt „der liebe Gott“. Nur Kandidat Modersohn steht auf verlorenem Posten. Er wird der Horde Siebzehnjähriger nicht Herr – bis plötzlich Unerwartetes geschieht… Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (69/71)
Quälend dehnen sich die Unterrichtsstunden für Hanno Buddenbrook, wenn die Lehrer einzelne Schüler examinieren. In der Lateinstunde lässt Oberlehrer Mantelsack einen nach dem anderen Ovid rezitieren. Mehrere seiner Kommilitonen versagen, Mantelsack verliert die Geduld und gerät in Zorn. In diesem Augenblick hört Hanno seinen Namen… Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (68/71)
Die Schule wird zum Albtraum für Hanno Buddenbrook. Er sitzt unvorbereitet im Religions- und Lateinunterreicht und fürchtet um seine Versetzung, falls er geprüft werden sollte. Doch er hat Glück. Nach den ersten Stunden verbringt er mit seinem Freund Kai Graf Mölln schweigsam die Pause auf dem lärmenden Schulhof. Ein jugendlicher Oberlehrer namens Goldener versieht die Pausenaufsicht… Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (67/71)
Hanno Buddenbrook ist sechzehn. Mit seiner Mutter wohnt er in einer kleinen Villa außerhalb des Zentrums. Im Stadttheater hat er am Sonntagabend „Lohengrin“ gesehen, die Opernvorstellung, die er lange ersehnt hatte. Am Montagmorgen verschläft er. Die Schule erreicht er gerade noch rechtzeitig vor Beginn der ersten Stunde. Völlig außer Atem betritt er das Klassenzimmer… Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (66/71)
Im elften und letzten Teil hören wir, was nach dem Tod von Senator Thomas Buddenbrook passiert. Christian ist nach Hamburg gezogen und hat dort geheiratet – seine Tänzerin, was ihm sein Bruder verboten hatte. Wie von Thomas testamentarisch verfügt, wird die Firma aufgelöst und verkauft. Dass er damit seinen Sohn Hanno übergangen hat, schmerzt vor allem Antonie Permaneder. Die Pläne ihrer verwitweten Schwägerin Gerda, mit Hanno zu ihrem Vater nach Amsterdam zu übersiedeln, kann Tony fürs Erste verhindern. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (65/71)
Thomas Buddenbrook ist tot. Der Senator musste sich einer Zahn-Operation unterziehen, war dann auf der Straße ohnmächtig geworden und gestürzt. Kurz darauf ist er zu Hause gestorben. Am Sterbebett ist – neben Doktor Langhals und der Pflegeschwester Leandra – die Familie versammelt: seine Frau Gerda und seine Geschwister Antonie und Christian. Der Bruder betrachtet das kalte Gesicht des Toten… Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (64/71)
Thomas Buddenbrook verlässt das Rathaus früher als sonst – obwohl dort die Bürgerschaft tagt. Es ist ein schmuddeliger Januartag des Jahres 1875. Der Senator schlägt einen ungewöhnlichen Weg ein. Von Stephan Kistenmaker, einem früheren Schulfreund, wird er prompt angesprochen: ob der die Sitzung schwänze? Thomas Buddenbrook beißt die Kiefer zusammen… Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (63/71)
Die Brüder Thomas und Christian Buddenbrook fahren gemeinsam an die Ostsee. Doktor Langhals hat Thomas ein paar Wochen Urlaub in Travemünde empfohlen – um seine Nerven zu beruhigen. Christian spricht schon lange von gesundheitlichen Problemen, seinen Beruf als Kaufmann hat er ganz aufgegeben. Die Brüder treffen im Kurhaus ein und begegnen dort Sigismund Gosch, ihrem alten Makler. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (62/71)
Senator Thomas Buddenbrook ist 48 Jahre alt und befindet sich in einer tiefen Krise. Seiner Frau Gerda unterstellt er ein Verhältnis mit dem jungen Offizier von Trotha, er fühlt sich krank, und die Entwicklung seines Sohnes Hanno bereitet ihm Sorgen. Er liest Schopenhauer und ahnt, dass er dem Tod entgegengeht. Dieser Gedanke fühlt sich beinahe tröstlich an – wie etwas Verheißungsvolles… Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (61/71)
Gerda Buddenbrook, die Frau von Senator Thomas Buddenbrook, spielt leidenschaftlich Geige. In letzter Zeit erhält sie regelmäßig Besuch eines jungen Offiziers: Leutnant von Trotha ist in allen Opern und Konzerten zu sehen, pflegt aber sonst kaum Kontakte mit den Familien der Stadt. Er spielt mehrere Instrumente – und trifft sich mit Gerda Buddenbrook zum gemeinsamen Musizieren in ihrem Salon. Zu oft, wie machen meinen – auch Thomas Buddenbrook ist unruhig. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (60/71)
Hanno Buddenbrook genießt seine Schulferien am Ostseestrand von Travemünde. Dort fühlt er sich wohl, weit weg vom Schulalltag. Sicher hat Thomas Mann seine eigene Kindheit vor Augen gehabt, wenn er Hannos Sommerfrische mit Baden, Kurkonzerten und leckerem Essen beschreibt. Am liebsten wäre ihm, wenn die vier Wochen niemals zu Ende gingen… Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (59/71)
Hanno Buddenbrook ist inzwischen elf. Sein Vater möchte ihn zu einem „tüchtigen“ Nachfolger heranziehen. Doch Hanno interessiert sich nicht für Sport, auch pflegt er keine Freundschaften zu den Ehrgeizigen unter seinen Mitschülern. Gut versteht er sich mit seinem Freund Kai, der am liebsten abenteuerliche Geschichten erzählt. Hanno spielt dazu Musik und macht Theater, anstatt zu den schulischen „Turnspielen“ zu gehen, wie es sein Vater wünscht. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (58/71)
Wir sind bereits im zehnten Teil des Romans angelangt. Das Familienhaus in der Mengstraße ist verkauft, Tony Permaneder ist mit ihrer Tochter Erika Grünlich und Enkelin Elisabeth in eine Mietwohnung gezogen, und auch Christian Buddenbrook hat sich eine Wohnung genommen, in der Nähe des Klubs. – Senator Thomas Buddenbrook hegt düstere Gedanken. Mit seinen 46 Jahren fühlt er sich „unaussprechlich müde und verdrossen“, alles ist leer in ihm, der Alltag strengt ihn an, er fühlt sich gehetzt. Seine Marotten lassen ihn nicht los. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (57/71)
Nach dem Tod der Konsulin Buddenbrook muss das herrschaftliche Haus der Familie in der Mengstraße verkauft werden. Ausgerechnet Hermann Hagenström ist interessiert. Antonie Permaneder verachtet ihn, seit er sie als Kind geküsst hat. Nun ist er ein reicher Kaufmann, und er braucht Platz für seine große Familie. Sein Haus in der Sandstraße werde ihm zu eng, sagt er – fast entschuldigend – bei einer Besichtigung zu Thomas Buddenbrook und seiner Schwester Tony. Auch der schrullige Makler Gosch ist mit dabei. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (56/71)
Elisabeth Buddenbrook wird feierlich zu Grabe getragen – im Herbst 1871 ist die Konsulin verstorben. Der kleine Hanno muss Abschied nehmen von seiner Großmutter. Seine Eltern, Tante Antonie und Cousine Erika nehmen die Beileidsbekundungen entgegen bei der Trauerfeier im Haus der Familie in der Mengstraße. Pastor Pringsheim hält eine Rede, dann zieht der Zug der zahlreich Versammelten zum Friedhof, wo der Pastor noch einmal spricht. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (55/71)
Die Brüder Thomas und Christian Buddenbrook haben sich einen erbitterten Streit geliefert. Es geht ums Erbe. Christian beansprucht Wäsche und Essgeschirr für sich, da er vorhat zu heiraten - wohl wissend, dass seine verstorbene Mutter einer Ehe mit der Tänzerin Aline Puvogel nie zugestimmt hätte. Der Streit eskaliert, als Christian ankündigt, auch die Kinder der Tänzerin adoptieren zu wollen. Thomas droht ihm mit „Vernichtung“. Wütend verlässt Christian den Raum. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (54/71)
Der Todeskampf der Konsulin Elisabeth Buddenbrook war furchtbar. Eine Qual, auch für die Angehörigen. Unmittelbar nach dem Ableben bemächtigt sich das Hauspersonal der Wäsche. Antonie Permaneder ist empört, ihr Bruder Thomas beschwichtigt sie: das Weißzeug sei wertlos. Er möchte die Verzeichnisse sehen, es geht ums Erbe. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (53/71)
Konsulin Elisabeth Buddenbrook liegt im Sterben. Die Ärzte – der alte Doktor Grabow und der junge Doktor Langhals – beschwichtigen die Familie zwar. Dennoch ist klar, dass es nicht mehr lange dauern wird. Eine katholische Pflegerin, Schwester Leandra, wird eingestellt. Die Konsulin selbst fühlt, dass zu vieles in ihrem Leben noch ungeklärt ist, um ruhig Abschied nehmen zu können. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (52/71)
Weihnachten ist vorüber. Beim kleinen Hanno hat das Fest viele Eindrücke hinterlassen. Was über aller Feierlichkeit schwebte – worüber aber eisern geschwiegen wurde – das ist der bevorstehende Prozess gegen Hugo Weinschenk, den Schwiegersohn von Tony Permaneder. Dem Versicherungsdirektor wird Betrug vorgeworfen. Ausgerechnet Staatsanwalt Moritz Hagenström, ein Spross der reichen Hagenström-Familie, wird die Anklage vertreten. Tony schlägt die Sache auf den Magen. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (51/71)
Der Weihnachtsabend bei Buddenbrooks wird opulent gefeiert. Im Mittelpunkt steht der kleine Hanno, der von seiner Großmutter, der Konsulin, ein Harmonium geschenkt bekommt. Besonders freut er sich über ein Puppentheater. Diese Leidenschaft teilt er mit seinem Onkel Christian. Der improvisiert eine kleine Szene mit den Figuren des Theaters, die sofort für gute Laune sorgt. Doch dann bricht er ab und verabschiedet sich in den Klub, nicht ohne Mahnung an seinen Neffen, sich mehr mit ernsten Dingen zu beschäftigen. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (50/71)
Das Weihnachtsfest 1869 steht unter keinem guten Stern bei Buddenbrooks: Hugo Weinschenk, Erikas Mann und Tonys Schwiegersohn, soll Versicherungsbetrug begangen haben. Die Sache liegt jetzt beim Staatsanwalt. Dennoch trifft sich die Familie am Weihnachtsabend im Haus der Konsulin. Sie hält fest an der alten Tradition – im Gedenken an ihren „seligen Jean“, wie sie sagt, und „zu Ehren Jesu“… Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (49/71)
Der achtjährige Hanno Buddenbrook hat sich mit Kai Graf Mölln angefreundet. Die beiden gehen gemeinsam zur Schule, und Kai verbringt viel Zeit bei den Buddenbrooks. Nachdem sie ihre Rechenaufgaben erledigt haben, liest Ida Jungmann, Hannos Kindermädchen, Märchen vor. Bald versucht Kai sich selbst als Geschichtenerzähler, und er verwebt dabei Wirkliches mit Geheimnisvollem… Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (48/71)
Musik ist Thomas Buddenbrook fremd. Enttäuscht muss er feststellen, dass die Musik, die Leidenschaft seiner Gattin Gerda, sich auf ihren Sohn Hanno übertragen hat. Beim Gedichte aufsagen – da scheitert Hanno. Aber eigene Kompositionen auf dem Klavier vorzuspielen, damit kann der Achtjährige seine Familie begeistern. Seinem Vater bleibt diese Begabung unverständlich. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (47/71)
Gerda, die Frau des Senators, hat die Musik ins Haus Buddenbrook gebracht. Sie spielt hervorragend Geige – eine Stradivari – und wird regelmäßig vom Organisten der Marienkirche, Herrn Pfühl, am Flügel begleitet. Sie kann ihn sogar von der Musik Richard Wagners überzeugen, die er als „zu modern“ eigentlich ablehnt. Der kleine Hanno lauscht stundenlang fasziniert, wenn seine Mutter und Herr Pfühl musizieren. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (46/71)
Senator Thomas Buddenbrook hat einen harten Tag zu überstehen: es wird das 100-jährige Bestandsjubiläum seiner Firma gefeiert. Unablässig kommen Gratulanten. Im Salon seines Hauses nimmt Buddenbrook die Glückwünsche entgegen. Nach dem Bürgermeister waren zahlreiche Konsuln erschienen, Doktor Grabow, Baumeister Voigt und Pastor Pringsheim sind auch schon da, Herren des Senats, der Bürgerschaft und der Handelskammer ebenfalls. Um halb zwölf ist die Hitze des Juli-Tags bereits unerträglich stark... Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (45/71)
Die Firma Buddenbrook besteht seit 100 Jahren. Eigentlich wollte Senator Thomas Buddenbrook das Jubiläum gar nicht feiern, doch kann er es nicht übergehen, das ist er seinem Ruf in der Stadt schuldig. Seinem Barbier klagt er am Morgen des Festtags sein Leid: er habe Kopfschmerzen, wenn er an die Empfänge, Gratulanten und Diners den ganzen Tag bis in die Nacht hinein denke… Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (44/71)
Thomas Buddenbrook geht es nicht gut. Die Geschäfte laufen nicht wie früher. Der 42-Jährige fühlt sich alt, er glaubt, seine Souveränität zu verlieren. Auch der jüngste Vorschlag seiner Schwester Tony beschäftigt ihn: Sollte er dem strauchelnden Gutsbesitzer von Maiboom nicht doch eine Ernte abkaufen? Grübelnd fragt er sich, ob er der Härte des Geschäftslebens überhaupt gewachsen ist. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (43/71)
Tony Permaneder hat sich lange mit ihrem Bruder, dem Senator Thomas Buddenbrook, unterhalten. Sie setzt sich für ihre Freundin Armgard von Schilling ein, die den mecklenburgischen Gutsbesitzer Ralf von Maiboom geheiratet hat. Wegen Spielschulden ist er in Schwierigkeiten geraten. Tony bittet ihren Bruder nun, Maiboom die Ernte abzukaufen, um ihm wieder auf die Beine zu helfen. Der Senator durchschaut Tonys Vorliebe für den Adel und lehnt das zweifelhafte Geschäft entschieden ab – vorerst. Im folgenden dritten Kapitel des achten Teils des Romans besucht Tony ihren Neffen Hanno. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (42/71)
Tony Permaneder ist überglücklich, denn ihre Tochter Erika hat den Versicherungsdirektor Erich Weinschenk geheiratet. Zu dritt bewohnen sie eine frisch renovierte Mietwohnung. Ihr Bruder Christian Buddenbrook lebt auch wieder in der Stadt. Gesundheitlich angeschlagen, versteht er es dennoch, ganze Gesellschaften köstlich zu unterhalten. Eben gibt er im Hause Weinschenk Geschichten zum Besten, die er in London und Valparaiso erlebt hat… Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (41/71)
Senator Thomas Buddenbrook ahnt: der Anfang vom Ende ist da. Seit er in sein neuerbautes Haus gezogen ist, reißt die Unglückssträhne nicht ab. Seine Mutter hat über seinen Kopf hinweg verfügt, das Erbteil der verstorbenen Schwester Clara an den Witwer, Pastor Tiburtius, auszuzahlen. Auch sein Bruder Christian, selbst bedürftig und krank in einer Hamburger Klinik liegend, war ihm in den Rücken gefallen. Viel Geld verloren hat er durch die zweite unglückliche Ehe seiner Schwester Tony. Und zu alledem herrscht Krieg im Jahr 1866. So dass auch wichtige Geschäftspartner ausgefallen sind. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (40/71)
Thomas Buddenbrook ist Senator geworden und hat mit seiner Frau Gerda und seinem Sohn Hanno ein stattliches neues Haus bezogen. Der kleine Hanno hat eine ernsthafte Erkrankung überstanden, auch durch die Pflege von Ida Jungmann, dem langjährigen Kindermädchen der Familie. Eben ist Tony Permaneder zu Besuch bei Senator Buddenbrook, ihrem Bruder – mit einem Anliegen, das bei einem Spaziergang durch den Garten besprochen werden soll… Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (39/71)
An einem Tauwettertag Ende Februar 1861 wird ein neuer Senator gewählt. Noch ist nichts entschieden. Größte Konkurrenten von Thomas Buddenbrook sind der Weinhändler Eduard Kistenmaker und Konsul Hermann Hagenström. Vor dem Rathaus hat sich eine Menschenmenge versammelt, die Stimmung ist aufgeheizt. Ein Gerücht macht die Runde: Hagenström soll die Wahl für sich entschieden haben. Doch Gewissheit verschaffen erst die beiden Ratsdiener, als sie den Weg durch die Menge zum Wohnhaus des neugewählten Senators einschlagen. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (38/71)
Wir sind im siebenten Teil des Romans – und es geht auf und ab mit der Familie Buddenbrook. Im ersten Kapitel haben wir von der Taufe des kleinen Hanno gehört, im zweiten Kapitel hat Christian seinem Bruder Thomas den Ausstieg aus seinem Geschäft in Hamburg gestanden. Er sei überfordert, gesundheitlich angeschlagen, außerdem müsse er Alimente bezahlen. Thomas ist außer sich, gestattet Christian aber, nach London zu gehen und dort eine Stelle zu suchen. Im folgenden Kapitel steht die Wahl eines neuen Senators an… Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (37/71)
Es gibt wieder Anlass zur Freude im Hause Buddenbrook: Konsul Thomas Buddenbrook und seine Frau Gerda haben Nachwuchs bekommen! Voller Stolz kann Antonie Permaneder, die Tante, ihre Vergangenheit hinter sich lassen – ihre zweite gescheiterte Ehe mit Alois Permaneder, der glücklicherweise sofort in die Scheidung eingewilligt hat und sogar die Mitgift zurückzahlt. Wir befinden uns am Beginn des siebten Teils des Romans, schreiben das Jahr 1861, und erleben die Taufe des Knaben, dessen Geburt nicht einfach gewesen ist. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (36/71)
Unter keinen Umständen will Tony Permaneder wieder zurück nach München. Sie ist in ihr Elternhaus geflohen, nachdem sie ihren Mann beim Begrapschen der Köchin ertappt hat. Ihr Bruder Thomas hat kein Interesse, dass der Fall an die Öffentlichkeit dringt. Er fürchtet um den guten Ruf der Familie. Doch Tony ist aufgewühlt. In München hat sie sich nie wohlgefühlt. Und sie stimmt Thomas zu, als er meint, nicht ihren Mann verabscheue sie, sondern die ganze Stadt. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (35/71)
Tony Permaneder ist aus München geflohen – zurück in ihr Elternhaus. Ihrer Mutter, der Konsulin, erzählt sie, was sie erleben musste: Alois Permaneder, ihr Gatte, hatte sich in betrunkenem Zustand über die Köchin hergemacht. Nachts habe sie die beiden erwischt. Sie sei fest entschlossen, nie wieder zu ihm zurückzukehren, sagt Tony – auch wenn Permaneder versucht habe, die Sache herunterzuspielen... Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (34/71)
Thomas Buddenbrook geht es gut. Seine Firma floriert, seine Gattin Gerda schmückt ihn, und sein Ansehen in der Stadt wächst. Probleme bereiten ihm sein Bruder Christian, der in Hamburg erfolglos wirtschaftet, seine Schwester Clara, die in Riga unter Kopfschmerzen leidet – und die Tatsache, dass bei ihm selbst noch keinen Nachwuchs in Aussicht steht. Aber auch seine Schwester Tony macht ihm Sorgen. Sie lebt mit Alois Permaneder in München. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (33/71)
Antonie Buddenbrook ist entschlossen, Alois Permaneder zu heiraten. Die Buddenbrooks unternehmen einen Familienausflug – die Gelegenheit für Permaneder, Tony einen Antrag zu machen. Das ist der Plan, doch die Sache gestaltet sich mühsam. Beim Spaziergang im Umland ziehen sich alle diskret zurück und überlassen Tony und Permaneder dem Zwiegespräch. Doch Permaneder schweift ins Allgemeine ab und lästert über Tonys geschiedenen Ehemann. Tony wird ungeduldig. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (32/71)
Tony Grünlich geborene Buddenbrook hat sich entschieden: sie will Alois Permaneder heiraten und zu ihm nach München ziehen. Er sei „nicht schön, aber ein grundguter Mann“, vertraut sie sich ihrer Haushälterin Ida Jungmann an. Sie fühle sich nicht ausgelastet, sagt sie. Sie will ihre erste Ehe „wieder gut machen“ und die Ehre der Familie wieder herstellen. Doch noch hat ihr Permaneder keinen Antrag gemacht… Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (31/71)
Alois Permaneder ist zu Besuch bei Buddenbrooks. Der Hopfenhändler spricht ausgeprägten bayrischen Dialekt. Er hatte Antonie Grünlich in München kennengelernt – und will sie wiedersehen. Sein Auftritt erstaunt und irritiert zugleich. Die Konsulin versteht ihn kaum, Tony ist sichtlich erfreut, ihr Bruder Thomas gibt sich alle Mühe, ein freundlicher Gastgeber zu sein – und auch die Haushälterin Ida Jungmann ist verblüfft über Permanders seltsame Sprache und seine fröhliche Ungeniertheit. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (30/71)
Der Konflikt zwischen den Brüdern Thomas und Christian Buddenbrook spitzt sich zu. Anlass für den Streit sind Bemerkungen Christians in dem Klub, den er regelmäßig besucht. Er soll sich über den Kaufmannsstand, lustig gemacht, also sein eigenes Metier verspottet haben. Tom stellt Christian zur Rede. Er wirft ihm vor, sein Leben als Possenreißer im Café und im Theater zu verbummeln, anstatt zu arbeiten. Christian widerspricht nicht, im Gegenteil: er stimmt seinem Bruder zu. Sie seien beide eben sehr verschieden… Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (29/71)
Antonie Grünlich ist zu Besuch in München, bei einer Freundin aus Schulzeiten. Dort lernt sie den Hopfenhändler Alois Permaneder kennen, ein bayerisches Original. Tony ist fasziniert von allerlei Münchner Eigenarten, wie sie in einem Brief an ihre Mutter berichtet, den die Konsulin am Frühstückstisch vorliest. Bruder Thomas amüsiert sich. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (28/71)
Im Sommer 1856 herrscht Hochstimmung im Hause Buddenbrook: es gibt gleich zwei Verlobungen. Gefeiert wird die Verbindung von Thomas Buddenbrook mit Gerda Arnoldsen, einer Schulfreundin seiner Schwester Tony – und Clara verlobt sich mit Pastor Tiburtius. Nach Reden und Musik – Gerda spielt mit ihrem Vater Duos auf der Geige – wird beschlossen, dass Clara und Tiburtius direkt nach Weihnachten heiraten werden, Thomas und Gerda dann zu Beginn des nächsten Jahres in Amsterdam. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (27/71)
Im Hause Buddenbrook finden immer häufiger „christliche Andachten“ statt. Konsulin Buddenbrook lädt dazu ein. Auch Pastoren sind regelmäßig zu Gast. So kommt es, dass Pastor Sievert Tiburtius aus Riga die jüngste Tochter, Clara, kennenlernt. Eine Verlobung wird verabredet, was ganz den Wünschen der Konsulin entspricht. Im folgenden siebten Kapitel des fünften Teils des Romans berichtet auch Thomas, der sich geschäftlich in Amsterdam aufhält, von einer neuen Bekanntschaft. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (26/71)
Onkel Gotthold ist gestorben. Der Halbbruder von Jean Buddenbrook war in Ungnade gefallen, weil er nicht standesgemäß geheiratet hatte und nur einen kleinen Laden betrieb. Sein Neffe Tom, Nachfolger seines Vaters als Inhaber der Firma Buddenbrook, hatte sich versöhnlich gezeigt, indem er ihm den Titel „Konsul“ überlassen hatte. Jetzt steht er am Totenbett des Onkels und reflektiert dessen Leben: Fantasie hat ihm gefehlt, denkt er, Idealismus und Enthusiasmus… Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (25/71)
Christian Buddenbrook ist angekommen. Der Tod seines Vaters war der Anlass, nach acht Jahren Abwesenheit in England und Südamerika in seine Heimatstadt zurückzukehren. Christian erzählt von seinen Abenteuern und seinen Leidenschaften – dem Theater und den Frauen. Er wirkt exzentrisch auf seine Geschwister, sie machen sich Sorgen. Tom fühlt sich in seiner Kaufmanns-Ehre angegriffen. Mit seiner Schwester Tony ist er sich einig: es gehe doch schließlich darum, etwas zu leisten! Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (24/71)
Das Familienoberhaupt Konsul Jean Buddenbrook ist gestorben, und jetzt wird seine Nachfolge geregelt. Sein Sohn Thomas soll die Geschäfte weiterführen, gemeinsam mit dem langjährigen Prokuristen des Vaters, Herrn Marcus. Bei der Testamentseröffnung ist selbstverständlich Antonie Grünlich anwesend, und auch Konsul Justus Kröger wird dazugebeten, der Bruder der Witwe Elisabeth Buddenbrook. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (23/71)
In der Geschichte der Familie Buddenbrook sind wir im Spätsommer des Jahres 1855 angelangt. Alle warten auf Konsul Jean Buddenbrook, denn angesagt ist ein Sonntag-Nachmittagsspaziergang mit der befreundeten Familie Kistenmaker. Besonders ungeduldig ist Tony - obwohl sie weiß, dass ihr Vater gesundheitliche Probleme hat und die Dinge langsam angehen soll. Auch ihre Mutter, die Konsulin, und ihr Bruder Tom sind schon bereit zum Aufbruch. Die kleine Schwester Clara und ihre Cousine Klothilde sind auch da, werden aber beim Ausflug nicht dabei sein. So warten sie… Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (22/71)
Wir befinden uns an einer Stelle der Handlung, die wiederum ein halbes Jahrhundert früher spielt – genauer: im Februar 1850. Antonie hat ihre Scheidung von Bendix Grünlich eigenhändig in die Familienchronik der Buddenbrooks eingetragen. Sie wohnt jetzt mit ihrer Tochter Erika wieder im Haus ihrer Eltern. Ihr Mann hatte betrügerisch gewirtschaftet, und ihr Vater konnte und wollte Grünlichs Firma nicht vor dem Konkurs retten. Tony hat ihren Stolz und ihre Lebensfreude wiedergewonnen. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (21/71)
Konsul Buddenbrook hat sich entschieden: er wird seine Tochter Antonie mit der dreijährigen Erika zu sich nach Hause nehmen. Bendix Grünlich, sein Schwiegersohn, hat Bankrott gemacht und jegliches Vertrauen verspielt. Noch hofft Grünlich auf einen Zuschuss seines Schwiegervaters. Von Bankier Kesselmeyer hat er über die Jahre Kredite bekommen, die er damit abzahlen könnte. Während Jean Buddenbrook Einblick in die Geschäftsbücher nimmt, dämmert ihm allmählich, welches Spiel Grünlich und Kesselmeyer gespielt haben… Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (20/71)
Bendix Grünlich, der Gatte von Antonie geborene Buddenbrook, hat sich in den Bankrott gewirtschaftet. In einem Brief bittet er seinen Schwiegervater um finanzielle Hilfe. Jean Buddenbrook eilt nach Hamburg und bespricht sich erst mit seiner Tochter. Ob sie Grünlich so sehr liebe, dass sie ohne ihn nicht leben könne, fragt er sie. Worauf Tony mit einem heuchlerischen „Ja“ antwortet… Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (19/71)
Antonie Buddenbrook, verheiratete Grünlich, lebt mit ihrem Gatten und ihrer dreijährigen Tochter Erika in Hamburg. Sie hat sich arrangiert mit ihrem Schicksal, aber sie ahnt, dass Bendix Grünlich finanzielle Schwierigkeiten hat. Er weigert sich, ein Kindermädchen einzustellen, meidet gemeinsame gesellschaftliche Anlässe und versagt ihr alle Wünsche. Tony konfrontiert ihren Mann mit Vorwürfen, als Herr Kesselmeyer auftaucht. Dieser etwas seltsame Bankier bedient Grünlich regelmäßig mit Krediten. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (18/71)
Die Revolution ist ausgebrochen in der Stadt. Die Bürgerschaft tagt im Sitzungssaal, und vor dem Gebäude tobt die Menge. Den Herren im Saal bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis sich die Lage beruhigt. Der alte Konsul Kröger empört sich über die Dreistigkeit der Protestierenden, während sein Schwiegersohn Jean Buddenbrook zur Tat schreitet. Angespornt von Makler Gosch spricht er zu den Menschen, die die Bürgerschaft belagern. Sie verstummen, als Konsul Buddenbrook sie auf Platt – in ihrer Sprache – auffordert, ihre Anliegen vorzutragen. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (17/71)
Im Oktober des Jahres 1848 brodelt es in der Stadt. Es geht ums Wahlrecht. Obwohl der Stadtrat eine neue, moderne Verfassung beschlossen hat, fordern viele - vor allem Arbeiter und junge Leute - ein „allgemeines Wahlrecht“. Konsulin Buddenbrook ist besorgt, weil ihr Gatte sich auf den Weg zur Bürgerschaft macht – trotz der Unruhen auf den Straßen. Dem Tuchhändler Benthien wurde bereits eine Scheibe eingeschlagen. Jean Buddenbrook verspricht, spätestens um fünf Uhr wieder zu Hause zu sein. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (16/71)
Thomas Buddenbrook hat sich von Anna verabschiedet, einer Blumenverkäuferin, seiner heimlichen Geliebten. Er geht nach Amsterdam, wo er seine Studien als Kaufmann absolvieren wird. Und auch Tony Buddenbrook ist aufgebrochen – nach Hamburg, mit ihrem Gatten Bendix Grünlich, den sie aus Vernunftgründen geheiratet hat. Von dort schreibt sie auch den Brief, der den vierten Teil des Romans eröffnet. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (15/71)
Tony Buddenbrook ist wieder zu Hause. Ihre Sommerferien hat sie in Travemünde an der Ostsee verbracht und sich dort in den Medizinstudenten Morten Schwarzkopf verliebt. Dass er diese Verbindung nicht dulden würde, hatte ihr Vater ihr schriftlich mitgeteilt. Zurück in der Mengstraße, versucht Tony tapfer, sich ihrem Schicksal zu fügen, das ihre Hochzeit mit dem verhassten Kaufmann Bendix Grünlich aus Hamburg vorsieht. Sie blättert in der Familienchronik – und wird sich so ihrer Stellung in der Familie bewusst. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (14/71)
Bendix Grünlich lässt nicht locker. Er hat Tony Buddenbrook einen Ring geschickt und sie an ihr „Versprechen“ – wie er behauptet – erinnert, ihn zu heiraten. Tony aber hat sich mit Morten Schwarzkopf verlobt, einem Medizinstudenten, den sie während ihres Sommerurlaubs in Travemünde kennengelernt hat. Ihre Pläne teilt sie ihrem Vater, dem Konsul Buddenbrook, in einem Brief mit. Er antwortet unmissverständlich: er werde diese Verbindung nicht akzeptieren. Sein Brief erreicht Tony kurz vor Ende ihres Urlaubs an der Ostsee. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (13/71)
Tony Buddenbrook hat sich in Travemünde mit Morten Schwarzkopf angefreundet. Er ist der Sohn des Lotsenkommandanten Schwarzkopf. In seinem Haus verbringt Tony ihre Sommerferien. Morten ist Medizinstudent und politisch engagiert. Bei einem gemeinsamen Ausflug zum Seetempel, einem Pavillon mit herrlicher Aussicht aufs Meer, schildert er leidenschaftlich seine Vision einer gerechten Gesellschaft: ohne Privilegien des Adels, mit gleichen Rechten für alle Bürger. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (12/71)
Tony Buddenbrook verbringt den Sommer in Travemünde, um wieder zu Kräften zu gelangen. Die bevorstehende Hochzeit mit dem Hamburger Kaufmann Bendix Grünlich belastet sie, an der Ostsee findet sie Ablenkung. Beim Frühstück unterhält sich Tony mit Morten Schwarzkopf, dem Sohn ihrer Gastwirte. Er studiert Medizin in Göttingen und hat mit seiner Geradlinigkeit schnell Tonys Neugierde geweckt. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (11/71)
Tony Buddenbrook ist in einer Zwangslage. Sie soll den Hamburger Kaufmann Bendix Grünlich heiraten, einen Geschäftspartner ihres Vaters. Ihre Eltern drängen sie dazu, und selbst Pastor Kölling fordert sie von der Kanzel der Marienkirche herab dazu auf. Grünlich hatte Tony mehrfach besucht und sie auf unangenehme Weise emotional zu erpressen versucht. Sie magert ab und verliert ihre Lebensfreude – was ihren Vater, Konsul Buddenbrook, veranlasst, Tony für die Sommermonate ans Meer zu schicken, nach Travemünde ins Haus von Lotsenkommandant Schwarzkopf. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (10/71)
Tony Buddenbrook steht unter Schock. Sie soll Bendix Grünlich heiraten, einen Hamburger Geschäftsmann, der ihr von Grund auf zuwider ist. Ihr Vater, Konsul Buddenbrook, hat ihr am Frühstückstisch den Antrag Grünlichs eröffnet. Mit Engelszungen hat er auf sie eingeredet. Jetzt sitzt Tony allein mit ihrer Mutter am Tisch und versucht, ihre Fassung wiederzugewinnen. Sie will wissen, wie die Konsulin über darüber denkt. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk.Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (9/71)
Buddenbrooks haben unerwarteten Besuch bekommen. Bendix Grünlich, ein Geschäftsmann aus Hamburg, trifft die Familie beim Nachmittagskaffee im Gartenhaus an. Er gibt vor, nicht stören zu wollen. Doch Konsulin Buddenbrook lädt ihn ein, Platz zu nehmen. Die Kinder Thomas, Christian und Antonie sind mit Lektüre beschäftigt. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (8/71)
Zwei seiner Kinder machen Jean Buddenbrook Probleme. Der 14-jährige Christian verehrt eine Schauspielerin des Stadttheaters und schenkt ihr öffentlich Blumen. Und Antonie, ein Jahr älter als Christian, wurde mit einem Gymnasiasten bei gemeinsamen Spaziergängen gesehen. Sogar Briefe soll sie heimlich mit ihm ausgetauscht haben. Entwicklungen, die Konsul Buddenbrook unterbinden will, indem er Tony aufs Mädchenpensionat von Fräulein Weichbrodt schickt. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (7/71)
Ein Generationenwechsel hat sich vollzogen im Hause Buddenbrook. Erst ist Antoinette Buddenbrook gestorben, kurz darauf ihr Mann Johann. Zuvor hatte er seinem Sohn Jean offiziell die Firma übertragen, der ohnehin schon länger die Geschäfte führt. Wen er nicht berücksichtigt hat, ist sein Sohn aus erster Ehe. Der 46-jährige Gotthold – Betreiber einer einfachen Leinenhandlung – hatte gehofft, dass der alte Buddenbrook seine Meinung kurz vor dem Tod noch ändert. Nun erfährt er von seinem Stiefbruder Jean, dass er vom verstorbenen Vater keine Erbschaft zu erwarten hat. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (6/71)
Die elfjährige Antonie Buddenbrook legt ihren Schulweg oft mit Julchen Hagenström zurück, der Tochter eines reichen Kaufmanns. Tony weiß, dass ihr Vater, Konsul Buddenbrook, nicht gut zu sprechen ist auf seinen Konkurrenten. Erstens lebt er noch nicht lange in der Stadt, und zweitens fühlt er sich von ihm in seinen Geschäften behindert. „Einen ollen Stänker“ nennt Buddenbrook Hinrich Hagenström, und er berichtet von konkreten Vorfällen, wo er sich von ihm behindert fühlte. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (5/71)
Wir sind bereits im „Zweiten Teil“ des Familienromans angekommen und schreiben das Jahr 1838. Die Kaufmannsfamilie Buddenbrook hat Nachwuchs bekommen: ein viertes Kind - nach Thomas, Antonie und Christian. Die Zimmer der großzügigen Stadtvilla sind für die Entbindung getauscht worden: Die Großeltern Johann und Antoinette bewohnen das Zwischengeschoss, während sich die Eltern, Konsul Jean Buddenbrook und seine Gattin Elisabeth, in deren Schlafzimmer eingerichtet haben. Direkt daneben, im Frühstückszimmer, trägt der Vater jetzt stolz die Neuigkeit in die Familienchronik ein. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (4/71)
Im ersten Teil des Romans stellt uns der Erzähler die Familie Buddenbrook und ihr Haus in der Mengstraße vor. Alle zwei Wochen donnerstags ist große Gesellschaft geladen. Nach einem opulenten Mahl hat Konsul Jean Buddenbrook seine Gäste diesmal in den Billard-Salon gebeten. Mit dabei sind Makler Grätjens, Weinhändler Köppen und Senator Langhals. Draußen herrscht stürmisches Wetter. Beim Spiel diskutieren die Herren über den jüngst gegründeten Zollverein. Konsul Buddenbrook schwärmt: der Zollverein werde den Handel zwischen den deutschen Ländern erleichtern... Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (3/71)
Es ist große Gesellschaft im Haus der Familie Buddenbrook. Während des Essens wird über Politik gesprochen: In Frankreich hat die Juli-Monarchie den Bürgern mehr Rechte eingeräumt. Konsul Jean Buddenbrook sympathisiert mit diesen neuen Entwicklungen – Weinhändler Köppen, Makler Grätjens und Senator Langhals stimmen ihm zu. Mit am Tisch sitzen Pastor Wunderlich und der Dichter Hoffstede. Nur der alte Buddenbrook steht dem Fortschritt skeptisch gegenüber. Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (2/71)
Wir schreiben das Jahr 1835. Alle vierzehn Tage laden Konsul Johann Buddenbrook und seine Gattin Antoinette in ihr Haus in der Mengstraße ein. Heute sind der Dichter Hoffstede und Pastor Wunderlich zu Gast. Selbstverständlich mit dabei sind der Sohn des Hauses, Jean Buddenbrook, mit Gattin Elisabeth und ihren drei Kindern Thomas, Antonie und Christian. Nicht anwesend ist Gotthold Buddenbrook, ein Sohn des Familienoberhaupts aus erster Ehe. Von ihm wird gleich die Rede sein, während sich die Gesellschaft zum Essen in den Speisesaal begibt… Es liest Thomas Sarbacher. Dies ist eine Produktion der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Thomas Mann: Buddenbrooks (1/71)
Auf radio3 feiern wir ein Jubiläum: vor 125 Jahren ist ein literarisches Meisterwerk erschienen, der erste Roman von Thomas Mann: „Buddenbrooks: Verfall einer Familie“. Am 26. Februar 1901 kam das Werk in zwei Bänden in der bescheidenen Auflage von 1.000 Exemplaren bei Samuel Fischer in Berlin heraus. Allerdings brachten erst einbändige und billigere Auflagen den Erfolg – und schließlich den Literaturnobelpreis, den Thomas Mann 1929 für „Buddenbrooks“ bekam. Bis heute gilt er als einer der wichtigsten Romane des letzten Jahrhunderts. Thomas Mann erzählt die Geschichte einer Kaufmannsfamilie über vier Generationen. Er ist in Lübeck aufgewachsen, sein Vater war dort Senator. Die Stadt und seine Familie nahm er sich als Vorlage für seinen Roman. Geschrieben hat er ihn der erst 25-Jährige dann in München, wohin seine Familie nach dem Tod des Vaters übersiedelt war. Auf radio3 senden wir die „Buddenbrooks“ in einer neuen Aufnahme mit Thomas Sarbacher. Der Hamburger Schauspieler lebt in der Schweiz – und dort hat er den Roman für die SBS, die Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte aufgenommen - in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Norddeutschen Rundfunk. Das Audio ist online bis zum 28. April 2027.

Leo Perutz: Nachts unter der steinernen Brücke (25/25)
Hier schließt sich der Kreis. Der hohe Rabbi Löw hat Besuch vom Engel Asael, der ihm vorwirft, zweimal das Gleichgewicht der Welt gestört zu haben. Das erste Mal verwandelte er einen Stein, der den Kaiser bei einem Besuch in der Judenstadt treffen sollte, in zwei Schwalben. Das zweite Mal ist der Auslöser für diese Geschichte: Dem Kaiser ist bei einem Ritt durch die Judenstadt ein Mädchen begegnet, und dessen Antlitz lässt ihn nicht mehr los. Doch er sucht das Mädchen vergeblich. Das Audio ist online bis zum 08.10.2026.

Leo Perutz: Nachts unter der steinernen Brücke (24/25)
„Rudolfe, hilf!“ - das hat die schöne Esther, die Frau des reichen Meisl, in der Nacht, in der sie starb, gerufen, und seitdem treibt es ihren Witwer um, wer mit „Rudolfe“ gemeint gewesen sein könnte. Jetzt ist Meisl selbst dem Tod nah, und die Ahnung, dass mit Rudolfe nur der Kaiser gemeint gewesen sein kann, lässt in ihm den Wunsch wachsen, ihm einmal zu begegnen. Ein Jude beim Kaiser - der kaiserliche Kammerherr Philipp Lang, der alle paar Monate beim Meisl vorbeikommt, um Geld für den Kaiser einzutreiben, winkt ab. Eine absurde Idee. Doch Meisl sinnt auf eine List. Der Kaiser indessen ahnt von nichts und ist eben dabei, seine Kunstschätze zu betrachten. Das Audio ist online bis zum 08.10.2026.

Leo Perutz: Nachts unter der steinernen Brücke (23/25)
Mit viel Geld hat der reiche Jude Mordechai Meisl sich die Schutz- und Privilegien-Rechte von Kaiser Rudolf erkauft. Alle drei Monate kommt dessen Gesandter Philipp Lang und treibt die Rechnung ein. Doch bei Rudolfs Vorliebe für wertvolle Gemälde ist alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Er wartet auf den Tod Meisls, der lungenkrank im Bett liegt. Dann, so denkt er, kann er dessen gesamten Reichtum haben. Doch noch lebt Mordechai Meisl. Philipp Lang sitzt an seinem Bett und gibt launige Geschichten vom Hof zum Besten, während er ein üppiges Nachtmahl verzehrt. Das Audio ist online bis zum 08.10.2026.

Leo Perutz: Nachts unter der steinernen Brücke (22/25)
Im Juli 1924 hatte Leo Perutz mit der ersten Novelle seines Romans begonnen, damals unter dem Arbeitstitel „Meisls Gut“. Doch dann legte er sie wieder beiseite. Fast 20 Jahre später, im palästinensischen Exil, abgeschnitten von der europäischen Kultur, die ihm Anregung und Material für seine Romane geliefert hatte, nahm Perutz die Arbeit an dem Roman wieder auf - und schrieb an Freunde: „Es fehlen nur zwei kleine Geschichten, mit denen ich mich herumschlage. Sie sind notwendig, um den Zusammenhang des Ganzen herzustellen. Das heißt, um aus einem Dutzend Alt-Prager Novellen den Roman von Mordechai Meisl und Rudolf dem Zweiten zu machen.“ Es dauerte dann noch sechs Jahre, bis die beiden fehlenden Novellen vollendet waren. „Das verzehrte Lichtlein“ ist die erste davon. Das Audio ist online bis zum 08.10.2026.

Leo Perutz: Nachts unter der steinernen Brücke (21/25)
Der Kaiser ist seit neun Jahren tot, in Böhmen wütet seit drei Jahren der Dreißigjährige Krieg, der Handel stockt, die Menschen hungern. Es ist der 11. Juni 1621. In den frühen Morgenstunden sind 27 protestantische böhmische Adlige enthauptet worden, darunter der Leibarzt des Kaisers, Doktor Jessenius. Im Gasthaus „Zum silbernen Hecht“ treffen am Abend die einstigen Bediensteten des Kaisers zusammen: der Hofnarr Brouza, der zweite Kammerdiener Čerwenka, der Lautenspieler Kasparek und der Barbier Svatek. Sie geben sich alten Anekdoten hin, Erinnerungen an bessere Zeiten. Der Kammerdiener Čerwenka hat eben behauptet, der Kaiser hätte ihm auf dem Sterbebett prophezeit, dass sein Leibarzt Doktor Jessenius einst hingerichtet werden würde. Aber dass der Kaiser prophetische Gaben hatte, wollen ihm die anderen nicht so recht glauben. Das Audio ist online bis zum 08.10.2026.

Leo Perutz: Nachts unter der steinernen Brücke (20/25)
In 14 Novellen und einem Epilog erzählt Leo Perutz seine Geschichte; mittlerweile sind wir bei der zwölften Novelle angelangt. Chronologisch gesehen ist es die letzte. Der Kaiser ist längst tot, und seit drei Jahren wütet der Dreißigjährige Krieg. Die Zeiten sind schlecht, die Aussichten düster. Das Audio ist online bis zum 08.10.2026.

Leo Perutz: Nachts unter der steinernen Brücke (19/25)
In der ersten Novelle haben wir sie schon kennengelernt: die beiden Spaßmacher Jäckele-Narr und Koppel-Bär. Damals hat der hohe Rabbi Löw sie auf den Friedhof geschickt, damit sie die Ursache für das große Kindersterben in der Judenstadt herausfinden. In dieser Geschichte jetzt - sie heißt „Der Branntweinkrug“ - wandern sie durch die nächtlichen Gassen der Prager Judenstadt. Es ist eine besondere Nacht zwischen dem jüdischen Neujahrs- und dem Versöhnungsfest, in der die Toten sich in der Altneuschule zum Fest versammeln und die Namen aller rufen, die im kommenden Jahr sterben müssen. Koppel-Bär und Jäckele-Narr kümmert das wenig, sie streiten. Auf einer Hochzeitsgesellschaft hat Koppel-Bär ein Fässchen Branntwein mitgehen lassen - dabei darf er den, seiner Gesundheit wegen, gar nicht trinken. „Branntwein, was soll uns der Branntwein? Dir ist er verwehrt und mir ist er zuwider“, schimpft ihn Jäckele-Narr. Das Audio ist online bis zum 08.10.2026.

Leo Perutz: Nachts unter der steinernen Brücke (18/25)
„Der vergesse Alchemist“ heißt die Novelle, in der wir uns gerade befinden. Der Alchemist Jakobus van Delle hat seinen Kopf verpfändet, dass er für Kaiser Rudolf Blei in Gold verwandeln kann. Es ist ihm nicht geglückt, und jetzt ist er auf der Flucht. Der Hofnarr Anton Brouza hat ihm über die Burgmauer geholfen, doch beim Absprung von der Strickleiter hat van Delle sich den Fuß verstaucht. Die Flucht endet in einer kleinen Hütte an der Umfassungsmauer, die dem Brouza gehört. Das Audio ist online bis zum 08.10.2026.

Leo Perutz: Nachts unter der steinernen Brücke (17/25)
Seit zwei Jahren ist der Alchemist Jakobus van Delle am Hof des notorisch blanken Rudolfs des Zweiten, Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Bei seinem Leben hat er Rudolf versprochen, aus Blei Gold zu machen. Jetzt ist die Frist um, kein Gold in Sicht - und van Delle sieht keinen anderen Ausweg, als von der kaiserlichen Burg zu fliehen. Das Geld für die Flucht will ihm sein einziger Vertrauter am Hof beschaffen, der Hofnarr des vorherigen Kaisers, Anton Brouza, der mit ihm fliehen will und eine ganz eigene Methode hat, aus nichts Gold zu machen. Er geht zu Kaiser Rudolf und lässt sich ein Gemälde zeigen, das der Kaiser kürzlich erstanden hat. Das Audio ist online bis zum 08.10.2026.

Leo Perutz: Nachts unter der steinernen Brücke (16/25)
Der Kaiser braucht Geld. Die Schatzkammern sind leer, und auf seine Räte will er nicht hören, die schon wüssten, wie zu sparen sei. Zum Beispiel, indem der Kaiser aufhörte, teure Gemälde zu kaufen. Doch der beschäftigt stattdessen lieber Alchemisten. Etliche hat er schon verschlissen, seit zwei Jahren ist jetzt Jakobus van Delle bei ihm in Dienst. Doch auch der wird kein Blei in Gold verwandeln. Der kaiserliche Kammerdiener Philipp Lang sagt es dem Kaiser frei heraus - denn er hat einen anderen Plan, wie sein Herr zu Geld kommen kann - und er selbst gleich mit. Das Audio ist online bis zum 08.10.2026.

Leo Perutz: Nachts unter der steinernen Brücke (15/25)
Vor drei Jahren ist die schöne Jüdin Esther gestorben, und ihr Mann, der reiche Mordechai Meisl, vermisst sie schmerzhaft. Er will ein Bild von ihr haben. Der Maler Brabanzio soll es nach seinen Angaben malen. Durch Zufall ist auch Kaiser Rudolf im Atelier des Malers. Der Kaiser, ein eifriger Kunstsammler, gibt sich als öffentlicher Schreiber aus, wenn er inkognito in Prag unterwegs ist. Auch er vermisst Esther, seine Traumgeliebte. Das Audio ist online bis zum 08.10.2026.

Leo Perutz: Nachts unter der steinernen Brücke (14/25)
Die schöne Jüdin Esther, die Frau des reichen Mordechai Meisl, ist uns in der Novelle „Nachts unter der steinernen Brücke“, die dem Roman den Titel gegeben hat, schon begegnet. Als Rosmarin und rote Rose waren sie und Kaiser Rudolf der Zweite ein Liebespaar, das Nacht für Nacht zusammenkam. Doch diese Nächte sind schon lang vorbei. Esther ist tot, und zwei Männer trauern um sie. Im Atelier des Malers Brabanzio führt sie der Zufall zusammen. Das Audio ist online bis zum 08.10.2026.

Leo Perutz: Nachts unter der steinernen Brücke (13/25)
Dass nicht der Mars, sondern die Venus sein Geschick bestimmen, hat Wallenstein vom Astronomen Kepler erfahren. Damit hat er nicht gerechnet. Schließlich will er bei einem Coup mitmachen, der ihm eine Menge Geld bringen soll. Was er dafür genau tun muss, will ihm der Patron, der Chef der Diebesbande, bei einem geheimen Treffen erzählen. Er soll nur in den Wagen steigen, den der Patron ihm zu nächtlicher Stunde schickt. Wallenstein tut, wie ihm geheißen. Doch dann kommt er aus dem Wundern nicht mehr heraus: der Patron ist eine Frau. Und statt über den Coup zu sprechen, gibt es ein formidables Abendessen und allerlei seltsame Andeutungen. Das Audio ist online bis zum 08.10.2026.

Leo Perutz: Nachts unter der steinernen Brücke (12/25)
Der sagenhafte Reichtum des Juden Meisl weckt Begehrlichkeiten. Barvitius, ein in Ungnade gefallener Hofbeamter, der jetzt der Kopf einer Diebesbande ist, plant einen Coup, um an Meisls Geld zu kommen. Es fehlt ihm lediglich noch ein Mann, der sich mit dem Kriegshandwerk auskennt. Sein vertrauter Leitnizer kennt da einen - jung, ungestüm und unzufrieden, der dringend Geld braucht, um groß rauszukommen: Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein, genannt Wallenstein. Das Audio ist online bis zum 08.10.2026.

Leo Perutz: Nachts unter der steinernen Brücke (11/25)
Es gibt einen Erzähler in diesem Roman, den Hauslehrer Jakob Meisl, ein Nachfahre des legendären Mordechai Meisl. Oft taucht er nicht auf, aber alle Novellen, die Sie hier hören, sind im Grunde Nachhilfestunden in Weltgeschichte, die Jakob Meisl seinem Schüler, Leo Perutz, erteilt. Die Theorien des Hauslehrers zum Lauf der Welt stehen so vermutlich in keinem Geschichtsbuch: Ein Hund, der bellte, und ein Hahn, der krähte - sie haben das Glück des Wallenstein begründet, erklärt er den Reichtum Wallensteins. Und davon handelt diese Novelle. Bis es so weit ist, dauert es aber noch. Im Moment ist Wallenstein abgebrannt und hat eben vom Astronomen Kepler erfahren, dass nicht der Mars, sondern die Venus seine Geschicke bestimmen wird. Das ist ganz und gar nicht das, was er erwartet hat. Das Audio ist online bis zum 08.10.2026.

Leo Perutz: Nachts unter der steinernen Brücke (10/25)
Aus 14 Novellen besteht dieser Roman, doch Leo Perutz erzählt seine Geschichte nicht in chronologischer Reihenfolge. Willkürlich ist diese Reihenfolge allerdings nicht, erklärt der Schriftsteller in einem Brief an seinen langjährigen Verleger Paul Zsolnay, sondern die für ihn einzig mögliche Anordnung. Am Anfang steht das Rätsel: welches Vergehen hat Gott so erzürnt, dass er die Pest über die Prager Judenstadt geschickt hat? Die Antwort darauf setzt sich in den folgenden Geschichten puzzleartig zusammen. Wir beginnen heute mit der achten Novelle. Zwei weitere Figuren der Weltgeschichte betreten die Bühne. Der Astronom Johannes Kepler und der junge Feldherr Albrecht von Waldstein, bekannt unter dem Namen Wallenstein. Das Audio ist online bis zum 08.10.2026.

Leo Perutz: Nachts unter der steinernen Brücke (9/25)
„Der entwendete Taler“ heißt die Novelle, in der wir uns gerade befinden. Rudolf der Zweite ist noch ein junger Mann. Ein Silbertaler bringt ihm Unglück, solange er nicht bei seinem Besitzer angelangt ist, einem Juden namens Meisl. Den sucht Rudolf vergeblich. Er wirft den Taler in den Fluss, wo ihn ein Fischer auffängt und in seine Manteltasche steckt. Der Mantel ist mittlerweile bei einem Altkleiderhändler in der Judenstadt angelangt, Rudolf auch. Der Altkleiderhändler beklagt sich bitter bei Rudolf über die Schwierigkeiten seines Gewerbes, erntet aber nur den schwachen Trost, dass die vom Stamme Ruben eben mit alten Kleidern Handel treiben müssten, weil sie einst um das Gewand von Jesus gewürfelt hätten. Das Audio ist online bis zum 08.10.2026.

Leo Perutz: Nachts unter der steinernen Brücke (8/25)
Und wieder springen wir in der Zeit. Wir haben den alten Kaiser Rudolf erlebt, der nachts wach liegt und um die schöne Jüdin Esther trauert. Wir haben vom reichen Juden Meisl gehört, dessen weißer Pudel nach seinem Tod durch die Straßen streunt und fast am Galgen endet. Doch in dieser Novelle sind sie beide jung, der Kaiser und Meisl - und letzterer ist bettelarm. Hier treffen sie zum ersten Mal aufeinander. Rudolf - der noch kein Kaiser ist, sondern nur Erzherzog - hat sich im Wald verirrt und stößt auf zwei riesenhafte Männer, die einen Stapel Gold, einen Stapel Silbermünzen und einen Stapel Kupferpfennige vor sich aufgetürmt haben. Als Rudolf sie fragt, wer sie seien, antwortet der eine: „Die unter mir stehen, nennen mich den Großen und Mächtigen. Und mein Geselle heißt der Furchtbare und Starke.“ Das Audio ist online bis zum 08.10.2026.

Leo Perutz: Nachts unter der steinernen Brücke (7/25)
Rudolf der Zweite, Kaiser des Heiligen Römischen Reichs und König von Böhmen, hat schlechte Nächte und beunruhigende Gedanken. Er glaubt sich von den Toten verfolgt und fürchtet ihre Rache. Manchmal erscheinen sie ihm als Krähe, Kuckuck oder Hummel und reden gotteslästerliches Zeug, manchmal schlüpfen sie in die Gestalt eines neuen Dieners oder eines unbekannten Gastes. Das macht die Audienzen beim Kaiser mitunter zu bizarren Veranstaltungen. Eben ist der marokkanische Gesandte - von Venedig kommend - in Prag abgestiegen. Er soll Rudolf ein Freundschafts-Schreiben des Herrschers von Marokko überreichen. Das Audio ist online bis zum 08.10.2026.

Leo Perutz: Nachts unter der steinernen Brücke (6/25)
Eifersucht und Eitelkeit haben den jungen venezianischen Grafen Collalto ins Verderben gestürzt. Bei einem Ball hatte den Baron Juranic wegen seines ungehobelten Tanzstils lächerlich gemacht. Der Baron hat ihn zum Duell gefordert, Collalto hat verloren. Und um sein Leben zu retten, verlangt der Baron nun von ihm, eine Sarabande zu tanzen - durch alle Gassen Prags, ohne Pause bis zum Morgen. Doch die Musikanten des Barons fallen vor jedem Kruzifix und jeder Marienstatue, an der sie vorbeikommen, auf die Knie und beten. Der Graf kann atemschöpfen, was den Baron verdrießt. Kurzerhand dirigiert er die Gruppe in die Judenstadt. Collalto tanzt zu Tode erschöpft am Haus von Rabbi Löw vorbei und fleht ihn um ein Christusbild an. Der Rabbi zaubert jedoch ein „Ecce homo“ an die gegenüberliegende Hauswand – ein Bild des verfolgten Judentums. Das rührt das steinerne Herz des Barons und bringt ihn von der grausamen Strafe ab. Das Audio ist online bis zum 08.10.2026.

Leo Perutz: Nachts unter der steinernen Brücke (5/25)
Die „Sarabande“ heißt die Novelle, in die wir heute einsteigen. Der geheime Rat und Kanzler von Böhmen, Herr Zdenko von Lobkowicz, veranstaltet ein Fest in seinem Prager Stadthaus. Die Herren sind à la Mode gekleidet: mit goldgestickten Röcken aus purpurfarbenem Samt und weißgefütterten geschlitzten Ärmeln. Nur einer fällt aus dem Rahmen: der Baron Juranic, der in Reisekleidern erscheint. Sein Gepäck ist auf der letzten Poststation liegen geblieben. Er ist das Kriegshandwerk gewöhnt, nicht die feine Gesellschaft. Und er tanzt ungefähr so elegant wie ein dressierter Bär. Dem jungen venezianischen Grafen Collalto könnte das egal sein, wenn der Baron nicht ein Auge auf das Fräulein geworfen hätte, um das auch er sich bemüht. Also versucht er nach Kräften, den Baron lächerlich zu machen. Doch der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Das Audio ist online bis zum 08.10.2026.

Leo Perutz: Nachts unter der steinernen Brücke (4/25)
Es ist ein Wintertag im Jahr 1609, an dem es dem armen Juden Berl Landfahrer an den Kragen gehen soll. Der Unglücksvogel hat einen gestohlenen Zobelfellmantel gekauft, und dafür soll er nun an den Galgen kommen. Um seine Schmach zu vergrößern, sollen gleich noch zwei Straßenhunde mit ihm gehängt werden. Die haben erst recht nichts verbrochen - ein abgemagerter Bauernköter mit rotbraunem Fell und ein weißer Pudel, der einst dem reichen Juden Mordechai Meisl gehört hat. Das Audio ist online bis zum 08.10.2026.

Leo Perutz: Nachts unter der steinernen Brücke (3/25)
Aus 14 in sich abgeschlossenen Novellen besteht dieser Roman. Und wir springen heute mitten hinein in die zweite Novelle. „Des Kaisers Tisch“ heißt sie, und sie spielt an einem Frühsommertag des Jahres 1598 in Prag. Dort herrscht der habsburgische Kaiser Rudolf der Zweite. Das ist nicht allen Untertanen recht. Der junge Peter Zaruba hofft auf einen König böhmischer Nation, der dem reformierten Glauben anhängt. Einer seiner Urahnen hat einst prophezeit, dass ein Sprössling aus seinem, dem Zaruba-Geschlecht, die Freiheit Böhmens wieder aufrichten wird. Aber - ganz wichtig - er darf niemals von des Kaisers Tisch essen, sonst wird es damit nichts. Peter Zaruba fühlt sich dazu auserwählt, Böhmen zu alter Größe zu verhelfen. Als ihn sein Schwager Georg Kapliř, der beim Kaiser geschäftlich zu tun hat, dorthin zum Essen mitnehmen will, schlägt er die Einladung empört aus. Stattdessen geht er in ein Gasthaus, wo es ein sagenhaftes Menü mit zwölf Gängen gibt, für nur drei böhmische Groschen: Nierenschnitten am Spieß gebraten, Fasanenragout und Kalbszünglein, gefüllten Schweinsfuß und - zum Nachtisch - Marzipankügelchen mit Zuckerguss. Peter Zaruba langt begeistert zu. Das Audio ist online bis zum 08.10.2026.

Leo Perutz: Nachts unter der steinernen Brücke (2/25)
Die Pest wütet in der Prager Judenstadt, und vor allem die Kinder fallen ihr zum Opfer. Rabbi Löw sucht den Schuldigen, der Gottes Zorn so stark erregt hat, dass er die Plage über die Stadt geschickt hat. Und er trägt den beiden Spaßmachern Jäckele-Narr und Koppel-Bär auf, die toten Kinder auf dem Friedhof zu befragen. Sie erhalten Antwort: „Es ist geschehen um der Sünde Moabs willen, die eine unter euch begangen hat.“ Doch keine Frau aus der Gemeinde will einen Ehebruch zugeben. Also bestellt der Rabbi die beiden Spaßmacher ein zweites Mal ein. Das Audio ist online bis zum 08.10.2026.

Leo Perutz: Nachts unter der steinernen Brücke (1/25)
Heute beginnen wir mit dem Roman „Nachts unter der Steinernen Brücke“ des österreichischen Schriftstellers Leo Perutz. Geboren wurde Leo Perutz, wie Franz Kafka, in Prag. Er gehörte zum Kreis um Robert Musil und Franz Werfel in Wien, später floh er vor den Nationalsozialisten ins Exil nach Palästina. Dort hat er seinen wichtigsten Roman vollendet - eine zeitlose Geschichte über eine untergegangene Welt. Sie spielt in Prag um das Jahr 1600. Zahllose Kinder sterben an der Pest. Wie Rabbi Löw tappen wir Hörerinnen und Hörer anfangs im Dunkeln: wer ist für diese Epidemie verantwortlich? In 14 Episoden löst er nach und nach das Rätsel um die unmögliche Liebe von Kaiser Rudolf zur schönen Esther, der Frau des reichen Mordechai Meisl. Leo Perutz verwebt historische Fakten, volkstümliche Sagen und jüdische Legenden – und erzählt so von der Zerstörung der alten Prager Judenstadt, in der er selbst aufgewachsen ist. Der Schauspieler Felix von Manteuffel liest »Nachts unter der steinernen Brücke« von Leo Perutz. Das Audio ist online bis zum 08.10.2026.

Henry David Thoreau: Walden oder Leben in den Wäldern (11/11)
Zweieinhalb Jahre hat Henry David Thoreau am einsamen Waldensee gelebt, nachdem er 1845 dem Lehrerberuf den Rücken gekehrt hatte. Im Lauf unserer Lesung haben wir ihn bei seinen Beobachtungen und Reflektionen einmal durch alle Jahreszeiten begleitet. Im letzten Kapitel seines Buches fasst Thoreau seine Überlegungen noch einmal in einer Art Glaubens-, oder besser: Lebensbekenntnis zusammen. Die Inschrift am Apollo-Tempel zu Delphi „Erkenne dich selbst“ wird neu, wird amerikanisch formuliert: Seid für die Welt in euch selbst ein Kolumbus - und eröffnet neue Straßen, nicht für den Handel, sondern für die Gedanken. Das Audio ist online bis zum 02.09.2026.
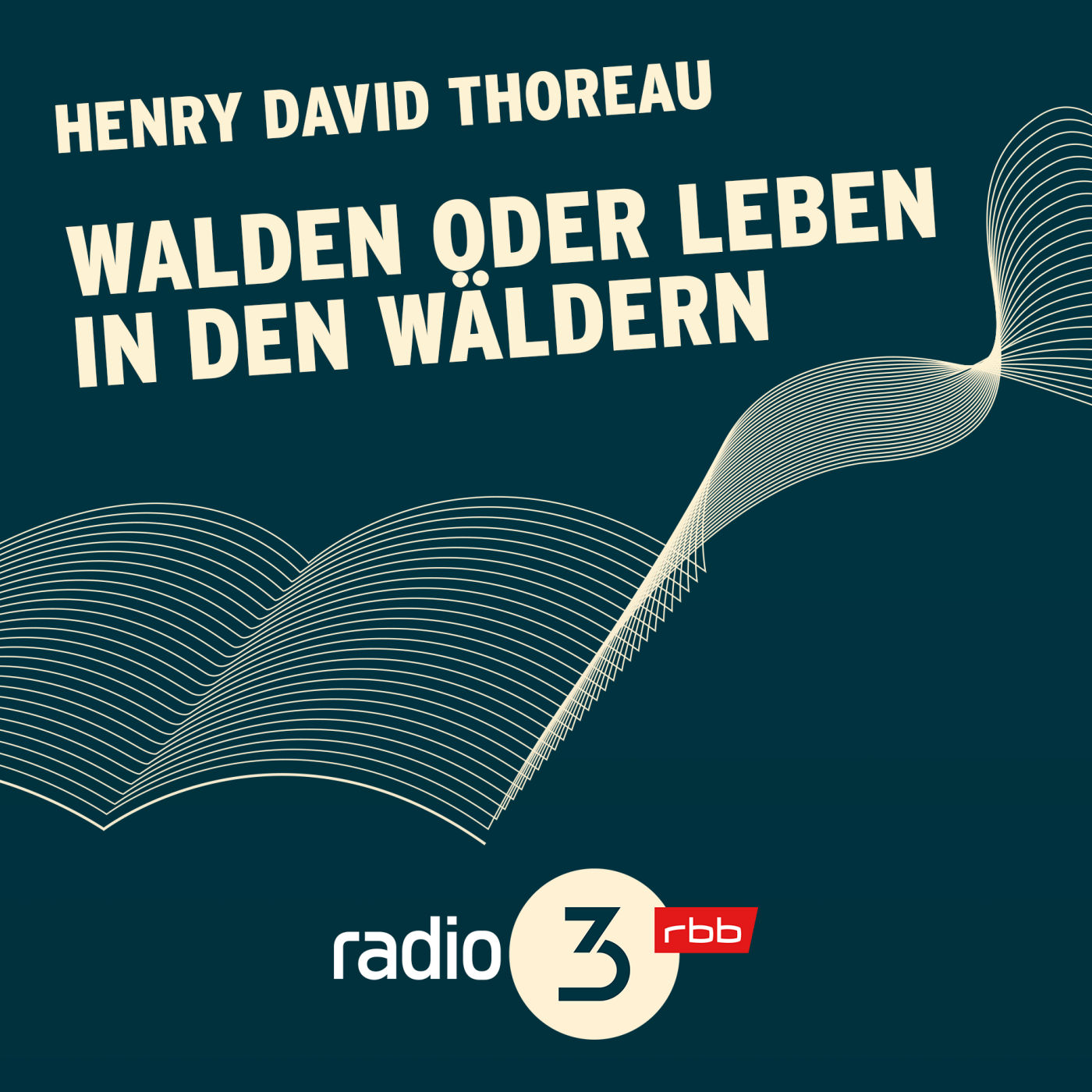
Henry David Thoreau: Walden oder Leben in den Wäldern (10/11)
Im Frühjahr 1845 hat sich Henry David Thoreau an den einsamen Waldensee zurückgezogen und dort zweieinhalb Jahre in einer selbstgebauten Blockhütte verbracht. Am Freitag haben wir gehört, wie Thoreau in seiner Hütte mit dem Winter fertig wurde. Im folgenden Kapitel kommt der Frühling. Das Audio ist online bis zum 02.09.2026.
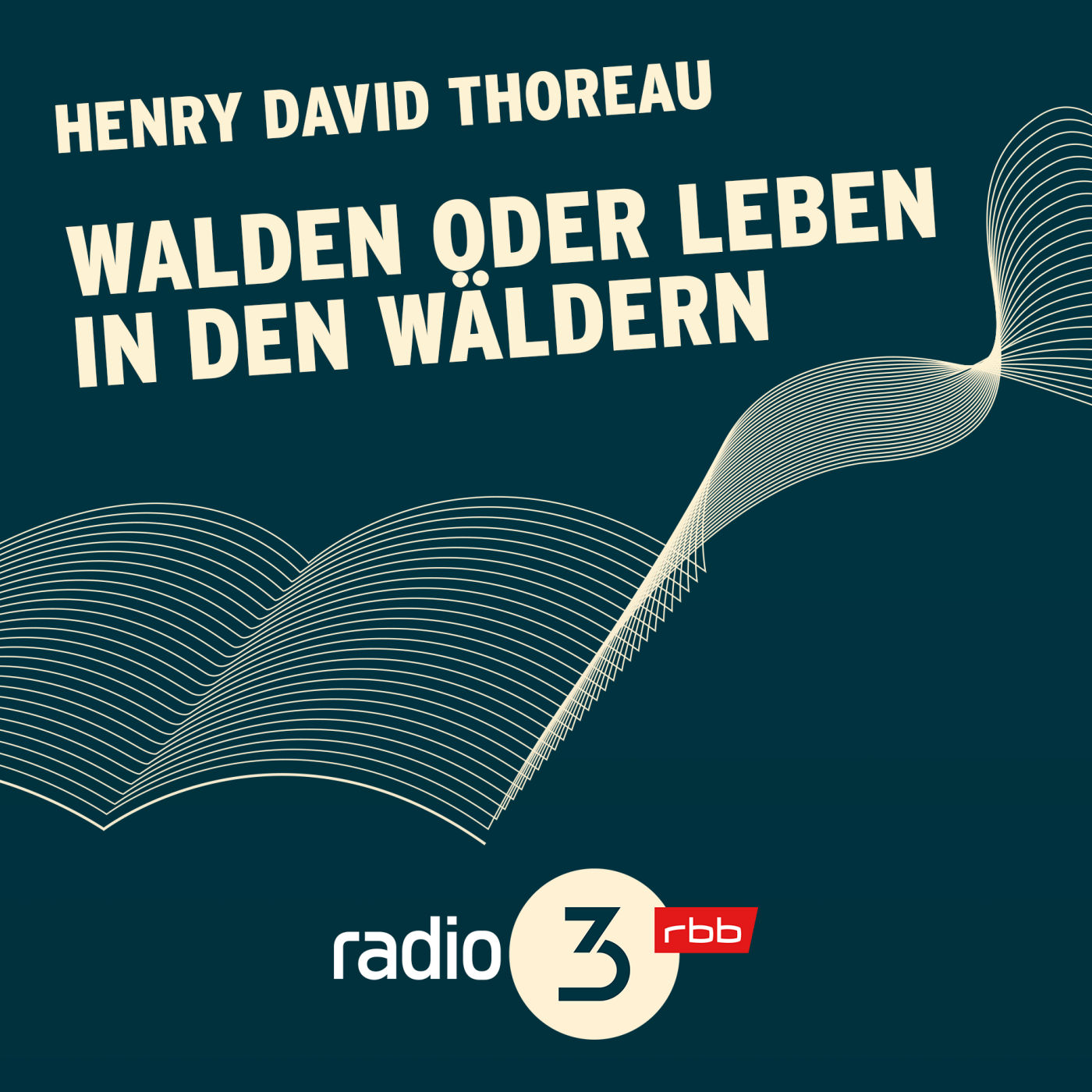
Henry David Thoreau: Walden oder Leben in den Wäldern (9/11)
Henry David Thoreau hat sich 1845 für zweieinhalb Jahre aus dem bürgerlichen Leben in der Stadt an den einsamen Waldensee zurückgezogen. Wie er dort während der Sommermonate lebt, haben wir in den vergangenen Kapiteln gehört. Jetzt wird es Herbst. Der Winter steht vor der Tür, und die selbstgebaute Hütte muss winterfest gemacht werden. Thoreau baut einen Kamin, und er singt ein Hohelied auf das Holz und das Feuer. Das erste Gedicht, das Sie in diesem Kapitel hören werden, ist eines der meist zitierten Gedichte von Thoreau selbst. Das abschließende Gedicht mit dem Titel „Waldfeuer“ hat Ellen Hooper geschrieben. Das Audio ist online bis zum 02.09.2026.
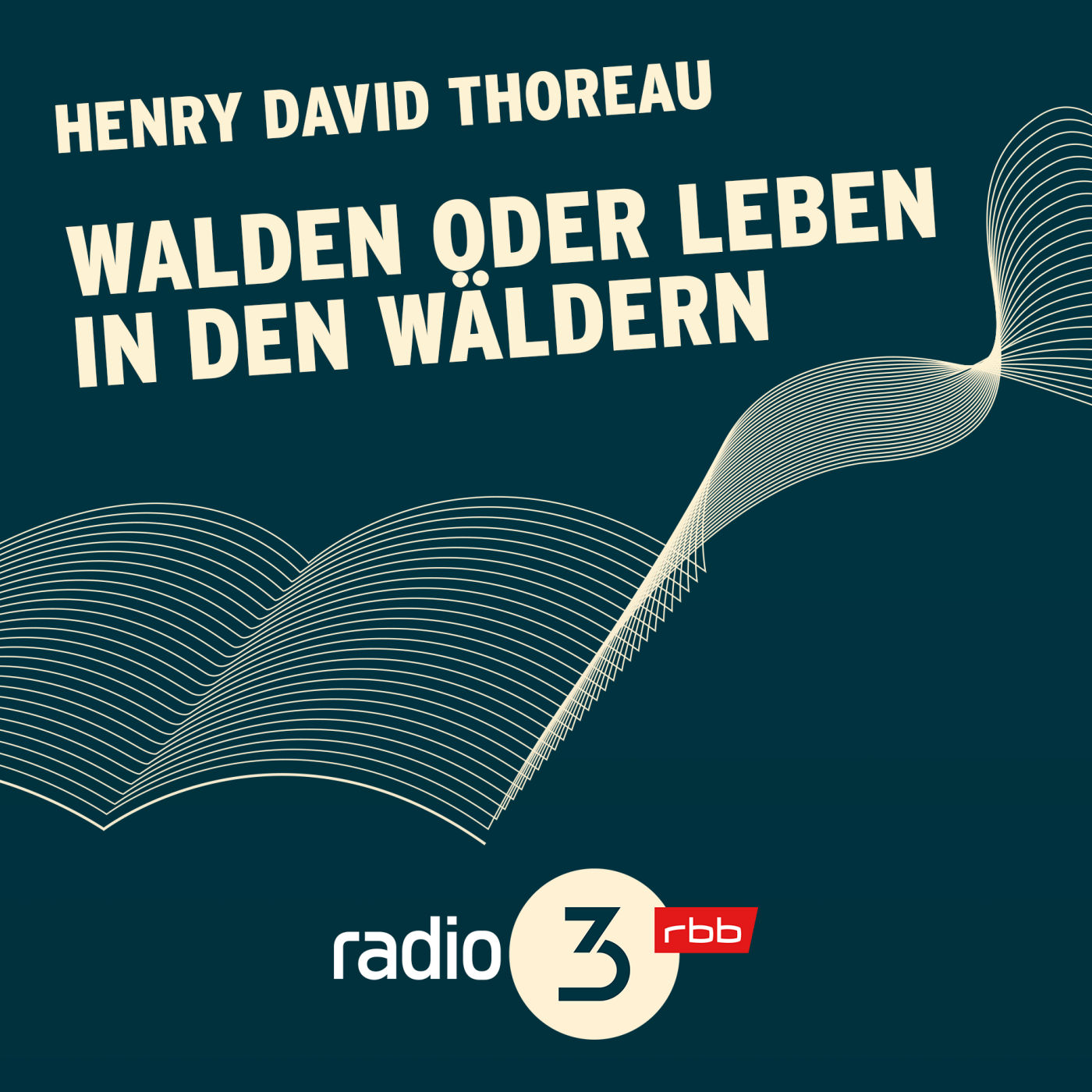
Henry David Thoreau: Walden oder Leben in den Wäldern (8/11)
Henry David Thoreau hat Mitte des 19. Jahrhunderts seine bürgerliche Existenz aufgegeben. Zweieinhalb Jahre lebt er allein in einer selbstgebauten Hütte am Waldensee in Massachusetts. Heute erzählt er etwas über diejenigen, die schon längst vor ihm hier gelebt haben: die Tiere. Thoreau bleibt nicht bei biologischen Erklärungen. Er macht sich alle Tiere gewissermaßen zu Lasttieren, zu Trägern seiner eigenwilligen Reflexionen, etwa wenn er Ameisenkämpfe als Völkerschlachten sieht. Das Audio ist online bis zum 02.09.2026.
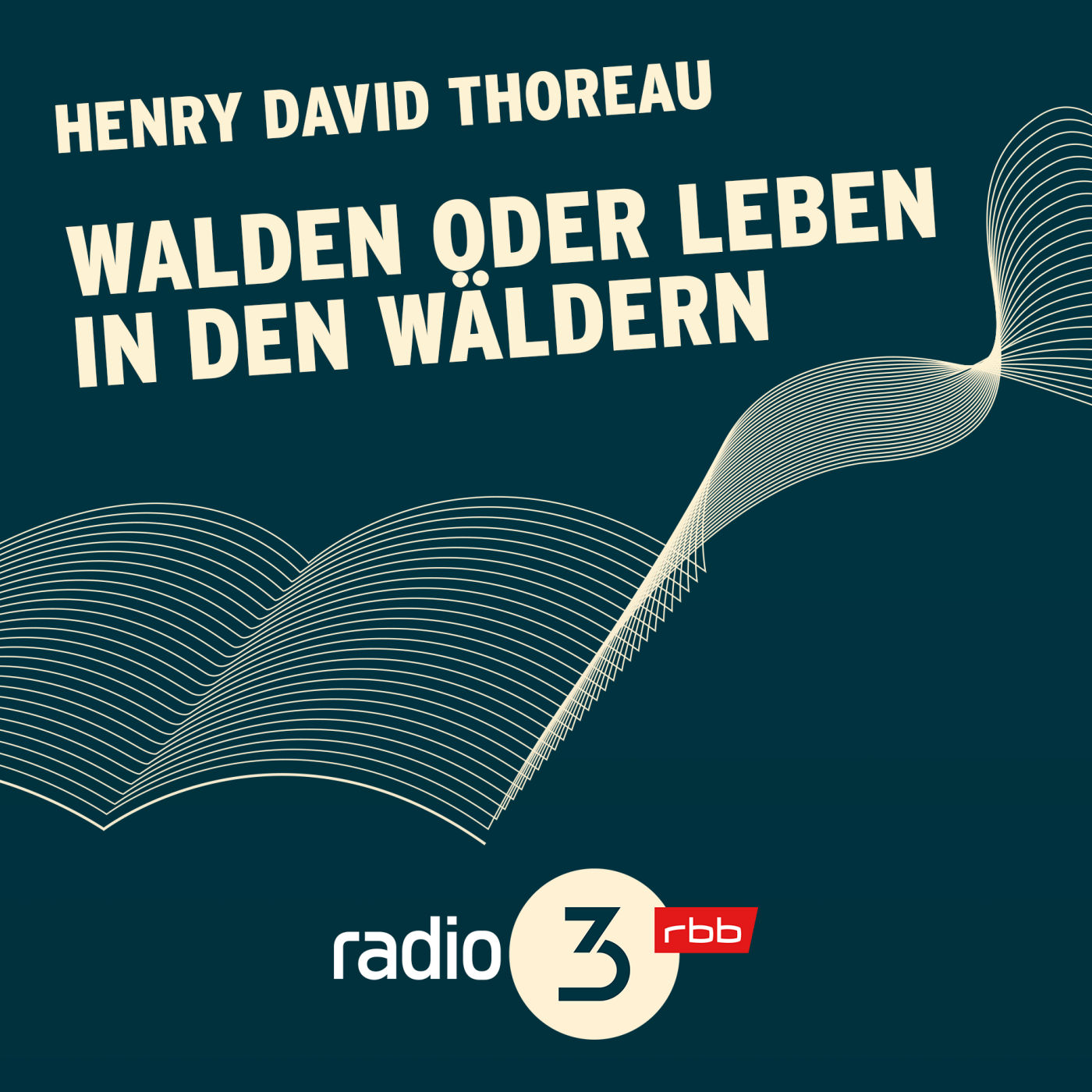
Gabriele Tergit: Käsebier erobert den Kurfürstendamm (1/31)
Wie wird man berühmt und wie lange hält die Berühmtheit an? In diesem Falle die von Käsebier, dem Volkssänger, Ende der 1920er Jahre, der auf einmal in aller Munde ist. Ilja Richter liest die immer noch sehr aktuelle Satire auf den Berliner Medienbetrieb. Das Audio ist bis zum 31.03.2026 verfügbar.