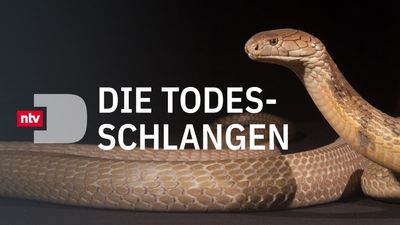Hier finden Sie Serien zu relevanten Wissensthemen aus allen Lebensbereichen - breitgefächert, vertiefend und orientierend. Autor: innen verbinden Expertise mit Alltagserfahrung, sowie Hintergrundwissen mit Reflexion. Redaktion: Ina Zwerger, Ulrike Schmitzer, Monika Kalcsics, Astrid Schwarz, Alexandra Augustin, Ute Maurnböck. Produktion: ORF Mediencampus Wien. Weitere Informationen: https://oe1.orf.at/radiokolleg
Alle Folgen
Ö1 Insektarium: Die Zecke (1)
Ein Lieblingsfeind des Menschen: der Zeck. Er ruft Ekel hervor, bohrt sich in die Haut und kann Krankheiten übertragen. Zecken sind große Milben, die sich parasitisch vom Blut von Säugetieren - auch des Menschen - ernähren. Es gibt mindestens 900 Zeckenarten, in Österreich auch viele "neue", die durch den Klimawandel heimisch werden. Sie können gefährlich werden, da sie Krankheiten übertragen: Am bekanntesten sind die Lyme-Borreliose und die Frühsommer-Meningoenzephalitis. Doch es gibt noch viele andere: Zecken sind Meister der Übertragung - kein anderer Parasit bringt so viele Krankheiten mit wie sie. Gestaltung: Sabine Nikolay. Redaktion: Monika Kalcsics.In Ö1 gesendet am 09. 02. 2026 im Rahmen des Ö1 Insektariums, das dauerhaft im zeit- und kulturgeschichtlichen Online-Archiv von Ö1 angeboten wird.

Ö1 Insektarium: Der Ammendornfinger (2)
Der vorwiegend nachtaktive Ammendornfinger, die Spinne des Jahres 2023, spinnt keine Fangnetze, sondern lauert seiner Beute - Insekten bis hin zu Gottesanbeterinnen und Heuschrecken - auf und überwältigt sie mit einem Giftbiss. Die Tage verbringt er in kugeligen Ruhegespinsten, meist in offenen Wiesen mit hohem Bewuchs, in Gestrüpp oder unter Steinen. Ihre Gelege aus 80 - 300 Eiern verteidigen die Spinnenweibchen sehr vehement. Die Jungen verlassen sofort nach dem Schlupf das Nest und überwintern bodennah in winzigen Ruhegespinsten. Gestaltung: Sabine Nikolay.In Ö1 gesendet am 10. 02. 2026 im Rahmen des Ö1 Insektariums, das dauerhaft im zeit- und kulturgeschichtlichen Online-Archiv von Ö1 angeboten wird.

Ö1 Insektarium: Die südrussische Tarantel (3)
Die größte Spinne Mitteleuropas lebt schon lange in Österreich, wo sie die westlichste Grenze ihres Verbreitungsgebiets erreicht. Ihr Lebensraum ist vorzugsweise lehmiger Uferbereich, wo sie eine Nisthöhle anlegt. Die Eier reifen in einem Kokon heran, den die Spinne mit den Hinterbeinen in die Sonne hält, um ihn zu wärmen. Nach dem Schlupf bleiben die Jungspinnen bei der Mutter, die sie auf dem Rücken trägt. Die Tarantel ist eine nachtaktive Jägerin, die kleinen Wirbeltieren und Gliederfüßern auflauert. Gestaltung: Sabine Nikolay. Redaktion: Monika Kalcsics.In Ö1 gesendet am 11. 02. 2026 im Rahmen des Ö1 Insektariums, das dauerhaft im zeit- und kulturgeschichtlichen Online-Archiv von Ö1 angeboten wird.

Ö1 Insektarium: Die Krätzmilbe (4)
Milben sind mikroskopisch kleine Tierchen die als Parasiten Hunde, Katzen und Pferde befallen und auch auf den Menschen übertragen werden können. Diese Räudemilben sind für den Menschen keine allzu große Belastung, da er ein "Fehlwirt" ist und die Tiere bald absterben. Sehr unangenehm und sogar gefährlich für den Menschen kann die "Krätzmilbe" werden. Sie ist 0,3 bis einen halben Millimeter groß und wird bei länger dauerndem direktem Hautkontakt übertagen. Die Parasiten bohren sich unter die oberste Hautschicht, legen dort ihre Eier ab und ernähren sich von abgestorbenen Zellen und Zellflüssigkeit. Diese "Wohngemeinschaft" bleibt nicht unerkannt: Es juckt bestialisch und muss schleunigst behandelt werden. Gestaltung: Sabine Nikolay. Redaktion: Monika Kalcsics.In Ö1 gesendet am 12. 02. 2026 im Rahmen des Ö1 Insektariums, das dauerhaft im zeit- und kulturgeschichtlichen Online-Archiv von Ö1 angeboten wird.

Schmerz lass nach (1)
Schmerz ist ein äußerst komplexes Phänomen. Jeder kennt ihn. Jede empfindet ihn. Doch jeder tut dies auf eine andere Art. Und jede geht unterschiedlich damit um. Die einen spüren ihn intensiv. Die nächsten blenden ihn aus. Und manche wieder suchen den Schmerz. Schmerz lässt sich erlernen, aber auch wieder verlernen. Woher kommt diese individuelle Wahrnehmung und woher der unterschiedliche Umgang damit? Und wie kann man sich all das therapeutisch zunutze machen? Teil 1: Wo tut's weh? Gestaltung: Daphne Hruby. Redaktion: Monika Kalcsics. Gesendet in Ö1 am 09. 02. 2026.

Schmerz lass nach (2)
Jeder Mensch leidet anders. Gestaltung: Daphne Hruby. Redaktion: Monika Kalcsics. Gesendet in Ö1 am 10. 02. 2026.

Schmerz lass nach (3)
Schmerz muss kein Schicksal sein. Gestaltung: Daphne Hruby. Redaktion: Monika Kalcsics. Gesendet in Ö1 am 11.02. 2026.

Schmerz lass nach (4)
Stress schmerzt. Gestaltung: Daphne Hruby. Redaktion: Monika Kalcsics. Gesendet in Ö1 am 12. 02. 2026.

100 Songs: "Big Yellow Taxi" - Joni Mitchell (Kanada, 1970)
Joni Mitchell hatte die Vorhänge ihres Hotelzimmers auf Hawaii geöffnet, sie sah in der Ferne vulkanische Berge, während sich unmittelbar vor dem Hotel ein riesiger Parkplatz auftat. "Wir haben das Paradies betoniert", sang die kanadische Songwriterin im Jahr 1970 relativ beschwingt. "Ist es nicht immer so, dass wir erst wissen, was wir hatten, wenn es nicht mehr da ist?", meinte sie weiter und schrieb mit "Big Yellow Taxi" eine der frühesten ökologischen Hymnen der Popmusik. Gestaltung: Stefan Niederwieser. Co-Host: Robert Stadlober. Redaktion: Astrid Schwarz. Diese Folge wurde in Ö1 am 3. 02. 2026 gesendet und ist Teil des kultur- und zeitgeschichtlichen Archivs von Ö1:Playlist und Literaturliste zum Podcast

100 Songs: "Construção" - Chico Buarque (Brasilien, 1971)
Als Chico Buarque im Jahr 1970 nach eineinhalb Jahren aus dem italienischen Exil heim in die brasilianische Militärdiktatur zurückkam, war er schockiert. Auf Autos klebten Sprüche wie "Brasilien, lieb es oder verlass es" oder "Brasilien, lieb es oder stirb". Im Titelsong des Albums "Construção" von 1971 verband Dichtung mit subtilen sozialen Kommentaren. Der Titel bedeutet übersetzt "im Bau" oder Baustelle. Damit konnte sowohl Brasilien gemeint sein, das neu errichtet werden sollte, die Arbeiterklasse im Land oder die kunstvolle Art, wie Chico Buarque das Album konstruiert hatte. Gestaltung: Stefan Niederwieser. Co-Host: Robert Stadlober. Redaktion: Astrid Schwarz. Diese Folge wurde in Ö1 am 3. 02. 2026 gesendet und ist Teil des kultur- und zeitgeschichtlichen Archivs von Ö1:Playlist und Literaturliste zum Podcast

100 Songs: "Bad Romance" - Lady Gaga (USA, 2009)
Mit der Weltfinanzkrise blühte sog. "Recession Pop" auf, also schnelle, laute, tanzbare Popmusik, die gute Stimmung zur schlechten Lage verbreiten wollte. Die New Yorker Sängerin Lady Gaga wurde 2008 fast über Nacht mit avantgardistischen Bühnenoutfits, Eurodance-Beats und queer-feministischem Spektakel weltbekannt. Ihr Song "Bad Romance" ist ein Jahr später ein Beispiel für den sog. 'Millennial Whoop', bei dem Silben ohne Bedeutung aneinandergereiht werden und Ordnung in chaotisch gewordene Zeichen bringen. Gestaltung: Stefan Niederwieser. Co-Host: Robert Stadlober. Redaktion: Astrid Schwarz. Diese Folge wurde in Ö1 am 4. 02. 2026 gesendet und ist Teil des kultur- und zeitgeschichtlichen Archivs von Ö1:Playlist und Literaturliste zum Podcast

100 Songs: "Susamam" - Saniser (Türkei, 2019)
In "Susamam" - deutsch "Ich kann nicht schweigen" - nahmen 20 türkische Rapper die Zustände in ihrem Land ins Visier. Eine verlorene Generation sprach über Umwelt, Dürre, Recht, Gerechtigkeit, Bildung, Neugier, Frauenrechte, Gewalt an Frauen, Tierrechte, Verkehr, Straßen, Suizid, Faschismus und natürlich über die Türkei. Das Video des Songs "Susamam" wurde innerhalb einer Woche 20 Millionen Mal angesehen. Gestaltung: Stefan Niederwieser. Co-Host: Robert Stadlober. Redaktion: Astrid Schwarz. Diese Folge wurde in Ö1 am 5. 02. 2026 gesendet und ist Teil des kultur- und zeitgeschichtlichen Archivs von Ö1:Playlist und Literaturliste zum Podcast

Phänomen Stau (1)
Stillstand und die Ursachen. Staus sind ein Indikator für die Überlastung unserer Infrastruktur. Staus gibt es aber nicht nur auf Straßen, sondern auch im Luft-, Bahn- oder Schiffsverkehr. Dabei gehen Milliarden Euro an Wertschöpfung verloren, es wird die Umwelt belastet und der Stresspegel steigt bei den Betroffenen. Gestaltung: Andreas Wolf. Redaktion: Ulrike Schmitzer. Gesendet in Ö1 am 2.02. 2026.

Phänomen Stau (2)
Die Psychologie des Staus. Viele Menschen lassen den täglichen Stau, zum Beispiel auf dem Weg in die Arbeit, wie ein Naturereignis über sich ergehen. Die Akzeptanz sinkt jedoch, wenn Staus außerhalb der Norm auftreten. Das führt, je nach Charakter und persönlicher Situation, zu Stress, Lethargie oder Aggressionen. Gestaltung: Andreas Wolf.Redaktion. Ulrike Schmitzer. Gesendet in Ö1 am 3. 03. 2026.

Phänomen Stau (3)
Sand im Logistikgetriebe. Die Grundlage unserer Dienstleistungsgesellschaft bilden "Just in Time" Lieferungen. Damit alles rechtzeitig am richtigen Ort geliefert wird, bedarf es genau abgestimmter Logistikketten. Neben der Schiene und der Straße umfassen diese auch Flugzeuge und Schiffe. Kommt es zu unerwarteten Zwischenfällen müssen Warenströme großflächig umgeleitet und manchmal sogar auf andere Transportmittel verladen werden. Erschwerend kommt hinzu, dass der Welthandel an bestimmten Knotenpunkten chronisch überlastet ist. So wird ein Viertel des globalen Güterverkehrs über die 800 Kilometer lange und an der engsten Stelle nur 50 Kilometer breite Straße von Malakka abgewickelt. Gestaltung: Andreas Wolf. Redaktion: Ulrike Schmitzer. Gesendet in Ö1 am 4. 02. 2026.

Phänomen Stau (4)
Stauvermeidung. Kuchl, Golling, Werfen: Kaum jemand war in den vergangenen Jahren mehr von Stau betroffen als die Gemeinden entlang der Tauernautobahn. Der Grund war die Sanierung einer Tunnelkette entlang der A10. Eine Möglichkeit dem Stau auf der Straße auszuweichen, wäre der Umstieg auf die Bahn. Doch auch hier gibt es Stau. Betroffen ist davon vor allem die Deutsche Bahn, die europaweit zum Inbegriff für Verspätungen und Zugausfälle wurde. Gestaltung: Andreas Wolf. Redaktion: Ulrike Schmitzer. Gesendet in Ö1 am 5. 02. 2026.

Digital abgehängt (1)
Die Digitalisierung hat viele analoge Möglichkeiten verdrängt, vom Bezahlen bis zu Behördenwegen, und setzt damit voraus, dass alle Menschen Geräte bedienen, online navigieren und ständig neue Updates bewältigen können. Wo analoge Alternativen verschwinden, entsteht Ausgrenzung: nicht, weil Menschen "zu wenig können", sondern weil Systeme wenig Rücksicht darauf nehmen, dass Lebensrealitäten, Körper und Gewohnheiten unterschiedlich sind. Gestaltung: Sarah Kriesche: Redaktion: Ina Zwerger. Gesendet in Ö1 am 2. 02. 2026.

Digital abgehängt (2)
Das Geschäft mit der Einfachheit. Ältere Menschen sind längst zu einer festen Zielgruppe des Technikmarktes geworden. Spezielle Telefone mit großen Tasten, abgespeckten Menüs oder Notrufknöpfen sollen Sicherheit vermitteln und den Einstieg erleichtern. Für viele Angehörige klingt das nach einer plausiblen Lösung: Sie kaufen solche Geräte in der Hoffnung, Eltern oder Großeltern den digitalen Alltag zu erleichtern. Gestaltung: Sarah Kriesche: Redaktion: Ina Zwerger. Gesendet in Ö1 am 3. 02. 2026.

Digital abgehängt (3)
Die Last der Anpassung. Immer mehr Lebensbereiche setzen voraus, dass man online ist: Bankfilialen schließen, Fahrpläne werden per App abgerufen, Behördenwege verlangen digitale Identitäten. Für viele bedeutet das nicht Vereinfachung, sondern zusätzlichen Druck. Gestaltung: Sarah Kriesche: Redaktion: Ina Zwerger. Gesendet in Ö1 am 4. 02. 2026.

Digital abgehängt (4)
Recht auf das Analoge. Digitalisierung wird oft als Allheilmittel präsentiert: schneller, günstiger, effizienter. Doch für viele bedeutet sie auch: Neue Barrieren. Die Frage nach digitaler Teilhabe wird inzwischen auch als Frage nach Grundrechten diskutiert. Nicht jede:r kann oder will digitale Dienste nutzen, wenn analoge Alternativen verschwinden, droht Isolation, respektive wird Teilhabe zur Zwangsdigitalisierung. Gestaltung: Sarah Kriesche: Redaktion: Ina Zwerger. Gesendet in Ö1 am 5. 02. 2026.

Leben ohne Müll? (1)
Die Welt erstickt im Abfall. In der EU wirft jede Person 130 Kilogramm Lebensmittel und 15 Kilogramm Textilien jährlich weg. Mit einem neuen Gesetz soll dieser Müll um 30 Prozent reduziert werden. Dazu kommen weltweit weitere 350 Millionen Tonnen Plastikmüll pro Jahr, der Großteils achtlos weggeworfen wird. Wie schaffen wir die Wende zu einer Gesellschaft ohne Müll? Einige Initiativen und Innovationen haben dem Müll den Kampf angesagt. Folge 1: Weg vom Plastik. Gestaltung: Ulrike Schmitzer und Mathias Widter. Redaktion: Ute Maurnböck. Gesendet in Ö1 am 26. 01. 2026.

Leben ohne Müll? (2)
Cradle-to Cradle - Der Stoffkreislauf als Lösung Der Weg zur müllfreien Gesellschaft führt über den Stoffkreislauf. "Kreislaufwirtschaft bedeutet, dass man Produkte wieder auseinander baut und die Materialien wieder einsetzt", erklärt der Pionier der Kreislaufwirtschaft, Michael Braungart. "Wenn die Dinge allerdings nicht für Kreisläufe hergestellt werden, dann schafft man keine Kreislaufwirtschaft, sondern nur ein Downcycling." Die Bauwirtschaft ist einer der größten Abfallerzeuger. Dänemark etwa produziert jährlich rund 11,7 Millionen Tonnen Bauabfälle - diese werden für Architekten zunehmend interessant. Die Idee ist einfach: Verwende Baustoffe, die sonst im Müll landen. Gestaltung: Gestaltung: Ulrike Schmitzer und Mathias Widter. Redaktion: Ute Maurnböck. Gesendet in Ö1 am 27. 01. 2026.

Leben ohne Müll? (3)
Ist die müllfreie Gesellschaft ein Mythos? Gab es schon einmal eine Gesellschaft ohne Müll? Und ist es ein Mythos, dass früher in der Landwirtschaft alles wiederverwertet wurde? Der Kulturhistoriker Roman Köster schreibt in seinem Buch "Müll. Eine schmutzige Geschichte der Menschheit": "Menschen haben schon immer Müll produziert. Die Frage ist, wann wurde das, was die Menschen nicht mehr brauchen, zum Problem? Es gibt Schätzungen der Weltbank, dass wir 2050 auf diesem Planeten 2/3 mehr Müll produzieren werden als jetzt schon. Und das wird noch weiter zunehmen". Gestaltung: Ulrike Schmitzer und Mathias Widter. Redaktion: Ute Maurnböck. Gesendet in Ö1 am 28. 01. 2026.

Leben ohne Müll? (4)
Wie schaffen wir das Zero Ziel: Null Müll? Daniela Hinteregger gehört zur Zero-Waste-Bewegung. Das ist ein Lebensstil, der jeglichen Müll vermeidet. Die Idee geht auf die Amerikanerin Bea Johnson zurück, die den gesamten Müll aus dem Haushalt holen wollte. Das Totschlagargument, eine einzelne Person könne nicht genug ausrichten, lässt sie nicht gelten. Für sie als Teil der Community ist der Austausch wichtig, auch, weiter Wissen zu vermitteln und am Ball zu bleiben. "Aber natürlich braucht es die Politik und die Unternehmen", sagt Daniela Hinteregger. Reparieren, Verwenden statt Besitzen und Second-hand: sind diese alten Ideen die Wegweiser für die Zukunft? Gestaltung: Ulrike Schmitzer und Mathias Widter. Redaktion: Ute Maurnböck. Gesendet in Ö1 am 29. 01. 2026.

Nach der Gewalt (1)
Wenn man derzeit Medien konsumiert, gewinnt man den Eindruck, dass Gewalt gegen Frauen exponentiell zugenommen hat: Kaum ein Tag, an dem nicht über eine Vergewaltigung, einen sexistischen Übergriff oder einen Femizid berichtet wird. Die Serie untersucht, was "Nach der Gewalt" passiert: Finden Frauen ausreichend Schutz und Hilfe? Womit haben sie nach der Gewalt zu kämpfen? Wie kann Gewalt verhindert werden? Gestaltung: Thomas Miessgang. Redaktion. Ulrike Schmitzer. Gesendet in Ö1 am 26.01. 2026.

Nach der Gewalt (2)
Der Tag nach der Gewalt. Frauen, die physische, psychische, ökonomische und institutionelle Gewalt erleben, suchen vor allem einmal Schutz. Um ihnen zu helfen, gibt es Frauenhäuser, Gewaltambulanzen, den Frauennotruf und eine Helpline. Expertinnen wie die Politikwissenschaftlerin und Frauenrechtlerin Maria Rösslhumer und die Obfrau Andrea Czak des Vereins FEM.A (=feministische Alleinerzieherinnen) erläutern, ob diese Infrastruktur ausreichend ist, um die Aufgaben erfüllen zu können. Gestaltung: Thomas Miessgang. Redaktion. Ulrike Schmitzer. Gesendet in Ö1 am 27.01. 2026.

Nach der Gewalt (3)
Nach der Trennung kommt die Post.Wenn Frauen mit Kindern es schaffen, sich von einem gewalttätigen Partner zu trennen, finden sie sich in der Rolle von Alleinerzieherinnen wieder - eine, wie aus sämtlichen Statistiken hervorgeht, besonders vulnerable gesellschaftliche Gruppe. Nicht nur, dass das Einkommen, das häufig in Teilzeit erwirtschaftet werden muss, kaum ausreicht, kommt es meist zu juristischen Auseinandersetzungen. Stichwort: Kampf ums Kind. Gestaltung: Thomas Miessgang. Redaktion: Ulrike Schmitzer. Gesendet in Ö1 am 28.01. 2026.

Nach der Gewalt (4)
Gewalt gegen Frauen - Was tun? Dass auch heute noch so viel Gewalt gegen Frauen stattfindet, ist nicht nur ein Armutszeichen für die politische Entwicklung, sondern verursacht auch massiven gesellschaftlichen Schaden: Statistiken belegen, dass dem Staat auf diese Weise jährlich 7,3 Milliarden entgehen, die in Infrastrukturkosten für Frauenschutz fließen oder durch zeitweise Arbeitsunfähigkeit der Betroffenen anfallen. Expert:innen wie die Autorin Petra Unger und die Psychologin Martina Rammer Gmeiner erläutern, wie der Nationale Aktionsplan gegen Frauengewalt, der vor kurzem verabschiedet wurde, zu bewerten ist und was man von der geplanten Familienrechtsreform erwarten kann. Gestaltung: Thomas Miessgang. Redaktion: Ulrike Schmitzer. gesendet in Ö1 am 29.01. 2026.

Positionen in der Kunst: Ulay und Marina Abramovic (1)
Zwölf Jahre lang waren sie das Traumpaar der Performance: Schlugen sich, verharrten 16 Stunden Rücken an Rücken, zeigten in einer dreimonatigen Marathon-Performance, dass man einander täglich acht Stunden bewegungslos anstarren kann. Zwischen 1976 und 1988 führten Ulay und Marina Abramovic am Kunstparkett einen abgründigen Pas-de-deux auf und malträtierten ihre Körper bis an die Grenzen der Belastbarkeit. Die Kunstwelt verdankt ihnen Performances, die im doppelten Wortsinn unter die Haut gehen. Derzeit ist eine große Retrospektive von Marina Abramovics Werk in der Albertina modern in Wien zu sehen. Die Cukrarna in Ljubliana zeigt bis 3. Mai unter dem Titel "Art Vital - 12 Years of Ulay und Marina Abramovic" eine Ausstellung, die die kollaborative Praxis des Künstlerpaares Ulay und Marina Abramovic in den Blick nimmt. Gestaltung: Christine Scheucher. Gesendet in Ö1 am 19.01. 2026.

Positionen in der Kunst: Julius von Bismarck (2)
Er peitschte auf die Felsen eines alpinen Bergmassivs ein, erfand mit seinem "Fulgurator" eine Geheimwaffe für ausgekochte Medien-Guerilleros und installierte am Wienerberg einen 8 Meter hohen Smiley, der anzeigt, wie sich die Wiener gerade fühlen. Julius von Bismarck schafft einprägsame Bilder, die in den öffentlichen Raum ausstrahlen. Studiert hat der 42-Jährige bei Olafur Eliasson, seine Themen findet der Deutsche abseits zeitgeistiger Debattenfelder. Das Kunsthaus Wien widmet von Bismarck derzeit unter dem Titel "Normale Katastrophe" eine große Schau, die zeigt, dass die Kunst des Experiments auch sinnliche Qualitäten entfalten kann. Gestaltung: Christine Scheucher. Gesendet in Ö1 am 20. 01. 2026.

Positionen in der Kunst: Tobias Pils (3)
Tobias Pils ist einer der aufregendsten Maler, die Österreich derzeit zu bieten hat, weil er es schafft, seine Kunst mit Dringlichkeit auszustatten: Schlichte Formen und eine reduzierte Farbpalette genügen, um eine suggestive Ästhetik der Reduktion zu entwerfen, banale Gegenstände werden transzendiert und erhalten eine existentielle Dimension. Gestaltung: Thomas Mießgang. Gesendet in Ö1 am 21. 01. 2026.

Positionen in der Kunst: Gerhard Richter (4)
Die Medien feierten ihn als Picasso des 21. Jahrhunderts. Einer breiten Öffentlichkeit ist Gerhard Richter vor allem als teuerster Maler der Gegenwart bekannt. Die Rolle als Star eines überhitzten Kunstmarktes fiel dem scheuen Maler wider Willen zu. Im Laufe seiner Karriere hat sich der Deutsche immer wieder neu erfunden: In seinem Werk trifft Fotorealismus auf Abstraktion, expressive Farben auf monochrome Leinwände. Die Fondation Louis Vuitton in Paris zeigt derzeit die wohl größte Retrospektive, die dem vielstimmigen Werk des Künstlers jemals gewidmet war und würdigt das Lebenswerk des 93jährigen, der vom Kunstmagazin "Monopol" zum einflussreichsten Künstler des Jahres 2025 gekürt wurde. Gestaltung: Christine Scheucher. Gesendet in Ö1 am 22. 01. 2026.

Keine Panik. Angststörungen (1)
Angst - ein Urgefühl, tief verankert im vegetativen Nervensystem von allen Arten von Tieren. Sie reagieren blitzschnell auf Gefahren: die Angst schießt regelrecht ein und augenblicklich kommt es zu hormonellen Veränderungen: Adrenalin wird freigesetzt, das den Blutdruck erhöht, die Sinne schärft und sämtliche vorhandenen Energieressourcen freisetzt. Das hat unterschiedliche Folgen. Je nach Tierart und Tarnung flüchtet das Tier - wie Pferde, Rotwild, Hasen und dergleichen, oder es erstarrt und stellt sich tot: wie Echsen und Insekten. Der Mensch ist ein besonderes Tier: er kann beides: weglaufen, sich verstecken, sich totstellen. Was bedeutet Angst für den Menschen? Wann wird dieses gesunde Schutzverhalten krankhaft? Und welche Ursachen und Auswirkungen hat das? Sabine Nikolay erkundet Angst und Panik. Gestaltung: Sabine Nikolay. Gesendet in Ö1 am 19.01. 2026.

Keine Panik. Angststörungen (2)
Überwältigende Angst.Wir leben in einer zusehends komplexeren und schwer zu durchschauenden Welt. Industrien und Umweltkatastrophen zerstören die Umwelt, das Klima ändert sich spürbar für alle, die Naturkatastrophen nehmen zu. Egal ob Überschwemmungen, Hochwasser, Tsunamis, Erdbeben oder Gletscherschmelze - noch ist nicht klar, wie rasch und mit welchen Langzeitfolgen sich die Erde erwärmt. Klar ist: Gesund ist das nicht. Dazu kommen Umweltgifte, illegale Deponien, ewige Chemikalien. Der einzelne Mensch steht vor all diesen menschengemachten Katastrophen und hat Angst. Wie kann man solchen Bedrohungen begegnen? Sabine Nikolay beschäftigt sich in dieser Folge ihrer Serie mit Strategien den Ohnmachtsgefühlen zu begegnen und in die Aktivität zu kommen. Der Schlüsselbegriff für die Angstbewältigung hier ist: Kontrolle. Gestaltung: Sabine NIkolay. Gesendet in Ö1 am 20. 01. 2026.

Keine Panik. Angststörungen (3)
Persönliche Ängste.Wir alle erschaffen uns eine Identität, die Halt gibt: Ausbildung, beruflicher Werdegang, Job, Kollegen, Karriere, eine eigene Familie, Partnerschaft, Kinder, gemeinsame Erlebnisse. Doch oft bekommen diese Traumerzählungen Risse, manche lassen sich nicht verwirklichen oder gehen in die Brüche. Der Mensch hat viele Strategien, um damit umzugehen oder diese Krisen zu bewältigen, manche sind toxisch: Verleugnung, Wegschauen, Beharren, Verheimlichen, und immer wieder dasselbe versuchen - obwohl es zu nichts führt. Manche sind gut - Neuanfang, Evaluierung, kritische Auseinandersetzung mit Zielen, Wünschen und Schritten hin zu deren Verwirklichung. Woher kommt die Angst, die einen auf einem normalen Lebensweg immer wieder heimsucht und wie können wir ihr selbstwirksam begegnen? Sabine Nikolay über eingeübte Muster und Neubewertungen. Gestaltung: Sabine Nikolay. Gesendet in Ö1 am 21. 01. 2026.

Keine Panik. Angststörungen (4)
Die Mikro-Angst."Wenn es Ihnen ganz schlecht geht, lächeln Sie", sagt die Psychoanalytikerin Erika Friedman. "Irgendwann realisiert das Gehirn: Der Mensch lächelt, also muss ich glücklich sein" - und setzt Endorphine frei, woraufhin sich tatsächlich ein Glücksgefühl einstellt. Ein ähnlicher Mechanismus kann auch der pathologischen Angst, unüberwindbaren Angstgefühlen und Panikattacken zugrunde liegen: Wer lange Kummer hat, bekommt früher oder später Magenschmerzen oder gar ein Magengeschwür. Bakteriell verursachte Magengeschwüre, eine gestörte Verdauung oder eine Gastritis können ebenso wirken: der Mensch entwickelt Angstgefühle scheinbar ohne Grund. Wie wirken Mikroben auf unsere Psyche? Sabine Nikolay untersucht mögliche Ursachen krankhafter Angst im Darm - und stellt Heilungsmethoden vor. Gestaltung: Sabine Nikolay. Gesendet in Ö1 am 22. 01. 2026.

Alte weise Frauen: Helga Kromp-Kolb
Wie man sich gegen alle Widerstände durchsetzt.Helga Kromp-Kolb war ab den 1970er Jahren Österreichs erste Klimawandelforscherin - und das noch zu einer Zeit, als von der "Klimakrise" und dem Klimawandel medial und gesellschaftlich keine Rede war: Von 1986 bis 1995 leitet sie die Abteilung "Umweltmeteorologie" an der Universität für Bodenkultur in Wien. Und an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik baut sie die gleichnamige Abteilung auf. Ab 1995 war Helga Kromp-Kolb Universitätsprofessorin an der Universität für Bodenkultur - damals lag der Anteil der Professorinnen an den Universitäten bei knapp 4 Prozent. In dieser feministischen Interviewreihe kommen statt der sogenannten „alten weißen Männer“ „alte weise Frauen“ zu Wort, um über gesellschaftspolitische Zustände zu reflektieren. Es gilt eine Regel: Ü60! Gestaltung: Alexandra Augustin. Gesendet in Ö1 am 6. 10. 2025.

Alte weise Frauen: Elisabeth Lukas
Wie man ein sinnerfülltes Leben lebt.Die "Sinnzentrierte Psychotherapie", auch als Logotherapie oder Existenzanalyse bekannt, ist eine von Viktor Frankl begründete Therapieform, die sich auf die Suche nach Sinn und Bedeutung im Leben konzentriert. Eine seiner wichtigsten Schülerinnen war Elisabeth Lukas: Sie gilt heute als eine der bedeutendsten österreichischen Psychotherapeutinnen und klinischen Psychologinnen und als Expertin für Logotherapie. Sie spezialisierte sich vor allem auf die praktische Anwendung und Weiterentwicklung der von Frankl begründeten sinnzentrierten Psychotherapie. In dieser feministischen Interviewreihe kommen statt der sogenannten „alten weißen Männer“ „alte weise Frauen“ zu Wort, um über gesellschaftspolitische Zustände zu reflektieren. Es gilt eine Regel: Ü60! Gestaltung: Alexandra Augustin. Gesendet in Ö1 am 09. 10. 2025.

Alte weise Frauen: Brigitte Ederer
Wie man CEO wird.Siemens - ein großer Name, der einst eng mit dem Wiener Wirtschaftsstandort und dem Aufstieg der Elektroindustrie verbunden ist. Und ein großer Name in der Geschichte von Siemens ist Brigitte Ederer: Geboren wurde sie 1956 als Tochter einer alleinerziehenden Mutter in Wien. Die Mutter arbeitete als Reinigungskraft, um ihren zwei Kindern eine Bildung zu ermöglichen. Mit nur 27 Jahren zog Brigitte Ederer 1983 in den Nationalrat ein - die erste Abgeordnete unter 30. Im April 1992 wurde Ederer unter Vranitzky Staatssekretärin für europäische Integration und Entwicklungszusammenarbeit. 2000 wechselte Brigitte Ederer in den Vorstand der Siemens AG Österreich. 2005 wurde sie Generaldirektorin. In dieser feministischen Interviewreihe kommen statt der sogenannten „alten weißen Männer“ „alte weise Frauen“ zu Wort, um über gesellschaftspolitische Zustände zu reflektieren. Es gilt eine Regel: Ü60! Gestaltung: Alexandra Augustin. Gesendet in Ö1 am 05. 10. 2025.

Alte weise Frauen: Andrea Brem
Gewalt gegen Frauen - Frauen gegen Gewalt.Was Gewalt gegen Frauen angeht, liegt Österreich EU-weit im traurigen Spitzenfeld und die COVID-19-Pandemie hat die Problematik weiter zugespitzt. Natürlich ist Gewalt gegen Frauen kein neues Phänomen aber nicht immer gab es Hilfe für diese Frauen. Geändert hat sich das in Österreich 1978, als das erste Frauenhaus Österreichs gegründet wurde. Andrea Brem hat viele Frauenhäuser in Wien mit aufgebaut. Von 2001 bis 2024 war Andrea Brem Geschäftsführerin im Verein Wiener Frauenhäuser. 2013 gründen die Wiener Frauenhäuser, das Frauenhaus in Graz und das Haus der Frau in St. Pölten den Zusammenschluss österreichischer Frauenhäuser, mit Andrea Brem als Vorsitzende. In dieser feministischen Interviewreihe kommen statt der sogenannten „alten weißen Männer“ „alte weise Frauen“ zu Wort, um über gesellschaftspolitische Zustände zu reflektieren. Es gilt eine Regel: Ü60! Gestaltung: Alexandra Augustin. Gesendet in Ö1 am 08.10.2025.

Das Gute Leben (3)
Freude am Sein. Gestaltung: Alexandra Augustin, Judith Brandner, Johannes Kaup, Juliane, Lehmayer, Sabine Nikolay, Barbara Volfing. Redaktion: Ute Maurnböck. Gesendet am 24. 12. 2025.

Das Gute Leben (2)
"Trotzdem" Ja sagen. Gestaltung: Alexandra Augustin, Ute Maurnböck, Johannes Kaup. Redaktion: Ute Maurnböck. Gesendet in Ö1 am 23. 12. 2025.

Das Gute Leben (1)
Der Mensch ist ein soziales Wesen. Und wer etwas für die Gemeinschaft tut, ist glücklicher und zufriedener, weiß auch die Hirnforschung. Wenn wir uns für andere einsetzen, entsteht etwas, das weit über uns hinauswirkt. Folge 1: Handeln für Alle - Wirken fürs Ganze. Gestaltung: Sonja Bettel, Daniel Kruppa, Ute Maurnböck, Diana Köhler, Barbara Volfing. Redaktion: Ute Maurnböck. Gesendet in Ö1 am 22. 12. 2025.

Ukraine - oder der nicht so alltägliche Alltag im Krieg (1)
Vor bald vier Jahren hat Russland die große Invasion der Ukraine begonnen. Aus Kindern sind Waisen geworden, aus Museums-Managerinnen Kultur-Kämpferinnen, aus Kleinunternehmern Soldaten und aus Soldaten oft Invalide. Stefan Schocher berichtet von einem Alltag in einem Land, das sich zur Wehr setzt. Folge 1: Leben mit Flugabwehr - der zähe Kampf gegen Drohnen. Gestaltung: Stefan Schocher. Redaktion: Monika Kalcsics. Gesendet in Ö1 am 15. 12. 2025.

Ukraine - oder der nicht so alltägliche Alltag im Krieg (2)
Die russische Besatzung ukrainischer Gebiete geht nebst Gewalt mit drei Dingen einher: neuen Lehrplänen für die Schulen, Kulturpolitik mitsamt Umdeutung von Museen und der russischen Kirche. Russland hat über Jahrhunderte für sich in Anspruch genommen, die Geschichte der Ukraine zu schreiben und die Kultur dieses Landes zu definieren - und tut das nach wie vor. Kunst, Kultur und Geschichte sind ein Feld, das Russland auch immer dazu benutzt hat, um Einfluss zu nehmen. Spätestens seit der Revolution der Würde 2014 hat die Ukraine das aber selbst in die Hand genommen. Heute ist das einst wichtigste russische Kloster in der Ukraine ein Museum, in dem ukrainische Geschichte von ukrainischen Historikern und Kunsthistorikern erzählt wird. Die Leiterin der Vereinigung ukrainischer Museen, Milena Chorna, führt durch das Kyiver Pecherska Lavra und eine Ausstellung. Gestaltung: Stefan Schocher. Redaktion: Monika Kalcsics. Gesendet in Ö1 am 16. 12. 2025.

Ukraine - oder der nicht so alltägliche Alltag im Krieg (3)
Eine Generation, die mit Krieg aufwächst.Russlands Krieg gegen die Ukraine hat mit sich gebracht, dass hunderttausende Menschen unter täglichem Beschuss leben. Großstädte wie Kharkiv, Sumy, Mykolayiv oder Zaporizhzhja werden immer wieder schwer beschossen. Vor allem Kinder leiden darunter. Viele sind bereits mehrmals umgezogen, haben Verwandte oder Schulfreunde verloren, viele haben es auch erlebt, wie diese gestorben sind. Was tun mit diesen Erfahrungen? Wie damit umgehen? Wie wirkt sich das aus? Im Rahmen von Feriencamps lernen Kinder, wie sie mit Wut, Ohnmacht und Trauer umgehen können. Nicht zuletzt sind solche Camps aber ganz einfach eine freudvolle Auszeit aus einem Alltag, der nicht viele Freuden bietet. Eine Psychologin sagt: Diese Kinder machten keine Pläne für ihr Leben, dafür sei ganz einfach kein Platz. Gestaltung: Stefan Schocher. Redaktion: Monika Kalcsics. Gesendet in Ö1 am 17. 12. 2025.

Ukraine - oder der nicht so alltägliche Alltag im Krieg (4)
Der Krieg und seine invaliden Heimkehrer.Je länger dieser Krieg dauert, desto mehr wird Invalidität zum Thema. Das Problem ist, dass die Ukraine weder administrativ noch infrastrukturell auf diese Flut vorbereitet ist. Der Unterschied zwischen der Ukraine und der EU seien 15 Zentimeter sagt Sasha Kikin, ein Kriegsinvalider, der zu so etwas wie einem Sprecher für die Anliegen von Kriegsinvaliden geworden ist. Was er damit meint, sind Treppen. Denn die sind überall in der Ukraine. Sasha Kikin ist zugleich auch Golf-Trainer für Veteranen. Denn Golf, ist der wohl inklusivste Sport, der zugleich Konzentration und Bewegungsfähigkeit trainiert. Beim Veteranen-Golf geht es allerdings um viel mehr als das Spiel, sondern vor allem auch um Gemeinschaft. Gestaltung: Stefan Schocher. Redaktion: Monika Kalcsics. Gesendet in Ö1 am 18. 12. 2025.

Gendermedizin - Mythen, Macht und Meilensteine (1)
Wer zum Beispiel verstehen möchte, wie sich Mythen rund um das Thema Frauengesundheit teilweise bis heute halten konnten, muss nur einen Blick in die Geschichte werfen: Das Patriarchat ist tief in der Medizin verwurzelt, das führt zu gefährlichen Versorgungslücken und Behandlungsfehlern. Doch wie kommt man hin zu einer guten medizinischen Versorgung - für alle Menschen? Folge 1: Ein Blick in die Geschichte. Gestaltung: Katrin Grabner. Redaktion: Alexandra Augustin. Gesendet in Ö1 am 15. 12. 2025.

Gendermedizin - Mythen, macht und Meilensteine (2)
Leerstellen und Lücken in der Forschung.In der Forschung stehen Frauen auch im 20. Jahrhundert auf dem Abstellgleis - sowohl als aktiver, als auch als passiver Part: Die Zahl der Medizinerinnen steigt zwar, die Zahl der Studienprobandinnen aber nicht unbedingt. Arzneimittelskandale wie die "Contergan-Tragödie" in den 1960er Jahren sorgen dafür, dass Frauen als Probandinnen aus Studien ausgeschlossen werden. Mit fatalen Folgen: In fast allen Bereichen der Medizin gibt es große Leerstellen. Seit 2010 gibt es in Wien eine Professur und eigene Abteilung am AKH für "Gendermedizin": Ein Teilgebiet der Humanmedizin, das erforscht, wie biologische und soziale Geschlechterfaktoren die Gesundheit, die Entstehung und den Verlauf von Krankheiten sowie deren Behandlung beeinflussen. Gestaltung: Katrin Grabner. Redaktion: Alexandra Augustin. Gesendet in Ö1 am 16. 12. 2025.

Gendermedizin - Mythen, Macht und Meilensteine (3)
Unsichtbare Leiden.Vor allem der Globalisierung und Social Media ist es zu verdanken, dass sich heutzutage Frauen weltweit über Gesundheit und Krankheit direkt miteinander austauschen - und so dafür sorgen, dass typische "Frauenleiden" wie Menstruationsbeschwerden, PMS, Wechseljahre, Migräne, Depression und Ähnliches in ein anderes Licht gerückt werden und mehr Aufmerksamkeit bekommen. Es wird immer deutlicher: Frauen erleben körperliche sowie psychische Erkrankungen und Beschwerden oft anders als Männer. Kritiker:innen betonen, dass es an der Zeit ist, dass sich dies auch in der Wissenschaft und Praxis abbildet. Der Wandel in der Medizin findet statt - langsam, aber doch. Der Ruf nach einer Anerkennung und allgemeingültigen Integration von Gendermedizin wird lauter - auch unter Fachpersonen. Gestaltung: Katrin Grabner. Redaktion: Alexandra Augustin. Gesendet in Ö1 am 17. 12. 2025.

Gendermedizin - Mythen, Macht und Meilensteine (4)
Eine Medizin, die allen hilft.Während Interessensvereine weltweit einen Anstieg an Queerfeindlichkeit, insbesondere an Transphobie beobachten, wächst das medizinische Wissen über Geschlechtsinkongruenz. Heute gibt es verschiedene Anlaufstellen für Nicht-binäre und Transgender Personen sowie Spezialambulanzen für Transgendermedizin. Die Geschichte der Genitalverändernden und Geschlechtsangleichenden Chirurgie (GA OPs) reicht bis ins alte Ägypten und birgt dunkle Kapitel. Doch wie steht es heute tatsächlich um die medizinische Versorgung queerer Menschen? Welche medizinischen Herausforderungen ergeben sich bei Genderinkongruenz und wie geht es Betroffenen mit ihren Behandlungsmöglichkeiten? Wie muss man die Geschlechtervielfalt in medizinische Forschung und Behandlungsmöglichkeiten einbeziehen? Wie kann man zu einer Medizin kommen, die allen Menschen gleichberechtigt hilft? Gestaltung: Désirée Prammer. Redaktion: Alexandra Augustin. Gesendet in Ö1 am 18. 12. 2025.

Das Ö1 Insektarium: Die japanische Buschmücke (1)
Die Weihnachtsferien gelten als die Hoch-Zeit für Fernreisen. Immer wieder hört man von Menschen, die nach der Rückkehr an tropischen Erkrankungen leiden. Diese werden von Bakterien und Viren ausgelöst - Überträger, in der Fachsprache auch "Vektoren" genannt, sind oft Insekten. Um zu erkranken, reicht ein Stich oder Biss - doch dabei bleibt es manchmal nicht. Die Insekten werden auch eingeschleppt - und manche sind, dank Klimawandel, gekommen, um zu bleiben. Die steigenden Temperaturen führen auch dazu, dass die Tiere selbständig einwandern, ohne sich in Schiffen, Containern, Autoreifen oder Flugzeugen zu verstecken. Die 13. Staffel des Ö1 Insektariums widmet sich den Immigranten: Insekten, die gekommen sind, um zu bleiben. Folge 1: Die japanische Buschmücke. Gestaltung: Sabine Nikolay. Redaktion: Monika Kalcsics. Gesendet in Ö1 am 09. 12. 2025.

Das Ö1 Insektarium: Die Sandmücke (2)
Phlebotomen - winzige stechende geräuschlos fliegende Schmetterlingsmücken - kommen überall auf der Welt mit Ausnahme einiger pazifischer Inseln und Neuseelands vor. Sie können die Leishmaniose übertragen, eine Erkrankung die Haut, Schleimhäute und Innenorgane befallen kann - im letzteren Fall kann das tödlich enden. Die Mücken sind nachtaktiv - aber Vorsicht: ein herkömmliches Moskitonetz schützt oft nicht, da die Tiere so winzig sind, dass sie durch die Öffnungen im Netz krabbeln können. In Mitteleuropa wurden sie als typisch mediterrane Insekten lange übersehen. Bekannt sind sie seit fast 30 Jahren, ihre Wanderung weiter nach Norden wird vermutlich durch den Klimawandel begünstigt. Gestaltung: Sabine Nikolay. Redaktion: Monika Kalcsics. Gesendet in Ö1 am 10. 12. 2025.

Das Ö1 Insektarium: Orthopodomyia pulcripalpis (3)
Orthopodomyia pulcripalpis ist ein lebendes Fossil. In Österreich wurde sie bei den regelmäßig stattfindenden Insektenmonitorings vor einigen Jahren im 14. Wiener Gemeindebezirk gefunden. Sie ist aber noch so neu, dass sie keinen deutschen Namen hat, wie die österreichische Biologin Carina Zittra darlegt. Tatsächlich ist sie aber seit langem in Europa heimisch - sie hat die letzte Eiszeit in eisfreien Nischen überlebt. Die Tiere können Träger von Arboviren sein, die sie aber wenn überhaupt dann auf Vögel übertragen. Die "Wohlfühlgelse" ist nämlich orthophil, sie sticht Vögel, aber keine Menschen. Gestaltung: Sabine Nikolay. Redaktion: Monika Kalcsics. Gesendet in Ö1 am 11. 12. 2025.

Rilke - Die Wiederverzauberung der Welt (1)
Die einen verehren Rainer Maria Rilke als genialen Sprachmagier, der das "Ganze des Daseins" in einer immer zerrisseneren Welt noch einmal in Worte fassen wollte. Für die anderen - den Philosophen Theodor W. Adorno etwa - war der Beamtensohn aus Prag ein Edel-Kitschier, ein Fabrikant süßlicher Gefühle, der selbst die Armut noch in weltfremden Versen zu romantisieren suchte. In letzter Instanz, so Adorno, sei Rilke mit seinen Dichtungen auf dem schmalen "Grat zum Faschismus" gewandelt. Folge 1: Düe frühen Jahre. Gestaltung: Günter Kaindlstorfer. Redaktion: Ulrike Schmitzer. Gesendet in Ö1 am 9. 12. 2025.

Rilke - Die Wiederverzauberung der Welt (2)
Dichter der Angst. Gestaltung: Günter Kaindlstorfer. Redaktion: Ulrike Schmitzer. Gesendet in Ö1 am 10. 12. 2025.

Rilke - Die Wiederverzauberung der Welt (3)
Religion nach dem Tod Gottes. Gestaltung: Günter Kaindlstorfer. Redaktion: Ulrike Schmitzer. Gesendet in Ö1 am 11. 08. 2025.

Was uns (be)hindert (1)
Die Bedürfnisse von "Menschen mit besonderen Bedürfnissen" sind meist gar nicht so besonders, wie man meinen möchte. Wie alle anderen Menschen auch, wollen sie ein schönes Leben, einen guten Job, soziale Absicherung, Hobbys und Freund:innen. Doch, was (be) hindert sie eigentlich in Alltag, Freizeit und beim Träumen? Mit dieser Frage beschäftigt sich das inklusive Team des Radiokollegs. Folge 1: Wunsch und Wirklichkeit in der Arbeitswelt. Gestaltung: Marietta Trendl, Christoph Dirnbacher, Sandra Knopp, Katharina Reiner, Udo Seelhofer und Helmuth Schlögl. Redaktion: Ulla Ebner, Judith Brandner, Juliane Nagiller. Gesendet in Ö1 am 1. 12. 2025.

Was uns (be)hindert (2)
Wie Einsparungen Inklusion bedrohen.Ein riesiges Loch klafft im österreichischen Budget. Gespart wird - wie könnte es auch anders sein - im Sozialbereich. Und das wird ganz besonders auch Menschen mit Behinderungen treffen. So hat beispielsweise das Sozialministerium den Mobilitätszuschuss für heuer halbiert. Diesen Zuschuss erhalten berufstätige Menschen, denen es aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen nicht zumutbar ist, den täglichen Arbeitsweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen. Wir fragen nach, wo sonst noch im Inklusionsbereich der Sparstift angesetzt wird, und stellen wichtige Projekte zur Förderung von Barrierefreiheit vor. Gestaltung: Sandra Knopp, Christoph Dirnbacher, Katharina Müllebner, Udo Seelhofer und Mario Simona. Redaktion: Ulla Ebner, Judith Brandner, Juliane Nagiller. Gesendet in Ö1 am 2. 12. 2025.

Was uns (be)hindert (3)
Barrierefreie Freizeit.Wir möchten gerne ein wenig träumen und uns fragen: Wie würde denn eine komplett barrierefreie Welt aussehen? Wie müsste beispielsweise ein Café konzipiert sein, damit sich dort sowohl eine Autistin als auch eine Rollstuhlfahrerin und eine Person mit Sehbehinderung wohlfühlen? Außerdem besuchen wir die Sportarena Wien und begleiten 20 sportbegeisterte Personen im Rollstuhl beim Rollballspielen. Und für jene, die sich nicht so gerne selbst bewegen, sondern das lieber ihre Computer-Avatare machen lassen, haben wir uns angeschaut, wie Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen Videogames spielen können. Gestaltung: Juliane Nagiller, Lisa Steiner, Alexander Zeitlhofer, Irmi Wutscher, Emma Lipka. Redaktion: Ulla Ebner, Judith Brandner, Juliane Nagiller. Gesendet in Ö1 am 3. 12. 2025.

Was uns (be)hindert (4)
Freundschaft und Liebe mit Handicap.Menschen sind soziale Wesen - die meisten zumindest. Menschen mit Behinderungen stellen da keine Ausnahme dar. Wir haben ein inklusives Clubbing besucht und am Rande des Dance Floors nachgefragt, ob es für Personen, die im Rollstuhl sitzen, eine Sehbehinderung oder andere Einschränkungen haben, eigentlich schwieriger ist, Freund:innen zu finden als für Leute ohne Behinderung. Und natürlich interessiert uns auch, wie es mit Liebe, Sex und Zärtlichkeit aussieht. Wir treffen ein ungleiches Paar und eine Dame, die Menschen mit Behinderungen dabei unterstützt, körperliche Lust zu leben. Gestaltung: Emma Lipka, Elisa Mattersberger, Melissa Felsinger und Isabelle Funke. Redaktion: Ulla Ebner, Judith Brandner, Juliane Nagiller. Gesendet in Ö1 am 4. 12. 2025.

Border Business (1/4)
Kameras mit Gesichtserkennung, die in Flüchtlingslagern jeden Schritt registrieren. Algorithmen, die über Asylanträge entscheiden. Drohnen, die Europas Grenzen in Echtzeit überwachen. Die EU verstärkt den Grenzschutz - mit Hochsicherheitslagern und immer neuen Kontrollsystemen. Dahinter steckt nicht nur Politik, sondern auch ein wachsendes Business. Die vierteilige Serie erzählt, wer investiert, wer profitiert - und wer verliert. Folge 1: Das Experiment - Schauplatz Albanien. Gestaltung: Franziska Grillmeier und Anja Troelenberg. Mit Stefanie Reinsperger als Erzählerin. Stimmen: Barbara Gassner, Roman Blumenschein. Studiotechnik: Fridolin Stolz, Georg Janser. Redaktion: Monika Kalcsics. Eine Ö1 Produktion in Kooperation mit ORF SOUND.

Border Business (2/4)
Der Zaun - Schauplatz Ungarn:Mitten in der Fluchtbewegung 2015 zieht Ungarn einen doppelten Maschendrahtzaun hoch - damals ein Tabubruch. Heute ist die Anlage mit Wärmebildkameras und Bewegungssensoren ausgestattet. Was einst für Empörung sorgte, gilt heute vielen Regierungen als Vorbild. Gestaltung: Franziska Grillmeier und Anja Troelenberg. Mit Stefanie Reinsperger als Erzählerin. Stimmen: Barbara Gassner, Roman Blumenschein. Redaktion: Monika Kalcsics. Gesendet in Ö1 am 25. 11. 2025.

Border Business (3/4)
Die Technik - Schauplatz Griechenland:Im Hochsicherheitslager auf Samos regelt das Einlasssystem "Hyperion" die Ein- und Ausgänge über elektronische Karten mit biometrischen Daten, während das Sicherheitssystem "Centaur" das gesamte Gelände mit KI-gestützten Kameras, Drohnen und Sensoren überwacht. Eröffnet wurde das Lager 2021 - als erstes von fünf neuen "Closed Controlled Access Centers" (CCACs) auf den ägäischen Inseln, die mit 276 Millionen Euro aus Brüssel finanziert werden. Es ist die politische Antwort auf den Brand des Flüchtlingslagers Moria. Das neue Prinzip lautet: Kontrolle. Gestaltung: Franziska Grillmeier und Anja Troelenberg. Mit Stefanie Reinsperger als Erzählerin. Stimmen: Barbara Gassner, Roman Blumenschein. Redaktion: Monika Kalcsics. Gesendet in Ö1 am 26. 11. 2025.

Border Business (4/4)
Das Geschäft - Schauplatz EU:Drohnen, Militärfahrzeuge, Satellitentechnik - auf der internationalen Verteidigungsmesse DEFEA in Athen präsentiert die Sicherheitsindustrie ihre neuesten Produkte. Rüstungsfirmen treffen auf Delegationen von Ministerien, Polizei und Grenzschutzbehörden. Von dort führt die Recherche nach Brüssel, wo nicht nur Leitlinien beschlossen, sondern auch enorme Summen verteilt werden. Im Rahmen der EU-Verteidigungsinitiative "Readiness 2030" (vormals "ReArm Europe") sollen bis zu 800 Milliarden Euro für Verteidigung mobilisiert werden - so viel wie nie zuvor. Gestaltung: Franziska Grillmeier und Anja Troelenberg. Mit Stefanie Reinsperger als Erzählerin. Stimmen: Barbara Gassner, Roman Blumenschein. Redaktion: Monika Kalcsics. Gesendet in Ö1 am 27. 11. 2025.

Wissenschaftsjournalismus unter Druck (1)
Aus der Nische ins Rampenlicht.Lange Zeit fristete der Wissenschaftsjournalismus ein Nischendasein. Doch spätestens seit Pandemie, Klimakrise und dem politischen Aufstieg der "Tech-Bros" in den USA, gestalten Wissenschaftsredakteure und Tech-Journalistinnen immer öfter die Aufmacher von Nachrichtenmagazinen. Sie versuchen, Orientierung zu schaffen im Wirrwarr von Studien, Fakten und alternativen Fakten. Gestaltung: Ulla Ebner. Redaktion: Ina Zwerger. Gesendet in Ö1 am 17. 11. 2025.

Wissenschaftsjournalismus unter Druck (2)
Die Politisierung der Wissenschaft.In vielen Ländern steht Wissenschaft unter Beschuss. Oder besser gesagt bestimmte Forschungsrichtungen. Im Jahr 2021 verbannte Victor Orban Gender Studies von den ungarischen Universitäten. In den USA werden Förderungen für Impfforschungen ebenso gestrichen wie Forschungsprojekte, die sich in irgendeiner Weise mit Chancengleichheit oder Gerechtigkeit beschäftigen. Von Klimaforschung ganz zu schweigen.In diesem Kontext wird auch Wissenschafts- und Tech-Journalismus politisch. Gestaltung: Ulla Ebner. Redaktion: Ina Zwerger. Gesendet in Ö1 am 18. 11. 2025.

Wissenschaftsjournalismus unter Druck (3)
Zwischen Aufklärung und Panikmache.Wir leben in Zeiten des Umbruchs - sowohl politisch als auch technologisch. Künstliche Intelligenz ist gerade dabei, viele Bereiche unseres Lebens zu verändern. Zum Guten und zum Schlechten. Wissenschaftsjournalismus hat hier eine Verantwortung, denn er trägt viel dazu bei, wie KI oder Klimawandel in der Öffentlichkeit gesehen werden. Konzentrieren wir uns vielleicht zu sehr auf die negativen Aspekte? Im Sinn von: Bad news are good news?Gestaltung: Ulla Ebner. Redaktion: Ina Zwerger. Gesendet in Ö1 am 19. 11. 2025.

Wissenschaftsjournalismus unter Druck (4)
ScienceFluencer.Der erste Podcast, der im deutschsprachigen Raum ein Massenpublikum erreichte, war weder eine True-Crime-Story noch ein Promi-Talk-Format - es war eine Wissenschaftspodcast. Mehrere Millionen Hörer:nnen lauschten im Jahr 2020 dem "Coronavirus-Update" des deutschen Virologen Christian Drosten. Der Mediziner wurde unverhofft zum Medienstar.Doch nicht nur Wissenschafter:innen, sondern auch Wissenschaftsjournalist:innen haben begonnen, neue Wissenschaftsformate für Social Media zu entwickeln. Gestaltung: Ulla Ebner. Redaktion: Ina Zwerger. Gesendet in Ö1 am 20. 11. 2025.

Archäologie - Forschung für die Zukunft (1)
Die Archäologie untersucht die materiellen Hinterlassenschaften des Menschen: Werkzeuge, Gebäude, Grabstätten oder auch textile Fundstücke können viel über die Vergangenheit verraten. Doch in den wissenschaftlichen Erkenntnissen finden sich auch Hinweise zu Fragen der Gegenwart und der Zukunft. Gestaltung: Barbara Volfing. Redaktion: Ulrike Schmitzer. Gesendet in Ö1 am 17. 11. 2025.

Archäologie - Forschen für die Zukunft (2)
Vom Wert des Handwerks. Gestaltung: Barbara Volfing. Redaktion: Ulrike Schmitzer. Gesendet in Ö1 am 18. 11. 2025.

Archäologie - Forschen für die Zukunft (3)
Energiepfade zwischen Feuerstelle und Microgrid. Gestaltung: Barbara Volfing. Redaktion: Ulrike Schmitzer. Gesendet in Ö1 am 19. 11. 2025.

Archäologie - Forschung für die Zukunft (4)
Alte Routen, neue Wege. Gestaltung: Barbara Volfing. Redaktion: Ulrike Schmitzer. Gesendet in Ö1 am 20. 11. 2025.

Die Macht der Stimme (1)
Die Geschichte der Stimme.Wir folgen dem Klang der Stimme in ihren unterschiedlichen Formen und in den vielfältigsten Bereichen - in Sprache und Geschichte, in der Psychotherapie und Politik, im öffentlichen Raum und im privaten Alltag, der immer häufiger von synthetischen Stimmen, etwa zur Navigationshilfe oder zur Sprachassistenz, bestimmt wird. Gestaltung: Richard Brem. Redaktion: Ute Maurnböck. Gesendet in Ö1 am 10. 11. 2025.

Die Macht der Stimme (2)
Stimmen der Nation.Die französische Chansonsängerin Edith Piaf galt einst als "Stimme der Nation" - weil in ihrer Stimme ein kollektives Selbstgefühl zum Ausdruck kam. Auch viele andere Länder haben so eine "Stimme der Nation". Hierzulande gilt Chris Lohner als eine solche, weil sie zunächst als Programmansagerin im Fernsehen und dann als Zugansagerin auf Bahnhöfen in ganz Österreich stimmlich stark den öffentlichen Raum prägt. Aber auch andere prominente Stimmen prägen den öffentlichen Raum - und liefern mit ihren stimmlichen und sprachlichen Eigenheiten reichlich Stoff für Stimmenimitatoren und das Kabarett.Gestaltung: Richard Brem. Redaktion: Ute Maurnböck. Gesendet in Ö1 am 11. 11. 2025.

Die Macht der Stimme (3)
Gefährliche und suggestive Stimmen.In der geschichtlichen Forschung wird die NSDAP mitunter auch als "Rednerpartei" bezeichnet. Und tatsächlich verdankt sich ein Teil ihres Aufstiegs und später auch Machterhaltes den rhetorischen Fähigkeiten von Hitler und Goebbels - und der geschickten Verbindung von manipulativer Redetechnik und der damals noch neuartigen Verstärkung der Stimme durch Mikrofone und Lautsprecher. Die suggestive Kraft der Stimme wird aber auch zu therapeutischen Zwecken eingesetzt, allen voran in der Hypnosepsychotherapie, wo sie dabei hilft, einen Trancezustand zu erzeugen und so in tiefere Schichten des Unbewussten vorzudringen. Gestaltung: Richard Brem. Redaktion: Ute Maurnböck. Gesendet in Ö1 am 12. 11. 2025.

Die Macht der Stimme (4)
Künstliche Stimmen.Das Aufkommen von modernen Mikrofonen und Aufnahmetechniken ab den 1920er Jahren machte auch neue Arten von Vortrag- und Singstimmen populär. Das Zusammenspiel von immer ausgefeilterer Technik und der menschlichen Stimme setzte sich in den nachfolgenden Jahrzehnten fort. Eine besondere Bedeutung nahm dabei der - ursprünglich für die Telekommunikation und Kriegszwecke entwickelte - "Vocoder" ein, der die menschliche Stimme komprimiert und ihr einen roboterartigen Klang verleiht. Die Medienkünstlerin Laurie Anderson und die Band Kraftwerk haben diese "Roboterstimme" sehr erfolgreich auch musikalisch eingesetzt. In der Gegenwart sind künstliche und synthetische Stimmen, etwa als Navigationshilfe in Autos oder zur Sprachassistenz, immer öfter in unserem Alltag zu hören. Gestaltung: Richard Brem. Redaktion: Ute Mauernböck. Gesendet in Ö1 am 13. 11. 2025.

30 Jahre Klimagipfel (1)
Im Frühjahr 1995 hat sich die internationale Staatengemeinschaft zur ersten Klimakonferenz zusammengefunden. In Berlin. Seither findet die "COP" einmal jährlich in wechselnden Destinationen der Welt statt. Schirmherrin ist die UNO. Kritik begleitet den Klimagipfel dabei genauso lange wie die regelmäßig verlautbarten Ziele zur Treibhausgasreduktion. Aktuellster Anstoß ist die Autobahn, die man anlässlich des Gipfels, der im November in der brasilianischen Stadt Belém ausgetragen wird, mitten durch den Regenwald planiert hat. Doch was wird auf diesen Zusammenkünften von wem genau entschieden und auf welcher Datengrundlage? Gestaltung: Daphne Hruby. Redaktion: Ulrike Schmitzer. Gesendet in Ö1 am 10. 11. 2025.

30 Jahre Klimagipfel (2)
Der Weg zum Gipfel. Gestaltung: Daphne Hruby. Redaktion. Ulrike Schmitzer. Gesendet in Ö1 am 11. 11. 2025.

30 Jahre Klimagipfel (3)
Das Gipfel-Team. Gestaltung: Daphne Hruby. Redaktion. Ulrike Schmitzer. Gesendet in Ö1 12. 11. 2025.

30 Jahre Klimagipfel (4)
Gipfel der Vernunft? Gestaltung: Daphne Hruby. Redaktion. Ulrike Schmitzer. Gesendet in Ö1 am 13. 11. 2025.

Welthandel - neu verhandelt (1)
Die USA waren in den vergangenen Jahrzehnten einer der größten Betreiber und zugleich einer der größten Profiteure der wirtschaftlichen Globalisierung. Doch die neue Administration von Donald Trump setzt auf Zölle, Handelsbarrieren und wirtschaftliche Abschottung - das wird massive Folge für die Weltwirtschaft weit über die USA hinaus haben. Das Radiokolleg schaut in die Zukunft, blickt aber auch zurück in die Geschichte des Protektionismus und des Freihandels und fragt nach, was aus der Hoffnung "Wandel durch Handel" wurde. Folge 1: America first" statt Globalisierung Gestaltung: Günter Kaindlstorfer, Wolfgang Ritschl, Alexander Hecht, Till Köppel. Redaktion: Ulrike Schmitzer, Alexander Hecht, Ina Zwerger. Gesendet in Ö1 am 3.11. 2025.

Welthandel - neu verhandelt (3)
Turbulenzen ohne Ende - Leben im Handelskonflikt. Gestaltung: Paul Sihorsch, Juliane Nagiller, Madeleine Amberger, Wolfgang Ritschl. Redaktion: Ulrike Schmitzer, Alexander Hecht, Ina Zwerger. Gesendet in Ö1 am 5.11. 2025.

Welthandel - neu verhandelt (2)
Vom Protektionismus zum Freihandel und retour? Gestaltung: Juliane Nagiller, Günter Kaindlstorfer, Alexander Hecht, Till Köppel. Redaktion: Ulrike Schmitzer, Alexander Hecht, Ina Zwerger. Gesendet in Ö1 am 4.11. 2025.

Welthandel - neu verhandelt (4)
Pluralisierung der Weltwirtschaftsordnung. Gestaltung: Alexander Hecht, Ulrike Schmitzer, Wolfgang Ritschl. Redaktion: Ulrike Schmitzer, Alexander Hecht, Ina Zwerger. Gesendet in Ö1 am 6.11. 2025.

Die wunderbare Welt der Pilze (1)
Mehr Tier als Pflanze.Pilze sind versteckte Lebewesen, von denen wir zumeist maximal den Fruchtkörper sehen, wenn er aus dem Waldboden oder aus einem Baumstamm wächst. Doch Pilze sind überall und erobern jeden Lebensraum. Sie ernähren sich von abgestorbenen und lebenden Pflanzen und Tieren, sie sind essenziell im Stoffkreislauf. Sie dienen Menschen und Tieren als Nahrungsmittel, Genussmittel und Heilmittel und sie können psychoaktive Wirkung haben. Pilze dienen sogar als Ersatz für Kunststoffe oder Beton: Man kann aus ihnen Kleidungsstücke, Taschen, Schuhe, Wandverkleidungen und Farbstoffe herstellen und sogar Häuser bauen. Gestaltung: Sonja Bettel. Gesendet in Ö1 am 27. 10. 2025.

Die wunderbare Welt der Pilze (2)
Sammeln oder züchten?Pilze dürfen in Österreich in kleinen Mengen gratis im Wald gesammelt werden. Das Schwammerlsuchen hat einen besonderen Reiz, weil es mit einer Erkundung des Waldes abseits der Wege verbunden ist und das Erkennen der genießbaren Pilze und Wissen über die besten Plätze und Zeiten erfordert. Doch Pilze zu sammeln kann auch gefährlich werden, wenn das Wissen fehlt. Denn viele Pilze sind nicht genießbar oder gar tödlich giftig und es besteht Verwechslungsgefahr. Pilze kann man aber auch gut züchten und das mit relativ wenig Aufwand. Austernpilze zum Beispiel wachsen ressourcenschonend auf Kaffeesatz oder Stroh und bilden auch eine gute Alternative für Fleischprodukte. Gestaltung: Sonja Bettel. Gesendet in Ö1 am 28. 10. 2025.

Die wunderbare Welt der Pilze (3)
Heilung für Körper und Geist.Pilze sind bei Wildtieren beliebt und wurden vermutlich schon vor hunderttausenden Jahren von Menschen und ihren Vorfahren gegessen - auch als Heilmittel und Rauschmittel. Das beweist unter anderem die Gletschermumie "Ötzi". Der Mann aus dem Eis trug zwei Pilze in der Tasche, die als Wundauflage und Schmerzmittel eingesetzt werden können. Die Komplementärmedizin in Europa setzt heute wieder auf diese Substanzen, die in der chinesischen Medizin durchgehend seit Jahrtausenden genutzt werden, um das Immunsystem zu stärken, als Begleitung bei Krebsbehandlungen oder gegen Allergien. Auch bei psychischen Erkrankungen können Pilze helfen. Gestaltung: Sonja Bettel. Gesendet in Ö1 am 29. 10. 2025.

Die wunderbare Welt der Pilze (4)
Nachhaltiger Rohstoff.Pilze kann man nicht nur essen oder Bier damit brauen, man kann sie auch auf dem Kopf tragen oder darin wohnen. Seit einigen Jahren entwickeln Forscherinnen und Designer immer mehr Möglichkeiten, mit Pilzmyzel und Restsoffen, wie z.B. Sägespänen, stabile Materialien zu erzeugen, in denen man Produkte sicher verpacken kann, die als Lederersatz dienen, zu Akkustikelementen verarbeitet werden oder sogar zu Hauswänden. Sind die Pilze, die seit schätzungsweise 900 Millionen Jahren auf der Erde existieren, die Zukunftslösung für viele unserer Probleme? Gestaltung: Sonja Bettel. Gesendet in Ö1 am 30. 10. 2025.

70 Jahre Bundesheer (1)
Bewährungsproben und organisierter Mangel. Unterfinanziert mit veralteter Bewaffnung und großteils demotiviertem Personal, das war lange Zeit das Image des Österreichischen Bundesheeres. Erst der Ausbruch des Ukrainekrieges führte zu einer Kehrtwende. Nun soll mit Milliarden Investitionen eine moderne Armee entstehen. Gestaltung: Andreas Wolf, Sarah Kriesche. Redaktion: Sarah Kriesche. Gesendet in Ö1 am 27. 10. 2025.

70 Jahre Bundesheer (2)
Wehrpflicht und neue Herausforderungen. Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Staaten gilt in Österreich nach wie vor die allgemeine Wehrpflicht. Wer tauglich ist und sich nicht für den Zivildienst entscheidet, leistet einen sechsmonatigen Grundwehrdienst. Die Wehrpflicht reicht grundsätzlich bis zum 50. Lebensjahr, für Offiziere, Unteroffiziere und Spezialisten bis zum 65. Lebensjahr. Frauen können sich freiwillig melden. Gestaltung: Andreas Wolf, Sarah Kriesche. Redaktion: Sarah Kriesche. Gesendet in Ö1 am 28. 10. 2025.

70 Jahre Bundesheer (3)
Vom Katastrophenschutz zur Mission Vorwärts. Eine zentrale Aufgabe des Bundesheeres war und ist der Katastrophenschutz. Herausragende Einsätze waren die Lawinenkatastrophe in Galtür 1999 sowie die Jahrhunderthochwässer 2002 und 2013. In solchen Situationen unterstützte das Heer mit Soldaten und technischem Gerät die zivilen Einsatzkräfte. Die speziell ausgebildeten Pionierabteilungen leisten auch im Ausland Hilfe, etwa nach Erdbeben. Gestaltung: Andreas Wolf, Sarah Kriesche. Redaktion: Sarah Kriesche. Gesendet in Ö1 am 29. 10. 2025.

70 Jahre Bundesheer (4)
Digitale Landesverteidigung. Digitale Technologien haben die Logik militärischer Operationen verändert. Aufklärungsdrohnen, satellitengestützte Kommunikation und digitale Lagebilder sind längst Teil der Gefechtsführung. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine macht sichtbar, wie eng militärische Schlagkraft heute mit digitaler Infrastruktur verbunden ist und wie stark auch Informationsoperationen und Cyberangriffe in konkrete Kampfhandlungen eingreifen.Auch in Österreich verändern digitale Systeme die militärische Praxis. Gestaltung: Andreas Wolf, Sarah Kriesche. Redaktion: Sarah Kriesche. Gesendet in Ö1 am 30. 10. 2025.

Osvobojeni / Befreit (1)
"Poglejmo / Hinschauen" Wie die Kärntner Slowen:innen zur Befreiung Österreichs vom Nationalsozialismus beigetragen haben und wie sie das heute prägt - eine Reihe von Tanja Malle, deren Familiengeschichte den Ausgangspunkt bildet. "Poglejmo / Hinschauen" lautet der Titel einer wegeweisenden Ausstellung, die vom 8. Mai bis zum 26. Oktober 2025 im kärnten.museum, dem Kärntner Landesmuseum, gezeigt wird. Erstmals sind dort die Verfolgung der Kärntner Slowenen durch die Nationalsozialisten Thema, wie auch ihr - erfolgreicher - Widerstand dagegen. Die Ausstellung ist nicht nur inhaltlich, sondern auch symbolisch von Bedeutung, denn in der offiziellen Kärntner Erinnerungskultur sind diese Themen bisher weitgehend ausgeblendet worden. Bis heute wird im öffentlichen Raum nicht der antifaschistischen Kärntner Partisan:innen gedacht. Gestaltung: Tanja Malle: Redaktion: Monika Kalcsics. Gesendet in Ö1 am 20. 10. 2025.

Osvobojeni / Befreit (2)
travma / Trauma. Die Erfahrung von Verfolgung durch die Nationalsozialisten und der Widerstand dagegen prägten nicht nur die unmittelbar davon betroffene Generation, sondern auch die Nachkommen. Bis heute. Das machte nicht zuletzt der überbordende Polizeieinsatz am zentralen Erinnerungsort der Kärntner Slowen:innen deutlich, der für viel Kritik gesorgt hat und umfassend untersucht wird. Forscher:innen untersuchen seit langem, wie sich solche Erfahrungen auswirken - als Quelle von Trauma, aber auch Quelle für politisches Bewusstsein. Denn ihr antifaschistischer Widerstand war für die Kärntner Slowen:innen - Koro?ki/e Slovenski/e - von existenzieller Bedeutung. Ohne ihn wären sie entweder (zwangs)assimiliert oder ermordet worden und heute als Volksgruppe inexistent. Gestaltung: Tanja Malle. Redaktion: Monika Kalcsics. Gesendet in Ö1 am 21. 10. 2025.

Osvobojeni / Befreit (3)
"V mojem srcu je upor. / In meinem Herzen ist Widerstand." Das ist ein Vers aus dem Gedicht des Kärntner Slowenischen Lyrikers Andrej Kokot, der mit seiner Familie 1942 von den Nationalsozialisten deportiert worden ist. Sein Bruder Jo?e wurde 1944 im Konzentrationslager Mauthausen ermordet. Die Lyrik von Kokot ist nur eines von vielen Beispielen dafür, wie Verfolgung und Widerstand Kunst und Kultur der Volksgruppe prägten. Lyrik und Grafik spielten auch innerhalb der Slowenischen Befreiungsfront / Osvobodilna Fronta, in die ja die Kärntner Slowenischen Partisan:innen eingegliedert waren, bereits während des Zweiten Weltkriegs eine bedeutende Rolle. Tanja Malle stellt beispielhaft einige bedeutsame Werke vor. Gestaltung: Tanja Malle. Redaktion: Monika Kalcsics. Gesendet in Ö1 am 22. 10. 2025.

Osvobojeni / Befreit (4)
danes / 80 Jahre danach. Antifaschismus heute. Mit ihrem Widerstand leisteten die Kärntner Slowen:innen einen wesentlichen Beitrag zur Befreiung Österreichs vom Nationalsozialismus, der auch von den Alliierten gewürdigt wurde. In der Unabhängigkeitserklärung vom 27. April 1945 bezeichnen sich die Gründungsparteien der Zweiten Republik - SPÖ, ÖVP und KPÖ - dezidiert als antifaschistisch. Und im Staatsvertrag von 1955 verpflichtet sich die Republik in Artikel 9 faschistische und sonstige Organisationen, die der Bevölkerung ihre demokratischen Rechte nehmen wollen, aufzulösen. Im aktuellen politischen Diskurs spielt Antifaschismus heute allerdings keine bedeutende Rolle mehr - eine Ausnahme sind Orte der Erinnerung, wie der Pers?manhof in Südkärnten und Organisationen wie der KZ-Verband, gegründet von ehemaligen Widerstandskämpfern und Opfern des Faschismus. Gestaltung: Tanja Malle: Redaktion: Monika Kalcsics. Gesendet in Ö1 am 23. 10. 2025.

Die Neutralität (1)
Österreichs Weg in die Unabhängigkeit.Die immerwährende Neutralität ist nicht nur im im Bundesverfassungsgesetz von 1955 verankert, sondern auch tief im Selbstverständnis der Zweiten Republik und der österreichischen Bevölkerung. Mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und der Abkehr der USA von der Sicherheit Europas ist die Diskussion um die österreichische Neutralität neu entflammt. Was sind die Möglichkeiten und Grenzen der Neutralität? Ist das Konzept der militärischen Bündnisfreiheit gar überholt? Gestaltung: Ute Maurnböck, Johannes Gelich. Gesendet in Ö1 am 20. 10. 2025.

Die Neutralität (2)
Die österreichische Seele: Konfliktscheu, harmonisierend?Bei den zahlreichen diplomatischen Gesprächen, die dem österreichischen Staatsvertrag und dem Neutralitätsgesetz von 1955 vorausgegangen waren, wurde immer wieder die Neutralität der Schweiz als Vorbild angeführt. Die Schweiz kann bereits auf eine 200-jährige Geschichte der Neutralität blicken, wurde diese de facto doch 1815 vom Wiener Kongress völkerrechtlich anerkannt. Doch auch Deutschland könnte heute theoretisch ein neutraler Staat sein, gab es doch noch im Jahr 1952, skizziert in der sogenannten Deutschland Note Stalins, von Seiten der Sowjetunion Pläne für ein geeintes neutrales Deutschland. Gestaltung: Ute Maurnböck, Johannes Gelich. Gesendet in Ö1 am 21. 10. 2025.

Die Neutralität (3)
Bündnislosigkeit im globalen Kontext.Eine Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher spricht sich nach wie vor für die Beibehaltung der Neutralität aus und sieht sie als Teil der Identität des Staates. Selbst nach dem Beginn des Ukraine-Krieges ist die Idee der Neutralität tief im Selbstverständnis der österreichischen Bevölkerung verankert. Doch inwieweit hat sich die politische Ausrichtung des Staates auch auf die Mentalität der österreichischen Seele ausgewirkt? Gestaltung: Ute Maurnböck, Johannes Gelich. Gesendet in Ö1 am 22. 10. 2025.

Alte weise Frauen: Lore Hostasch (4)
In dieser Folge ist Elenora „Lore“ Hostasch (80) zu Gast. Hostasch war die erste Frau, die es als Gewerkschaftsvorsitzende an die Spitze einer österreichischen Gewerkschaft geschafft hat (1989, GPA), außerdem war sie einst auch die erste Arbeiterkammerpräsidentin (1994). Ab 1997 war Lore Hostasch Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales. In dieser Folge spricht die Grande Dame der Österreichischen Sozialpartnerschaft mit Alexandra Augustin über mächtige Frauen und darüber, wie Frauen an die Macht kommen. In dieser feministischen Interviewreihe kommen statt der sogenannten „alten weißen Männer“ „alte weise Frauen“ zu Wort, um über gesellschaftspolitische Zustände zu reflektieren. Es gilt eine Regel: Ü60! Gestaltung: Alexandra Augustin. Gesendet in Ö1 am 21. 08. 2025.(Erstausstrahlung März 2025)