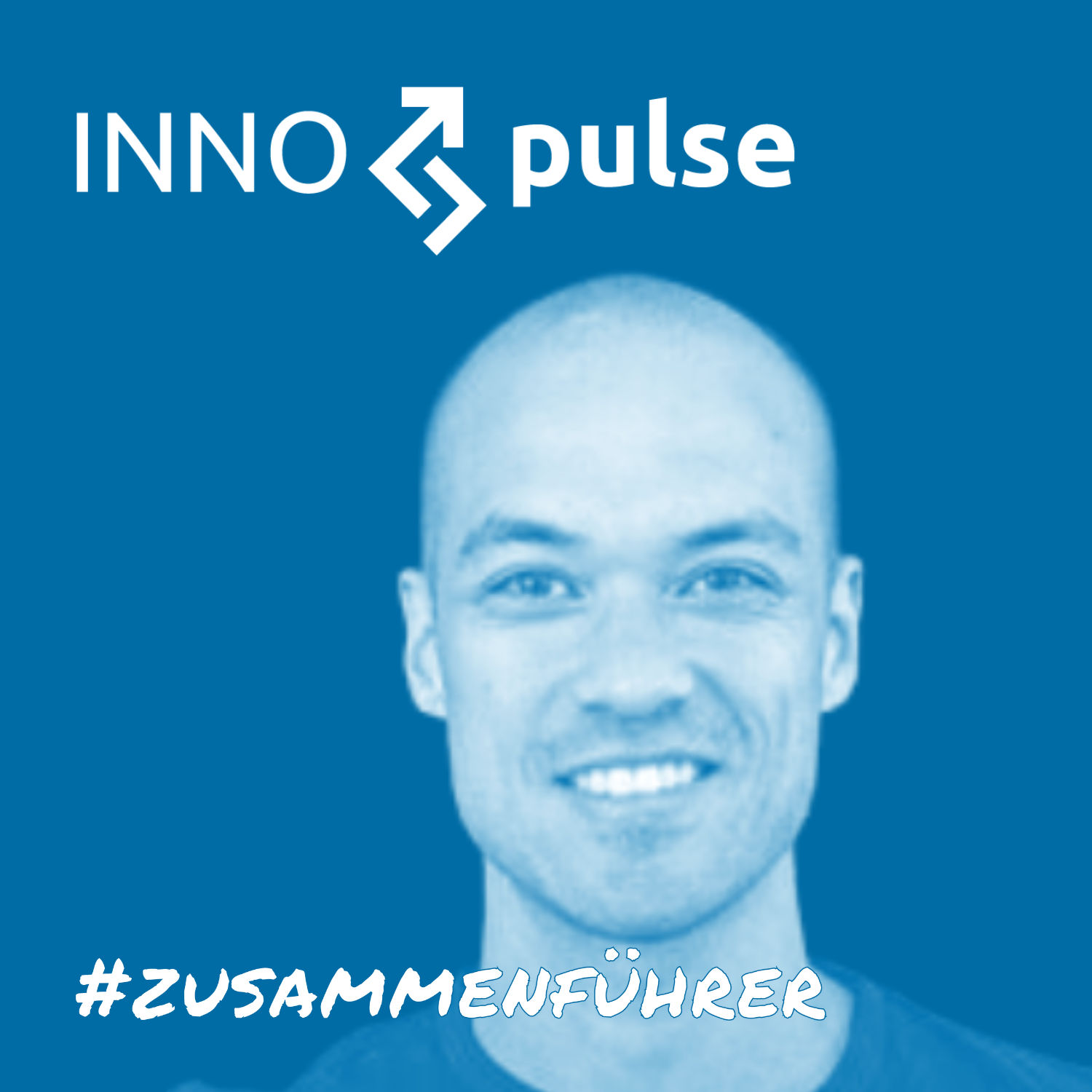Der Podcast INNOpulse - INNOVATORS! Not Innovation. gibt Einblicke in die Menschen hinter den Innovationen. Hier erwarten die Hörer spannende Diskussionen über Innovationsökosysteme und die Herausforderungen sowie Erfolge, die Innovatoren bei der Entwicklung neuer Ideen und Technologien erleben. In jeder Episode kommen Experten zu Wort, die ihre Erfahrungen und Perspektiven aus verschiedenen Bereichen der Innovation teilen.
Alle Folgen
Subscription-Modelle bei der Heidelberger Druckmaschinen AG
Unternehmen ergänzen ihre bestehenden Geschäftsmodelle zunehmend um Subscription-Modelle. Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat bereits 2017 begonnen ihr eigenes Subscription-Modell mit Fokus Pay-per-Output auf den Markt zu bringen. Herr Oliver Demus berichtet über das Warum, Wie und Was der Subscription-Modelle bei der Heidelberger Druckmaschinen AG.

Startup Kooperationen bei der Sporlastic GmbH, ein Unternehmen der Hauber Gruppe
Unternehmen suchen zunehmend Innovationspotentiale am Markt, um ihre eigene Innovationsfähigkeit zu erhalten oder auszubauen. Die Sporlastic GmbH mit Sitz in Nürtingen bei Stuttgart hat vor ein paar Jahren begonnen trotz ihrer Unternehmensgröße mit Startup-Unternehmen zu kooperieren. Dr. Timo Schmeltzpfenning, Prokurist und Leiter Forschung und Entwicklung, berichtet über das Warum, Wie und Was bei dem Eingehen von Startup Kooperationen bei der Sporlastic GmbH.

Innovationspartnerschaften bei der Creditplus Bank AG, ein Unternehmen der Crédit Agricole Gruppe
Die Creditplus Bank mit Sitz in Stuttgart hat vor ein paar Jahren begonnen, als deutsche Tochterfirma der französischen Konsumfinanzierungsgruppe Crédit Agricole Consumer Finance, gezielt mit Startup-Unternehmen zusammen in operativen Projekten zu arbeiten. Stephan Baumann, Leiter Strategisches Produkt- und Innovationsmanagement und Kristina Kovac, Innovationsmanagerin berichten über ihre bisherige Erfahrungen mit Innovationspartnerschaften in der Finanzbranche und geben auch einen Ausblick über das Potential der branchenfremde Startup-Unternehmen für sie bieten.

Innovation-Toolkits und Innovationsmethoden bei der Gerresheimer AG
Innovationstoolkits und Innovationsmethoden helfen Organisationen und Mitarbeitern neue innovative Potentiale zu identifizieren. Dabei spielen zunehmend digitale Toolkits, aber auch kundenzentrierte Vorgehensweisen wie Design Thinking bzw. Tools wie das Business Model Canvas eine besondere Rolle. Dabei müssen insbesondere produktionsorientierte Unternehmen nicht nur auf den klassischen Technology-Push, sondern auch auf den Market-Pull Ansatz setzen. Maike Wolf (geb. Blankartz) gibt Einblicke, wie die Gerresheimer AG Innovation strukturell angeht und was sie bei der Anwendung von Innovationsmethoden und Innovationstools gelernt hat.

Mit Innovationsformaten Unternehmerisches Denken und Handeln erlernbar machen
Intrapreneurship-Programme werden von Großunternehmen häufig als Format eingesetzt um strukturiert Innovationen zu fördern. Allerdings können solche Formate nicht nur für bspw. für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle eingesetzt werden, sondern auch, um unternehmerisches Denken und Handeln bei den Mitarbeitern nachhaltig zu verankern. Dr. Christian Stumpf berichtet über seine Arbeit mit verschiedenen Innovationsteams und unterstreicht die Relevanz sich insbesondere auf das Problem an sich zu fokussieren.

Die Gestaltung lokaler Innovationsökosysteme in Städten und Gemeinden am Beispiel der Industriellen Werke Basel
In der Episode des INNOpulse Podcasts mit Olivier Ferilli von den Industriellen Werken Basel wird über die Gestaltung lokaler Innovationsökosysteme in Städten und Gemeinden gesprochen. Olivier Ferilli, Open Innovation Developer und Smart City Enabler, erklärt, wie bestehende Ökosysteme sich wandeln können und welche Rolle digitale Hilfsmittel dabei spielen. Er beschreibt, wie man durch erhöhte Partizipation der Bevölkerung und digitale Plattformen die Identifikation mit dem Wohnort stärken kann. Ferilli betont die Wichtigkeit von Vertrauen und Offenheit für den Erfolg von Ökosystemen und erläutert, dass digitale Tools unterstützende Elemente sind, aber die Basis stimmen muss. Er spricht auch über seine Rolle bei den Industriellen Werken Basel und die Bedeutung von Open Innovation, bei der mit anderen Firmen zusammengearbeitet wird, um neue Lösungen zu entwickeln. Olivier Ferilli teilt seine Erfahrungen und Einblicke in die Entwicklung von Innovationsökosystemen und die Bedeutung von Partizipation und digitalen Hilfsmitteln für die Zukunft von Städten und Gemeinden. Er hebt hervor, dass die Transformation von Ökosystemen nicht einfach ist, aber durch einfache Mittel und die Einbeziehung der Bevölkerung möglich gemacht werden kann.

Digitale Innovationsökosysteme auf Basis offener Schnittstellen am Beispiel Heidelberger Druckmaschinen AG & Zaikio GmbH
Digitale Innovationsökosysteme werden insbesondere seit der Verbreitung der Plattformökonomie immer mehr diskutiert und spielen für Unternehmen zur Sicherstellung der digitalen Wertschöpfung eine strategisch wichtige Rolle. Dabei wird die Wertschöpfung der Zukunft im wesentlichen durch offene Schnittstellen einheitliche Datenstandards und nutzenorientierten Anwendungen für verschiedene Partner einer ganzen Branche geschaffen. Herr Grimm und Herr Fischer berichten mit ihren gemeinsam über 50 Jahren Erfahrung bei Heidelberger Druckmaschinen über die Transformation des Konzerns, der mit weltweit über 50% Marktanteil in der Druckbranche sich mit der Tochterfirma und Konnektivitätsplattform Zaikio für die Zukunft aufstellt. Was sie bereits alles bei der Etablierung des Ökosystems gelernt haben und was sie noch mit Zaikio vorhaben berichten sie im INNOpulse Podcast.

Die Gestaltung regionaler Innovationsökosysteme am Beispiel von Allgäu Digital
Antonia Widmer, die Leiterin von Allgäu Digital, spricht im Podcast über die Gestaltung regionaler Innovationsökosysteme. Sie beschreibt ihren Weg zu dieser Rolle als unerwartet, da sie ursprünglich nicht für ein deutsches Unternehmen gearbeitet hatte. Ihre Karriere begann im Produktmanagement auf EMEA-Ebene, wo sie für Software- und Hardware-Allianzen zuständig war. Nach einer Pause aus familiären Gründen und der Geburt ihrer drei Kinder, kehrte sie als Trainerin für Startups zurück und übernahm schließlich die Leitung von Allgäu Digital. Allgäu Digital ist eines der 19 Gründerzentren in Bayern, gefördert vom Wirtschaftsministerium. Die Organisation unterstützt Startups und fördert die Zusammenarbeit zwischen Mittelstand und Startups, um Innovationen zu schaffen. Antonia betont die Bedeutung von Netzwerken und Partnerschaften, um ein lebendiges Innovationsökosystem zu schaffen. Sie sieht ihre Rolle darin, Menschen zusammenzubringen und die Schnittstellen zwischen Startups und etablierten Unternehmen zu nutzen, um gegenseitige Vorteile zu erzielen. Antonia spricht auch über die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der geografischen Lage des Allgäus ergeben. Sie betont die Notwendigkeit, regionale Ökosysteme zu stärken und gleichzeitig die Verzahnung mit globalen Innovationszentren zu fördern. Die Organisation arbeitet daran, Veranstaltungen und Netzwerke zu schaffen, die den Austausch und die Zusammenarbeit fördern.

Die Rolle des Partnermanagements bei der Etablierung digitaler Innovationsökosysteme am Beispiel der Uhlmann Group
In der Podcast-Folge mit Kathrin Günther und Jasmin Franz von der Uhlmann Group wird die Rolle des Partnermanagements bei der Etablierung digitaler Innovationsökosysteme beleuchtet. Die Uhlmann Group hat erkannt, dass Partnerschaften entscheidend sind, um Innovationen voranzutreiben und neue Lösungen zu entwickeln. Jasmin Franz beschreibt, wie wichtig es ist, Partnerschaften regelmäßig zu evaluieren und sicherzustellen, dass sie auf Augenhöhe und als Win-Win-Situation gestaltet sind. Die Rolle des Partnermanagers ist relativ neu und wird als strategisch wichtig angesehen, um die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern zu steuern und zu optimieren. Kathrin Günther erklärt, dass die Entscheidung, eine Partnermanagerin einzustellen, aus der Notwendigkeit heraus entstanden ist, mit der Entwicklung von Packsite und der Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern. Es wird betont, dass nicht alle Innovationen allein umgesetzt werden können und dass die Plattformökonomie ein schnelllebiges Geschäft ist, das Vertrauen in Partner erfordert. Die Uhlmann Group sieht in der Zusammenarbeit mit Startups und anderen Unternehmen eine Möglichkeit, neue Lösungen zu schaffen und das Ökosystem mit Leben zu füllen. Die Diskussion zeigt, dass das Partnermanagement eine zentrale Rolle spielt, um die Innovationskraft der Uhlmann Group zu stärken und die Zusammenarbeit mit Partnern effektiv zu gestalten. Es wird deutlich, dass die richtige Orchestrierung und das Verständnis der gemeinsamen Ziele entscheidend sind, um Enttäuschungen zu vermeiden und erfolgreiche Partnerschaften zu etablieren.

Multiperspektivität als wichtige und unterbewertete Fähigkeit im Innovationsmanagement
Georgiana Menny, Innovationsmanagerin bei der Hekatron Vertriebs GmbH, spricht über ihre Rolle und ihren Werdegang im Bereich Innovationsmanagement. Sie beschreibt sich selbst als Neogeneralistin mit einem multikulturellen Hintergrund, was ihr hilft, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Georgiana hat einen analytischen Hintergrund und begann ihre Karriere im Bankwesen, bevor sie in verschiedenen Konzernen und Beratungen tätig war. Ihre Arbeit bei Vitra war ein Wendepunkt, da sie dort erkannte, wie gut das Konzept von New Work zu ihren Talenten passt. Sie betont die Bedeutung von Serendipity, also das Finden von Antworten auf Fragen, die man sich nicht gestellt hat, und wie dies zu ihrer Rolle als Innovationsmanagerin führte. Georgiana nutzt die Methodik "Working Out Loud", um verschiedene Perspektiven kennenzulernen und zu integrieren. Ihre Arbeit bei Hekatron konzentriert sich auf Brandschutz und Sicherheitstechnik, wobei sie stets nach neuen Lösungen sucht, um Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Sie sieht ihre Rolle als Innovationsmanagerin als eine natürliche Entwicklung ihrer Karriere, die durch ihre vielfältigen Erfahrungen und ihr Interesse an der Verbesserung und Neuerfindung von Prozessen geprägt ist.

Mitarbeiterzentrierte Intrapreneurship Programme bei der Drägerwerk AG & Co. KGaA
Thomas Glöckner, Head of Global Innovation Management bei der Drägerwerk AG, spricht über die Bedeutung von Intrapreneurship und Innovationsmanagement im Unternehmen. Er beschreibt seinen beruflichen Werdegang, der ihn von einer technischen Ausbildung und Kundenkontakt bis hin zur Leitung des Innovationsmanagements führte. Glöckner betont die Wichtigkeit der Mitarbeiter als wertvollstes Asset des Unternehmens und erklärt, wie Dräger durch Intrapreneurship-Programme die Kreativität und Innovationskraft der Mitarbeiter fördert. Ein zentraler Bestandteil dieser Programme ist die Adobe Kickbox, die Mitarbeitern ermöglicht, ihre Ideen zu entwickeln und zu validieren. Glöckner hebt hervor, dass von 600 eingereichten Ideen sechs Corporate Startups entstanden sind, von denen fünf erfolgreich weitergeführt werden. Er betont die Bedeutung von "Fail fast" und der schnellen Validierung von Ideen, um Ressourcen effizient zu nutzen. Dräger setzt auf eine offene Kommunikation und demokratische Entwicklung innerhalb der Teams, um die Innovationskraft zu stärken. Glöckner beschreibt, wie das Unternehmen durch gezielte Programme und Veranstaltungen, wie Buchvorstellungen und Konferenzen, die Weiterbildung und Vernetzung der Mitarbeiter fördert. Drägerwerk AG ist bekannt für seine Medizintechnikprodukte, insbesondere Beatmungsgeräte, und hat sich während der Pandemie einen Namen gemacht. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, Technik für das Leben zu entwickeln und setzt dabei auf die Kreativität und das Engagement seiner Mitarbeiter.

Die Verprobung von Subscription-Modellen im Kleinkindmarkt am Beispiel von Stokke AS
Alexander Grosch, Head of Early Stage Innovation und Design bei Stokke AS, spricht in dieser Podcast-Folge über die Einführung und Entwicklung von Subscription-Modellen im Kleinkindmarkt. Stokke, bekannt für den ikonischen Tripp-Trapp-Hochstuhl, fokussiert sich auf nachhaltige Produkte, die mit Kindern mitwachsen. Grosch erläutert, dass Stokke ein globales Unternehmen mit norwegischen Wurzeln ist und sich auf Produkte rund um das Kinderzimmer spezialisiert hat, darunter Betten, Kinderwagen und Bademöglichkeiten für Kinder. Ein zentrales Thema der Folge ist die Pilotierung von Subscription-Modellen, die sich aus der veränderten Kundenpräferenz und dem Trend zur Kreislaufwirtschaft ergeben. Grosch erklärt, dass Stokke in Deutschland mit dem Modell "Stockstart" begonnen hat, bei dem Zubehörteile für den Tripp-Trapp vermietet werden, während der Hochstuhl selbst weiterhin gekauft wird. Dies ermöglicht es Eltern, flexibel und nachhaltig zu agieren, ohne die Emotionalität des Besitzes eines neuen Produkts zu verlieren. Grosch betont die Bedeutung von Fehlern und Tests in der frühen Innovationsphase, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und Geschäftsmodelle zu optimieren. Er spricht auch über die Herausforderungen und Chancen, die sich durch die Digitalisierung und Nachhaltigkeit ergeben, und wie Stokke diese Themen in ihre Produktentwicklung integriert. Zum Abschluss der Folge wird die Lernkurve der Organisation angesprochen, die sich durch die Einführung neuer Geschäftsmodelle und die Anpassung an Markttrends ergibt. Grosch zeigt sich optimistisch und gespannt auf die zukünftigen Entwicklungen und Innovationen bei Stokke.

Dezentrales Innovieren in der Baubranche am Beispiel der Geiger Gruppe
Fabian Ritter und Dominik Bayer von der Geiger Gruppe diskutieren im Podcast über die Innovationsfähigkeiten und die Rolle der Dezentralisierung in ihrem Unternehmen. Die Geiger Gruppe ist ein familiengeführtes Bauunternehmen, das seit fast 100 Jahren besteht und von der vierten Generation der Familie geleitet wird. Das Unternehmen hat sich von einem Baustofflieferanten zu einem umfassenden Anbieter in der Bauindustrie entwickelt, der die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt, von der Planung bis zum Rückbau von Immobilien. Fabian Ritter, ein gelernter Bauingenieur, ist seit sechseinhalb Jahren bei der Geiger Gruppe und hat sich auf Building Information Modeling spezialisiert, um die Digitalisierung der Bauprozesse voranzutreiben. Dominik Bayer, ein Wirtschaftsingenieur mit Erfahrung in der Metallindustrie, ist seit Januar Teil des Innovationsmanagements der Geiger Gruppe und bringt seine Expertise in Werkstoffwissenschaften und Entwicklung ein. Die Geiger Gruppe ist dezentral organisiert, mit 19 strategischen Geschäftsfeldern, die jeweils eigenständig am Markt agieren. Diese Struktur ermöglicht es dem Unternehmen, marktnah zu arbeiten und schnell auf Veränderungen zu reagieren. Das Innovationsmanagement der Geiger Gruppe unterstützt die Geschäftsfelder durch Dienstleistungen und Prozessverantwortung, um innovative Projekte zu fördern und Ressourcen effizient zu nutzen. Ein zentraler Fokus des Unternehmens liegt auf Nachhaltigkeit und der Frage, wie die Bauindustrie ihren CO2-Ausstoß reduzieren kann. Digitalisierung wird dabei als Mittel zum Zweck gesehen, um nachhaltige Bauweisen und Prozesse zu entwickeln. Automatisierung und neue technische Möglichkeiten sind weitere Themen, die die Geiger Gruppe in Zukunft beschäftigen werden. Die Diskussion zeigt, wie die Geiger Gruppe als mittelständisches Unternehmen Innovation umsetzt und dabei die Vorteile einer dezentralen Struktur nutzt, um flexibel und effizient zu bleiben.

Die Skalierung von Abo-Modellen im Mobilitätsmarkt am Beispiel von ViveLaCar GmbH
Florine von Caprivi ist eine vielseitige Unternehmerin, die aus dem Schwabenland stammt und in Stuttgart lebt. Sie hat zwei kaufmännische Ausbildungen absolviert und später studiert. Ihre selbstständigen Eltern haben sie früh dazu inspirierte, selbst unternehmerisch tätig zu werden. Ein Mentor spielte eine entscheidende Rolle in ihrer Entwicklung und motivierte sie, verschiedene Unternehmen zu gründen. Florine hat insgesamt fünf Unternehmen in unterschiedlichen Phasen gegründet. Ihr erstes Projekt war ein Joint Venture mit einem Versicherungskonzern, um schnelle und innovative Lösungen zu entwickeln. Sie war auch im Bereich E-Health tätig und hat Vifla K. mitgegründet, ein Unternehmen, das sich mit Auto-Abos beschäftigt. Derzeit arbeitet sie an einem Unternehmen im Bereich digitaler Weiterbildung und Employee Retention sowie an einem Projekt im Bereich Quick Commerce für Baumärkte. Florine betont die Bedeutung von Role Models und Female Entrepreneurship und sieht sich selbst als praktischen und praxisorientierten Menschen. Sie hat gelernt, dass Perfektion nicht immer der beste Berater ist und dass es wichtig ist, einfach Dinge auszuprobieren. Ihre Erfahrungen haben ihr gezeigt, dass schnelle Internationalisierung nicht immer sinnvoll ist und dass der Bedarf an Personal oft höher ist als ursprünglich geplant. Florine ist überzeugt, dass Menschen bereit sind, für guten Service zu zahlen, und sieht dies als eine wichtige Erkenntnis aus ihrer unternehmerischen Reise.

Komplementäre Innovationsansätze: Technology Push UND Market Pull am Beispiel der Lapp Group
In dieser Episode sprechen Dr. Martin Allmendinger, Dr. Susanne Grichel und Dr. Patrick Olivan über die Innovationsfähigkeiten von Lapp, einem Familienunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Kabeln spezialisiert hat. Sie diskutieren über die verschiedenen Innovationsstrategien Technology Push und Market Pull und wie sie in Einklang gebracht werden können. Sie erörtern das Konzept der „Armee der Freiwilligen“, das Portfolio-Management und die Notwendigkeit, mehrere Optionen in Betracht zu ziehen.

Design von Intrapreneurship Programmen am Beispiel der STRABAG SE
Franz Klager, Innovationsmanager und Programmleiter des Adastra Entrepreneurship Programms bei der Strabag SE, beschreibt seinen Werdegang und die Entwicklung des Programms. Er begann seine Karriere im Strabag-Konzern in der Projektentwicklung für Infrastrukturprojekte, bevor er in das Innovationsmanagement wechselte. Dort war er für Trends und Ideenmanagement zuständig, was ihn zum Thema Entrepreneurship führte. Vor drei Jahren wurden die Innovations- und Digitalisierungsaktivitäten des Konzerns zusammengeführt, was ihm die Möglichkeit gab, sich auf das Entrepreneurship-Programm zu konzentrieren. Das Adastra Entrepreneurship Programm ist ein strukturiertes Programm, das darauf abzielt, Geschäftsideen von Mitarbeitern zu fördern und in Startups umzuwandeln. Es beinhaltet eine Qualification Phase, Prototyping und endet mit einem Demo Day. Externe Venture Architects unterstützen die Teams, um Geschwindigkeit und Erfahrung einzubringen. Das Programm ist darauf ausgelegt, Ventures zu kreieren und gleichzeitig die Fähigkeiten der Mitarbeiter zu stärken. Franz Klager betont die Wichtigkeit von Stakeholder-Management und die Herausforderungen, die mit der Integration von Innovationsprogrammen in einen großen Konzern verbunden sind. Er spricht über die Nebeneffekte des Programms, wie die Befähigung der Mitarbeiter und die Validierung von Projekten, die sich als nicht rentabel herausstellen. Das Programm hilft dem Konzern, sich besser zu organisieren und mit Startups zusammenzuarbeiten.

Umsetzung von Legal Innovation in Anwaltskanzleien am Beispiel von Simmons & Simmons LLP
In der Podcast-Folge mit Alkan Dogan von Simmons & Simmons LLP wird das Thema Legal Innovation in Anwaltskanzleien beleuchtet. Alkan Dogan, der Innovationsmanager bei Simmons & Simmons, beschreibt seinen Werdegang und wie er in die Welt der Legal Innovation eingestiegen ist. Ursprünglich aus Heilbronn, studierte er Wirtschaftspädagogik und Management, bevor er bei KPMG im zentralen Innovationsmanagement tätig wurde. Dort sammelte er Erfahrungen im Prozess- und Innovationsmanagement und betreute das Innovationsbudget sowie verschiedene Innovationsplattformen und Challenges. Simmons & Simmons LLP ist eine internationale Wirtschaftskanzlei mit einer klassischen Partnerschaftsstruktur, die Rechtsberatung in verschiedenen Bereichen wie Arbeitsrecht, Finanzrecht, Corporate und IP anbietet. Alkan Dogan erklärt, dass die Kanzlei sich mit technologiebasierten Lösungen beschäftigt, um interne Prozesse effizienter zu gestalten und Mandanten besser zu bedienen. Er betont die Bedeutung von Legal Tech und Innovation, um sich im Markt abzuheben und den zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden. Die Folge diskutiert auch die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung in der Rechtsbranche und wie Kanzleien sich darauf vorbereiten können, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Alkan Dogan sieht die Zukunft der Anwaltskanzleien in der Integration von Technologie und der Entwicklung neuer Services, um den sich wandelnden Marktanforderungen gerecht zu werden.

Demokratisierung von Innovation durch Partizipation am Beispiel der Basler AG
Ariane Scheer-Danielsson, Head of Business Innovation bei der Basler AG, spricht über die Demokratisierung von Innovation und die Rolle ihres Bereichs innerhalb des Unternehmens. Die Basler AG, ein Weltmarktführer im Bereich Computer Vision und Machine Vision, hat sich auf Industriekameras und Softwarelösungen spezialisiert. Ariane betont die Bedeutung der Verbindung von Technologie und Business, um einen Problem-Solution-Fit zu erreichen. Ihr Bereich fokussiert sich auf die Marktsicht und die Kundensicht, um Technologien mit Kundenproblemen zu verheiraten. Ein zentrales Thema ist die Einführung von Bottom-up-Innovationsprogrammen, die es Mitarbeitern ermöglichen, Ideen einzubringen und diese durch einen strukturierten Prozess zu entwickeln. Ariane hebt hervor, dass Open Innovation ein wichtiger Trend ist, der Unternehmen helfen kann, Innovationen schneller und kosteneffizienter zu entwickeln. Sie sieht die Demokratisierung von Innovation als Schlüssel, um die Innovationskraft des gesamten Unternehmens zu nutzen und effektive Ergebnisse zu erzielen. Ariane Scheer-Danielsson hat einen vielfältigen beruflichen Hintergrund, der von Projektmanagement in der Heavy Industry bis hin zu strategischen Beratungsprojekten reicht. Sie hat sich im Laufe ihrer Karriere zunehmend auf Innovation und Technologie fokussiert und ist nun bei der Basler AG tätig, einem Unternehmen, das von Anfang an technologiezentriert war und stark wächst.
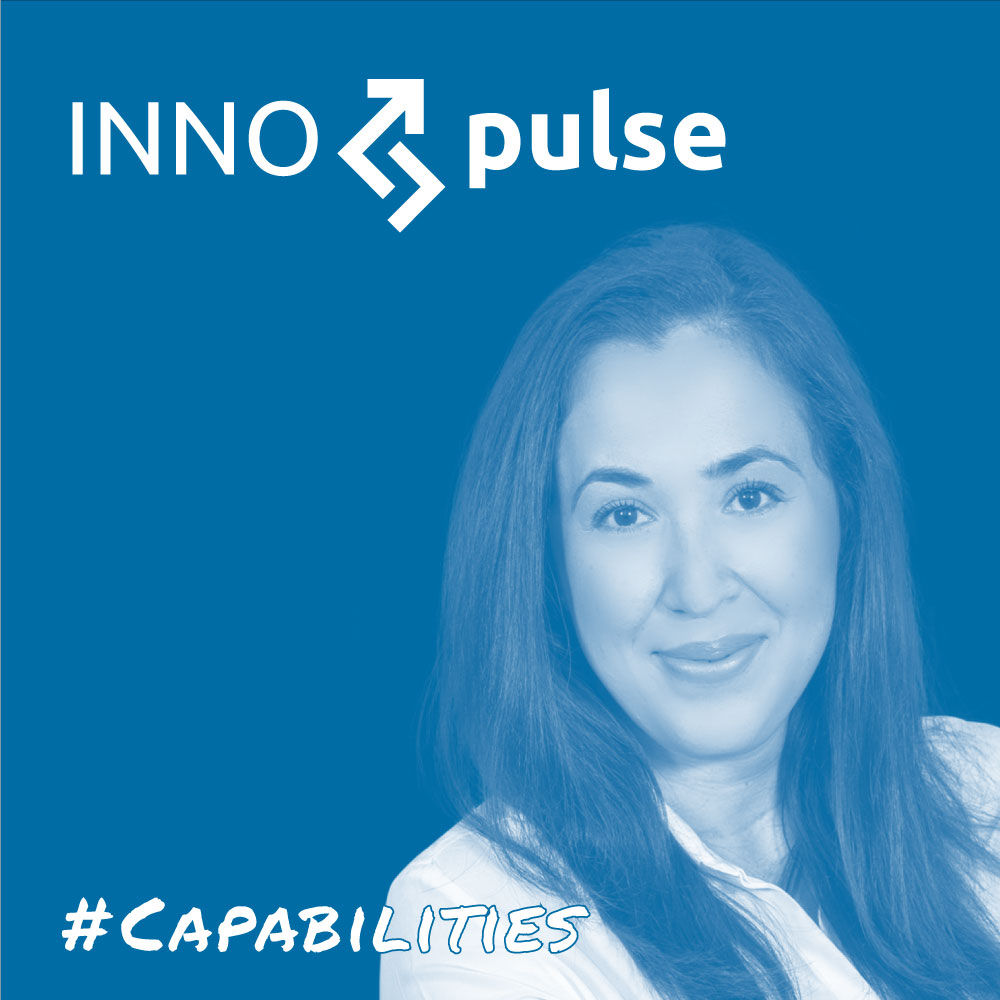
Die Skalierung von Remote-Work-Infrastructure via Subscriptions am Beispiel von Emma Wanderer GmbH
In der Podcast-Folge von INNOpulse sprechen Andreas Jaritz und Julia Trummer über ihr Unternehmen Emma Wanderer, das sich auf die Bereitstellung von Remote-Work-Infrastruktur durch Abonnements spezialisiert hat. Andreas, ein erfahrener Software-Ingenieur und Unternehmer, und Julia, mit einem Hintergrund in Tourismus und Hospitality, haben sich zusammengetan, um ein innovatives Konzept zu entwickeln, das die Art und Weise, wie Menschen arbeiten und leben, neu denkt. Emma Wanderer bietet Unternehmen und deren Mitarbeitern die Möglichkeit, an inspirierenden Naturstandorten zu arbeiten, und positioniert sich als ganzheitlicher Dienstleister für eine zukunftsorientierte Hospitality-Erfahrung. Die Idee entstand aus der Beobachtung, dass traditionelle Arbeits- und Lebensweisen nicht mehr zeitgemäß sind und dass der Tourismusmarkt neue, authentische Konzepte benötigt. Die beiden Gründer betonen, dass ihr Ansatz nicht nur auf Profit ausgerichtet ist, sondern auch einen positiven gesellschaftlichen Einfluss haben soll. Sie sehen Emma Wanderer als eine Marke, die die Legitimierung von Remote-Arbeit in der Natur vorantreibt und dabei hilft, Vorbehalte gegenüber neuen Arbeitsmodellen abzubauen. Andreas und Julia haben ihre Erfahrungen aus verschiedenen Branchen und Projekten genutzt, um ein Konzept zu entwickeln, das sowohl die Bedürfnisse der modernen Arbeitswelt als auch die Herausforderungen des Tourismusmarktes adressiert. Ihr Ziel ist es, eine nachhaltige und innovative Lösung zu bieten, die den Menschen ermöglicht, produktiv zu arbeiten und gleichzeitig die Natur zu genießen.

Die Skalierung im E-Commerce via Software as a Service am Beispiel der Taxdoo GmbH
In der Podcast-Folge mit Dr. Matthias Allmendinger von der Taxdoo GmbH wird die Entwicklung und Skalierung des Unternehmens im Bereich E-Commerce und Software as a Service beleuchtet. Matthias, der einen Hintergrund in Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt auf Steuerlehre hat, erzählt von seinem Weg zur Gründung von Taxdoo. Ursprünglich begann er mit einer Promotion an der Uni Hamburg und entwickelte nebenbei seine Programmierfähigkeiten, was ihm später bei der Gründung von Taxdoo zugutekam. Taxdoo bietet eine Lösung zur Verwaltung von Umsatzsteuer und Finanzbuchhaltung für E-Commerce-Händler und Steuerberater. Das Unternehmen hat sich als führende Lösung in Deutschland etabliert und unterstützt Händler bei der umsatzsteuerlichen Meldung im EU-Ausland. Matthias beschreibt, wie Taxdoo den Zugang zu neuen Märkten demokratisiert, indem es den Compliance-Prozess automatisiert und Eintrittsbarrieren eliminiert. Ein wesentlicher Teil der Diskussion dreht sich um die Herausforderungen und Learnings bei der Skalierung des Unternehmens. Matthias spricht über die Bedeutung von Cloud-Native-Technologien für die technische Skalierung und die Notwendigkeit eines starken Service-Teams für die Unterstützung der Kunden. Er betont die Wichtigkeit des Product-Market-Fit und wie Taxdoo durch faire Preisgestaltung und die Einbindung von Steuerberatern Vertrauen bei den Kunden aufgebaut hat. Matthias gibt auch einen Ausblick auf Trends im E-Commerce, insbesondere die Nachhaltigkeit und die Kreislaufwirtschaft, und wie diese Themen die Zukunft des Handels beeinflussen könnten.

Der Nutzen von Trendmanagement für das Innovieren am Beispiel der Wieland Gruppe
Dr. Lennard Hermann von der Wieland Gruppe spricht im Podcast über das Thema Trendmanagement und seine Rolle als Senior Manager Innovation Enablement. Er beschreibt, wie Wieland als traditionsreiches Unternehmen mit 8800 Mitarbeitenden weltweit Trendmanagement betreibt, um sich auf zukünftige Entwicklungen vorzubereiten. Hermann erklärt, dass das Ziel des Innovationsmanagements bei Wieland darin besteht, die Business Units zu befähigen, innovativ zu sein, und dass das Unternehmen keine Monopolstellung auf Innovationen hat. Er betont die Wichtigkeit von Trendmanagement, um langfristig erfolgreich zu bleiben und nicht disruptiert zu werden. Hermann sieht die Zukunft des Trendmanagements in der verstärkten Nutzung von digitalen Tools und KI, um Entwicklungen schneller zu erkennen und zu analysieren. Er hofft, dass Trendmanagement auch in den universitären Bildungsapparat Einzug findet. Dr. Hermann hebt hervor, dass Trendmanagement nicht nur das Erkennen von Trends umfasst, sondern auch die Fähigkeit, diese Trends in konkrete Innovationsprojekte umzusetzen. Er spricht über die Herausforderungen, die mit der schnellen Veränderung der Industrie verbunden sind, und die Notwendigkeit, flexibel und proaktiv zu agieren. Hermann sieht die Rolle von KI als unterstützend, um Trends vorherzusagen und schneller darauf zu reagieren. Er betont, dass Trendmanagement ein Prozess ist, der sowohl fest als auch flexibel sein muss, um effektiv zu sein.

Die Corona-Pandemie als Innovation Boost – Digitalisierungsbeschleunigung am Beispiel der NürnbergMesse
Dr. Michael Melcher von der NürnbergMesse spricht über die Herausforderungen und Innovationen in der Veranstaltungsbranche, insbesondere im Kontext der Corona-Pandemie. Er beschreibt, wie die NürnbergMesse sich an die veränderten Bedingungen angepasst hat, indem sie digitale Angebote entwickelt und neue Geschäftsmodelle ausprobiert hat. Die Pandemie hat die Messe gezwungen, ihre traditionellen Geschäftsmodelle zu überdenken und sich stärker auf digitale Plattformen und hybride Veranstaltungen zu konzentrieren. Melcher betont die Bedeutung von Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Er sieht die Zukunft der Messebranche in einer Kombination aus physischen und digitalen Angeboten, die sowohl Networking als auch Geschäftsmöglichkeiten bieten. Die NürnbergMesse hat sich darauf konzentriert, ihre IT-Infrastruktur zu verbessern und neue Wege zu finden, um Kundenbedürfnisse zu erfüllen und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Dr. Melcher hebt hervor, dass die Messebranche trotz der Herausforderungen durch die Pandemie weiterhin eine wichtige Rolle als Plattform für den Austausch und die Zusammenkunft von Menschen spielt. Er sieht die Zukunft der Branche in der Integration von Technologie und Innovation, um das Kundenerlebnis zu verbessern und neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen. Die NürnbergMesse hat sich darauf konzentriert, ihre Angebote zu diversifizieren und neue Revenue-Streams zu entwickeln, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.

Das innovative Autohaus der Zukunft. Proaktive Familienunternehmen am Beispiel der Spindler Gruppe
In der Podcast-Folge über die Spindler Gruppe wird die Transformation und Innovationsfähigkeit eines traditionsreichen Familienunternehmens beleuchtet. Jeannine Krenn, die Nachfolgerin der vierten Generation, und Dr. Gesa Köberle, Beirätin, diskutieren die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Digitalisierung und dem Wandel in der Mobilitätsbranche ergeben. Jeannine Krenn beschreibt ihre Rolle im Unternehmen und die Verantwortung, die sie als Teil der Familie trägt, um das Unternehmen zukunftsfähig zu gestalten. Sie betont die Bedeutung von Innovation und die Notwendigkeit, den Wandel als Chance zu begreifen. Die Spindler Gruppe, die seit 1919 besteht, hat sich von einer Werkstatt zu einem Mobilitätshaus entwickelt und ist heute mit mehreren Automarken an verschiedenen Standorten vertreten. Dr. Gesa Köberle erläutert ihre Rolle als Beirätin und die Vorteile, die ein Familienunternehmen in Bezug auf Geschwindigkeit und Herzblut bietet. Sie hebt die Bedeutung von Finanzen und Führung hervor, um innovative Ideen zu unterstützen und umzusetzen. Der Beirat wurde gegründet, um die Transformation zu begleiten und Expertise von außen einzubringen. Ein zentrales Thema der Folge ist das Innovationsmanagement innerhalb der Spindler Gruppe. Es wird ein strukturierter Prozess beschrieben, der es Mitarbeitern ermöglicht, Ideen einzureichen und diese in sogenannten Sprints weiterzuentwickeln. Ein Coach unterstützt die Teams dabei, ihre Ideen zu einem Entscheidungstag zu bringen, an dem über die Umsetzung entschieden wird. Die Folge vermittelt, wie die Spindler Gruppe durch die Kombination von Tradition und Innovation erfolgreich in der sich wandelnden Mobilitätsbranche agiert und dabei die Mitarbeiter aktiv einbindet, um neue Geschäftsfelder zu erschließen.

Vom Sozialversicherungsträger zum Innovationsökosystem im Bereich Gesundheit am Beispiel der AOK Baden-Württemberg
In der Podcast-Folge von INNOpulse mit Michael Noll und Marco Filo von der AOK Baden-Württemberg wird das Thema Innovationsökosysteme in der Gesundheitsbranche beleuchtet. Michael Noll, Leiter Digitale Innovation, und Marco Filo, Product Owner, diskutieren die Rolle der AOK als Sozialversicherungsträger und die Herausforderungen der digitalen Transformation. Michael Noll beschreibt seine Karriere bei der AOK und seine Leidenschaft für die digitale Innovation. Er betont die Bedeutung der AOK als Solidargemeinschaft und die Notwendigkeit, das Geschäftsmodell kontinuierlich zu hinterfragen und anzupassen. Die AOK strebt danach, nicht nur administrativ tätig zu sein, sondern auch als Gesundheitslotse zu fungieren, der die Versicherten durch verschiedene Lebensphasen begleitet. Marco Filo spricht über die Rolle des Product Owners und die Bedeutung der Kundenzentrierung. Er erklärt, wie die AOK durch ein Versicherten-Panel und Co-Creation mit den Versicherten innovative Lösungen entwickelt. Beide betonen die Wichtigkeit der digitalen Identität und der Plattformökosysteme, um die Versicherten besser zu unterstützen und die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Die AOK Baden-Württemberg sieht sich als Teil eines komplexen Ökosystems und strebt danach, durch Kooperationen und innovative Ansätze die Gesundheitsversorgung zu optimieren. Die digitale Transformation wird als Chance gesehen, um präventive und personalisierte Angebote zu schaffen und die Versicherten besser zu betreuen.

Konfrontation oder Kooperation zwischen IT und Innovationsmanagement? Digitales Innovieren in Krankenhäusern
In der Podcast-Folge von INNOpulse sprechen Katja Österreicher, Head of Innovation Management, und Otfried Cerwenka, Leiter IT der Vinzenz Gruppe, über die Innovationsfähigkeiten in der Gesundheitsbranche. Katja beschreibt ihren Werdegang, der sie von der Forschung über Unternehmensgründungen bis zur Leitung des Innovationsmanagements der Vinzenz Gruppe geführt hat. Sie betont die strategische Ausrichtung der Gruppe auf Innovation und Digitalisierung und die Bedeutung einer integrierten Gesundheitsversorgung, die über episodische Krankenhausaufenthalte hinausgeht. Otfried Cerwenka erläutert seine Rolle als IT-Leiter und die Herausforderungen, die mit der Digitalisierung und der Integration neuer Technologien verbunden sind. Er hebt die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen IT und Innovationsmanagement hervor, insbesondere bei der Entwicklung neuer digitaler Lösungen und der Nutzung von Daten und künstlicher Intelligenz. Beide betonen die Notwendigkeit einer offenen und flexiblen IT-Architektur, um Innovationen zu ermöglichen und gleichzeitig die Sicherheit zu gewährleisten. Die Vinzenz Gruppe verfolgt eine zentrale und dezentrale Struktur, wobei das Innovationsmanagement zentral organisiert ist, aber durch Innovation Fellows in den Gesundheitseinrichtungen vor Ort unterstützt wird. Diese Struktur ermöglicht eine enge Zusammenarbeit und den Aufbau einer Innovationskultur. Trotz regulatorischer Herausforderungen im Gesundheitswesen sieht die Gruppe Möglichkeiten für disruptive Innovationen, insbesondere in ihren Gesundheitsparks, die als Netzwerkplattformen für verschiedene Gesundheitsdienstleister dienen.

Sinn oder Unsinn von Innovationsmanagement-Standards? - Systemisches Innovieren am Beispiel der Uhlmann Group
In der Podcast-Folge mit Bastian Brinkmann von der Uhlmann Group wird das Thema Innovationsmanagementsysteme und deren Bedeutung für Unternehmen beleuchtet. Bastian Brinkmann, der Head of Corporate Future Lab und Sustainability Management bei der Uhlmann Group, erklärt seine Rolle und die Aufgaben, die er in diesen Positionen übernimmt. Er beschreibt, wie er mit einem kleinen Experimentierteam neue Themen erkundet und Ideenräume schafft, die nicht auf dem klassischen inkrementellen Korridor liegen. Zudem betont er die Wichtigkeit, Nachhaltigkeit als neues Normal in die Arbeitsweise zu integrieren, um nicht von Reporting-Pflichten übermannt zu werden. Bastian Brinkmann gibt auch einen Einblick in seinen beruflichen Hintergrund, der ihn von Hamburg nach Süddeutschland führte, und seine Erfahrungen im Innovationsmanagement bei Tesa und in der Unternehmensberatung. Er spricht über die Uhlmann Group, die seit 75 Jahren im Verpackungsmaschinenbau tätig ist und sich durch verschiedene Tochterfirmen in Europa und China auszeichnet. Das Future Lab der Uhlmann Group spielt eine zentrale Rolle bei der Erschließung neuer Innovationswege und der Übersetzung von Marktanforderungen in technische Lösungen.

Innovation für Handwerker? Kundenzentrierung bei digitalen Lösungen am Beispiel der Festool GmbH
In der Podcast-Folge mit Marco Pfeiffer von Festool wird die Kundenzentrierung bei digitalen Lösungen für Handwerker thematisiert. Festool, ein deutscher Mittelständler, ist bekannt für die Herstellung von Premium-Elektrowerkzeugen für professionelle Handwerker. Marco Pfeiffer, Head of Smart and Digital Products, spricht über die Notwendigkeit, sich weiterzuentwickeln und digitale Lösungen zu integrieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Festool hat erkannt, dass die Digitalisierung und Technologien für die Zukunft entscheidend sind und hat sich bereits intensiv mit digitalen Technologien auseinandergesetzt. Die Organisation hat sich in den letzten Jahren verändert, um digitale Produkte als eine Säule für die Zukunft zu etablieren. Dabei wird ein Innovationsframework genutzt, das Suchfelder identifiziert, Ideen qualifiziert und validiert, um Lösungen zu entwickeln, die den Kundenbedürfnissen entsprechen. Ein wichtiger Aspekt ist der Dialog mit den Kunden, um deren Probleme zu verstehen und Lösungen anzubieten, die oft digitaler Natur sind. Festool sieht sich nicht in einer missionierenden Rolle, sondern möchte im Dialog herausfinden, welche Probleme es zu lösen gilt. Die Organisation setzt auf Co-Creation-Ansätze und kurze Innovationszyklen, um schnell auf Kundenfeedback zu reagieren und Lösungen zu entwickeln, die im Markt akzeptiert werden. Marco Pfeiffer betont, dass die Digitalisierung im Handwerk möglich und notwendig ist, um den Kundenmehrwert zu steigern. Festool fokussiert sich darauf, zufriedene Kunden zu gewinnen und zu halten, wobei Technologie und Digitalisierung als Mittel zum Zweck dienen.

Clean Air as a Service? Vom Filterhersteller zum Lösungsanbieter für saubere Luft am Beispiel von MANN + HUMMEL
Jan-Erik Raschke von der MANN + HUMMEL Gruppe spricht im Podcast über die Transformation des Unternehmens vom traditionellen Filterhersteller hin zu einem Lösungsanbieter für saubere Luft und Wasser. Er beschreibt, wie Mann+Hummel sich durch innovative Projekte und Technologien weiterentwickelt hat, um den Herausforderungen der modernen Welt gerecht zu werden. Ein zentrales Thema ist die Entwicklung von Geschäftsmodellen wie "Clean Air as a Service", das sich an Software-as-a-Service-Modelle anlehnt und darauf abzielt, kontinuierlich saubere Luft zu liefern. Raschke betont die Bedeutung von Digitalisierung und der Integration von Sensorik in Filtrationssysteme, um effizientere und bedarfsgerechte Lösungen zu bieten. Er erläutert auch die Rolle von Mann+Hummel in der globalen Regulatorik und wie das Unternehmen sich an unterschiedliche Anforderungen in verschiedenen Märkten anpasst. Raschke hebt hervor, dass die Innovationskraft des Unternehmens durch die Offenheit für neue Technologien und die Zusammenarbeit mit Partnern gestärkt wird. Ein Beispiel dafür ist die Kooperation mit Ströer, um Luftreinigungssysteme in urbanen Werbeträgern zu integrieren. Raschke zeigt sich optimistisch, dass Mann+Hummel mit seinen Lösungen einen positiven Beitrag zur Zukunft leisten kann, insbesondere in den Bereichen Luft- und Wasserreinhaltung.

Vom Hidden Champion zum Open Champion? Verfahrensexpertise als Innovationsvoraussetzung am Beispiel C.F. Maier
Maximilian Maier, CEO der C.F. Maier Firmengruppe, spricht über die Entwicklung und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. C.F. Maier, gegründet 1925, hat sich von einer Aluminiumgießerei zu einem führenden Anbieter in der Kunststofftechnik entwickelt. Die Firma fokussiert sich auf die Herstellung von faserverstärkten Kunststoffteilen in kleineren Serien für verschiedene Industrien, darunter Reisemobile, Stadt- und Reisebusse sowie landwirtschaftliche Fahrzeuge. Maximilian Maier betont die Bedeutung der Verfahrenstechnik und die Fähigkeit, große Bauteile mit technischen Anforderungen wie hoher Langlebigkeit und Festigkeit herzustellen. Er beschreibt seine Rolle als CEO als vielseitig, mit einem Fokus auf strategische Fragestellungen, Organisationsentwicklung und Kommunikation. Als Familienunternehmen ist C.F. Maier stark in der Region verwurzelt, aber auch international tätig, mit Produktionsstätten in Tunesien, Ungarn, der Türkei und den USA. Maier hebt die Offenheit für Partnerschaften und die Bedeutung von Innovation hervor, insbesondere in Bezug auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Er sieht die Zukunft des Unternehmens in der Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten, um gemeinsam innovative Lösungen zu entwickeln. Maximilian Maier spricht auch über seine persönliche Reise und die Entscheidung, die Rolle des CEO zu übernehmen. Er beschreibt den Übergang als einen langen Prozess, der durch seine Ausbildung und Erfahrungen in der Beratung geprägt wurde. Die familiäre Verbindung zum Unternehmen spielte eine wichtige Rolle in seiner Entscheidung, die Führung zu übernehmen.

Wie wird man Partner of Choice? Offenes Innovationsmanagement bei den Stadtwerken Bonn
Calvin Deppisch, stellvertretender Leiter der Konzernentwicklung und Innovationsmanager der Stadtwerke Bonn, spricht im Podcast über die Rolle der Stadtwerke Bonn als Klimawerk und die Bedeutung von Innovationsökosystemen. Er beschreibt, wie die Stadtwerke Bonn sich von einem traditionellen Stadtwerk zu einem Klimawerk entwickelt haben, um bis 2035 klimaneutral zu werden. Calvin hebt die Bedeutung von Synergien zwischen verschiedenen Geschäftsbereichen wie Energie, Verkehr und Verwertung hervor und erklärt, wie diese Synergien genutzt werden, um innovative Lösungen zu entwickeln. Er betont die Wichtigkeit von Kooperationen und Innovationsmanagement, um die Zukunftsfähigkeit der Stadtwerke und der Stadt Bonn zu sichern. Calvin spricht auch über die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Zusammenarbeit mit anderen Stadtwerken und Unternehmen ergeben, und wie diese Kooperationen helfen können, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Er sieht die Vernetzung von verschiedenen Branchen und die Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten als entscheidend für die Entwicklung von Innovationen und die Schaffung von Mehrwerten. Calvin Deppisch zeigt auf, dass die Stadtwerke Bonn nicht nur als Versorger, sondern als Innovator und Partner in der Region agieren, um nachhaltige und zukunftsfähige Lösungen zu schaffen.

How to Spinoff? Vom internen zum externen Innovationstreiber am Beispiel von vent.io GmbH
In der Podcast-Folge mit Sven Siering von der vent.io GmbH wird die Entwicklung und der Weg der Ausgründung von vent.io aus der Deutschen Leasing AG beleuchtet. Sven Siering, Geschäftsführer von vent.io, beschreibt seine Rolle und die Herausforderungen, die mit der Gründung einer neuen Gesellschaft verbunden sind. Er betont die Unterstützung durch die Muttergesellschaft, die Deutsche Leasing AG, und die Bedeutung von Prozessen und Strukturen, die für die erfolgreiche Umsetzung von Innovationen notwendig sind. Vent.io positioniert sich als Full-Stack-CVC (Corporate Venture Capital) und fokussiert sich auf drei Hauptbereiche: Entwicklung und Bau von Produkten, Partnerschaften und Investitionen. Die Gesellschaft strebt danach, die Digitalisierung im deutschen Mittelstand voranzutreiben und neue digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln, die das Kerngeschäft der Muttergesellschaft erweitern und bereichern. Sven Siering spricht über die Herausforderungen und die Notwendigkeit, eine Brücke zur Muttergesellschaft zu erhalten, um als integraler Bestandteil des Unternehmens wahrgenommen zu werden. Er betont die Wichtigkeit von Ausdauer und der Bereitschaft, neue Wege zu gehen, um die Transformation erfolgreich zu gestalten. Die Folge endet mit einem Ausblick auf die zukünftige Entwicklung von vent.io und den weiteren Schritten, die das Unternehmen unternehmen wird, um seine Ziele zu erreichen.

Ein mittelständisches Innovationsnetzwerk mal anders betrachtet am Beispiel der ZSI Technology GmbH
In der Podcast-Folge mit Angela Rebekka Werbik und Luisa Katzenberger von der ZSI Technology GmbH wird das Thema branchenübergreifende Ökosysteme im Mittelstand behandelt. Angela Werbik beschreibt ihren Werdegang und ihre Leidenschaft für Technik, die sie durch ein Ingenieurstudium und ihre Arbeit in verschiedenen Unternehmen entwickelt hat. Sie betont die Bedeutung des Mittelstands als Rückgrat der deutschen Wirtschaft und die Möglichkeit, sich dort fachlich und organisatorisch zu entfalten. Werbik erläutert, wie sie strategisch vorgegangen ist, um die Wertschöpfung des Unternehmens zu verlängern, indem sie einen Produktionsbetrieb aufbaute, um der zunehmenden Komplexität der Technik gerecht zu werden und sich vom Wettbewerb abzugrenzen. Sie hebt die Flexibilität und das breite Angebotsspektrum des Mittelstands hervor, das es ermöglicht, auch in Krisenzeiten zu bestehen. Luisa Katzenberger ergänzt die Diskussion mit ihrer Erfahrung in verschiedenen Branchen und betont die Bedeutung von Netzwerken, die homogen in den Werten und heterogen in den Fähigkeiten sind. Sie sieht den Mittelstand als eine Plattform für kundenorientiertes, agiles und innovatives Arbeiten, das ohne die Staubschicht eines Großkonzerns auskommt. Beide sprechen über die Herausforderungen des Fachkräftemangels und die Notwendigkeit, Netzwerke zu nutzen, um neue Mitarbeiter zu gewinnen und die Flexibilität zu erhöhen. Die Folge endet mit einem Appell an die Zuhörer, die Möglichkeiten des Mittelstands zu nutzen und die Bedeutung von Netzwerken zu erkennen, um erfolgreich zu sein.
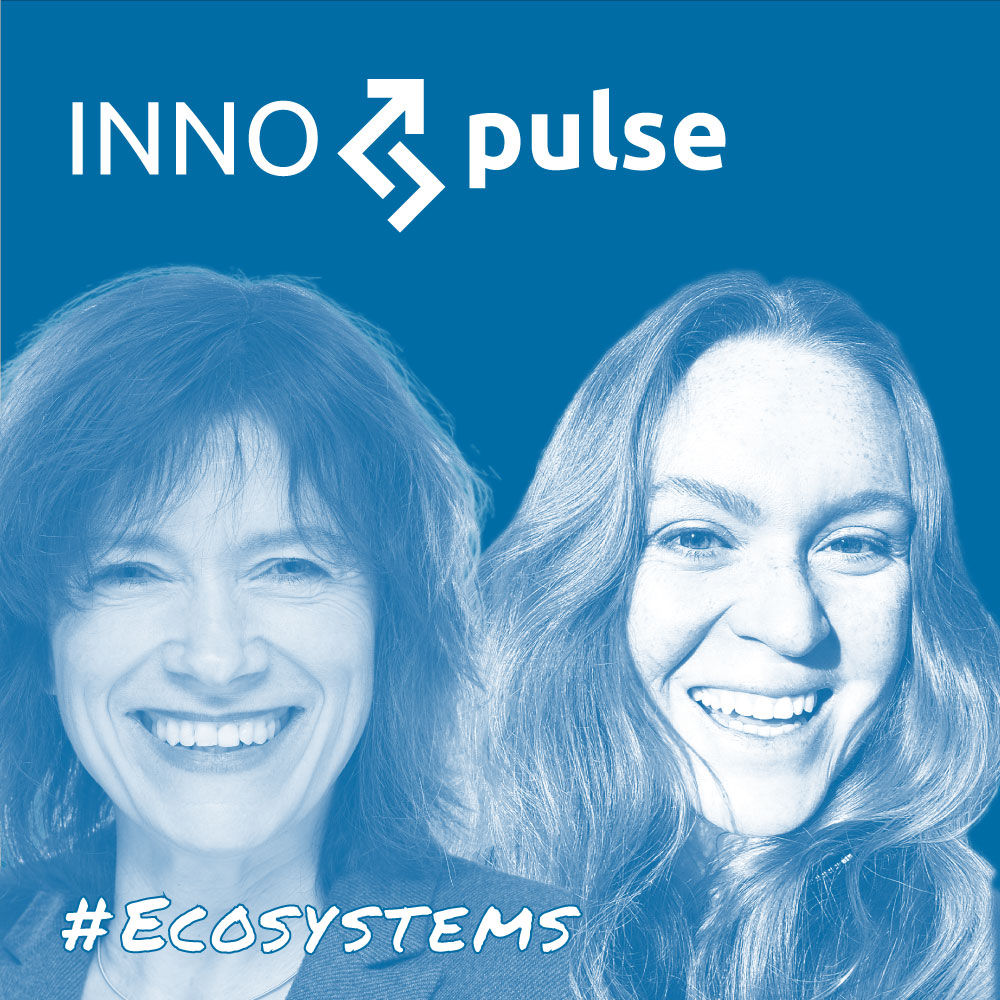
Innovationslabs im Mittelstand - Wirkungsloses Instrument oder unterschätzte Initiative? Ein Erfahrungsbericht von HIMA
In der Podcast-Folge mit Dr. Leontin Grafmüller und Knut Haberkant von der HIMA Paul Hildebrandt GmbH wird das Innovationslab "Himalaya" vorgestellt, das im Mittelstand als Instrument zur Förderung von Innovationen dient. Die beiden Gäste erläutern, wie das Lab entstanden ist und welche Rolle es innerhalb der HIMA spielt. Dr. Leontin Grafmüller beschreibt seinen Werdegang im Innovationsmanagement und seine Erfahrungen mit Geschäftsmodellinnovationen im deutschen Mittelstand. Er hebt hervor, dass das Lab sich auf die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle konzentriert und dabei eng mit Kunden zusammenarbeitet, um deren Bedürfnisse zu verstehen und innovative Lösungen zu entwickeln. Knut Haberkant, der aus der Ingenieurswelt kommt, erklärt, wie das Lab als Raum für Exploration und Innovation konzipiert wurde. Er betont die Bedeutung des Labs für die HIMA, insbesondere in Bezug auf die Digitalisierung und die Entwicklung neuer Ideen, die über die traditionellen Sicherheitsprodukte hinausgehen. Das Lab bietet einen physischen und inhaltlichen Raum, in dem Ideen gesammelt, strukturiert und weiterentwickelt werden können. Es wird als Enabler für Digitalisierungsthemen innerhalb der HIMA gesehen und fokussiert sich auf Projekte mit einem hohen Innovationsgrad. Ein zentraler Punkt der Diskussion ist die Balance zwischen Sicherheit und Innovation. Das Lab ermöglicht es den Mitarbeitern, in einem sicheren Raum zu experimentieren, ohne die strengen Sicherheitsstandards der HIMA zu gefährden. Die Folge endet mit einem Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Labs und die Hoffnung, dass es weiterhin als wertvolles Instrument für die Innovationsförderung im Mittelstand dient.

Konvergente Transformationen - Warum Unternehmen und ihre Führungskräfte heute Zukunftsentwicklungen einpreisen müssen
Raphael Gielgen, Trendscout bei Vitra, spricht in der Podcast-Folge über die Rolle von Vitra als Design-Company und die Bedeutung von Innovationsfähigkeiten im Kontext konvergenter Transformationen. Er beschreibt, wie Vitra seit 1953 kontinuierlich versucht, die Zukunft zu implizieren und sich mit der Frage beschäftigt, wie sich die Art und Weise, wie Menschen arbeiten und wohnen, verändert. Gielgen betont die Wichtigkeit von Design und Schönheit in den Produkten von Vitra, die oft lebenslange Begleiter der Menschen sind. Er erläutert, dass Vitra eine eigene Schwerkraft und Geschwindigkeit entwickelt hat, um sich in einer sich ständig verändernden Welt zu behaupten. Ein zentraler Punkt ist die Auseinandersetzung mit Designern und Architekten, die Vitra eine "Superkraft" verleihen. Diese Zusammenarbeit hat dazu geführt, dass Vitra nicht nur kommerziell erfolgreich ist, sondern auch kulturell bedeutend. Gielgen spricht über die Herausforderungen der Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit, die Vitra in der heutigen Zeit angeht. Er beschreibt die Transformation der Wirtschaft als eine seismische Veränderung und sieht die Pandemie als Vorbereitung auf diese neue Zeit. Gielgen teilt seine Erfahrungen als Trendscout und die Bedeutung von Neugierde und der Fähigkeit, Zusammenhänge zu verstehen. Er hebt hervor, dass starke Narrative eine wichtige Rolle spielen, um Menschen zu verführen und in neue Welten zu führen. Diese Narrative helfen, die eigene Rolle und die Vorteile in einer neuen Welt zu verstehen. Gielgen betont, dass die Fähigkeit, aus Puzzleteilen mögliche Bilder abzuleiten, eine Superkraft der neuen Zeit ist.

Wie digitalisiert man Anwaltskanzleien?
In der Podcast-Folge mit Stefan Schicker von SKW Schwarz wird die Digitalisierung und Transformation von Anwaltskanzleien thematisiert. Stefan Schicker, der ehemalige Managing Partner der Kanzlei, spricht über die Herausforderungen und Chancen, die mit der Integration von Technologie in den Rechtsbereich verbunden sind. Er betont die Notwendigkeit, dass Anwälte nicht nur juristische Expertise, sondern auch technisches Verständnis haben müssen, um in der modernen Welt erfolgreich zu sein. Die Kanzlei SKW Schwarz hat sich auf Medien-, IT- und IP-Recht spezialisiert und ist bekannt für ihre innovative Herangehensweise. Schicker beschreibt, wie die Kanzlei sich von einer traditionellen Anwaltskanzlei zu einer modernen, technologieaffinen Organisation entwickelt hat. Er spricht über die Bedeutung von Partnerschaftsgesellschaften und die Flexibilität, die sie bieten, um Fachkompetenzen zu bündeln und ein breiteres Spektrum an Dienstleistungen anzubieten. Ein zentraler Punkt der Diskussion ist die Veränderung der Rechtsbranche hin zu datengetriebenen Organisationen und die Notwendigkeit, Prozesse zu optimieren und zu digitalisieren. Schicker erläutert, wie SKW Schwarz durch die Einführung von digitalen Tools und Plattformen versucht, effizienter zu arbeiten und den Mandanten einen Mehrwert zu bieten. Er hebt hervor, dass die Kanzlei sich nicht als IT-Dienstleister sieht, sondern digitale Services als Ergänzung zur traditionellen Rechtsberatung anbietet. Schicker teilt auch seine Erfahrungen und Herausforderungen bei der Transformation der Kanzlei, einschließlich der Einführung neuer Systeme und der Anpassung an die sich schnell ändernden Anforderungen des Marktes. Er betont die Wichtigkeit, strategische Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig flexibel zu bleiben, um auf neue Entwicklungen reagieren zu können.

Heute bereits die Zukunft lernen? Innovative Lösungen im Bildungsmarkt am Beispiel von Fischertechnik
In der Podcast-Folge mit Thomas Bußhart, Geschäftsführer der Fischertechnik GmbH, wird das Thema Geschäftsmodelle und die Zukunft der Bildung behandelt. Thomas Bußhart stellt sich zunächst vor und beschreibt seinen beruflichen Werdegang, der ihn über Stationen bei Intel, Apple und Lego Education zu Fischertechnik geführt hat. Er betont die Bedeutung von Bildung und sieht seine Rolle bei Fischertechnik als Chance, einen positiven Beitrag zu leisten. Fischertechnik, gegründet 1965 von Professor Arthur Fischer, ist bekannt für seine Nähe zur Technik und hat sich über die Jahre im Bildungs- und Industriebereich etabliert. Bußhart erläutert, wie Fischertechnik sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich tätig ist und beschreibt die Lernfabrik 4.0, die Produktionsabläufe simuliert und in Berufsschulen sowie Hochschulen eingesetzt wird. Ein Schwerpunkt der Diskussion liegt auf der Integration neuer Technologien in Bildungsprodukte, um Future Skills zu fördern. Bußhart spricht über die Herausforderungen des Bildungsmarktes, insbesondere in Deutschland, und die Notwendigkeit, Produkte an die sich wandelnden Anforderungen anzupassen. Er betont die Wichtigkeit von spielerischem Lernen und die Rolle von Fischertechnik bei der Entwicklung von Lösungen, die sowohl haptische als auch digitale Elemente kombinieren. Bußhart geht auch auf globale Bildungsmodelle ein und beschreibt, wie Fischertechnik versucht, mit neuen Technologien am Puls der Zeit zu bleiben. Er spricht über die Bedeutung von Nachhaltigkeit und die Entwicklung von Produkten mit Biokunststoffanteil. Abschließend wird die Rolle von Fischertechnik im Bildungsbereich und die Zusammenarbeit mit Partnern wie OMM Solutions hervorgehoben.

Von Legaltech zu Legal Innovation? Neue Geschäftsmodelle am Beispiel der Reguvis Fachmedien GmbH
Dr. Sascha Theißen, CEO der Reguvis Fachmedien GmbH, spricht in der Podcast-Folge über die digitale Transformation und Innovation im Verlagswesen, insbesondere bei Reguvis. Er beschreibt seinen Werdegang, beginnend als Jurist und später als Leiter der Rechtsabteilung bei Holzbrink, wo er sich mit digitalen und strategischen Weiterentwicklungen beschäftigte. Bei Reguvis setzt er sich für die Integration von digitalen Geschäftsmodellen ein, um den wachsenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Reguvis ist ein Fachverlag, der sich auf die Bereitstellung von praktischen Informationen für verschiedene Branchen spezialisiert hat, darunter Außenwirtschaft, Bau und Immobilien sowie Familie und Soziales. Der Verlag bietet eine Vielzahl von Produkten an, von Fachliteratur über digitale Angebote bis hin zu Weiterbildungen und Kongressen. Dr. Theißen betont die Bedeutung der Kundenzentrierung und die Notwendigkeit, die Organisation entlang des Wertstroms zu strukturieren, um die Bedarfe der Kunden besser zu bedienen. Er spricht auch über die Herausforderungen der Digitalisierung und Innovation im Rechtsmarkt, die durch demografische Veränderungen und den Einsatz von KI-Tools verstärkt werden. Reguvis strebt danach, nicht nur als Verlag, sondern auch als Anbieter von digitalen Lösungen und Software zu agieren, um den Kunden bei der Umsetzung von Regulatorik zu unterstützen. Dr. Theißen sieht die Zukunft des Verlags in der Entwicklung von Softwarelösungen und der Bildung von Partnerschaften, um die digitale Transformation voranzutreiben. Er betont, dass die Integration von Kunden in den Entwicklungsprozess entscheidend ist, um praxisnahe Lösungen zu schaffen.

Wie funktionieren regionale Innovationsökosysteme? Community as a Service am Beispiel von CODE_n GmbH
In der Podcast-Folge mit Christian Lorenz, Geschäftsführer der Code_n GmbH, wird das Konzept von regionalen Innovationsökosystemen und Community as a Service am Beispiel von Code_n beleuchtet. Christian Lorenz, ursprünglich aus dem Kulturmanagement kommend, beschreibt seinen Weg zu Code_n und seine Rolle als Community-Manager. Code_n versteht sich als Plattform zur Vernetzung von kreativen und innovativen Köpfen aus Technologie, Wirtschaft und Kunst. Ursprünglich als Halle auf der CeBIT gestartet, bietet Code_n heute Raum für Innovation in Form von physischen Spaces, Events und Services. Ein zentraler Aspekt ist die Schaffung eines vertrauensvollen Rahmens, in dem Unternehmen, von Startups bis zu Großkonzernen, ihre Innovationsprozesse vorantreiben können. Code_n fördert den Austausch und die Horizonterweiterung, indem es Unternehmen dabei unterstützt, über ihre Fachkompetenzen hinauszublicken und datengetriebene Geschäftsmodelle zu entwickeln. Christian Lorenz betont die Bedeutung von Unternehmertum und Risikobereitschaft in der heutigen Zeit und sieht Code_n als einen Ort, der sowohl progressiven Unternehmen als auch Bedürftigen Unterstützung bietet. Christian Lorenz spricht auch über die Herausforderungen, die Unternehmen haben, wenn sie versuchen, innovative Teams innerhalb ihrer Strukturen zu integrieren. Er sieht eine Chance darin, dass solche Teams in externen Ökosystemen wie Code_n arbeiten, um freiere und schnellere Ergebnisse zu erzielen. Abschließend wird die Bedeutung von Unternehmertum und die Notwendigkeit, Risiko einzugehen, hervorgehoben, um in der heutigen wirtschaftlichen Landschaft erfolgreich zu sein.

Müssen Städte Innovationsökosysteme aktiv stärken? Motivation und Maßnahmen am Beispiel der Landeshauptstadt Stuttgart
In der Podcast-Folge mit Konstantin Schneider, Teamleiter Innovation der Landeshauptstadt Stuttgart, wird die Rolle der Stadt in der Förderung von Innovationsökosystemen beleuchtet. Schneider beschreibt, wie Stuttgart als Standort für Innovationen agiert und welche Maßnahmen ergriffen werden, um die Innovationsfähigkeit der Unternehmen zu unterstützen. Ein zentraler Punkt ist die Sichtbarmachung von Innovationen durch Initiativen wie den Innovationspreis, der die innovativsten Unternehmen in Stuttgart auszeichnet. Schneider betont die Bedeutung der Vernetzung regionaler Akteure und die Förderung von Schnittstellen zwischen verschiedenen Branchen, um transformative Innovationen zu ermöglichen. Er spricht über die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der geografischen Lage und den kulturellen Besonderheiten ergeben, und wie diese in die strategische Planung einfließen. Ein weiteres Thema ist die Rolle der Stadt als verbindendes Element zwischen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und staatlichen Institutionen. Schneider erläutert, wie die Stadt durch Veranstaltungen und Netzwerke wie die "Innovation Drivers" und das "City Innovation Lab" den Austausch und die Entwicklung neuer Ideen fördert. Er geht auch auf die Konkurrenz zwischen Städten ein und wie Stuttgart versucht, sich als attraktiver Standort für Unternehmensansiedlungen zu positionieren. Dabei wird die Bedeutung eines funktionierenden Innovationsökosystems hervorgehoben, das Unternehmen anzieht und hält. Schneider gibt Einblicke in die strategischen Prozesse und die Identifizierung von Zukunftsthemen wie Green AI, die durch gezielte Impulse und Veranstaltungen vorangetrieben werden. Abschließend wird die Bedeutung der Kommunikation und Darstellung der Innovationskraft Stuttgarts betont, um den Standort auch international zu stärken.

Digitales Innovieren als Landesrundfunkanstalt am Beispiel des Südwestrundfunks
Die Folge des INNOpulse-Podcasts mit Martin Allmendinger als Gastgeber und Thomas Dauser, dem Direktor für Innovationsmanagement und digitale Transformation beim SWR, als Gast, beleuchtet verschiedene Facetten der Innovation in öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Herr Dauser teilt seine berufliche Laufbahn, die ihn vom Journalismus ins Management führte, und betont, wie diese Erfahrungen ihn auf seine aktuelle Rolle vorbereitet haben. Er diskutiert die Notwendigkeit für Landesrundfunkanstalten, zu innovieren, um mit den sich schnell verändernden Medienkonsumgewohnheiten und der digitalen Landschaft Schritt zu halten. Es werden außerdem spezielle Herausforderungen angesprochen, die mit der digitalen Transformation einhergehen, wie das Balancieren zwischen bewährten Angeboten und neuen Medienformaten, um sowohl ältere als auch jüngere Zielgruppen effektiv zu erreichen. Dauser illustriert, wie der SWR darauf reagiert, indem er neue Teams und Abteilungen wie ein Innovationslabor und ein Audience Development Team einführt, die darauf spezialisiert sind, neue digitale Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und die Reichweite des Senders zu erhöhen. Es wird auch die Bedeutung von Datenanalysen und benutzerzentrierten Ansätzen hervorgehoben, um sicherzustellen, dass die Angebote des SWR relevant und ansprechend bleiben. Die Diskussion erstreckt sich ebenso auf die Herausforderungen, die sich aus der Konkurrenz durch große Technologieplattformen ergeben, und die strategischen Überlegungen, die notwendig sind, um als traditionelle Medieninstitution in einem von digitalen Riesen dominierten Markt zu bestehen.

Digitales und Nachhaltiges Innovieren als Baustoffhersteller am Beispiel der Ardex GmbH
In dieser Folge spricht Moderator Martin Allmendinger mit Marco Schröder, dem Head of Innovation bei Ardex, über dessen Rolle und die Innovationen im Unternehmen. Marco, der seit zehn Jahren bei Ardex tätig ist, beschreibt die Transformation von klassischer Forschung und Entwicklung hin zu einem breiteren Innovationsansatz, der auch gesellschaftliche Megatrends berücksichtigt. Die Diskussion umfasst die Herausforderungen und Möglichkeiten der Digitalisierung sowie die Bedeutung von nachhaltigen Geschäftspraktiken. Marco betont die Notwendigkeit, über den traditionellen Entwicklungsrahmen hinauszudenken und diskutiert die Rolle von externen Kooperationen und Partnerschaften, die Ardex dabei helfen, innovativ zu bleiben. Er teilt seine Erfahrungen mit der Einführung neuer Technologien und die strategische Ausrichtung von Ardex, um auf globale Veränderungen zu reagieren, insbesondere im Hinblick auf Umweltschutz und effiziente Ressourcennutzung.

Nachhaltigkeit als Innovationsform für Unternehmen? Nachhaltigkeitsinnovationen am Beispiel von HAILO
Zu Gast in der Episode sind Dr. Carolin Heins und Christoph Erbach von Hailo. Carolin Heins beschreibt ihre Aufgaben als Bereichsleiterin Home & Business und ihre Rolle bei der Einführung von Innovationen in ihrem Segment. Christoph Erbach erzählt von seinem Weg zum Geschäftsführer des Hailo Digital Hub und betont die Bedeutung von digitalen Innovationen und neuen Geschäftsmodellen. Beide diskutieren, wie sie Innovationen vorantreiben und wie diese sowohl Geschäftsmodelle als auch Unternehmenskulturen beeinflussen. Der Fokus liegt auf der Verbindung von digitaler Transformation und Nachhaltigkeit, wobei sie spezifische Herausforderungen und Chancen in ihren Bereichen beleuchten.

Innovationsökosysteme in der Sozialwirtschaft am Beispiel der Diakonie Württemberg
In der Folge des Innopuls Podcasts spricht Martin Allmendinger von OMM Solutions GmbH mit Andrea Schwarz, Leiterin des Zukunftszentrums Futurum der Diakonie Württemberg, über Innovationen in der Sozialwirtschaft und die Entwicklung des neuen Zentrums. Andrea, die ursprünglich aus der Automobilindustrie kommt, erläutert ihren Wechsel zur Sozialwirtschaft und die Rolle, die sie im Aufbau des Zentrums spielt, das sich noch in der Gründungsphase befindet. Sie diskutieren die Herausforderungen und Notwendigkeiten von Innovationen im sozialen Sektor, insbesondere im Kontext digitaler Transformation und gesellschaftlicher Veränderungen. Dabei wird deutlich, dass der Innovationsbedarf in der Sozialwirtschaft nicht nur durch technologische Entwicklungen, sondern auch durch soziale Herausforderungen getrieben wird.

Behörden als digitale Matchmaker? Chancen und Herausforderungen am Beispiel des Innovationslabors im StaatsministeriumBW
Der Podcast mit Björn Beck von der Landesregierung Baden-Württemberg beleuchtet die Arbeit des Innovationslabors im Staatsministerium, das darauf abzielt, Innovationstrends frühzeitig zu erkennen und die Landesregierung zu beraten. Björn beschreibt seinen unkonventionellen Karriereweg vom Jurastudenten und Webentwickler zum Leiter des Innovationslabors und betont die Bedeutung interdisziplinärer Teams für erfolgreiche Digitalisierungsprojekte. Das Innovationslabor fungiert als Katalysator, der Technologieanbieter und Bedarfsträger zusammenbringt, um innovative Projekte zu initiieren und zu unterstützen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Nutzung von KI und Extended Reality, um praktische Lösungen für die öffentliche Verwaltung und den Mittelstand zu entwickeln. Björn betont die Herausforderungen der Bürokratie und die Notwendigkeit, Unternehmen bei der Einhaltung neuer Regulierungen wie dem AI-Act zu unterstützen.

Wie funktionieren digitale Geschäftsmodelle im globalen B2B? Besonderheiten von Plattformen in der Konsumgüterindustrie
Timo von Bargen von der Covalo AG beleuchtet die Entwicklung und das Geschäftsmodell der Plattform, die Konsumgüterherstellern hilft, Rohmaterialien besser zu managen. Timo beschreibt seinen beruflichen Werdegang, beginnend mit einem Studium der Wirtschaftswissenschaften und ersten unternehmerischen Erfahrungen in der Eventbranche. Covalo monetarisiert durch jährliche Subscriptions von Lieferanten wie Clariant und BASF und bietet Analytics, Lead-Dashboards und Integrationen in CRM-Systeme an. Die Plattform hat mittlerweile über 10.000 Nutzer und bietet auch Custom-Portale für größere Unternehmen an, um Kollaborationsfeatures und Integrationen in Bestandssysteme zu ermöglichen. Timo betont die Herausforderungen und Erfolge bei der Finanzierung und dem Aufbau eines globalen Geschäftsmodells aus Europa heraus.
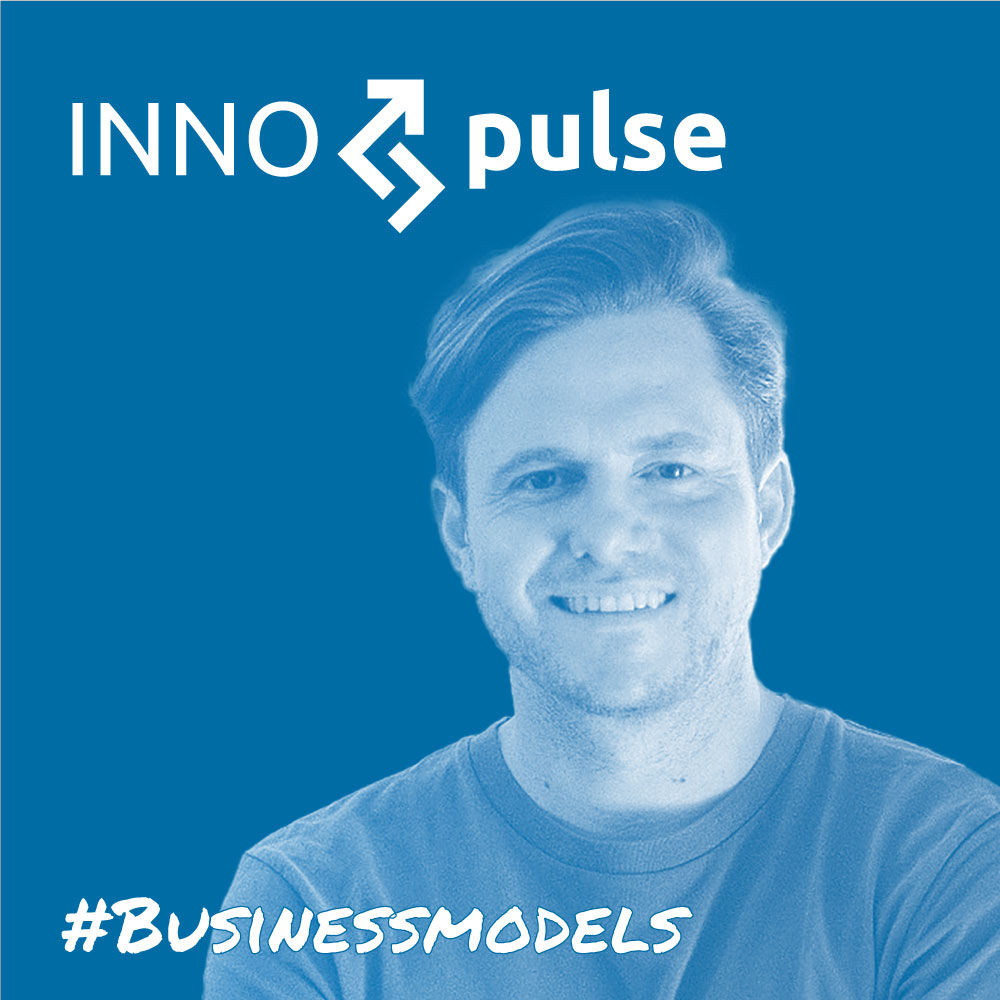
Diagnostics as a Service? Ki-basierte Geschäftsmodelle in der Gesundheitsbranche am Beispiel von IQONIC.AI
Der Podcast mit Maria-Liisa Bruckert von IQONIC.AI behandelt die Entwicklung und Anwendung von KI-basierten Geschäftsmodellen in der Gesundheitsbranche. Maria-Liisa beschreibt ihren beruflichen Werdegang von der Elektrotechnik-Studentin und Siemens-Mitarbeiterin zur Gründerin von IQONIC.AI, motiviert durch den Wunsch nach Selbstwirksamkeit und direkter Umsetzung von Innovationen. Sie erläutert, wie IQONIC.AI durch personalisierte KI-Lösungen die Gesundheitsindustrie transformiert und dabei auf individuelle Kundenbedürfnisse eingeht. Der Podcast thematisiert auch die Herausforderungen und Erfolge bei der Implementierung von KI, einschließlich der Anpassung an verschiedene Märkte und der Notwendigkeit, mutig und innovativ zu bleiben. Abschließend betont Maria-Liisa die Bedeutung von Risikobereitschaft und kontinuierlichem Lernen für den Erfolg im Unternehmertum.

Was können Wirtschaftsförderungen wirklich? Innovationsbeschleuniger oder Schreibtischtäter?
Britta Thiele-Klapproth vom Swiss Business Hub Germany beleuchtet die Rolle und Aufgaben des Hubs, der als Brückenbauer zwischen der Schweiz und Deutschland fungiert. Thiele-Klapproth beschreibt, wie der Hub Schweizer Unternehmen bei der Markterschließung in Deutschland unterstützt und deutsche Unternehmen in die Schweiz begleitet, um deren Wertschöpfung zu steigern. Sie betont die Bedeutung von Netzwerken und die Vorteile, die der Hub durch seine lokale Verankerung und Expertise bietet. Zudem wird die Innovationskraft der Schweiz hervorgehoben, die durch eine unternehmerfreundliche Politik und effiziente Strukturen begünstigt wird. Abschließend diskutiert sie die Herausforderungen und Erfolge des Hubs, einschließlich der Anpassung an neue Marktbedingungen und der Förderung von Kooperationen zwischen deutschen und Schweizer Ökosystemen.

Befähigung vs. Lösungsentwicklung: Positionierungsstrategien von Innovationsabteilungen am Beispiel der SV
Max Hartmann von der SV Versicherung berichtet über die Rolle und Herausforderungen des Innovationsmanagements in der Versicherungsbranche. Hartmann beschreibt seinen beruflichen Werdegang und die Bedeutung von Innovation für die SV, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, die über das traditionelle Versicherungsgeschäft hinausgehen. Er betont die Notwendigkeit, Digitalisierung in allen Projekten zu integrieren, und erläutert die Unterschiede zwischen Digitalisierung und Innovation. Zudem spricht er über die strategische Ausrichtung der SV, die auf organisches Wachstum und ressourceneffiziente Ansätze setzt, anstatt große, risikoreiche Projekte zu starten. Abschließend diskutiert er die Bedeutung von Ökosystemen und die Herausforderungen, diese effektiv zu gestalten und zu pilotieren.

Vom Service zum Produkt? Digitale Transformation am Beispiel von WISAG
Till Eichenauer, Head of Digital Transformation and Innovation bei der WISAG Facility Service Holding SE, beschreibt im Podcast die digitale Transformation und Innovationsstrategie des Unternehmens. Er erläutert, dass WISAG sowohl interne Prozesse digitalisiert als auch neue digitale Produkte und Services für Kunden entwickelt, um Effizienz und Qualität zu steigern. Eichenauer betont die Bedeutung von Robotik und Automatisierung, um Ressourcen optimal einzusetzen und manuelle Aufgaben zu reduzieren. Ein Highlight ist der Chatbot "Eli", der Nutzeranfragen effizienter bearbeitet und bereits erfolgreich in vielen Projekten eingesetzt wird. Abschließend reflektiert er über die Herausforderungen und Erfolge der letzten Jahre und gibt einen Ausblick auf zukünftige Projekte, insbesondere im Bereich Nachhaltigkeit und KI.

Wer steuert die Roboter von morgen? Software-Lösungen in der Intralogistik am Beispiel von Node Robotics
Lukas Teichmann, Geschäftsführer und Co-Founder von Node Robotics, spricht im Podcast über die Entwicklung und das Geschäftsmodell seines Unternehmens, das Software für die autonome Navigation und das Flottenmanagement mobiler Roboter entwickelt. Er beschreibt, wie Node Robotics aus dem Fraunhofer-Institut heraus gegründet wurde und welche Herausforderungen und Chancen sich dabei ergaben. Teichmann betont die Bedeutung von Teamdynamik und die Notwendigkeit, flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren, um langfristig erfolgreich zu sein. Er erläutert, dass Node Robotics sowohl Software-Lizenzen verkauft als auch Mietmodelle anbietet, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Abschließend reflektiert er über die persönlichen und unternehmerischen Learnings, die er während der Gründungsphase gemacht hat, und gibt Einblicke in die zukünftigen Pläne des Unternehmens, einschließlich der bevorstehenden Series-A-Finanzierungsrunde.

Die Energiewende gemeinsam schaffen: Multilaterale Innovationsansätze am Beispiel der Wien Energie
Peter Schließelberger, Teamlead Innovation and Grants bei der Wien Energie GmbH, erläutert im Podcast die Bedeutung von Innovationsökosystemen und multilateralen Partnerschaften für die Energiewende. Er betont, dass die Zusammenarbeit mit Startups und etablierten Unternehmen im Climate Lab entscheidend ist, um Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen. Schließelberger beschreibt, wie Wien Energie durch gezielte Projekte, wie den Einsatz von Wasserstoff auf Baustellen, konkrete CO2-Einsparungen erzielt. Er hebt hervor, dass klare Strategien, ausreichende Ressourcen und die richtigen Partner essenziell sind, um erfolgreiche Innovationen zu implementieren. Abschließend reflektiert er über die Herausforderungen und die Notwendigkeit, kontinuierlich an der Weiterentwicklung und Umsetzung von Projekten zu arbeiten.

Welchen Innovationsbeitrag können Hochschulen leisten? Regionale Ökosysteme am Beispiel des BIC der Zeppelin Universität
Elisabeth Lindt, Leiterin des Bodensee Innovationsclusters Digitaler Wandel an der Zeppelin Universität, spricht über die Bedeutung von regionalen Innovationsökosystemen und die Vernetzung von Unternehmen in der Bodenseeregion. Sie betont die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft, um Innovationen voranzutreiben und die Zukunftsfähigkeit der Region zu sichern. Lindt beschreibt die Zeppelin Universität als eine kleine, unternehmerisch geprägte Hochschule, die praxisnahe Ausbildung und enge Kooperationen mit regionalen Unternehmen fördert. Sie hebt hervor, dass das Bodensee Innovationscluster durch Synergieeffekte und vertrauensvolle Zusammenarbeit einen wichtigen Beitrag zur regionalen Entwicklung leistet. Abschließend reflektiert sie über ihre persönliche Motivation und die Herausforderungen und Chancen, die mit der Leitung eines solchen Clusters verbunden sind.

Foresight, Incubation, Venture Clienting: Offene Innovationsansätze am Beispiel der LBBW - Landesbank Baden-Württemberg
Dominik Schütz, Head of Innovation Lab bei der LBBW, spricht im Podcast über die Bedeutung von Innovation im Finanzsektor und wie die LBBW diese durch verschiedene Ansätze wie Foresight, Incubation und Venture Clienting fördert. Er betont, dass Innovationen nicht nur um ihrer selbst willen durchgeführt werden, sondern um echten Business Impact zu schaffen, der sich in Umsatzsteigerungen, Kosteneinsparungen und verbesserten Prozessen widerspiegelt. Schütz erläutert, dass die LBBW bewusst keine festen Suchfelder für Innovationen definiert, sondern sich an den konkreten Bedürfnissen und Problemen der internen Abteilungen orientiert. Er hebt hervor, dass Regulatorik sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance darstellt, insbesondere für etablierte Player, die dadurch Vertrauen und sichere Rahmenbedingungen schaffen können. Abschließend beschreibt er die LBBW als eine der größten Banken Deutschlands mit einem breiten Angebotsspektrum und einer starken regionalen Verwurzelung, die jedoch auch global agiert.

Vom Check-In bis ins Hotelzimmer und weiter: Digital Guest Journey as a Service am Beispiel von STRAIV
Alexander Hausmann, Gründer und Geschäftsführer der STRAIV GmbH, spricht im Podcast über die Entwicklung und das Geschäftsmodell von STRAIV, das eine digitale Guest Journey für Hotels anbietet. STRAIV deckt den gesamten Prozess von der Buchung bis zum Checkout ab, einschließlich digitaler Gästemappen, automatisierter Kommunikation und Self-Check-In-Lösungen. Hausmann betont die Herausforderungen und Learnings, die mit der Gründung und dem Wachstum des Unternehmens verbunden sind, insbesondere in der konservativen Hotelbranche. Er hebt die Bedeutung eines starken Teams und die Notwendigkeit von Anpassungsfähigkeit und Innovationsbereitschaft hervor. Abschließend reflektiert er über die Zukunft von STRAIV und die kontinuierliche Weiterentwicklung der digitalen Lösungen für die Hotellerie.

Mobility oder Tax-Tech Startup? Mobility Budget as a Service am Beispiel von MOBIKO
Nicola Büsse, Co-Founderin und Geschäftsführerin der Mobiko GmbH, erläutert im Podcast die Entstehung und das Geschäftsmodell von Mobiko, das als Ausgründung von Audi Business Innovation entstand. Mobiko bietet ein flexibles Mobilitätsbudget für Mitarbeitende an, das verschiedene Mobilitätsformen wie Carsharing und ÖPNV umfasst und steuerrechtlich korrekt abgerechnet wird. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Bedürfnisse von Arbeitgebern, um deren Prozesse zu vereinfachen und gleichzeitig die CO2-Emissionen zu reduzieren. Nicola betont die Wichtigkeit von Durchhaltevermögen, KPI-Fokussierung und der richtigen Unternehmenskultur für den Erfolg eines Startups. Zudem spricht sie über die zukünftige Ausrichtung von Mobiko, einschließlich der Integration von Mobilitätsbudgets in bestehende Verkehrs-Apps und die Digitalisierung von Ausgaben.

"Innovation Follower vs. First Innovator" - Innovieren als Entwicklungsdienstleister am Beispiel der Bertrandt Group
Im Podcast wird die Bertrandt Group als Entwicklungsdienstleister vorgestellt, der sich mit der Frage auseinandersetzt, ob er als Innovation Follower oder First Innovator agieren sollte. Manuel Hausmann, Innovationsmanager bei Bertrandt, erklärt, dass Bertrandt als Engineering-Dienstleister sehr nah an den Kunden arbeitet und dadurch schnell auf deren Anforderungen reagieren kann. Die Stärke von Bertrandt liegt darin, spezifische Kundenbedürfnisse und technologische Fähigkeiten schnell zu adaptieren. Der Podcast beleuchtet die Herausforderungen, die Bertrandt als Dienstleister hat, insbesondere den Trade-off zwischen kurzfristiger Wertschöpfung und langfristiger Innovationsfähigkeit. Bertrandt hat einen zentralen Innovationsprozess eingeführt, um die Innovationsagenda zu strukturieren und transparent zu gestalten. Dabei wird Wert darauf gelegt, dass alle Mitarbeitenden die Möglichkeit haben, ihre Ideen einzubringen, und dass diese auf die strategische Agenda des Konzerns einzahlen.

Wie kann man als Anwaltskanzlei skalieren? Schadensregulierung as a Service am Beispiel der Kanzlei PHP
Im Podcast wird die Kanzlei PHP unter der Leitung von Jan-Henning Brandt als ein innovatives Beispiel für die Skalierung durch Schadenmanagement dargestellt. Die Kanzlei hat sich auf die Schadensregulierung als Service spezialisiert, insbesondere für große Flotten und Mobilitätsdienstleister. Jan-Henning Brandt erklärt, dass die Kanzlei ein eigenes System entwickelt hat, um schadenrelevante Daten effizient zu verwalten und Prozesse zu optimieren. Durch die Nutzung von Technologie und KI-Lösungen wird das Wissen aus der Schadenregulierung nutzbar gemacht, was die Bearbeitung von Fällen beschleunigt und verbessert. PHP bietet eine End-to-End-Begleitung vom Schadenereignis bis zur rechtlichen Abwicklung, was es der Kanzlei ermöglicht, große Mengen an Schadenfällen effizient zu bearbeiten und ihre Dienstleistungen individuell auf Kundenbedürfnisse anzupassen. Der Einsatz von KI spielt eine zentrale Rolle, indem er semantische Suchen und Vergleichsfälle ermöglicht, um die Bearbeitung von Schadenfällen zu unterstützen.

Wie bereitet man die Jurist:innen der Zukunft vor? Der Rechtsmarkt im Wandel am Beispiel der Bucerius Education GmbH
Der Podcast behandelt die Herausforderungen und Veränderungen im Rechtsmarkt und wie die Bucerius Education GmbH darauf reagiert. Dr. Patrick Schröer, CEO der Bucerius Education, spricht über die Notwendigkeit, Jurist:innen nicht nur mit juristischem Fachwissen, sondern auch mit betriebswirtschaftlichen, technologischen und Führungskompetenzen auszustatten. Die Bucerius Education bietet Programme an, die sich nicht nur an Jurist:innen richten, sondern auch an andere Berufsgruppen im Rechtsmarkt, um eine ganzheitliche Entwicklung zu fördern. Ein zentraler Punkt ist die Anpassung der Bildungsangebote an die Bedürfnisse des Rechtsmarktes, der sich durch Digitalisierung und neue Technologien stark verändert. Sie sieht sich als Partner in der Transformation des Rechtsmarktes und bietet praxisorientierte Weiterbildung, die auf die spezifischen Anforderungen der Branche zugeschnitten ist.

Gemeinsam besser forschen? Forschungsökosysteme am Beispiel des innBW e.V.
Der Podcast beleuchtet die Innovationsallianz Baden-Württemberg, die aus zwölf außeruniversitären Forschungsinstituten besteht. Diese Allianz fokussiert sich auf die anwendungsorientierte Forschung und unterstützt insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen. Prof. Dr. Katja Schenke-Leiland, stellvertretende Vorständin der Innovationsallianz, erklärt, dass die Allianz eine Scharnierfunktion zwischen Universitäten und der Industrie einnimmt, um exzellente Forschung in die Praxis zu bringen. Die Institute arbeiten eng zusammen, um komplexe, interdisziplinäre Projekte zu realisieren, die einzelne Institute allein nicht stemmen könnten. Ein zentraler Aspekt ist die Förderung von Kooperationen und die Schaffung von Synergien, um innovative Lösungen zu entwickeln und die Wettbewerbsfähigkeit der Region zu stärken. Die Allianz ist auch ein wichtiger Akteur in der Förderung von Start-ups und der Schaffung von Arbeitsplätzen durch Ausgründungen.

Die digitale Transformation gemeinsam lernen? Wissensökosysteme am Beispiel des vediso e.V.
Im Podcast berichtet Sarah Theune, die Vorständin des Verbands Vediso, wie der Verband als Netzwerk und Plattform für gemeinnützige Organisationen fungiert, um die Herausforderungen der Digitalisierung zu bewältigen. Der Verband unterstützt seine Mitglieder durch Bildungsangebote, Workshops und Netzwerkveranstaltungen, um die digitale Zukunft aktiv zu gestalten. Ein zentrales Thema ist die digitale Teilhabe, die als Schlüssel für soziale Teilhabe gesehen wird. Vediso strebt an, die Sozialwirtschaft durch innovative Ansätze und Kooperationen zu stärken und die digitale Transformation voranzutreiben.

Für klein und groß - Wie Unternehmen mit Business Ökosystemen neue kollaborative Vorteile erzielen können
In der Episode mit Raphael Boemelburg wird das Thema Business-Ökosysteme und deren kollaborative Vorteile für Unternehmen diskutiert. Raphael Boemelburg erklärt, dass Business-Ökosysteme durch ein Netzwerk von Firmen ein konkretes, neuartiges Wertversprechen schaffen. Diese Ökosysteme unterscheiden sich von traditionellen Partnerschaften oder M&A-Aktivitäten, da sie auf die Entwicklung neuer Wertversprechen abzielen, die durch die Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen entstehen. Ein zentrales Thema der Episode ist die Fähigkeit von Unternehmen, flexibel Ressourcen innerhalb und außerhalb der Organisation zu nutzen, um kollaborative Vorteile zu erzielen. Boemelburg betont, dass es wichtig ist, nicht nur strategische Visionen zu haben, sondern konkrete Wertversprechen zu entwickeln, die am Markt erfolgreich sind. Er gibt Beispiele, wie Unternehmen wie die Helvetia und die Schweizerische Post Ökosysteme nutzen, um innovative Lösungen zu entwickeln, die auf spezifische Kundenbedürfnisse eingehen.

Global Home of Human AI? Wenn physische Ökosysteme auf virtuelle Megatrends treffen am Beispiel des IPAI
In der Episode schildert Moritz Gräter, CEO IPAI, über die Entwicklung von Innovationsökosystemen am Beispiel des IPAI in Heilbronn. Gemeinsam mit Dr. Martin Allmendinger diskutiert er, wie physische Ökosysteme mit virtuellen Megatrends interagieren und welche Rolle das IPAI dabei spielt. Moritz erklärt, dass das IPAI als Plattform dient, um Unternehmen bei ihrer KI-Reise zu unterstützen, indem es ihnen Zugang zu Ressourcen, Partnern und einer Community bietet. Ein zentrales Thema ist die Bedeutung von physischen Orten als Symbole für Innovation und Transformation, die Menschen zusammenbringen und Energie freisetzen. Das IPAI verfolgt das Ziel, ein menschenzentriertes Innovationsökosystem zu schaffen, das Vertrauen in KI fördert und europäische Werte integriert.

Digitalstrategien in Wirtschaftskanzleien entwickeln und umsetzen am Beispiel von Menold Bezler
In der Episode berichten Stefanie Müller, COO, und Dr. Carsten Ulbricht, Partner und IT-Rechtler, wie die Kanzlei Menold Bezler das Thema Digitalisierung strategisch und ganzheitlich angeht. Stefanie Müller beschreibt dabei auch ihre Rolle als COO, die in Kanzleien nicht immer typisch ist, und erklärt, wie sie strategische Themen und die Gesamtentwicklung der Kanzlei mitgestaltet. Dr. Carsten Ulbricht teilt seine Erfahrungen als IT-Rechtler und wie digitale Werkzeuge zur Vermarktung und Innovation in der Kanzlei beitragen. In der Episode hebt Dr. Martin Allmendinger außerdem besonders hervor, dass Menold Bezler eine der wenigen mittelgroßen Wirtschaftskanzleien in Deutschland ist, die Digitalisierung priorisiert, proaktiv und strategisch umsetzt.

Neue Geschäftsmodelle nach Corona? - Team-Erlebnisse stressfrei für Unternehmen ermöglichen am Beispiel von Cloopio
In der Episode erzählt Inga Mende, der Mitgründerin und CEO von Cloopio, über die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle nach der Corona-Pandemie und wie Cloopio Unternehmen dabei unterstützt, ihre Mitarbeitenden durch Erlebnismomente außerhalb des Büros sinnvoll zusammenzubringen, um die Unternehmenskultur zu stärken. Inga Mende teilt ihre Erfahrungen aus der Startup-Szene und erklärt, wie die Pandemie den Bedarf an persönlichem Austausch und Zusammenarbeit in neuen Kontexten verstärkt hat.

Regionale Ökosysteme und neue Mehrwerte: Heimat digital gedacht am Beispiel der VR Star GmbH
In der Episode berichtet Katrin Weiland wie die VR-Bank Bodensee-Oberschwaben in Zusammenarbeit mit der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eine App entwickelt hat, um regionale Mehrwerte digital sichtbar zu machen. Die App zielt darauf ab, lokale Veranstaltungen und Angebote hervorzuheben, die oft übersehen werden, und ermöglicht es den Nutzern, selbst zu bestimmen, welche Regionen sie als ihre Heimat betrachten. Die Banken betonen die Bedeutung der Zusammenarbeit über Geschäftsgrenzen hinweg, um ein umfassenderes Angebot zu schaffen und die genossenschaftliche Idee ins Digitale zu übertragen.

Von Legaltech zu Legal Ai - Die Entwicklung von Innovationsökosystemen am Beispiel vom Legal Ai Network
In der Episode sprechen Patrik Walter, Innovation Ecosystem Manager des Legal AI Network und Dr. Martin Allmendinger über Innovationsnetzwerke. Sie diskutieren, wie sie ein Innovationsnetzwerk in der Rechtsbranche aufgebaut haben und welche Herausforderungen und Erfolge und Misserfolge sie dabei erlebt haben. Patrik Walter teilt seine Erfahrungen und Einblicke in die Entwicklung des Netzwerks und die Bedeutung von Legal AI für die Branche.

Build, Partner & Enable! Komplementäre Innovationsportfolio-Ansätze am Beispiel der Provinzial Holding AG
In der Episode sprechen Konrad Bartsch, Bereichsleiter Innovation und Digitalisierung bei der Provinzial Holding AG und Dr. Martin Allmendinger über Innovationsstrategien in der Versicherungsbranche. Konrad Bartsch erläutert, wie sich ein traditionsreiches Unternehmen durch Kooperationen, technologische Offenheit und Anpassung an neue Risiken zukunftsfähig aufstellt. Dabei teilt er persönliche Erfahrungen aus über 25 Jahren und spricht über Herausforderungen wie kulturelle Hürden und die Ansprache junger Zielgruppen.

Financial Wellbeing für Alle? Entwicklung von Innovationsökosystemen am Beispiel der House of Finance & Tech Berlin GmbH
In der Episode sprechen Dr. Sebastian Schäfer, CEO des House of Finance & Tech Berlin, und Dr. Martin Allmendinger über den Aufbau von Innovationsökosystemen. Dr. Sebastian Schäfer gibt Einblicke in seinen Werdegang, seine Erfahrungen im Fintech-Bereich und seine Rolle bei der Gründung und Leitung des Techquartiers in Frankfurt. Gemeinsam beleuchten sie die Herausforderungen, Erfolgsfaktoren und die Bedeutung von unternehmerischem Denken sowie interdisziplinärer Zusammenarbeit für die Entstehung erfolgreicher Innovationsnetzwerke.

Arzt am Tag, IT'ler bei Nacht - Wenn durch Corona Dinge plötzlich anders laufen müssen
In der Episode sprechen Dr. Luis Haberstock, Arzt und IT-Experte im Gesundheitsamt Augsburg, und Dr. Martin Allmendinger über die Verbindung von Medizin und Technologie im öffentlichen Gesundheitswesen. Dr. Luis Haberstock berichtet von seiner Doppelrolle, die er im Zuge der Corona-Pandemie eingenommen hat, und wie er medizinisches Wissen mit technologischem Denken verknüpft, um innovative Lösungen zu entwickeln. Gemeinsam beleuchten sie die Transformation des Gesundheitsamts, die Bedeutung spielerischen Lernens, teamorientierter Zusammenarbeit und einer sinnstiftenden Arbeitskultur. Die Folge zeigt, wie durch Eigeninitiative, Bürgerzentrierung und interdisziplinäre Ansätze neue Wege in der öffentlichen Verwaltung beschritten werden können.

An der Schnittstelle zwischen Forschung und Innovation in der Zeiss Group - Von der Forscherin zur Scoutin
In der Episode sprechen Sophia Schmitt, Innovation Scout bei der ZEISS Group, und Dr. Martin Allmendinger über die Schnittstelle zwischen universitärer Forschung und industrieller Anwendung. Sophia Schmitt gibt Einblicke in ihren Weg von der Chemie-Promotion zur Innovationsarbeit bei ZEISS am KIT Campus in Karlsruhe. Gemeinsam beleuchten sie die Herausforderungen und Chancen ihrer Rolle als Innovation Scout, die Bedeutung von Eigeninitiative, interdisziplinären Netzwerken und der Zusammenarbeit mit Startups und Studierenden. Dabei steht im Fokus, wie Forschungsergebnisse in marktfähige Anwendungen übersetzt und neue Geschäftsfelder für ZEISS erschlossen werden.

Über 20 Jahre innovatives Unternehmertum - Vom Erschaffer zum Zusammenführer
In der Episode sprechen Manfred Tropper, Gründer und Geschäftsführer von Mantro, und Dr. Martin Allmendinger über den Wandel vom IT-Dienstleister zum Venture-Builder. Manfred Tropper gibt Einblicke in seinen Werdegang, die Entwicklung von Mantro und seine Rolle als Brückenbauer zwischen Technologie und Geschäftsmodellen. Gemeinsam beleuchten sie die Herausforderungen beim Aufbau eines Innovationsunternehmens, die Bedeutung von PR und medialer Sichtbarkeit sowie die Notwendigkeit, Geschäftsmodelle kontinuierlich zu iterieren. Zudem thematisieren sie die Rolle von Spezifikationen, Domänenwissen und Führungserfahrungen im Kontext erfolgreicher Technologieprojekte.
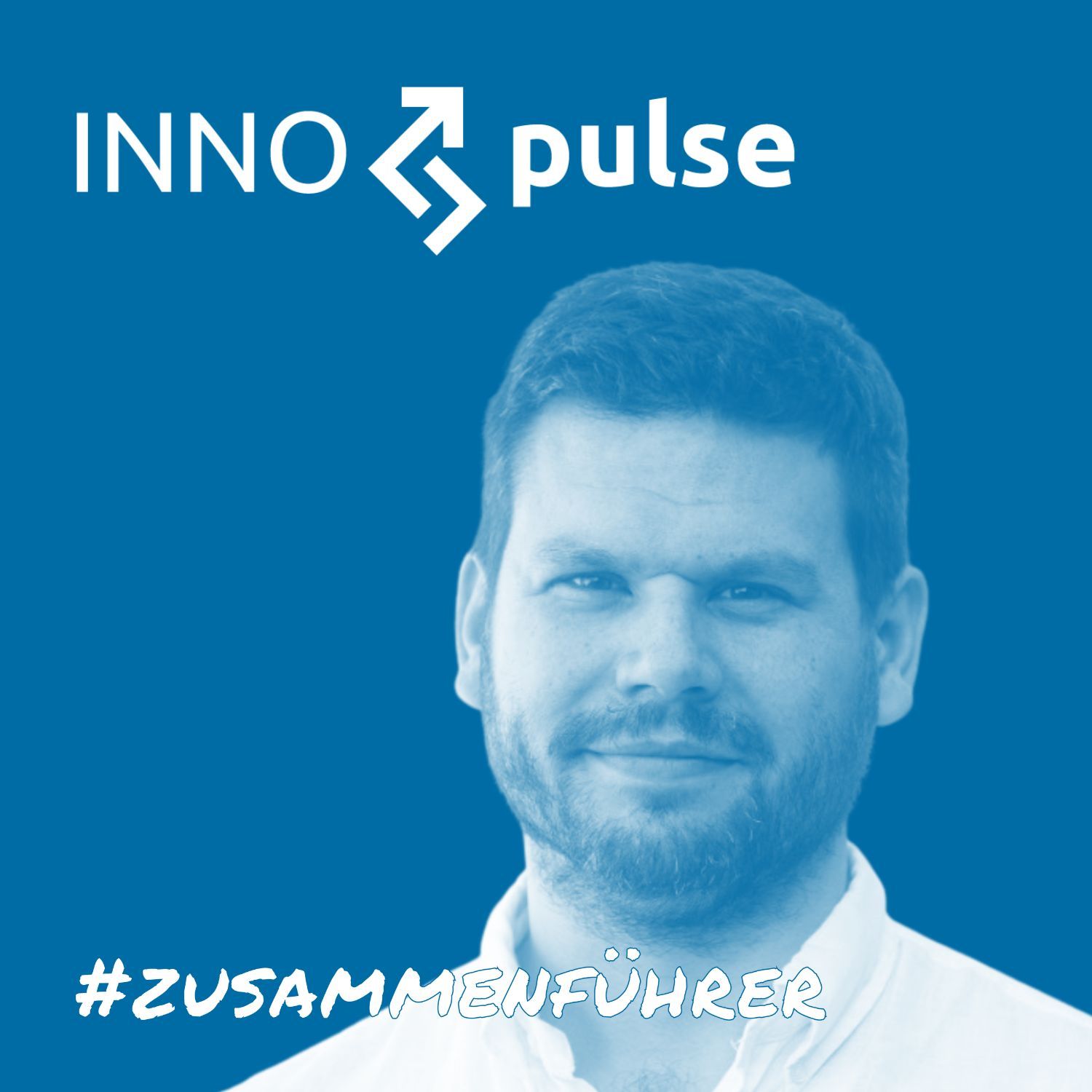
Heute Tech-Unternehmerin, morgen Bundeskanzlerin? Wenn Innovationsmindset auf die Rechtsbranche trifft
In der Episode sprechen Lisa Gradow, Mitgründerin und CEO von FIDES, und Dr. Martin Allmendinger über Innovation im Legal-Tech- und Corporate-Governance-Bereich. Lisa Gradow gibt Einblicke in ihren Werdegang, ihre Motivation als „Erschafferin“ und die Gründung von FIDES. Gemeinsam beleuchten sie die Rolle des Rechts als gesellschaftliches Betriebssystem, das sich stetig weiterentwickeln muss, sowie die Verbindung von juristischer Expertise und Technologie. Die Folge thematisiert Herausforderungen internationaler Jurisdiktionen, den Aufbau globaler Partnerschaften und die Bedeutung von Offenheit, Anpassungsfähigkeit und visionärem Denken für unternehmerischen Erfolg.

Branchen-Disruption als Anreiz für persönliches Unternehmertum? Vom Bootstrapper zum Scale-Up Manager
In der Episode sprechen Julian Schulz, Founder und CEO von metergrid, und Dr. Martin Allmendinger über die Transformation der Energiewirtschaft durch dezentrale Systeme. Julian Schulz gibt Einblicke in die Herausforderungen von Mieterstrommodellen in Mehrfamilienhäusern und mit welcher Lösung metergird an dieser Stelle ansetzt. Die Diskussion verdeutlicht, dass erfolgreiche Skalierungsprozesse neben innovativen Ansätzen vor allem eine Unternehmenskultur erfordern, die auf Transparenz und Augenhöhe basiert.

Zwischen Praxis und Forschung - Von der Pflegehelferin zur Institutsleiterin für Innovation
In der Episode sprechen Dr. Judith Schoch, Leiterin des Instituts für Innovation, Pflege und Alter bei der Evangelischen Heimstiftung, und Dr. Martin Allmendinger über die Zukunftsgestaltung der Pflege. Dr. Judith Schoch gibt Einblicke in ihre akademische Laufbahn, sowie ihre prägenden praktischen Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen mit Demenz. Gemeinsam beleuchten sie die Chancen, sowie ethischen Herausforderungen der sozialen Robotik im Pflegealltag. Die Diskussion verdeutlicht, dass erfolgreiche Innovationen in der Sozialwirtschaft vor allem eine partizipative Einbindung der Mitarbeitenden und eine reflektierte, offene Haltung gegenüber dem digitalen Wandel voraussetzen.

Vom Innovator "in Corporates" zum Innovator "for Corporates" - Kleine Experimente für den Innovationserfolg
In der Episode sprechen Frank Ilg, Gründer von innowate, und Dr. Martin Allmendinger über den Weg in die unternehmerische Selbstständigkeit. Frank Ilg gibt Einblicke in seinen beruflichen Werdegang, der ihn bei der Firma Peri bis hin zur Position des Head of Innovation führte, sowie in seine intrinsische Motivation als lebenslanger Innovator. Gemeinsam beleuchten sie die verschiedenen Rollen eines Innovators als Befähiger, Erschaffer und Zusammenführer sowie den strategischen Übergang von inkrementellen zu explorativen Innovationsprozessen.