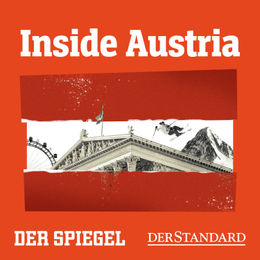FAZ Essay – der Podcast für die Geschichte hinter den Nachrichten
Ein Blick zurück auf die Studentenrevolte von 1968, die von Markus Söder angezettelte Kreuz-Debatte oder der katalanische Nationalismus: Der neue Podcast FAZ Essay widmet sich jede Woche aktuellen politischen und gesellschaftlichen Ereignissen – und gibt ihnen mit geistreichen Beiträgen von Wissenschaftlern und Politikern Tiefe und Substanz. Daniel Deckers, Politikredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, trägt die Essays aus dem Ressort „Die Gegenwart“ vor – und bietet damit umfassende Einsichten in die Geschichte hinter den Nachrichten.
Alle Folgen
#113: Shuttle nach Schönefeld
Nach der Wiedervereinigung der deutschen Hauptstadt Berlin werde man mit dem Helikopter vom Flughafen Tempelhof nach Schönefeld fliegen und von dort in die Welt aufbrechen – dachte man sich 1956 in der DDR. Nun ist es anders gekommen. Tempelhof ist eine Brache, Tegel wurde geschlossen, im Osten entstand der BER – und nicht alles aus DDR-Zeiten ist schlecht. Ein Essay von Dr. Annette Vowinckel. Der Verfasserin leitet die Abteilung „Zeitgeschichte der Medien- und Informationsgesellschaft“ am Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam und ist Privatdozentin für Neuere und Neueste Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Daniel Deckers, Politikredakteur der F.A.Z. und dort verantwortlich für das Ressort „Die Gegenwart“, trägt den Essay vor. Weitere Essays des Ressorts finden Sie hier: https://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/, alle Podcast-Folgen hier: https://www.faz.net/podcasts/f-a-z-essay-podcast/. Mehr über die Geschichte hinter dem Podcast erfahren Sie in diesem Text von Daniel Deckers: https://blogs.faz.net/essay/2018/08/08/die-zukunft-beginnt-jeden-augenblick-54/.

#112: Der Marathon-Mann
Vor fast fünfzig Jahren wurde Joe Biden zum ersten Mal in den Senat gewählt. Seither hat er mehrfach vergebens versucht, in das höchste Staatsamt der Vereinigten Staaten zu gelangen. Würde der Demokrat am Dienstag die Präsidentenwahl gewinnen, geböte er über ein Land und eine Partei, die sich in den vergangenen Jahrzehnten massiv verändert haben – und er sich mit ihnen. Ein Essay von Professor Dr. Stephan Bierling. Der Verfasser lehrt Internationale Politik und Atlantische Beziehungen an der Universität Regensburg. Daniel Deckers, Politikredakteur der F.A.Z. und dort verantwortlich für das Ressort „Die Gegenwart“, trägt den Essay vor. Sie können ihn hier (mit Fplus) nachlesen: https://www.faz.net/suche/bundestagswahlrecht-fehlleistung-wahlrechtsreform-16940863.html Weitere Essays des Ressorts finden Sie hier: https://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/, alle Podcast-Folgen hier: https://www.faz.net/podcasts/f-a-z-essay-podcast/. Mehr über die Geschichte hinter dem Podcast erfahren Sie in diesem Text von Daniel Deckers: https://blogs.faz.net/essay/2018/08/08/die-zukunft-beginnt-jeden-augenblick-54/.

#111: Fehlleistung Wahlrechtsreform
Die Parteiführungen von CDU, CSU und SPD wollen das Bundestagswahlrecht ändern. Ihr Vorschlag zur „Dämpfung“ der Zahl der Abgeordneten ist jedoch wenig wirksam. Überdies ist er verfassungsrechtlich problematisch und demokratiepolitisch prekär. Ein Essay von Professor Dr. Florian Grotz und Professor Dr. Friedrich Pukelsheim. Florian Grotz lehrt Politikwissenschaft an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr Hamburg. Friedrich Pukelsheim ist emeritierter Professor für Mathematik der Universität Augsburg. Daniel Deckers, Politikredakteur der F.A.Z. und dort verantwortlich für das Ressort „Die Gegenwart“, trägt den Essay vor. Sie können ihn hier (mit Fplus) nachlesen: https://www.faz.net/suche/bundestagswahlrecht-fehlleistung-wahlrechtsreform-16940863.html Weitere Essays des Ressorts finden Sie hier: https://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/, alle Podcast-Folgen hier: https://www.faz.net/podcasts/f-a-z-essay-podcast/. Mehr über die Geschichte hinter dem Podcast erfahren Sie in diesem Text von Daniel Deckers: https://blogs.faz.net/essay/2018/08/08/die-zukunft-beginnt-jeden-augenblick-54/.

#110: Als die Cholera nach Europa kam
Abgeriegelte Grenzen, Hamsterkäufe, Ausgangssperren, alleingelassene Sterbende, Angstzustände, Aufstände, Wutbürger, Stigmatisierung des Fremden, leere Staatskassen und wilde Verschwörungstheorien: Was wir von einem Blick in das Jahr 1831 lernen können, als eine aus Asien kommende Seuche Preußen in die Krise stürzte. Ein Essay von Professor Dr. Birgit Aschmann. Die Verfasserin lehrt Europäische Geschichte des 19. Jahrhunderts an der Humboldt-Universität Berlin. Daniel Deckers, Politikredakteur der F.A.Z. und dort verantwortlich für das Ressort „Die Gegenwart“, trägt den Essay vor. Sie können ihn hier (mit Fplus) nachlesen: https://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/corona-was-wir-von-der-cholera-lernen-koennen-16951651.html?premium Weitere Essays des Ressorts finden Sie hier: https://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/, alle Podcast-Folgen hier: https://www.faz.net/podcasts/f-a-z-essay-podcast/. Mehr über die Geschichte hinter dem Podcast erfahren Sie in diesem Text von Daniel Deckers: https://blogs.faz.net/essay/2018/08/08/die-zukunft-beginnt-jeden-augenblick-54/.

#109: Die Flucht aus unserer Geschichte
Die Gewaltmaschine der Ost-Diktatur? Wurde zusehends aus der Öffentlichkeit hinauskomplimentiert, weggeblinzelt im medialen Beliebigkeits-Sprech und dem ungestillten Bedürfnis der Konsenskultur Ost nach Verdrängung. Über deutsch-deutsche Echokammern im Jahr 30 der Einheit. Ein Essay von Ines Geipel. ----- Die Verfasserin ist Schriftstellerin. Zuletzt veröffentlichte sie „Umkämpfte Zone. Mein Bruder, der Osten und der Hass“. Daniel Deckers, Politikredakteur der F.A.Z. und dort verantwortlich für das Ressort „Die Gegenwart“, trägt den Essay vor. Sie können ihn hier (mit Fplus) nachlesen: https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/30-jahre-einheit-die-flucht-aus-unserer-geschichte-16974291.html Weitere Essays des Ressorts finden Sie hier: https://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/, alle Podcast-Folgen hier: https://www.faz.net/podcasts/f-a-z-essay-podcast/. Mehr über die Geschichte hinter dem Podcast erfahren Sie in diesem Text von Daniel Deckers: https://blogs.faz.net/essay/2018/08/08/die-zukunft-beginnt-jeden-augenblick-54/.

#108: Das Ergebnis war immer Verlassenheit
Erwachsene, die in ihrer Kindheit sexuell gequält und gefoltert wurden, überleben oft nur deshalb, weil sie ihr Ich in unterschiedliche Persönlichkeiten aufgespalten haben. Verstanden werden Personen mit einer dissoziativen Identitätsstörung aber nur selten. Ein Essay von Heike Schmoll. ----- Die Verfasserin ist politische Korrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.) in Berlin. Daniel Deckers, Politikredakteur der F.A.Z. und dort verantwortlich für das Ressort „Die Gegenwart“, trägt den Essay vor. Sie können ihn hier (mit Fplus) nachlesen: https://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/missbrauchsfolgen-leben-mit-dissoziativer-identitaetsstoerung-16917795.html Weitere Essays des Ressorts finden Sie hier: https://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/, alle Podcast-Folgen hier: https://www.faz.net/podcasts/f-a-z-essay-podcast/. Mehr über die Geschichte hinter dem Podcast erfahren Sie in diesem Text von Daniel Deckers: https://blogs.faz.net/essay/2018/08/08/die-zukunft-beginnt-jeden-augenblick-54/.

#107: Der alte Elefant
Weder war es selbstverständlich, dass Helmut Kohl 1982 Bundeskanzler wurde. Noch, dass der CDU-Politiker es bis 1998 blieb. Als er abtrat, war die Zeit über ihn hinweggegangen. Doch als er 1976 das erste Mal antrat, war das Scheitern nicht das Ende, sondern nur Anfang. Ein Leben als Lehrstück über Politik und Politiker. Ein Essay von Günter Bannas. ----- Der Verfasser war bis zum Frühjahr 2018 Leiter der Parlamentsredaktion der F.A.Z. in Berlin. Dem Essay liegt ein Beitrag zugrunde, der in dem von Norbert Lammert herausgegebenen Sammelband „Beiträge und Positionen zur Geschichte der CDU“, Siedler Verlag, München 2020, erschienen ist. Daniel Deckers, Politikredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dort verantwortlich für das Ressort „Die Gegenwart“, trägt den Essay vor. Sie können ihn hier (mit Fplus) nachlesen: https://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/helmut-kohls-leben-lehrstueck-ueber-politik-und-politiker-16907870.html. Weitere Essays des Ressorts finden Sie hier: https://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/, alle Podcast-Folgen hier: https://www.faz.net/podcasts/f-a-z-essay-podcast/. Mehr über die Geschichte hinter dem Podcast erfahren Sie in diesem Text von Daniel Deckers: https://blogs.faz.net/essay/2018/08/08/die-zukunft-beginnt-jeden-augenblick-54/.

#106: Die Erfindung des Katholizismus
Vor genau 150 Jahren wurde während des I. Vatikanischen Konzils eine Behauptung als von Gott geoffenbarte Wahrheit ausgegeben, die bis dahin ausdrücklich als falsch gegolten hatte: dass der Papst allein, ohne Rückbindung an den einmütigen Konsens der Bischöfe und die Glaubensüberzeugung der ganzen Kirche, unfehlbare Entscheidungen fällen könne. Ein nachgerade klassisches Beispiel für Identitätssicherung durch „invention of tradition“. Ein Essay von Professor Dr. Dr. h. c. Hubert Wolf. Der Verfasser lehrt Mittlere und Neuere Kirchengeschichte an der Universität Münster. Daniel Deckers, Politikredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dort verantwortlich für das Ressort „Die Gegenwart“, trägt den Essay vor. Weitere Essays des Ressorts finden Sie hier: https://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/, alle Podcast-Folgen hier: https://www.faz.net/podcasts/f-a-z-essay-podcast/. Mehr über die Geschichte hinter dem Podcast erfahren Sie in diesem Text von Daniel Deckers: https://blogs.faz.net/essay/2018/08/08/die-zukunft-beginnt-jeden-augenblick-54/.

#105: Die Generation Z und die fünfte Welle des Terrorismus
Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert hat sich der Terrorismus in vier einander überlappenden Wellen von je etwa vierzig Jahren Dauer entwickelt. Wenn sich das Großeltern-Enkel-Muster fortsetzt, müsste die fünfte Welle wieder auf Systemkritik basieren – diesmal als Reaktion auf die Globalisierung. Das Erstarken von antiliberalen bis hin zu rechtsextremen Kräften ließe sich damit erklären. Ein Essay von Dr. Carolin Görzig. Die Verfasserin leitet die Forschungsgruppe „Wie ,Terroristen‘ lernen“ am Max-Planck- Institut für ethnologische Forschung in Halle (Saale). Daniel Deckers, Politikredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dort verantwortlich für das Ressort „Die Gegenwart“, trägt den Essay vor. Sie können Ihn hier nachlesen: https://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/die-generation-z-und-die-fuenfte-welle-des-terrorismus-16877108.html. Weitere Essays des Ressorts finden Sie hier: https://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/, alle Podcast-Folgen hier: https://www.faz.net/podcasts/f-a-z-essay-podcast/. Mehr über die Geschichte hinter dem Podcast erfahren Sie in diesem Text von Daniel Deckers: https://blogs.faz.net/essay/2018/08/08/die-zukunft-beginnt-jeden-augenblick-54/.

#104: Die Katastrophe nach der Katastrophe
Seit zehn Jahren wird Angehörigen und Opfern des Love-Parade-Unglücks eine umfassende amtliche Aufarbeitung verweigert. Weder wurde ein Sonderermittler eingesetzt noch ein Untersuchungsausschuss. Der 44 Seiten umfassende Beschluss, mit dem das Landgericht Duisburg den Prozess Anfang Mai einstellte, ist voller Widersprüchlichkeiten und Verzerrungen, die vom Kern des Skandals ablenken: Wie war es möglich, dass die Genehmigung für eine Massenveranstaltung erteilt wurde, bei der sehenden Auges Gefahren für Leib und Leben der Besucher in Kauf genommen wurden? Ein Essay von Reiner Burger. Der Verfasser ist Politischer Korrespondent der F.A.Z. in Nordrhein-Westfalen. Daniel Deckers, Politikredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dort verantwortlich für das Ressort „Die Gegenwart“, trägt den Essay vor. Sie können Ihn hier (mit Fplus) nachlesen: https://www.faz.net/aktuell/politik/love-parade-prozess-die-katastrophe-nach-der-katastrophe-16867750.html. Weitere Essays des Ressorts finden Sie hier: https://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/, alle Podcast-Folgen hier: https://www.faz.net/podcasts/f-a-z-essay-podcast/. Mehr über die Geschichte hinter dem Podcast erfahren Sie in diesem Text von Daniel Deckers: https://blogs.faz.net/essay/2018/08/08/die-zukunft-beginnt-jeden-augenblick-54/.

#103: Auferstehen in Ruinen
Niemand hatte sich so gründlich auf seine Mission vorbereitet wie die deutschen Kommunisten in Moskau. Die „Brigade Ulbricht“ war programmatisch und organisatorisch allen anderen Kräften überlegen. Im Juli 1945 war Ost-Berlin fest in ihrer Hand. Ein Essay von Dr. Jochen Staadt.

#102: Aus eigener Stärke
Krisenhafte Entwicklungen hat es in Europa schon lange gegeben. Jetzt sollten wir die Corona-Pandemie dazu nutzen, uns zu fragen: Was haben wir in der Vergangenheit übertrieben? Wo sollten wir maßvoller werden? Was können wir für die Zukunft besser machen? Identitäten sind nicht in Stein gemeißelt, sie können sich als Resultat gemeinsam bestandener Bewährungsproben verändern. Ein Essay von Dr. Wolfgang Schäuble. Die Verfasserin leitet die Forschungsgruppe „Wie ,Terroristen‘ lernen“ am Max-Planck- Institut für ethnologische Forschung in Halle (Saale). Daniel Deckers, Politikredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dort verantwortlich für das Ressort „Die Gegenwart“, trägt den Essay vor. Sie können Ihn hier nachlesen: https://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/die-generation-z-und-die-fuenfte-welle-des-terrorismus-16877108.html Weitere Essays des Ressorts finden Sie hier: https://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/, alle Podcast-Folgen hier: https://www.faz.net/podcasts/f-a-z-essay-podcast/. Mehr über die Geschichte hinter dem Podcast erfahren Sie in diesem Text von Daniel Deckers: https://blogs.faz.net/essay/2018/08/08/die-zukunft-beginnt-jeden-augenblick-54/.

#101: Eine kurze Geschichte des Impfens
Die medizinische Erfolgsgeschichte, die Ende des 18. Jahrhunderts mit dem Kampf gegen die Pocken begann, war von Anfang an immer auch ein politisches Thema. Es geht um Zwang - und um die Frage, was am besten gegen Infektionskrankheiten hilft. Ein Essay von Professor Dr. Robert Jütte. Der Autor ist Leiter des Instituts für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung in Stuttgart. Daniel Deckers, Politikredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dort verantwortlich für das Ressort „Die Gegenwart“, trägt den Essay vor. Sie können Ihn hier (mit Fplus) nachlesen: https://zeitung.faz.net/faz/politik/2020-06-29/eine-kurze-geschichte-des-impfens/476303.html Weitere Essays des Ressorts finden Sie hier: https://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/, alle Podcast-Folgen hier: https://www.faz.net/podcasts/f-a-z-essay-podcast/. Mehr über die Geschichte hinter dem Podcast erfahren Sie in diesem Text von Daniel Deckers: https://blogs.faz.net/essay/2018/08/08/die-zukunft-beginnt-jeden-augenblick-54/.

#100: Mit Mut und Neugier
75 Jahre CDU zeigen zweierlei: Da ist ein tiefer Drang, Verantwortung zu übernehmen, der Wille zum Gestalten und Regieren im Jetzt – denn nur so kann eine Partei ganz konkrete Probleme lösen. Und es gibt eine starke visionäre Kraft, den Willen, nicht einfach im Hier und Jetzt stehenzubleiben und ängstlich irgendwie den Status quo zu verteidigen, sondern eine glückliche Zukunft zu gestalten. Ein Essay von Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Autorin ist Vorsitzende der CDU und Bundesministerin der Verteidigung. ##Shownotes## Daniel Deckers, Politikredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dort verantwortlich für das Ressort „Die Gegenwart“, trägt den Essay vor. Sie können Ihn hier (mit Fplus) nachlesen: https://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/mit-mit-und-neugier-akk-ueber-75-jahre-cdu-16825779.html. Weitere Essays des Ressorts finden Sie hier: https://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/, alle Podcast-Folgen hier: https://www.faz.net/podcasts/f-a-z-essay-podcast/. ~ Mehr über die Geschichte hinter dem Podcast erfahren Sie in diesem Text von Daniel Deckers: https://blogs.faz.net/essay/2018/08/08/die-zukunft-beginnt-jeden-augenblick-54/.

#99: Als die Panzer kamen
Vor genau achtzig Jahren begann die sowjetische Okkupation Litauens, Lettlands und Estlands. Was damals geschehen ist, sorgt heute für neue politische Konflikte, weil Russland die Legende vom freiwilligen Beitritt der drei Länder zur Sowjetunion wieder aufleben lässt. Die Geschichte des Einmarsches in drei Länder, die sich in einer aussichtslosen Lage befanden. Ein Essay von Professor Dr. Joachim Tauber.

#98: Europas Verfassungskrise
Das EZB-Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat ein ungelöstes Problem akut gemacht. Andere Konflikte über die richtige Verfassung der EU waren schon zuvor ausgebrochen oder harren ihrer Austragung. Sie auf die Spitze zu treiben und markante Entscheidungen zu suchen wäre der falsche Weg. Ein Essay von Professor Dr. Dr. Udo Di Fabio.

#97: Der Tag des Sieges
Das Kriegsgedenken in Russland war mit seinen monumentalen Denkmälern und Paraden immer eine staatliche Inszenierung. Aber es war stets auch sehr viel mehr: Wie sich die Bedeutung des 9. Mai 1945 über die Jahrzehnte gewandelt hat. Ein Essay von Dr. Mischa Gabowitsch.

#96: Der Schmerz der Ungarn
Vor hundert Jahren wurde der Vertrag von Trianon unterzeichnet, durch den Ungarn zwei Drittel seines Territoriums verlor. Das Land sah sich als unschuldiges Opfer der Siegermächte des Ersten Weltkriegs. Aber war es das auch? Ein Essay von Georg Paul Hefty.

#95: Das Virus als Wegmarke
„Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ Dieser Satz aus Psalm 90 hat für viele Menschen neue lebensweltliche Plausibilität gewonnen. Die Corona-Krise zwingt uns zu der Einsicht, dass auch unser modernes Leben gefährdet und bedroht ist von Kräften, die stärker sind als all unsere medizinische Kompetenz und unser vieles Geld. Ein Essay von Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm.

#94: Arbeit am Mythos
Vor hundert Jahren wurde Karol Wojtyla geboren. Als Papst Johannes Paul II. schrieb er zwischen 1978 und 2005 Weltgeschichte. Doch die Geschichte des ersten Polen auf dem Stuhl des Bischofs von Rom ist längst noch nicht geschrieben.

#93: Täter als Opfer, Opfer als Täter: die RAF
Auch fünfzig Jahre nach ihrer Gründung und gut zwanzig Jahre nach ihrer Selbstauflösung ist die "Rote Armee Fraktion" nicht Geschichte. Noch immer sind zahlreiche Morde nicht aufgeklärt. Auch die Propaganda der RAF verdient eine eingehende Analyse. Ein Essay von Dr. Harald Bergsdorf.

#92: Bibel, Axt und Zeitungen
Die amerikanischen Qualitäts-Medien stehen angesichts der Corona-Pandemie vor einem Dilemma: Um Ausgewogenheit zu dokumentieren, müssen sie auf Desinformationskampagnen reagieren. Wer profitiert? Ein Essay von Professor Dr. Jan-Werner Müller.

#91: Europa neu denken
Die Erfolgsgeschichte der europäischen Einigung, die bald nach dem Zweiten Weltkrieg begann, ist schon längst in eine Krisengeschichte der Europäischen Union umgeschlagen. Doch ausweglos ist diese Krise nicht. Ein Paradigmenwechsel tut Not. An die Stelle eines unspezifischen, unumkehrbaren Integrationsprozesses muss projektgebundenes, föderatives Handeln treten. Die Corona-Pandemie wäre dafür ein guter Anlass. Ein Essay von Professor Dr. Peter Graf Kielmansegg.

#90: Heiliger Geist und Zeitgeist
Die erstmalige Ordination von Frauen zum evangelischen Pfarramt während des Zweiten Weltkriegs verdankte sich einer glücklichen Allianz von zeitlosen Wahrheiten und Gegenwartsbezügen. Dasselbe Muster lässt sich in der Verdrängung von Frauen aus kirchlichen Ämtern in der Spätantike beobachten – nur gingen Heiliger Geist und Zeitgeist damals eine durchaus unheilige Allianz ein. Ein Essay von Professor Dr. Dr. h.c. mult. Christoph Markschies.

#89: An den Grenzen der Verfassung
Das Modell der liberalen Demokratie schlägt sich in der Pandemie überraschend gut. Es gilt, Leben zu schützen und dabei schonend mit den Grundlagen der freien Gesellschaft umzugehen. Ein Essay von Professor Dr. Udo Di Fabio.

#88: Solidarität und Verantwortung in der Corona-Krise
Der Deutsche Ethikrat hat eine ethische Orientierungshilfe in dramatischen Handlungs- und Entscheidungssituationen verfasst, vor allem solchen der sogenannten Triage. Überdies werden Verfahrensmaßgaben und Kriterien skizziert, wann und in welcher Weise auf eine Renormalisierungsstrategie umgestellt werden kann. Eine gekürzte Version dieser sogenannten Ad-hoc-Empfehlung im F.A.Z.-Essay-Podcast.

#87: Hungermord
Das größte einzelne Verbrechen der Sowjetunion ist im Westen noch immer kaum bekannt: Die von Stalin verursachte Hungersnot in der Ukraine 1932/33. Ein Essay von Professor Dr. Martin Schulze Wessel.

#86: Willy Brandt ans Fenster!
Im März 1970 reist Bundeskanzler Willy Brandt zum ersten deutsch-deutschen Gipfeltreffen nach Erfurt. Mit dabei: der BND. Doch die Informationen aus Pullach über die Lage in der DDR sind oft widersprüchlich. Ein Essay von Dr. Jan Schönfelder.

#85: Deutschland, einig Bundesstaat?
Es erscheint paradox: Die Rationalität des deutschen Bundesstaates liegt nicht darin, regionale Vielfalt zu bewahren, sondern gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen. Das aber kann nicht das letzte Wort sein. Ein Essay von Professor Dr. Wolfgang Renzsch.

#84: Religiöse Konflikte unter dem Grundgesetz
Der Islam trägt mittlerweile erheblich zur Veränderung der Rolle von Religion in Deutschland bei: Auf die zunehmende Sichtbarkeit muslimischer Symbole reagiert das Gemeinwesen mit deren Ausschluss aus immer weiteren Bereichen von Staat und Gesellschaft. Doch was ist damit gewonnen? Ein Essay von Professor Dr. Rudolf Steinberg.

#83: Die Symbiose von Schleppern und Seenotrettern beenden!
Die internationalen Fluchtbewegungen werden zunehmen – und die inneren Widersprüche der europäischen Flüchtlingspolitik wohl so schnell nicht abnehmen. Grund für Fatalismus ist das nicht. Allein für die Beendigung des massenhaften Ertrinkens im Mittelmeer gibt es mehrere Optionen. Eine von ihnen führte direkt in einen gemeinsamen europäischen Asylraum. Vorschläge zur Güte von Professor Dr. Egbert Jahn.

#82: Seit' an Seit'
Seit ihrer Gründung im Jahr 1919 ist die Arbeiterwohlfahrt nicht ohne die SPD zu denken. Aber sowohl der Wohlfahrtsstaat wie auch die Parteienlandschaft sind in Bewegung. Was bleibt? Ein Essay von Professor Dr. Jürgen Mittag.

#81: Autoritäre scharfe Macht und ihre digitale Agenda
Digitale Plattformen und Technologien, die in repressiven Regimen wie Russland und China entwickelt wurden, sind auf dem besten Weg, sich in demokratischen Ländern zu verbreiten. Autoritäre politische Normen könnten sie dorthin begleiten. Ein Essay von Christopher Walker, Shanthi Kalathil und Jessica Ludwig.

#80: Szymons Bilder
Szymon Groskop überlebte den Holocaust im besetzten Polen als Kind. Nach mehr als sieben Jahrzehnten fährt er zum ersten Mal wieder in die heute zur Ukraine gehörenden Orte zurück, an denen seine Familie ermordet wurde. Ein Essay von Felix Ackermann.

#79: Angekommen
Einst musste der Konsens der Demokraten gegen die SED-Nachfolgepartei PDS beschworen werden. Heute beschwört die Linkspartei den Konsens der Demokraten gegen die AfD. Eine kurze Geschichte einer bemerkenswerten Metamorphose von Dr. Thorsten Holzhauser.

#78: Die Experten
Auch Sieger haben es schwer: Für die Vertreter der neuen Staaten Osteuropas war die Pariser Friedenskonferenz eine Enttäuschung. Die eigentlichen Gewinner waren Männer im Hintergrund. Ein Essay von Maciej Górny.

#77: Was ist Wahrheit?
Je weniger es eine Vorstellung davon gibt, was richtig ist, desto erbitterter wird darüber gestritten. Über den schwierigen Umgang mit Wahrheitsansprüchen in der Demokratie. Ein Essay von Professor Dr. Uwe Volkmann.

#76: Generation Willy
Dass Gernot Erler ausgerechnet 1970 Mitglied der SPD wurde, war kein Zufall. In seinem Essay schildert er, wie ihn die Ereignisse dieses Jahres geprägt haben.

#75: Deutschland einig Vaterland
Der Stand der deutschen Einheit ist besser als ihr Ruf. Die Bereitschaft, Unterschiede unverzerrt wahrzunehmen, ohne auszurasten, ist ausbaufähig. Ein Essay von Professor Dr. Richard Schröder.

#74: Die katholische Kirche braucht keine neue Sexualmoral!
Eine Verzweckung der Sexualität zur individuellen oder sozialen Reproduktion war lange Zeit plausibel. Heute ist es an der Zeit, eine sinnstiftende Semantik der Liebe zu entfalten – gerade für die christliche Theologie. Ein Essay von Professor Dr. Christof Breitsameter.

#73 Zur Abwechslung Krise
Die jüngsten Unruhen in vielen Staaten Lateinamerikas und der Unmut großer Teile der Bevölkerung haben vor allem länderspezifische Gründe. Sie verwiesen gleichzeitig auf eklatante Schwächen der Demokratie auf dem Subkontinent. Ein Essay von Professor Dr. Nikolaus Werz.

#72: Minderheitsregierung? Warum eigentlich nicht!
Minderheitsregierungen gelten in Deutschland als unerwünschte Abweichung von einem als gut empfundenen Normalzustand, bestenfalls als notwendiges Übel. Aber in Zeiten parteipolitischer Umbrüche gilt es, die Chancen und die Risiken solcher Konstellationen neu abzuwägen. Ein Essay von Prof. Dr. Werner J. Patzelt.

#71 ... zu viel Glauben geschenkt?
Nach 1945 schienen nur wenige Zahnärzte in Deutschland so mit dem NS-Regime verstrickt gewesen zu sein, dass sie als kompromittiert gelten mussten. Viele konnten in der Bundesrepublik Karriere machen. Für die jüdischen Opfer in ihren Reihen gilt dies nicht. Ein Essay von Professor Dr. Dr. Dr. Dominik Groß und Dr. Matthis Krischel.

#70: Wir werden dran glauben müssen
Weltreligionen sind ursprünglich nicht dazu da, dass sie Frieden stiften. Wer das Gegenteil behauptet, hat Geschichte und Gegenwart nicht auf seiner Seite, allenfalls die moralphilosophischen Bedürfnisse unserer Zeit. Religiös geprägte Gewalt unterschiedlicher Reichweite wird auch künftig in keinem Fall auszuschließen sein. Ein Essay von Prof. Dr. Wolfgang Reinhard.

#69: Wissenschaft: Freiheit und Verantwortung
"Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei." So lautet der Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes. Dass im Jubiläumsjahr zu dessen 70. Geburtstag ein einschlägiger Essay mit diesem Zitat beginnen muss, versteht sich. Im Folgenden geht es allerdings nicht um die Grundrechtslehren zur wissenschaftlichen Freiheit, sondern um ihr philosophisches Fundament. Ein Essay von Professor Dr. Reinhard Merkel.

#68: Demokratie! Jetzt!
Altdeutsche Vorbehalte gegenüber der westlichen Demokratie und ihrer politischen Kultur hatten bessere Überlebenschancen dort, wo es nicht die Möglichkeit gab, allmählich in das neue System hineinzuwachsen. Die radikal unterschiedliche Entwicklung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg wirkt bis heute nach. Ein Essay von Professor Dr. Heinrich August Winkler

#67: Abschied von „Junker Jörg“
Martin Luther ist vielfältig und schillernd. Ihn neu zu erfinden, ist ein Gebot der theologischen und der gesellschaftspolitischen Vernunft. Zur Entmythologisierung eines wirkungsreichen Luther-Porträts. Ein Essay von Professor Dr. Thomas Kaufmann.

#66: Die DDR am Ende
Übersiedlungsprobleme, Sieg-Heil-Geschrei und so viele tote Flüchtlinge wie nie. Impressionen aus den letzten Monaten des SED-Staates. Ein Essay von Dr. Jochen Staadt.

#65: Konservativ – ein stacheliges Wort
Der neurechte Anspruch auf den Konservatismusbegriff macht es für die Unionsparteien schwierig, ihn für sich zu beanspruchen. Doch diese Konstellation ist nicht neu, sondern reicht in die fünfziger Jahre zurück. Die These vom „konservativen Substanzverlust“ in der Ära Merkel erscheint vor diesem Hintergrund als unhistorisch, ja falsch. Ein Essay von PD Dr. Martina Steber.

#64: Widersprüchlich und keine Lösung
Unter dem Namen „doppelte Widerspruchslösung“ liegt dem Bundestag ein Gesetzentwurf vor, der zu einer Erhöhung der Zahl der Organspenden führen soll. Doch bei genauer Betrachtung entpuppt sich der Vorschlag als eindimensionales Wunschdenken. Er würde das Problem der Organknappheit nicht lösen und begegnet erheblichen ethischen und verfassungsrechtlichen Bedenken. Ein Essay von Professor Dr. Steffen Augsberg und Professor Dr. Peter Dabrock.

#63: Ungleichheit und soziale Spannungen
Für winzige Wohnungen zahlen die Bürger gewaltige Summen. Die wirtschaftliche Ungleichheit hat seit der Rückgabe der Kronkolonie an China zu- und nicht abgenommen. Nun sollen auch noch die politischen Freiheiten eingeschränkt werden. Ein Bericht über die tiefen Ursachen der Proteste in Hongkong. Ein Essay von Professor Dr. Heribert Dieter.

#62: Weimar in Westminster
Die Bemühungen Boris Johnsons, mit den britischen Verfassungsgesetzen zu spielen, müssen hellhörig machen. Dass der Premierminister dies unter Berufung auf das Referendum und damit auf „die Demokratie“ tun kann, verweist auf deren paradoxe Selbstgefährdungspotentiale. Ein Essay von Professor Dr. Andreas Wirsching.

#61: Wem gehört mein Körper – und warum?
In diesem Herbst will der Deutsche Bundestag ein Gesetz beschließen, mit dem die Zahl der Organspender erhöht werden soll. Im Parlament stehen sich die Befürworter einer Widerspruchslösung und einer erweiterten Entscheidungslösung gegenüber. Ethisch gleichermaßen neutral sind die Vorschläge nicht. Die Bereitschaft zur Organspende ist eine Verfügung über das eigene Sterben – und muss daher eine Entscheidung bleiben. Ein Essay von Professor Dr. Stephan Sahm.

#60: Politik und Apokalypse
Die Demokratien haben trotz wachsender Sensibilität für Umweltzerstörungen auf die säkulare Herausforderung der ökologischen Krise in den vergangenen Jahrzehnten zu spät, zu langsam, zu unentschlossen reagiert. Muss die handlungsschwache, gegenwartsfixierte Demokratie nicht durch eine allein der Weltrettung verpflichtete Diktatur, eine „Ökodiktatur“, ersetzt werden? Ein Essay von Professor Dr. Peter Graf Kielmansegg.

#59: Zeitung der Einheit
Die Frankfurter Allgemeine trat stets für die Wiedervereinigung ein – während andere von einer "Lebenslüge" der Bonner Republik sprachen und das Provisorium für einen Dauerzustand hielten. Ein Essay von Professor Dr. Peter Hoeres.

#58: Abgrenzen, eingrenzen
Der Verweis auf das verlorene konservative Erbe der CDU ist ein altes Klagelied. Und schon Angela Merkels Vorgänger mussten auf Erfolge von Parteien rechts der Union reagieren. Was kann die CDU von heute aus dem Umgang mit dem BHE, der NPD und den Republikanern lernen? Ein Essay von Professor Dr. Frank Bösch.

#57: "... in vier Jahren kriegsfähig"
Vom ersten Tag ihrer Regierung an waren die Nationalsozialisten bestrebt, Deutschland auf einen neuen Weltkrieg vorzubereiten. Anders als während des Ersten Weltkrieges durfte die "Heimatfront" nicht wanken. Also musste die Gesellschaft umfassend militarisiert und darauf vorbereitet werden, jede Art von Gewalt im Inneren wie im Äußeren wenn nicht auszuüben, so doch zu tolerieren. Ein Essay von Professor Dr. Michael Wildt.

#56: Wie Hefe in Deutschland
Es gibt keine historische Grammatik des Sächsischen, die verschiedene Epochen und politische Systeme überdauert hätte. Umso mehr hilft die jüngere Geschichte des Freistaats dabei, seine politische Landschaft zu verstehen. Ein Essay über die politischen Dimensionen einer historischen Meistererzählung von Professor Dr. Simone Lässig.

#55: Das Ding mit dem Osten
1989 – in das Trauma der Doppeldiktatur krachte das Trauma der Verunsicherung. Verstörung, Abwehr, Gefühlsmüdigkeit, Desillusion machten sich breit. Nach vorn hin wurde saniert und saniert, inwendig blieb das Ganze ohne Boden. Ein Resümee im Jahr 2019 von Ines Geipel.

#54: Auf dem Weg zu einer multipolaren Weltordnung
Die Erwartungen waren riesig. Die Siegermächte des Ersten Weltkrieges wollten eine neue Ordnung schaffen. Stattdessen produzierte die Pariser Friedenskonferenz eine Welt, die mit der von 1914 nur noch wenig gemein hatte. Ein Essay von Professor Dr. Jörn Leonhard.

#53: Die Verwandlung der westlichen Demokratien
Die westlichen Demokratien sind heute gespalten entlang der Bruchlinien soziokultureller Identitätsangebote. Man braucht keine prophetischen Gaben, um zu optieren, wem die Zukunft gehört. Aber wie diese Zukunft aussieht, ob sie friedlich, liberal, erfolgreich sein wird, ist nicht gewiss. Ein Essay von Professor Dr. Udo Di Fabio.

#52: Kritik des Klerikalismus
In ihrem antimodernistischen Abwehrkampf hat die katholische Kirche auf die Loyalität klerikaler Hierarchien gesetzt und sich der Moderne entfremdet. Zunehmend drohte die Gefahr, dass sie sich auch ihren Gläubigen entfremdet. Der sexuelle Missbrauch und vor allem dessen langanhaltende, systematische Vertuschung wirken wie Brandbeschleuniger. Ein Essay von Professor Dr. Franz-Xaver Kaufmann.

#51: Für ein besseres Deutschland?
Zwischen dem Scheitern des Attentats auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 und der Arbeit des Parlamentarischen Rates lagen nicht einmal fünf Jahre. Welche Linien führen vom Widerstand zum Grundgesetz? Ein Essay von Professor Dr. Christian Waldhoff.

#50: Teilnehmende Beobachter
1968 interessierte sich nicht nur der westdeutsche Verfassungsschutz für die revoltierenden Studenten. Die DDR erkannte eine Chance, die Bundesrepublik zu destabilisieren – und nutzte sie. Ein Essay von Dr. Jochen Staadt.

#49: Ein Anspruch auf tönernen Füßen
Mit der Überhöhung des Prinzips, nur einer der Spitzenkandidaten könne Präsident der EU-Kommission werden, ist viel Verwirrung gestiftet worden. Denn die Mitgliedstaaten sind und bleiben die Garanten der europäischen Demokratie. Auch transnationale Kandidatenlisten wären ein Irrweg.

#48: Die heiligen Grenzen der Heimat
Eine der vielen neuen Grenzen, die seit 1919 bis heute das Europa des 19. Jahrhunderts durchschneiden, verläuft mitten durch Tirol. In ihrem Essay erinnern Marion Dotter und Dr. Stefan Wedrac an eine Wasserscheide der Geschichte.

#47: Grüner New Deal
Auch wenn die Gefahr eines Auseinanderdriftens in der Flüchtlingsfrage vorläufig gebannt scheint, ist die EU in einem beängstigenden Zustand. Wie das europäische Projekt wieder durch freiwillige Kooperation und Koordination an Schwung gewinnen kann – ein Essay von Ralf Fücks.

#46: Was ist dran an „IM Erika“?
Wer bei Google oder Twitter nach „Angela Merkel“ sucht, der stößt bald auf „IM Erika“. Zahllose Nutzer wähnen sich in dem Glauben, dass die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland unter diesem Decknamen in der DDR für das Ministerium für Staatssicherheit gearbeitet hat. Was ist dran an dieser Behauptung? Dr. Hubertus Knabe begibt sich in seinem Essay auf eine Spurensuche.

#45: Der Mythos der Englishness
"Robinson Crusoe" , erstmals im April 1719 erschienen und seitdem unzählige Male überarbeitet, übersetzt und nachgeahmt, war der erste moderne realistische Roman in englischer Sprache. Daniel Defoes Protagonist gab einer Haltung ein Gesicht, die bis heute das Selbstverständnis der Briten prägt – und sei es in dem Gefühl ihres Verlustes.

#44: Mehr Führung wagen
Die Weltordnung ist in einem Umbruch begriffen, den die Europäer mitgestalten müssen, wenn sie im 21. Jahrhundert eine Rolle spielen wollen. Technologische Unabhängigkeit herzustellen ist die Führungsaufgabe, die Deutschland übernehmen muss – nicht auf sich allein gestellt, aber doch als Anführer aller anderen. Ein Essay von Professor Dr. Herfried Münkler.

#43: Der Niedergang der Volksparteien
Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war die Blütezeit der Volksparteien. Seither trocknen die Individualisierung der Gesellschaft, die Fragmentierung ihrer Öffentlichkeit und die Diversifizierung von Arbeitsmarkt und Anstellungsverhältnissen den gesellschaftlichen Nährboden aller Großverbände aus. Ein Essay von Professor Dr. Wolfgang Merkel.

#42: Die zarten Seelen freier Bürger
In Zeiten, in denen der Liberalismus seine Selbstverständlichkeiten verloren hat, hilft es nicht, dessen Prämissen noch einmal im hohen Ton zu wiederholen. Stattdessen gilt es, die populistische Herausforderung ernst zu nehmen und offensiv anzugehen. Ein Essay von Dr. Detlef von Daniels.

#41: Schuld und Sühne
Die Abkehr von Sexismus und Rassismus ist das eine, die Ausbildung einer über die Jahrzehnte politisch immer schlagkräftigeren Symbiose von Schuld- und Opferidentitäten das andere. Heute schadet die Identitätspolitik der Linken der Gesellschaft mehr, als dass sie ihr nützt. Ein Essay von Dr. Sandra Kostner.

#40: Steinmeier greift ein
Mit dem Jamaika-Aus im November 2017 entstand eine politische Konstellation, die es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie gegeben hatte. Die Parteien, die regieren wollten, konnten es mangels Mehrheit im Bundestag nicht. Sollten die Bürger nun zum ersten Mal seit 1949 von einer Minderheitsregierung geführt werden oder noch einmal neu abstimmen? Bundespräsident Steinmeier blieb hart: Die Parteien hätten die Pflicht, sich auf die Bildung einer Regierung zu verständigen, mahnte der Bundespräsident. Und so wurde Merkel schließlich ein viertes Mal zur Kanzlerin gewählt, fast ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl. Ein Essay von Günter Bannas.

#39: Als die Bergstraße Bergstraat hieß
19 Tage nach der Gründung der Nato und genau einen Monat vor der Gründung der Bundesrepublik Deutschland begann am 23. April 1949 eines der skurrilsten Kapitel der westdeutschen Nachkriegsgeschichte: Die Niederlande annektierten mehrere deutsche Grenzorte. Erst im August 1963 endete die "Auftragsverwaltung" – mit einer kleinen Wiedervereinigung im Westen und der legendären "Butternacht" in Elten. Ein Essay von Reiner Burger.

#38 Gibt es christliche Politik – und wenn ja, warum und wie viel?
Seit Anbeginn wendet sich das Christentum nicht an ein bestimmtes Volk, sondern an alle Menschen guten Willens: Auch in lebenspraktischen Fragen erhebt es einen universalistischen Anspruch. Handfeste politische Rezepte verbieten sich. Aber im Christentum wurzeln zahlreiche Gestaltungsgrundsätze, die zusammengenommen den Rang einer sozialethischen Grammatik für offene Gesellschaften verdienen.

#37: Das Ende der "Großen Illusion"
Er war Journalist, Politiker, Bestsellerautor und hatte 1933 den Friedensnobelpreis erhalten. Als nach dem Zweiten Weltkrieg eine Verteidigungsgemeinschaft der westlichen Demokratien gegen die Bedrohung durch die Sowjetunion gegründet wurde, war Sir Norman Angells lebenslange Suche nach einem Rezept zur Überwindung von Kriegen am Ziel. Ein Essay von Michael Rühle.

#36: Teufel oder Beelzebub
Mit der Festlegung von wissenschaftlich nicht begründbaren Grenzwerten für Stickstoffdioxid hat die Politik Deutschland in die Diesel-Falle gesteuert. Und nur die Politik kann das Land aus dieser Falle befreien. Einstweilen muss die Justiz die Schieflage zwischen dem gesetzlichen Grenzwert, den Handlungsoptionen der Gemeinden und den Rechten der Bürger korrigieren. Ein Essay von Professor Dr. med. Dr. rer nat. Alexander S. Kekulé.

#35: Zwei Spanien
Vor 80 Jahren ist mit dem Sieg Francos der Spanische Bürgerkrieg zu Ende gegangen. Die Spaltung des Landes, die seine Folge war, wirkt in Politik und Gesellschaft bis heute nach. Ein Essay von Professor Dr. Birgit Aschmann.

#34: Schaffen wir das?
Entwicklungshilfe kann dazu beitragen, Fluchtursachen zu bekämpfen. Allerdings wird sie nur selten so eingesetzt, dass sie dieses Ziel auch erreicht. Regierungen reagieren oft zu spät und zu halbherzig auf Krisen, die sich häufig schon früh abzeichnen. Das Verhalten der Bundesregierung im Jahr 2015 war da keine Ausnahme. Ein Essay von Professor Dr. Axel Dreher, Professor Dr. Andreas Fuchs, Dr. Valentin Lang und Dr. Sarah Langlotz.

#33: Haupthindernis: Deutschland
Auf dem Weg zur Politischen Union sollte die EU nicht am deutschen, sondern am britischen Wesen genesen. Ein Essay von Brendan Simms zur Einstimmung auf die „Denk ich an Deutschland“-Konferenz der F.A.Z. und der Alfred Herrhausen Gesellschaft am 15. März in Berlin.

#32: Erst die Moral, dann das Fressen
Was verbindet die europäischen Rechtspopulisten von Viktor Orbán über Geert Wilders bis zu Marine Le Pen? Die Sorge um das materielle Wohlergehen ist es nicht. Es dominieren kulturelle Motive und Identitätsvorstellungen. Ein Essay von Professor Dr. Christian Joppke.

#31: Wohltätiger Staat ja, lästiger Staat nein?
Wenn es um das Synchronmaulen über sozialpolitisches Versagen der Regierungskoalition geht, ist vielen Verbänden jede Gelegenheit recht. Die vielen ethischen Fallstricke in der Debatte über eine zielführende Sozialpolitik werden dabei geflissentlich übersehen. Zu mehr Gerechtigkeit führt das nicht – im Gegenteil. Ein Essay von Professor Dr. Georg Cremer.

#30: Der Brexit: ein Dilemma auch für die EU
Den zweitgrößten Mitgliedstaat und historisch engen Verbündeten Großbritannien mögen Brüssel und die Verantwortlichen in den EU-Mitgliedstaaten ziehen lassen. Aber der Diskussion über die Reform eines auf Überkonstitutionalisierung beruhenden Integrationsprozesses wird die EU-27 langfristig nicht ausweichen können. Ein Essay von Professor Dr. Susanne K. Schmidt.

#29: Ein Zusammenprall der Kulturen?
Vor 30 Jahren rief der iranische Revolutionsführer Ajatollah Chomeini zum Mord an dem Schriftsteller Salman Rushdie und seinen Unterstützern auf. Leben wir seither in einem neuen Zeitalter der Blasphemie? Ein Essay von Professor Dr. Gerd Schwerhoff.

#28: Über Migration reden
Kein Konflikt hat die zweite deutsche Demokratie so gespalten wie der über die Grenzen der Einwanderung. In dieser Lage führt kein Weg um eine strategische Konzeption herum, die die Bereitschaft zu helfen mit dem Willen zur Behauptung des Eigenen verbindet. Diesen mittleren Weg haben wir noch nicht gefunden. Um ihn zu finden, müssen wir lernen, in einer Sprache der Mitte über die Aufgabe, vor der wir stehen, miteinander zu reden. Ein Essay von Professor Dr. Peter Graf Kielmansegg.

#27: Eine neue Ordnung für die Welt
Vor 40 Jahren veränderten konservative Revolutionäre die Ordnung der Welt. Papst Johannes Paul II. und der iranische Ajatollah Chomeini standen unverkennbar für eine neue politische Bedeutung von Religionen. Deng Xiaoping wollte den Kapitalismus den chinesischen Kommunisten dienstbar, Margret Thatcher mit Hilfe des ungezügelten Kapitalismus Großbritannien „great again“ machen. Sie alle prägten nicht nur ihre eigenen Länder nachhaltig. Ein Essay von Professor Dr. Frank Bösch.

#26: Die zerrissene Nation
Die parteipolitische Polarisierung ist heute größer als zu jedem anderen Zeitpunkt der amerikanischen Geschichte. Das bedroht die Funktionsfähigkeit des politischen Systems. Denn es ist auf die Fähigkeit und die Bereitschaft zum Kompromiss aufgebaut. Ein Essay von Professor Dr. Stephan Bierling.

#25: Auf Bewährung
Als Provisorium für die Zeit der Teilung wurde es geschaffen, zum Definitivum im vereinigten Deutschland ist es geworden. Nun steht der 70. Geburtstag des Grundgesetzes bevor. Ist es noch immer auf der Höhe der Zeit? Ein Essay von Professor Dr. Dieter Grimm.

#24: Populismus oder die entgleiste Aufklärung
Auf den ersten Blick könnte der Rechtspopulismus als Manifestation des altbekannten Autoritarismus durchgehen. Begreift man den Populismus indes als grundsätzlich misstrauende und paranoide, vor allem aber tendenziell antiautoritäre Bewegung, lassen sich viele Phänomene viel besser erklären. Ein Essay von Dr. Torben Lütjen.

#23: Pflichten und Grenzen der Solidarität
In den aktuellen kirchlichen Stellungnahmen aus Deutschland zu Flucht und Migration bleibt das Erfordernis einer Grenzkontrolle ein blinder Fleck. Der Heilige Stuhl und Papst Franziskus kennen das Thema Grenzen in ihren Stellungnahmen noch weniger. Mit der katholischen Soziallehre hat das nichts mehr zu tun. Ein Essay von Professor Dr. Manfred Spieker.

#22: Viel Feind, viel Ehr?
Der italienische Innenminister Matteo Salvini machte unlängst mit einem Mussolini-Zitat von sich reden: „Tanti nemici, tanto onore“ weist aber nicht nur auf den italienischen Diktator zurück. Der Führer der Lega bemühte auch die bis heute verschwiegene Kolonialgeschichte Italiens. Eine Spurensuche von Markus Wurzer.

#21: Aufgabe erfüllt
Mit dem Zusammenbruch des Kaiserreiches vor hundert Jahren ging die letzte Phase des (evangelischen) Staatskirchentums in Deutschland zu Ende. Die religionsverfassungsrechtlichen Kompromisse, die aus der Revolution des Jahres 1918 hervorgingen, haben bis heute Bestand. Ein Essay von Professor Dr. Christian Waldhoff.

#20: Mythos Ruhrgebiet
Eine Schönheit war das Ruhrgebiet noch nie, aber war seine Wahrnehmung jemals so unterschiedlich wie heute? Das Selbstbild einer Vorzeige-Region für gelungenen, technologiebasierten Strukturwandel steht in starkem Kontrast zur Wahrnehmung als abgehängter Industrielandschaft ohne Zukunft. Das Jahr 2018 besiegelt den Wandel des Ruhrgebiets endgültig – Zeit für eine historische Bilanz. Ein Essay von Dr. Karl-Peter Ellerbrock.

#19: Links und rechts – zwei Spielarten des Populismus
Im Süden Europas ist der Populismus tendenziell links, im Norden Europas tendenziell rechts – eine Folge der unterschiedlichen Verletzbarkeit der jeweiligen Politischen Ökonomien durch die Globalisierung. Ein Essay von Professor Dr. Philip Manow

#18: Ein emotionaler Mensch
1994 wurde Helmut Kohl zum fünften Mal in Folge als Bundeskanzler vereidigt. Danach gab es in Bonn nur ein Thema: Wann endet die Ära Kohl? Erinnerungen von Günter Bannas, dem früheren Leiter der Parlamentsredaktion der F.A.Z

#17: Bürgerkrieg im Herzen Europas
Mit den Waffenstillständen vom November 1918 endete die Gewalt nicht – im Gegenteil: Im vom Krieg verwüsteten Ostmitteleuropa ging sie erst richtig los. In Kämpfen aller gegen alle um die Grenzen der neu entstehenden Nationalstaaten wurde nicht mehr zwischen Zivilisten und Kombattanten unterschieden. Ein Essay von Dr. Jochen Böhler.

#16: Kaiser Wilhelm II. als Krüppel und Psychopath
Nicht erst im November 1918 wurden psychiatrische Diagnosen der angeblichen Geisteskrankheit des Kaisers zu Waffen im politischen Kampf – es ging um nichts weniger als um die Kriegsschuld der Deutschen. Mit scheinbar wissenschaftlicher Autorität ließ sich damals Ordnung in eine ungeordnete Zeit bringen. Ein Essay von Dr. David Freis, M.A.

#15: Eine mehrfach überschriebene Zäsur
Mit dem 9. November 1918 begann der historisch-politische Deutungskampf über die Revolution. Bis heute will er nicht enden – ein Essay von Professor Dr. Alexander Gallus

#14: Pflicht und Schuldigkeit
Die deutsche Revolution von 1918/19 ist nicht als eine der großen demokratischen Revolutionen des Westens in die Geschichte eingegangen. Dennoch steht die Berliner Republik in einer Tradition, aus der der 9. November 1918 nicht wegzudenken ist – ein Essay von Professor Dr. Heinrich August Winkler.

#01 Den Sinn des Kreuzes öffentlich machen
Für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder ist das Kreuz „ein grundlegendes Symbol unserer bayerischen Identität und Lebensart“. Der Horizont von Heinrich Bedford-Strohm, Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und Vorsitzender des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland, ist mehr als nur etwas weiter.