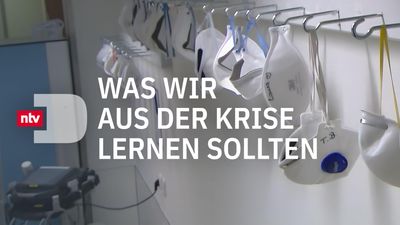Wie funktioniert die digitale Transformation und welche Auswirkungen hat sie auf unser Leben? Wir schauen aus Wissenschaft (Frauke) und Wirtschaft (Christof) und die aktuellen digitalen Trends. Unsere Interview-Gäste bringen Praxiserfahrung und wissenschaftliche Tiefe ein - eine Stunde "dig deep"!
Alle Folgen
Anna Kopp, wie bringt Microsoft Mensch und KI zusammen?
n dieser Folge sprechen wir mit Anna Kopp, Director Microsoft Digital Germany, über eine der zentralen Fragen unserer Zeit: Wie bringen wir technologische Innovation – insbesondere KI und Agenten – sinnvoll mit menschlicher Arbeit zusammen? Anna blickt auf über 20 Jahre bei Microsoft zurück und beschreibt eindrucksvoll, wie sich Arbeit seit der Pandemie verändert hat: mehr Meetings, mehr E-Mails, mehr Komplexität – bei gleichbleibenden Zielen. Wir diskutieren, warum KI für viele Wissensarbeiter inzwischen unverzichtbar ist, wo ihre Grenzen liegen und weshalb Governance, Datenqualität und Unternehmenskultur entscheidender sind als einzelne Tools. Ein besonderer Fokus liegt auf Agentic AI: Was Agenten heute schon leisten, warum sie eher wie neue Kolleginnen und Kollegen als wie Apps zu verstehen sind und weshalb Unternehmen jetzt lernen müssen, mit Tausenden von Agenten strukturiert umzugehen. Anna erklärt, warum gute Daten die Grundlage jeder KI-Nutzung sind und weshalb Innovation immer von echten Problemen ausgehen sollte – nicht von Technologiebegeisterung allein. Wir sprechen außerdem über digitales Mindset, Lernkultur, Verantwortung der Geschäftsführung und darüber, warum Transformation ohne Zeit zum Nachdenken nicht funktionieren kann. Eine Folge über Technologie – und vor allem über Menschen. Darum geht es in dieser Folge: Die Rolle von KI in der Arbeitswelt Mensch vs. Maschine: Die Zukunft der Arbeit Agenten und ihre Rolle in der Unternehmenswelt Governance und Sicherheit in der digitalen Welt Teamarbeit und Ergebnisse Kultur und Lernumgebung Digitales Mindset und Transformation Innovationsansätze und Problemlösungen Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI

Live von der CES in Las Vegas
In dieser Folge geht es nach Las Vegas: Wir berichten live von der CES, der weltweit größten Messe für Consumer-Elektronik – und inzwischen auch eine der Leitmessen der globalen Automobil-Industrie. Für Auto-Fans war auf der diesjährigen CES wenig zu beobachten – könnte man meinen. Denn die meisten Hersteller verzichteten auf große Stände und Fahrzeugvorstellungen. Sehr spannend ist aber dennoch, was unter der Motorhaube passiert. Und da bahnen sich weitere große Disruptionen an. Zentrales Thema war der Perspektivwechsel: Weg von sichtbaren Gimmicks, hin zu den strukturellen Grundlagen moderner KI. Hardware wird zunehmend Commodity, der eigentliche Wettbewerb verlagert sich auf Trainingsdaten, Simulationsumgebungen, Reasoning-Modelle und skalierbare Infrastrukturen. Die wichtigste KI-Anwendung im Auto bleibt dabei das automatisierte Fahren. Besonders spannend ist dabei der Umgang mit dem „Longtail“ – jenen seltenen, aber sicherheitskritischen Situationen, die autonome Systeme heute noch vor große Probleme stellen. Und hier hilft die KI der KI, wie die spannende Keynote von NVIDIA-Gründen Jen-Hsun Huang aufzeigte. Das große Leitmotiv der CES war Physical AI: Nach der Sprache erobern nun KI-Modelle auch die dreidimensionale Welt und kombinieren Sprache, Bilder, 3D und Aktionen. Humanoide Roboter können sich wie Menschen bewegen, wenngleich es mit dem gesunden Menschenverstand noch etwas hapert. Aber eines ist klar: autonome Fahrzeuge werden nur eines von vielen physischen KI-Endgeräten sein, und unsere Welt wird um viele technische Mitbewohner reicher werden. Wie wir uns in dieser neuen Wohngemeinschaft wohl gemeinsam arrangieren werden?

Armin Nassehi, wie gelingt gesellschaftliche Transformation?
In dieser Folge nehmen wir uns gemeinsam mit dem Soziologen Armin Nassehi die vielleicht wichtigste Frage unserer Zeit vor: Warum wissen wir so genau, was sich ändern muss – und scheitern dennoch regelmäßig an der Umsetzung? Wir starten mit der Diagnose einer kollektiven Transformationsmüdigkeit. Klimawandel, Digitalisierung, geopolitische Verschiebungen – die Ziele sind formuliert, die Probleme benannt, die Dringlichkeit unbestritten. Und doch passiert gefühlt zu wenig. Armin zeigt, dass dieses Gefühl kein individuelles Versagen ist, sondern tief in den Strukturen moderner Gesellschaften verankert liegt. Dabei müssen wir klar zwischen Organisationen und Gesellschaften unterscheiden. Unternehmen funktionieren, weil sie die „Fiktion der Steuerbarkeit“ aufrechterhalten: klare Ziele, klare Verantwortlichkeiten, definierte Erfolgsparameter. Gesellschaften hingegen sind keine Firmen. Wer versucht, sie mit denselben Logiken zu führen, landet bei überbordender Bürokratie, Kontrollillusionen oder – historisch betrachtet – autoritären Tendenzen. Wir sprechen auch darüber, warum die große politische Gesten zwar mobilisieren, aber selten transformieren. Warum echte Veränderung nicht aus moralischen Appellen entsteht, sondern aus mühsam ausgehandelten, kleinteiligen Schritten – und weshalb Win-win-Konstellationen zwischen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kommunen entscheidender sind als jede Sonntagsrede. Zum Schluss wird es grundsätzlich: Wir ordnen KI und Digitalisierung als Medienbruch ein, vergleichbar mit dem Buchdruck. Daten werden zur eigentlichen Wirklichkeit, KI spiegelt uns unser eigenes Denken als Muster-Rekombination – und stellt damit unsere klassische Vorstellungen von Expertise in Frage. Der neue Experte ist nicht mehr derjenige, der alles weiß, sondern derjenige, der mit diesen Systemen kritisch und produktiv umgehen kann. Armin Nassehis Blick hilft, Transformation nicht länger zu romantisieren oder managen zu wollen, sondern sie als das zu begreifen, was sie ist: ein komplexer, konfliktreicher, sozialer Prozess, der uns alle betrifft – im Unternehmen, im Privaten und in der Gesellschaft.

Wird KI der neue Kollege, Prof. Sabine Pfeiffer?
Eine Studie des MIT hat vor einigen Wochen viele aufgeschreckt: KI scheint zwar in privater Hand längst zum Alltag zu gehören, aber die Anwendungen in den Firmen bleiben weit hinter der Erwartungen zurück. Viel Lärm um nichts also? Weit gefehlt. Denn wie so oft sind die vielversprechenden Narrative nicht unbedingt hilfreich, um neue Technologien tatsächlich produktiv zum Einsatz zu bringen. Nicht ohne Grund braucht es viel Expertise, um in industriellen Anwendungen Produkte und Services auf den Markt zu bringen. Wenn KI hier helfen soll, die Produktivität zu steigern - und langweilige Routinejobs zu automatisieren -, dann müssen Mensch und Maschine beginnen, eng zusammenzuarbeiten. Denn ganz gleich, wie gut die "Foundational Models" sind, sie brauchen auch in nächster Zeit noch menschliches Bewertungsvermögen, um das wahrscheinlichste Ergebnis vom richtigen Ergebnis zu unterscheiden. Und das bedeutet: Die erfolgreiche Einführung von KI in Unternehmen ist weit mehr als eine technische Frage, sie benötigt die Einbeziehung der Mitarbeitenden von Anfang an - sonst sind die Projekte zum Scheitern verurteilt. Unser Studiogast Prof. Sabine Pfeifer untersucht am Institut für Soziologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, wie dieses Zusammenspiel von Technik, Arbeit und Gesellschaft erfolgreich gelingen kann. #digdeep ist stolzer Teil der Brand Eins Podcast-Familie!

Wie verändert Google mit KI alles, Wencke Schmidt?
Es fühlt sich schon wie eine Ewigkeit an, aber der große Auftritt der "generativen KI" jährt sich erst zum dritten Mal. Und ob KI-Blase oder nicht: KI macht sich unaufhaltsam daran, alle Lebensbereiche grundlegend zu verändern. Unser Studiogast Wencke Schmidt leitet bei Google das deutsche Cloud-Geschäft in der Automobilbranche. Und auch diese Branche wird durch KI stark verändert: nicht nur im Fahrzeug selber, sondern vor allem auch im Entwicklungsprozess. Die neuen KI-unterstützten Fähigkeiten ermöglichen uns Dinge, die vor Kurzem noch Science Fiction waren. Und sie entwickeln sich exponentiell weiter, weil wir mit KI noch bessere KI bauen können: Wir stehen also gerade erst am Beginn einer langen Entwicklung. Das bringt Veränderung an allen Fronten mit sich, für die Gesellschaft, für Firmen, aber auch für jeden Einzelnen. Wir haben Wencke gefragt, wie KI ihr Leben bereits heute verändert hat - als jemand, der direkt an der Quelle sitzt. #digdeep ist stolzes Mitglied der Brand Eins Podcast-Familie! Brand Eins ist das beste deutschsprachige Wirtschaftsmagazin, finden wir: unabhängig, kritisch, konstruktiv. So gut, dass man es am besten abonniert ;-) Bitte unterstützt unsere Arbeit durch Feedback, Bewertungen und Empfehlungen. Ihr wisst ja, wie das geht. Und wenn ihr Vorschläge für Gäste & Themen habt, kontaktiert uns gerne: info (at) digdeep.de

Wie gestaltet Synera die Produktentwicklung der Zukunft, Moritz Maier?
Das Entwickeln von physischen Produkten ist eine Sache für Experten: Der Umgang mit CAD-Systemen, die Konstruktion von Bauteilen, die Kenntnis der Normen, die Umsetzung von Anforderungen und Spezialwissen für unterschiedlichste Tools mit vielen Schnittstellen - das erfordert ein Ingenieurstudium. Wie aber wäre es, wenn die Produktentwicklung auf einer gemeinsamen, visuellen Sprache aufbauen würde - ein einfaches System von Elementen und Funktionen, die miteinander wie Plug&Play kombinierbar sind. Und auf deren Basis KI-Agenten immer mehr der Routine-Aufgaben übernehmen, so dass die menschlichen Experten sich auf das konzentrieren könnten, was den Menschen ausmacht. Unser Studiogast Moritz Maier hat sich als Co-Founder von Synera dieser Aufgabe gestellt. Sein Startup baut eine Plattform, in der die Produktentwicklung wie beim "Low Code" Programmieren vereinfacht wird. Ganz nebenbei entsteht eine konsistente Datenumgebung, die den Einsatz von AI Agenten erst sinnvoll ermöglicht. Der Weg dorthin war für Moritz und seine Mitstreiter alles andere als eine gerade Linie. Die erste Gründungsidee war es, die Effizienz der Bauweisen der Natur auch für Konstruktionsaufgaben nutzbar zu machen. Eine tolle, aber mühsam umsetzbare Idee, die letztlich aber die perfekte Grundlage für den heutigen Ansatz geliefert hat. Nun steht der Sprung in die USA an, um auch im Hotspot für AI anzugreifen. Wir wünschen dem Team viel Erfolg! #AI #Startup #GermanEngineering #digdeep ist stolzer Teil der Brand Eins Podcast-Familie. Auf brandeins.de findet ihr die beste deutschsprachige Wirtschaftszeitschrift - und ganzes Ökosystem guter Ideen. Unser Werbepartner in dieser Folge ist clockodo.com - eine tolle App und Plattform, um eure Arbeitszeiten zu erfassen.

Live von der herCareer mit Anne Greul: Wie Startup-Pivots gelingen
Wer ins unternehmerische Risiko geht, der hat es nicht leicht. Selten ist die erste Idee diejenige, die auch funktioniert - für die Kunden, aber auch mit dem Team. Unserer Podcast-Gast hat nicht den leichten Weg eingeschlagen. Statt einer Karriere in der Beratung oder der Automobilwirtschaft hat sie gemeinsam mit Wegbegleitern ein Startup zum Thema Web 3.0/Blockchain gegründet, um dann festzustellen: Das Thema fliegt nicht wie geplant. Scheitern, sich hinsetzen, und neu anfangen: Das nennt sich auf englisch "Pivot". Und dieser Pivot ist Anne mit ihrem zweiten Startup Leegle.AI wunderbar gelungen. Nun kümmert sich AI darum, dass Firmen die Vielzahl von Regulatorien identifizieren und sicher anwenden können. Die persönliche Geschichte von Anne ist eine tolle Inspiration für viele andere - und daher haben wir sie auch live auf der herCareer-Messe in München aufgenommen, Europas führender Karriere- und Networking-Plattform für Frauen. --- #digdeep ist Teil der wunderbaren Brand Eins Podcast-Familie. Und Brand Eins ist das führende Wirtschaftsmagazin im deutschsprachigen Raum, unabhängig, kritisch und konstruktiv. www.brandeins.de --- Diese Folge von #digdeep wird von unserem Werbepartner Clockodo unterstützt. Clockodo erleichtert euch die Zeiterfassung in euren Projekten. Unter clockodo.com/de/digdeep könnt ihr die Plattform drei Monate lang kostenlos testen.

Wie bringen wir Deutschland digital auf Spur, Cihan Sügür?
Die Zeitschrift "Capital" meint: "Deutschland mag in der Dauerkrise stecken, doch an vielen Stellen geht auch einiges voran - danke junger Macher und großer Talente - die Top 40 unter 40." Cihan Sügür ist seit 2024 einer von Ihnen. Seine Familie steht stellvertretend für viele, die sich persönlich auf einen mutigen Weg begeben haben: aus alten Umgebungen aufzubrechen, und mit Mut und Tatkraft etwas Neues zu schaffen. Cihans Mission ist die Digitalisierung. Nach Stationen bei Porsche, Olympus, IBM und der Deutschen Bahn ist er nun Associated Partner bei MHP. Als Gewinner der CIO Young Talent Awards war er Stipendiat der CIO Stiftung sowie MBA Studierender an der renommierten WHU. Nebenbei ist noch Mitglied der Atlantik-Brücke und engagiert sich politisch - weil ihm die Weiterentwicklung auch ein gesellschaftliches Anliegen ist: "Wir leben in dem schönsten Deutschland, das es je gab, und es liegt an uns, dass es lebensfähig in der Zukunft auch ist." Wir finden: Cihan steckt an, mit seinen Überzeugungen und viel Entrepreneurship. Also: Reinhören in eine tolle Folge über Wirtschaft, Gesellschaft & Mindset! ----- Unser Werbepartner in dieser Folge ist übrigens Clockadoo - eine tolle App und Plattform zur Zeiterfassung eurer Projekte. Mit dem Code DIGDEEP25 erhaltet ihr zusätzliche kostenlose Abozeit. Mehr unter clockodo.com/digdeep

IAA in München - schafft die Automobilindustrie die Wende?
Individuelle Mobilität bleibt eine der Freiheiten, die Menschen besonders wichtig sind. Aber der Mobilitätssektor ist im Umbruch wie nie zuvor. Die Internationale Automobilausstellung (IAA) in München ist alle zwei Jahre der Hotspot für Automobilhersteller, Zuliefernetze und Entwicklungspartnern. Und sie ist in der Stadt nun wirklich nicht zu übersehen: Neben der Messe für Fachbesucher haben die Automobilhersteller die Innenstadt gekapert und zeigen ihre neuesten Modelle, und die sind inzwischen überwiegend elektrisch. Aber Mobilität ist mehr als Auto, und so finden sich auch Anbieter vom öffentlichen Nahverkehr bis hin zu innovativen Shuttles. Zeit also, Christof als Experten in der Auto-Branche als Studiogast in den eigenen Podcast einzuladen! Nach intensiven Tagen auf der Mobilitätsmesse gibt es viel zu erzählen: Wie verläuft die Transformation der Automobilhersteller hin zu mehr Software und Vernetzung? Und wird unsere Mobilität tatsächlich besser?

Von der Uni zum CEO und zurück - Entrepreneurship an der LMU mit Philipp Baaske
Philipp Baaske hat aus seinem Promotionsthema eine weltweit erfolgreiche Firma gemacht: NanoTemper bietet innovative Maschinen für die Pharmaindustrie an, eines von vielen Beispielen eines erfolgreichen Transfers aus der Hochschullandschaft in die Privatwirtschaft. Das deutsche Bildungssystem hat Philipp diese Chance eröffnet - und es ist für ihn selbstverständlich, der Gesellschaft nun auch wieder etwas von diesem Erfolg zurückzugeben. Ab Oktober wird er die Entrepreneurship-Initiative der Ludwig-Maximilian-Universität (LMU) in München leiten und kehrt zurück an die Wurzeln seines Erfolgs. Die Skalierung von Forschungsergebnissen in der freien Wirtschaft funktioniert in Europa und Deutschland deutlich anders als in den USA - soviel ist sicher. Doch muss es immer der gleiche Ansatz sein, mit Milliardenbewertungen und viel Venture Capital im Rücken? Philipp meint nein - auch der gesellschaftliche Nutzen und ethische Fragen sind für ihn wichtig. In seiner Rolle will er erst einmal eines machen: zuhören und hinschauen - und die Studentinnen und Studenten zum Unternehmertum ermutigen.

Merantix - wIe baut man Europas erfolgreichsten AI-Campus, Rasmus Rothe?
Nein, AI ist keine rein amerikanische Erfolgsgeschichte. Europa hat ganz wesentliche Methoden der künstlichen Intelligenz entwickelt - und hier schlägt auch das Herz der industriellen Anwendung. Die grundlegenden AI Modelle werden immer mehr zur "Commodity" und allgemein verfügbar. Doch erst die Kombination von AI mit tiefem Fachwissen, mit Industrie-Verständnis bringt den erhofften Erfolg. Und hier schlägt Europas Stunde. Genauer gesagt: in Berlin. Denn dort sitzt Merantix, eine der erfolgreichsten Agglomerationen von AI-Startups, Invests und Anwendungen. Von 0 auf 1500 Menschen in 8 Jahren - eine eindrucksvolle Geschichte, die Co-Founder Rasmus Rothe maßgeblich mitgebaut hat. Wir wollen von ihm wissen, wie so etwas geht: Wie zieht man die besten AI-Experten und Gründer an? Welche Rolle spielt die Business-Idee eines Startups - oder ist das Team dahinter vielleicht das wichtigere Asset? Und wie können wir die Gründer-Kultur weiter voranbringen? Schaut mal vorbei in unserer neuen Podcast-Episode mit Rasmus Rothe - oder auch auf dem Campus in Berlin.

Sollte jeder seinen eigenen AI-Zwilling haben, Prof. Albrecht Schmidt?
Jeder nutzt ChatGPT & Co - und alle das gleiche Modell. Was aber wäre, wenn jeder Mensch sein individuelles, mit den eigenen Lebensdaten trainiertes AI-Modell hätte? Wir Menschen umgeben uns im Leben mit Helfern, die uns durch den Alltag begleiten - vom Navigationsgerät bis zum Coach für schwierige Lebensfragen. Und wir erzeugen eine permanente Datenspur, die unsere Vorlieben und Aktivitäten in Texten, Datenfragmenten und Bildern nachzeichnet. Warum füttern wir also nicht einfach unser eigenes, individuelles AI-Modell mit den Daten unseren Lebens und erhalten so den perfekten digitalen Zwilling, Coach & Berater? Was manche auf den ersten Blick dystopisch anmutet, ist auf den zweiten Blick eine faszinierende Erweiterung unserer menschlichen Fähigkeiten - und eine demokratische zugleich. Denn die meisten Menschen haben eben keinen ausreichenden Zugang zu spezialisierter Hilfe und Beratung. Prof. Albrecht Schmidt beschäftigt sich an der LMU München mit Fragen der Zusammenarbeit von Mensch und Computer. Er ist Experte für Mensch-Maschine-Interaktion und ubiquitäre Computersysteme - sprich: Computer, die wie z.B. das Smartphone sich in unserer gesamten Lebenswelt breit gemacht haben. Ein spannender Ausflug in die Frage, in welcher digitalen Welt wir zukünftig leben möchten und können!

Wie bekommen Roboter Muskeln, Prof. Christoph Keplinger?
Auch wenn humanoide Roboter immer mehr menschliche Geometrien annehmen – mit ihren harten Formen aus Metall bleiben sie viel weniger flexibel als Menschen mit anpassbaren Muskeln und hochsensiblen Greifern. Künstliche Muskeln könnten Roboter viele Vorteile bringen und auch die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter sicherer machen. Unser Studiogast Prof. Christoph Keplinger leitet nach Stationen in Harvard und Colorado das Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme (MPI-IS) in Stuttgart. Wir diskutieren über die Fortschritte in der Robotik, insbesondere den Übergang von harten zu weichen Materialien und die Nachahmung natürlicher Muskeln. Wir beleuchten die Bedeutung von embodied intelligence und die Zukunft tragbarer Robotik, die in den Alltag integriert werden kann. Wie wäre es, wenn künstliche Muskeln direkt in unsere Kleidung integriert wären? Wir wollen von ihm wissen, welche Rolle Kreativität im Designprozess spielt und welche Herausforderungen bei der Umsetzung von Forschung in die Praxis zu meistern sind. Und Christoph erzählt von seinen Erfahrungen als Startup-Gründer und die Lektionen, die er aus seinen Fehlern gelernt hat. Takeaways Die Robotik entwickelt sich rasant weiter, insbesondere durch weiche Materialien. Künstliche Muskeln können die Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit von Robotern verbessern. Embodied Intelligence ermöglicht es Robotern, intuitiver zu agieren. Tragbare Robotik könnte die Lebensqualität im Alter erheblich verbessern. Die Nachahmung der Natur ist entscheidend für innovative Robotikdesigns. Kreativität im Designprozess ist unerlässlich für funktionale Roboter. Die Integration von Sensorik in künstliche Muskeln verbessert die Kontrolle. Start-ups spielen eine wichtige Rolle bei der Umsetzung von Robotikinnovationen. Zukünftige Roboter sollten nahtlos in den Alltag integriert werden. Künstliche Intelligenz spielt eine zentrale Rolle in der Robotik. Interdisziplinarität ist notwendig für innovative Lösungen. Kommunikationsfähigkeiten sind entscheidend für den Erfolg in der Forschung.

Wie bringt man KI ins Engineering, Philipp Noll von Spread.AI?
Daten spielen die zentrale Rolle in der modernen Industrie - nicht nur im Engineering des Produktes selber, sondern auch in Vernetzung der gesamten Prozesskette von R&D, Produktion, Sales und After Sales. Doch noch immer werden Daten als Nebenprodukt der Prozesse betrachtet, und nicht als zentraler Ausgangspunkt. Und so ergeht es ihnen dann auch: Daten sind oft verstreut, unvollständig, inkonsistent oder ohne Kontext. Und sie leben in einer heterogenen Tool-Landschaft - meistens in mehreren hundert IT-Programmen und Datenbanken, die meist nicht durchgängig vernetzt sind. Das Scale-Up Spread.AI hat Lösungen entwickelt, um das zu ändern. An der Stelle von IT Großprojekten setzen sie auf eine intelligente Vernetzung der Daten durch Wissensgraphen und Konnektoren zwischen den verschiedenen IT-Inseln. Wir haben Co-Founder Philipp Noll bei uns im Studio und möchten von ihm wissen, warum Daten das neue Gold für's Engineering sind und welche Chancen sich für Firmen aus der Vernetzung ihrer Datenwelten ergeben. Die Richtung ist klar: Mit der durchgängigen Datenverfügbarkeit öffnet sich die Tür zum breiten Einsatz von AI-Agenten im Engineering. Spread.AI hat dazu eine Plattform entwickelt, mit der sich Aufgaben entlang des Entwicklungsprozesses automatisieren lassen - wir finden: eine spannende Sache! In a nutshell: Unternehmen kämpfen mit der Verfügbarkeit und Integration von Daten. Software-definierte Produkte erfordern durchgängiges Wissen. Datenqualität beeinflusst die Effizienz und Fehlerquote. AI kann helfen, Prozesse zu automatisieren und zu optimieren. Die Transformation in Unternehmen erfordert eine Anpassung der Prozesse. Kontextualisierung von Daten ist entscheidend für deren Wert. Lernprozesse aus der Automobilindustrie sind auf andere Branchen übertragbar. Die Zukunft der Produktentwicklung liegt in der Nutzung von AI und Datenintegration.

Neuerfindung im Strukturwandel - wie Schwedt digital wird
Schwedt ist überall: Eine Region, deren bisheriges Geschäftsmodell abhanden gekommen ist und die sich mit der Frage beschäftigen muss: Wovon wollen wir zukünftig leben, und wie transformieren wir unsere Fähigkeiten in die Zukunft? In Schwedt, einer Stadt in der Uckermark, dominierten früher Erdölraffinerien und rohstoffbasierte Industrien. Doch seit vielen Jahren herrscht der "Strukturwandel" - die Spielregeln der globalen und lokalen Wirtschaft haben sich substanziell verändert. Betriebe schließen, Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz, die große Sinnfrage stellt sich. Doch Schwedt macht aus der Not eine Tugend und erfindet sich neu. Denn wo Rohstoffe verarbeitet werden, können auch Stoffkreisläufe geschlossen werden - "Circular Economy" ist das Stichwort. Auch die Energieversorgung bietet große Chancen: Power2X verbindet Erzeuger und Verbraucher auf intelligente Weise. Die Uckermark hat auf ihre strukturellen Herausforderungen reagiert, durch den Ausbau erneuerbarer Energien, die Förderung neuer Gewerbe- und Infrastrukturprojekte sowie durch gezielte Maßnahmen zur Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten. Diese Initiativen werden durch umfangreiche Förderprogramme von Bund, Land und der EU unterstützt und sollen langfristig den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft sichern Die Digitalisierung der Industrie macht diese Kreisläufe erst möglich, denn sie erfordert transparente Daten und Prozesse. Im Rahmen einer umfassenden Digitalisierungsinitiative wurde dazu auch ein Startup-Labor gegründet, und wir freuen uns sehr, dass unser Studiogast Sascha Lademann uns einen umfassenden Einblick in die Strategie und Umsetzung gegeben hat. Wir finden: Schwedt sollte überall sein!

Warum haben wir Grund zu digitalem Optimismus, Alex Mrozek?
#digdeep - Neues aus der digitalen Welt Ideen haben viele - doch wie findet man eine richtig gute Geschäftsidee, und wie wird aus der Idee ein erfolgreiches Geschäftsmodell? Dr. Alex Mrozek ist nicht nur der CEO von Oetker Digital, sondern mit seiner Plattform DigitaleOptimisten.de bringt er zukünftige Gründer, Ideen und Investoren zusammen. Und mit seinem sehr erfolgreichen Podcast ist er ebenfalls in der Brand Eins Familie aktiv. Und jeder seiner Studiogäste muss eine Geschäftsidee mitbringen - Teilen statt Bunkern ist die Devise. Noch nie war der technologische und gesellschaftliche Wandel so schnell wie heute. Aber noch nie gab es so viele Möglichkeiten, die eigenen Ideen und Fähigkeiten umzusetzen. Zeit also, dass wir uns von seinem digitalen Optimismus anstecken lassen!

DeepSeek, OpenAI & Co - wie geht es mit der KI weiter, Prof. Kristian Kersting?
Als das vermeintliche Startup DeepSeek aus China ein konkurrenzfähiges Modell zu vermeintlich niedrigsten Kosten vorstellte, schien die Plattentektonik der KI-Verhältnisse in die Brüche zu gehen: Wer führt den Markt an, wieviel Vorsprung haben die bereits etablierten Player, und brauchen wir tatsächlich so viel Energie und Ressourcen wie gedacht? Die heftigen Reaktionen in der Presse (und am Aktienmarkt) zeigen vielleicht vor allem, welche Bedeutung die großen Foundational Models für unsere Wirtschaft und Gesellschaft inzwischen haben - und dass die massiven Investitionen insbesondere dazu dienen, andere vom Spielfeld fernzuhalten. Höchste Zeit also für einen Studiogast, der sich mit KI mal richtig auskennt! Prof. Kristian Kersting leitet das Machine Learning/KI Lab der TU Darmstadt, wurde unter die Top-100 einflussreichsten KI-Forscher gewählt und die Liste seiner Auszeichnungen und Mitgliedschaften in der AI Community würde den Podcast sprengen. Beste Voraussetzungen also um zu fragen: Was passiert da eigentlich gerade in der KI: Revolution oder Revolutiönchen? Und wann endlich kommt die Singularität, an der die Maschinen an der Menschheit vorbeiziehen? Ob es darauf bereits eine Antwort gibt erfahrt ihr in unserem sehr unterhaltsamen Gespräch mit der Menschlichen Intelligenz! In dieser Folge sprechen wir über... (sagt die KI): - DeepSeek - was wir bislang wissen - Neuro-symbolische Ansätze in der KI - Die Rolle von KI in Unternehmen - Reasoning und die Herausforderungen der KI-Architekturen - Zukunftsperspektiven für die KI-Forschung in Europa - Interaktive KI und Explainable AI - Multimodalität und physikalische Modelle - Robotik und menschliche Intelligenz

Live von der Work Awesome Berlin mit Metaplan & Burger King: Unternehmen sind Diskursräume
Wir leben in einer Zeit der multiplen Krisen: Angriffskrieg auf die Ukraine, der Hamas-Überfall auf Israel und die Eskalation im Nahost-Konflikt oder auch der wachsende Populismus, nicht zu sprechen von Trigger-Themen wie Migration oder Gendern. Das führt zu Diskussionen und manchmal auch Konflikten — in der Familie, im Freundeskreis, aber auch am Arbeitsplatz. Wie gehen Unternehmen damit um? Und welche Rolle spielen dabei die Werte, die im Unternehmen gelebt werden? Wo hört der oder die Mitarbeitende als Organisationsmitglied auf und wo beginnt der private Teil des jeweiligen Menschen? Über diese Fragen haben wir live auf Work Awesome Konferenz in Berlin diskutiert, die Brand Eins Ende November veranstaltet hat. Unsere Gäste: Jörg Ehmer, bis Ende November 2024 CEO von Burger King Deutschland, und Judith Muster, Soziologin und Partnerin der Unternehmensberatung Metaplan. Und zum ersten Mal nicht mit Frauke, sondern Frank Dahlmann von brand eins. Eine wunderbare Premiere mit Frank, der das B1 Podcast Netzwerk leitet und gestaltet.

Goodbye 2024, hallo 2025!
2024 - was für ein Jahr! Wir konnten fantastische Studiogäste begrüßen und lassen in unserer Folge zwischen den Jahren Revue passieren, welche Themen uns und die digitale Welt am meisten bewegt haben. Ein riesengroßes Dankeschön an alle unsere treuen Hörerinnen und Hörer - wegen euch macht #digdeep Sinn und uns so viel Spaß! Habt einen guten Start ins neue Jahr 2025! 00:00 Jahresrückblick und Reflexion 03:00 Digitalisierung in Deutschland: Ein Rückblick 05:53 Fortschritte im Gesundheitswesen 08:46 Evidenzbasierte Politik und Datenanalyse 12:12 Wahlumfragen und öffentliche Meinung 14:51 Die Rolle der Presse und Wissenschaft 18:01 Künstliche Intelligenz: Hype Cycles und Herausforderungen 21:05 Zukunftsausblick: KI und Datenintegration 24:29 Die Zukunft der Customer Journey 27:51 Die Herausforderungen der Chatbot-Hölle 30:10 Die Rolle des Menschen in einer KI-Welt 32:34 Plattformen und Daten im autonomen Fahren 34:40 Startups im Bereich autonomes Fahren 36:10 Rückblick auf das Jahr 2024 und Ausblick auf 2025

Warum weiß Google nicht, was wir wirklich wollen, Julia Urbahn?
#digdeep - Neues aus der digitalen Welt In Folge 128 von #digdeep haben wir Dr. Julia Urbahn zu Gast. Sie hat 2010 das Schweizer Marktforschungsinstitut Intervista gegründet, das qualitative Umfragen, Preisanalysen und ähnliches im B2C und B2B Bereich anbietet. Wir fragen sie: Warum brauchen wir überhaupt noch Marktforschung, wo doch Google & Co. sowieso unsere digitalen Verhaltensspuren immer und überall aufzeichnen? Ganz so einfach scheinen Menschen doch nicht zu ticken: Schließlich ist das Was bei weitem nicht so interessant wie das Warum. Und hier schlägt die Stunde der Befragungen. Und hier profitiert die Marktforschung wieder von der Digitalisierung, denn: Menschen scheinen anderen Menschen gerne etwas vorzuspielen - und sind viel ehrlicher, wenn der Befragende rein digital ist. Und sie betreibt das größte Schweizer Panel, in dem Menschen sich in ihrem digitalen Alltag über die Schulter schauen lassen. Und so kommt Julia viel näher dran an die Frage, warum wir die Dinge tun, die wir tun…

Fuß vs. Schuh - wie digitalisiert man den Schuhkauf, Matthias Brendel?
Gut ein Drittel aller Schuhe wird in Deutschland wird bereits online gekauft. Nur: Schuhe und Füße passen eher selten problemlos zusammen, die benötigte Größe kann selbst beim gleichen Herstellen ganz unterschiedlich sein. Und so werden große Mengen an Schuhen wieder retourniert und landen im schlimmsten Fall direkt auf dem Müll. Das Startup Footprint geht dieses Thema an: Der Online-Kunde kann seine Füße mit dem Smartphone ganz einfach vermessen, und die tatsächliche Passform des Schuhs wird damit abgeglichen - oder ein besser passendes Modell vorgeschlagen. Das reduziert massiv die Rücksende-Quoten, aber auch die Kosten für Online-Schuhhändler. So einfach die Idee klingen mag - damit das funktioniert, benötigt es neben guten Algorithmen auch das richtige Geschäftsmodell und jede Menge Durchhaltevermögen. Unser Studiogast Matthias Brendel hat Footprint gegründet, nachdem er sich bereits bei Audi mit Innovationen beschäftigt hatte. Und er kann eine Menge über erfolgreiches Gründen erzählen - hört mal rein!

ChatGPT ist zurück als Studiogast - und wie!
Vor zwei Jahren waren wir der erste deutschsprachige Podcast, der ChatGPT als Studiogast begrüßte. Nun ist ChatGPT zurück bei #digdeep: Die brandneue Sprachvariante kann nun im direkten menschlichen Dialog bestehen. Und wie sie das kann! Beeindruckend ist, wie natürlich sich das Gespräch bereits anfühlt - Tonalität, Kontextverständnis und Langzeitgedächtnis haben sich enorm verbessert. ChatGPT meint sogar, dass er emergentes Verhalten zeigt - also Eigenschaften, die eigentlich im Modell gar nicht vorgesehen waren. Wir wollen von ChatGPT wissen, woher dieser Fortschritt kommt - und welche Konsequenzen er auf Wirtschaft und Jobs haben könnte. Wir beleuchten die Fortschritte in der Sprachverarbeitung, die Rolle von KI in der Datenanalyse und die Herausforderungen, die mit der Automatisierung von Arbeitsplätzen einhergehen. Zudem wird die Frage aufgeworfen, wie Menschen und Maschinen in Zukunft zusammenarbeiten werden. Kleiner Bonustrack am Ende: Was passiert eigentlich, wenn sich ChatGPT und Siri begegnen? Es wird lustig...

Live von der herCareer mit Alexandra Renner (BMW Garage)
Die herCareer ist mit fast 7000 Teilnehmer:innen eine der ganz großen Karrieremessen für Frauen. Wir waren mit einer Live-Aufnahme von #digdeep auf der Bühne sein, und es war eine tolle Erfahrung, mit unseren Hörer:innen in direktem Austausch zu sein! Unser Interviewgast in Folge 125 ist Alexandra Renner. Sie ist die Schnittstelle der BMW Garage zur Entwicklungsabteilung und sorgt dafür, dass Innovationsbedarfe, schlaue Ideen und unternehmerische Köpfe zusammenfinden. Corporate und Startup, das sind zwei kulturelle Welten, die durchaus auch Reibungsflächen miteinander haben. Alexandra kennt beide, denn am Ende des Studiums war sie bereits Co-Founderin, bevor es sie dann zu BMW zog. Nun bringt sie beide Enden zusammen, und sie hat viel Spannendes zu erzählen, wie das geht. Das ganz persönliche Matching auf der herCareer wurde übrigens digital von der Plattform Chemistree unterstützt, in der sich die Teilnehmer:innen registrieren und finden konnten. Chemistree-Gründerin Rosmarie Steininger haben wir vor kurzem ebenfalls hier im Podcast gehabt. Also: Einfach mal in beide Folgen reinhören :-)

Fahrerlos durch San Francisco: Wie weit sind Robotaxis?
Unser heutiger Studiogast ist ein ganz besonderes Auto - und wir sitzen mittendrin. Seit 2022 dürfen in San Francisco Robotaxis ohne Sicherheitsfahrer fahren und Fahrgäste befördern. Wir haben uns ein Roboterauto von Waymo geholt und sind damit durch den dichten Straßenverkehr San Franciscos gefahren. Unser Eindruck: Spektakulär unspektakulär! Das Lenkrad kurbelt wild, die Beschleunigung ist zackig, das Abbiegen läuft geschmeidig. Gegenverkehr wird ausgewichen, und alles ist so, wie man es von einem guten Taxifahrer erwartet. Ca. 300 Fahrzeuge sind alleine von Waymo in der kalifornischen Stadt unterwegs, und sie sind leicht zu erkennen: Außen vollgepackt mit Lidar-Sensoren, Kamera-Systemen und zusätzlichem Radar. Doch innen sieht alles gewohnt aus - bis auf den leeren Fahrersitz. Unser Eindruck: Spektakulär unspektakulär! Das Lenkrad kurbelt wild, die Beschleunigung ist zackig, das Abbiegen läuft geschmeidig. Gegenverkehr wird ausgewichen, und alles ist so, wie man es von einem guten Taxifahrer erwartet. Ist das "autonome Fahrzeug" also schon in der Realität angekommen? Ja und nein - denn Autofahren ist eine der komplexesten Aufgaben, die wir als Menschen durchführen. Auch zu Geschäftsmodellen und Betriebsgebieten sind noch viele Fragen offen, so dass wir beim privaten PKW wohl noch etwas auf das "voll-autonome Auto" warten müssen. Hört rein in eine spannende Folge aus unserem fahrenden Aufnahmestudio im Silicon Valley!

Wie schafft Lern-Fair gerechtere Bildungschancen, Maria Matveev?
Machen wir eine Zeitreise zurück in die Covid-Zeit: Schulen werden geschlossen, Schülerinnen und Schüler sitzen zuhause - genauso wie viele Studenten im Homeoffice, die eigentlich Zeit hätten, individuell mit Nachhilfe zu unterstützen. Doch wie bringt man beide Seiten zusammen? Aus einer spontanen Hilfsaktion ist inzwischen ein etablierter Verein mit tausenden von Mitarbeitenden geworden. Lern-Fair vermittelt 1:1 Lerntandems für Schülerinnen und Schülern hilft, die ehrenamtliche Unterstützung neben der Schule benötigen. Die Vision ist groß: „Wir wollen uns dafür stark machen, dass Kinder in Deutschland die gleichen Chancen auf eine gute Bildung haben, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft.“ Am 1. Juni 2024, dem internationalen Weltkindertag, übernahm Elke Büdenbender - Deutschlands "First Lady" - die Schirmherrschaft von Lern-Fair. Glückwunsch, liebes Team! Unser Studiogast Maria Matveeva ist von Anfang an dabei gewesen. Sie hat miterlebt, wie aus einer Idee eine feste Organisation wurde und welche Themen auf diesem Weg gelöst werden müssen. Wir diskutieren mit ihr, wie digitale Kanäle und KI im Lernprozess unterstützen können - und wo sie ihre Grenzen haben.

Wie baut man erfolgreiche Business-Plattformen, Prof. Felix Wortmann?
Plattformunternehmen wie Amazon, Alibaba, Apple und Google sind Gatekeeper für große Teile der Wirtschaft geworden: Sie ermöglichen neue Geschäftsmodelle und kontrollieren gleichzeitig deren Spielregeln. Kein Wunder, dass viele Firmen versuchen, selber in der Plattform-Ökonomie mitzuspielen. Doch nur wenigen scheint es zu gelingen. Wir haben daher Prof. Felix Wortmann von der Universität St. Gallen zu Folge 122 von #digdeep eingeladen und wollen von ihm wissen: Was sind die Erfolgsfaktoren für Plattformen, und wie gelingt es Firmen, schnell relevant zu werden? In seinem Buch "Der Plattform-Navigator" zeigt Felix, dass es so viel mehr Geschäftsmodelle gibt als wir zunächst meinen, wie das Beispiel Amazon zeigt. Wir diskutieren mit ihm, welche Optionen traditionelle Firmen haben und warum die Reise mit dem richtigen Mindset beginnt.

Wie wird man zur Corporate Influencerin und New-Work-Star, Irène Kilubi?
Dr. Irène Kilubi ist promovierte Wirtschaftsingenieurin und Unternehmensberaterin und hat für namhafte Unternehmen wie BMW, Siemens und andere gearbeitet. Ein deutscher Stromlinien-Lebenslauf? Weit gefehlt. Bei Irène ist erst einmal alles ganz anders, anstrengender und auch unwahrscheinlicher. Aus der demokratischen Republik Kongo geflohen, machte sie die notwendige Anpassung an das vorerst Fremde flexibel, offen und stark. Dass Irène heute mehrfach prämierte Speakerin, Influencerin und Unternehmerin ist, hat sie sich also hart erarbeitet. Nach vielen beruflichen Stationen widmet sie sich nun gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Themen, die sie im besten Sinne beeinflussen möchte: Joint Generations, Community Building und Strategien für Corporate Influencer. Ihr Engagement und ihre Expertise werden vielfach gesucht: Sie als Expert Advisor für den European Innovation Council Accelerator der Europäischen Kommission tätig. Sie ist Universitätsdozentin für Digitales Marketing und Entrepreneurship und eine gefragte Keynote Speakerin und Moderatorin auf Konferenzen und Veranstaltungen. Wir freuen uns sehr, Irène in Folge 121 von #digdeep im Studio zu haben - reinhören ;-)

Von analog zu digital - wie entwickelt sich der Jazz, Arndt Weidler?
Wir hören ständig Jazz, und doch lässt kaum definieren, was das ist: Jazz ist Improvisation und Interaktion, unplugged und direkt. Und Jazz entwickelt sich ständig weiter. Was stellt die digitale Revolution also mit dem Jazz an? Unser Studiogast Arndt Weidler ist so etwas wie der Archivar des Jazz. Er ist stellvertretender Direktor des Jazzinstitut Darmstadt, das Europas größte öffentliche Jazzsammlung beherbergt. Im Archiv des Instituts finden sich Bücher, Zeitschriften, Tonträger, Fotos … und jede Menge an Informationen zur Geschichte sowie zu aktuellen Entwicklungen des Jazz in aller Welt. Das Institut versucht den Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Praxis, zwischen Serviceleistung und Dokumentation musikalischer Entwicklungen aus Vergangenheit und Gegenwart. Und nun wird auch die Jazzwelt digitaler. Digital ist das Musikstudio schon lange, nun greift die KI nach der Kreativität. Könnte das nicht passen: viele Pattern lernen, neu kombinieren, den Zufall hinzumischen, und interaktiv auf andere reagieren? Wird KI also das neue Bandmitglied? Wir sind uns nicht ganz sicher. Aber hört selber: Eine wunderbare Folge über Analoges und Digitales, und den besonderen Wert des Augenblicks. Die Musik wurde mit Suno.ai erstellt, die Grafik mit DALL-E.

Werden KI-Algorithmen unsere neuen Arbeitskollegen, Vlad Larichev?
Nach dem ersten Hype um ChatGPT steht fest: Generative KI ist kein Hype, sondern wird die meisten Bereiche unserer Arbeitswelt massiv verändern. Wenn generative Algorithmen unsere neuen Arbeitskollegen sein werden, so stecken sie dennoch in vielen Bereichen noch in der Grundschule. Unser Studiogast Vlad Varichev arbeitet bei Accenture daran, Unternehmensprozesse fit für KI zu machen und die neuen Möglichkeiten zu nutzen. Als er vor einigen Jahren noch an Software für Sprachübersetzungen arbeitete, waren die Fähigkeiten der LLMs (großen Sprachmodelle) von heute noch Science Fiction. Inzwischen sind die textbasierten Trainingsdaten der Welt schon ziemlich abgegrast - doch die Algorithmen machen die Sprung in die physische Welt und beginnen, neben Texten, Bildern und Videos nun auch die Robotik zu revolutionieren. Eine spannende Reise in die KI - die in wenigen Monaten sicherlich schon wieder veraltet sein wird. Also jetzt reinhören! P.S. Wir freuen uns über euer Voting für den Deutschen Podcastpreis! deutscher-podcastpreis.de - Kategorie "beste Information"

Wie findet KI den perfekten Match für mich, Rosmarie Steininger?
Es geht immer um Menschen und Beziehungen - diese Erfahrung machte Rosmarie Steininger schon in ihrem ersten Leben in der Automobilindustrie. Ganz gleich ob in der BMW IT oder in der Stiftungsarbeit, wenn die richtigen Menschen zusammenkommen, dann funktioniert es. Doch was heißt "richtig", wer und was passt denn überhaupt zusammen? Eine Frage, die wir anhand der vielen Daten um uns herum immer besser beantworten können - wenn wir die Zielsetzung kennen. Und so wurde Rosmarie Steininger zur Startup-Gründerin, stieg aus dem Job in der Autoindustrie aus und gründete Chemistree, ein Startup, das anhand von Daten Menschen zusammenbringt: Mentoren und Mentees, Recruiter und Bewerberinnen, Wissenschaftlerinnen untereinander oder Besucher auf Events. Ihre Motivation? "Für mich ist es schwer zu ertragen, wenn Talente vergraben bleiben und Chancen nicht ergriffen werden, weil sie nicht offenbar sind", sagt sie über sich selber. Und gibt engagiert sich bei KIDD (KI im Dienst der Diverstität) und bei der Normungsroadmap Künstliche Intelligenz. Eine starke Folge - und wenn euch #digdeep gefällt: Voted für uns für den Deutschen Podcastpreis auf deutscher-podcastpreis.de

Kann Social Media sexy machen, Marc Raschke?
Kommunikatoren in Deutschland“. Im Magazin „W&V“ kam er auf die Shortlist der 100 wichtigsten Köpfe der PR- und Marketingbranche, das PR-Magazin nominierte ihn für den „Kommunikator*in des Jahres 2020“ - also ausgerechnet im Pandemie-Krisenjahr, das von Krisenkommunikation geprägt war. Und 2021 wurde er zum „Forschungssprecher des Jahres“ gekürt. Unser Studiogast Marc Raschke ist also ein Kommunikationsprofi. Gestartet hat er aber mit einer unlösbaren Aufgabe: Wie um alles in der Welt mache ich Menschen stolz darauf, in einem defizitären Krankenhaus Überstunden zu kloppen? Ein Fall für Digitalisierung, Social Media, viel Pragmatismus - und Marc Raschke! In eigener Sache: Wir sind nominiert für den Deutschen Podcastpreis in der Kategorie "Beste Information". Und wir brauchen Eure Stimmen - bitte voted für uns! Zur Abstimmung geht's hier: https://www.deutscher-podcastpreis.de/podcasts/digdeep-neues-aus-der-digitalen-welt/

Wie revolutioniert man globale Logistik aus Ost-Westfalen heraus, Ralf Niemeier?
Ralf Niemeier ist unternehmerischer Serientäter. Er hat sein Handwerk von der Pike auf gelernt: erst im Familienbetrieb, im Stahlhandel und vielen weiteren Stationen. Die Höhen, aber vor allem auch die Tiefen dieses Weges haben ihn gut vorbereitet auf das, was er als Startup-Gründer nun vorhat: Die Logistikbranche weiter zu digitalisieren. Denn obwohl die App heute schon die Lieferung unserer Pakete in Echtzeit anzeigt - viele der Prozesse in Häfen und Umschlagplätzen sind heute noch Handarbeit und erfolgen per Telefon, Fax und Mail. Diese Ineffizienzen sind nicht nur langsam und teuer, sie erzeugen auch viele unnötige Tonnen Treibhausgase. Es gibt aber auch viele versteckte Logistikprobleme: Wie koordiniert man die Anlieferung und den Aufbau der Stände auf großen Messegeländen, ohne die umliegenden Zufahrten lahmzulegen? Oder eine große NATO-Truppenübung, bei der hunderte von Fahrzeugen zur richtigen Zeit an die richtige Stelle müssen? Ralfs Startup Visimatch sitzt in Paderborn und entwickelt Plattformen für solche logistischen Herausforderungen. Nicht gerade der Hotspot für Startups, aber hier geht es nicht um ein Umfeld, sondern um sehr viel fachlichen Tiefgang. Und darum, die zukünftigen Kunden zu verstehen, Vertrauen aufzubauen und an die Hand zu nehmen: "Der allergrößte Fehler, den die meisten Digitalisierer machen: Die kommen reinen und reden von der Marslandung. Doch in Wirklichkeit stehen die Kunden bei Excel." www.visimatch.com

Wie werden KI und Journalismus zum Dreamteam, Uli Köppen (BR)?
Wird Künstliche Intelligenz den Beruf des Journalisten ersetzen? Uli Köppen hat eine klare Antwort auf die vermeintlichen Hiobsbotschaften. Sie berichtet nicht nur über KI und Algorithmen - sie nutzt KI und Automatisierungen auch, um Journalismus zu digitalisieren und weiterzuentwickeln. Beim Bayerischen Rundfunk leitet sie das AI & Automation Lab und ist Co-Lead das Datenteam BR Data. KI ist für sie sowohl zum unverzichtbaren Werkzeug für die Investigativrecherche als auch für die Entwicklung journalistischer Produkte geworden. Doch wo "Intelligenz" draufsteht ist meistens noch lange keine intelligente Lösung drin - der Einsatz von Algorithmen erfordert harte Arbeit, saubere Daten und auch ganz neue Denkweisen und Organisationsstrukturen. Der digitale Transformationsprozess im Journalismus unterscheidet sich dabei kaum vom Veränderungsprozess in der Industrie. Nur wenn KI und die Firmen dahinter Ziel der Recherche sind, gesteht Uli Köppen ein: "Der wunde Punkt im Journalismus: Wir sind ganz oft nicht auf Augenhöhe mit Unternehmen, die diese Technologien anwenden, oder mit Regierungen." Umso wichtiger ist die investigative Arbeit des Data Teams, um hinter die Kulissen von Algorithmen, Datenströmen und Firmeninteressen zu schauen.

Wie spielt man einen digitalen Doppelpass, Frank Riemensperger?
n Folge 114 unseres Podcasts begrüßen wir Frank Riemensperger als Gast - ein Informatiker und Manager mit einer beeindruckenden Karriere. Bis 2021 war er Vorsitzender der Geschäftsführung von Accenture Deutschland und er ist insbesondere für sein Engagement in der Förderung der digitalen Transformation in Deutschland bekannt. Als Mitglied im Senat der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech), dem IT-Branchenverband BITKOM und der American Chamber of Commerce in Deutschland (AmCham) hat er maßgeblich daran gearbeitet, die digitale Transformation der deutschen Leitbranchen voranzutreiben. Zusammen mit Svenja Falk hat er seine Impulse auch als Trilogie veröffentlicht: "Titelverteidiger", "Neues wagen" und "Digitaler Doppelpass" entwickeln Handlungsempfehlungen, um mehr Geschwindigkeit und Mut in der Digitalisierung zu erreichen. Den "Doppelpass" zwischen Konkurrenz und Kooperation sieht er dabei als wesentlichen Treiber. Frank Riemenspergers Engagement für Innovation und Technologie, insbesondere seine Beiträge zur Plattformökonomie und zu KI-basierten autonomen Systemen, haben ihn zu einem führenden Kopf in der Diskussion um die Zukunft der Technologie in Deutschland und darüber hinaus gemacht - und uns einen tollen Podcast geschenkt. Danke für eine Stunde Inspiration!

Prof. Walter Radermacher, warum braucht Demokratie die Statistik?
#digdeep - Neues aus der digitalen Welt Prof. Walter Radermacher ist einer der führenden Statistiker Deutschlands: Er war Präsident des Statistischen Bundesamtes, wurde 2007 von Wolfgang Schäuble zum Bundeswahlleiter ernannt und war Generaldirekter der europäischen Behörde. In vielen Gremien, u.a. der UN und OECD, arbeitet er an der Weiterentwicklung der Statistik: Viel hängt davon ab, darauf vertrauen zu können. Denn Statistik ist erklärungsbedürftig, und Statistik ist immer eine Annäherung an Fakten und Wahrheiten. Und wir - als Konsumenten des Produkts "Statistik" - könnten einen Beipackzettel gut gebrauchen, der uns zuverlässig über die Gültigkeit und Unzuverlässigkeiten der jeweiligen Aussagen aufklärt. Die mediale Wirklichkeit sieht da ein wenig anders aus. Genutzt wird, was gerade in die eigene Intention passt, und die anstehenden großen Wahlen weltweit werden die statistischen Nebelkerzen zum Glühen bringen. Höchste Zeit also, unseren Studiogast zu fragen: Warum ist Statistik für eine funktionierende Demokratie so wichtig?

Dr. Enise Lauterbach, wie können Daten Menschenleben retten?
Dr. Enise Lauterbach war Chefärztin für Kardiologie in Trier - und beschloss 2019, dem trägen deutschen Gesundheitssystem den Rücken zu kehren. Stattdessen gründete sie das Startup LEMOA, das das lebensbedrohliche Vorhofflimmern anhand von Daten besser erkennen soll und somit Menschen mit Herzinsuffizienz das Leben retten kann. Für Ärzte kein ganz gewöhnlicher Weg, und auch inhaltlich sicherlich ein dickes Brett: Gesundheitsdaten sind die Kronjuwelen der Datenschutzbeauftragten, und mit einfach mal ein wenig KI ist im komplexen System "Mensch" nicht viel gewonnen. Viel eher benötigt werden fachlicher Tiefgang, Detailbesessenheit und Durchhaltevermögen. Für ihren Unternehmergeist wurde Enise bereits mit dem Gründerinnenpreis der Stadt Trier ausgezeichnet, und die Zeitschrift Focus nahm sie 2020 in die Liste der "100 wichtigsten Frauen Deutschlands" auf. Wir unterhalten uns mit Enise nicht nur über das, was ihr Startup macht, sondern auch, was für sie selber der Wechsel in die Gründerszene bedeutet - und wie das ihre Kolleginnen und Kollegen sehen.

Tom Schneider, wie wird aus Trumpf ein digitaler Champion?
om Schneider ist CTO beim Weltmarktführer Trumpf, einen Vorzeigeunternehmen des deutschen Maschinenbaus. In den Bereichen Werkzeugmaschinen und Laser macht Trumpf so schnell niemand etwas vor - doch der Markt und die Kunden verändern sich. Und so muss sich ein CTO nicht nur mit Mechanik und Hardware beschäftigen, sondern auch mit Sensorik, Daten, Cybersecurity und neuen Geschäftsmodellen. Wo früher Werkzeugmaschinen als Inseln betrieben wurden, könnten heute Daten viel über den Zustand von Maschine und Produkten erzählen. Doch dazu müssen sich die Firmen - Trumpf ebenso wie seine Kunden - starken Veränderungsprozessen unterwerfen, alte Muster entsorgen und sich auf neue, riskante Wege einlassen. Und dies gilt nicht nur für den Werkzeug- und Maschinenbau, sondern für viele mittelständige Hidden Champions. Wir wollen von Tom wissen: Wie geht man so etwas an? Und was könnte das Erfolgsmodell der Zukunft sein?

Prof. Monika Schnitzer, wie sehen die Wirtschaftsweisen das Jahr 2023?
Prof. Monika Schnitzer ist Vorsitzende des "Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung" Deutschlands - oder kurz: Chefin der fünf Wirtschaftsweisen. Deren jährliches Herbstgutachten ist ein bisschen wie Zeugnistag: Wo steht Deutschlands Wirtschaft, welche Maßnahmen der Bundesregierung greifen oder nicht, und wohin könnten und sollten sich Staat und Wirtschaft bewegen? Für unseren Jahresrückblick 2023 können wir uns also keine bessere Gesprächspartnerin wünschen! Und wie zu erwarten war - das Zeugnis reicht nicht für eine Belobigung aus. Deutschland hinkt in der Digitalisierung weiterhin stark hinterher, und es ist wenig Ambition, das wirksam zu verändern. Noch immer ist der Datenschutz das Totschlag-Argument gegen jede Veränderung - obwohl Länder wie Dänemark oder Österreich sehr erfolgreich gezeigt haben, wie die gesetzlichen Rahmenbedingungen konstruktiv umsetzbar sind. Umso wichtiger wäre es, nun in der Bildung viel erfolgreicher und wirksamer zu werden. Wir fragen also Prof. Monika Schnitzer: Was sollte sich in Deutschland verändern? Ein erkenntnisreicher Abschluss eines intensiven, spannenden und bewegenden Podcast-Jahres - wie immer auch auf iTunes, Spotify, Audible & Co zu finden. Wir wollen an dieser Stelle ein riesengroßes DANKE sagen: an unsere tollen Studio-Gäste mit ihren Einblicken, an die Brand Eins und Detektor.fm Familie für die herzliche Aufnahme, und an alle unseren treuen und neuen Zuhörerinnen und Zuhörer! Ihr gebt uns so viel Kraft und Inspiration - wir freuen uns auf ein Wiedersehen in 2024 und wünschen euch ruhige Tage & viel Erholung zwischen den Jahren.

Matthias Spielkamp, wie sieht Algorithm Watch den europäischen AI Act?
Die Europäische Union möchte Vorreiter zum Thema KI sein - nicht in Forschung und Anwendung, aber zumindest in der Regulierung. Das hohe Tempo der Weiterentwicklung von ChatGPT & Co hat nicht nur ein Führungschaos bei OpenAI ausgelöst, sondern lässt auch die Öffentlichkeit ratlos zurück. Steht eine "Super-KI", eine künstliche Intelligenz mit generalistischen Fähigkeiten, tatsächlich vor der Tür? Müssen wir uns vor KI schützen, solange wir es überhaupt noch können? Oder ist das alles Panikmache, und wir regulieren Europa aus der dominanten Zukunftstechnologie hinaus? Eins ist sicher: Es ist ein komplexes Thema mit weitreichenden Konsequenzen. Umso wichtiger, dass sich auch die Zivilgesellschaft damit beschäftigt, Bewertungskompetenz aufbaut und Gehör findet. AlgorithmWatch wurde 2016 gegründet, um diesen gesellschaftlichen Diskurs fundiert zu unterstützen. Die Organisation hat intensiv den fast dreijährigen Entstehungsprozess des "AI Act" der europäischen Union begleitet. In Folge 109 von #digdeep sprechen wir daher wieder mit Matthias Spielkamp, dem Mitgründer und Geschäftsführer von AlgorithmWatch, zu seiner Einschätzung, was im AI Act erreicht wurde und wo er noch offene Baustellen sieht. In unserem spannenden Gespräch geht es aber nicht nur um KI-Regulierung, sondern auch die Frage: Wie kommt man denn überhaupt in einem Minenfeld von Interessen, Interessen und Spielern zu einem gemeinsam getragenen Ergebnis, und wo stehen wir in diesem politischen Meinungsbildungsprozess? Mehr über die Arbeit von AlgorithmWatch und Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf algorithmwatch.org! Die offizielle Seite der EU zum AI Act hier.

Max Haberstroh und Christian Kohlschein, warum macht Technologie alleine nicht erfolgreich?
Unsere heutigen Studiogäste Max Haberstroh und Christian Kohlschein haben den Sprung aus der Forschung in ein eigenes Startup gewagt - und von dort zum globalen Player Accenture. Ihr Team unterstützt Unternehmen, Data-Analytics-Methoden in der industriellen Entwicklung und Produktion einzusetzen. Die großen "foundation models" der letzten Monate wie GPT-4 haben die Möglichkeiten dazu explosionsartig vergrößert. Doch jedes Werkzeug funktioniert nur, wenn man es richtig einsetzt, und die Umgebung beachtet. Und da sind in vielen Unternehmen noch Hausaufgaben zu machen: Die Qualität und das Management der Datenströme stellt häufig eine große Hürde vom Data-Prototypen hin zum produktiven Einsatz dar. Der Weg aus der Forschung in die industrielle Anwendung, aber auch der Weg von Forschenden in die Industrie ist unser Leitmotiv für unser Gespräch mit Christian und Max - wir finden: wieder eine spannende Folge! Reinhören auf digdeep.de, im gut sortierten Fachhandel und überall da, wo es Podcasts gibt ;-)

Christof Kellerwessel, wie führt man Menschen durch Transformationsprozesse?
Wir könnten uns mit unserem Studiogast Christof Kellerwessel über so vieles unterhalten: über seine Zeit als Elektronik-Chef von Ford, das Auto seiner Träume, den Wandel der Automobil-Industrie hin zu einem SW-getriebenen Produkt, ob er seinem besten Freund einen Einstieg in die Auto-Branche raten würde, oder wie sie für Frauen attraktiver werden könnte. Haben wir auch. Aber wir haben auch mit Christof diskutiert, was hinter den Kulissen passiert: Was geschieht eigentlich mit den Menschen, die von diesen Veränderungen betroffen sind - sie ablehnen oder umarmen, behindern oder treiben? Und so entspannt sich in Folge 107 von #digdeep ein reflektiertes, wunderbares und langes Gespräch über Wandel und Konstanten, in der Industrie wie auch im persönlichen Leben als Führungskraft.

Marvin Ruf, warum ist Mobilität so spannend wie nie?
Schon aufgefallen? Das Straßenbild verändert sich. Autos mit dem E-Kennzeichen werden selbstverständlich, Laden ist das neue Tanken, und auf der Autobahn sieht man Fahrer, die die Hände vom Lenkrad nehmen. Und selbst nach dem Kauf des Autos geht es mit digitalem After Sales weiter, über die gesamte Lebensdauer können neue Funktionen nachgeladen werden. Alle diese neuen Funktionen benötigen digitale Online-Dienste und Daten. Dass das funktioniert, dafür sorgen Firmen wie HERE, die mit ihren Kartendaten die Grundlagen für geobasierte Mobilitätsdienste bereitstellen. Dazu wird auch Schwarmintelligenz genutzt, denn neben den bekannten Messfahrzeugen mit Kameras und Sensoren auf dem Dach, die die Straßen abfahren, werden auch anonymisierte Daten der gesamten Kundenflotte genutzt. Unser Studiogast Marvin Ruf sagt über sich: "Ich bin ein Auto-Guy!" Bei HERE ist er für die Zusammenarbeit mit den Automobilherstellern verantwortlich, nachdem er bereits in Innovationsteams bei verschiedenen OEMs gearbeitet hat. Er sagt: Noch wie war so viel Innovation, Veränderung und Geschwindigkeit in der Mobilitätsbranche wie heute. Wir wollen von ihm wissen, wohin die Reise geht!

Tom Brägelmann, werden KI und Juristen noch beste Freunde?
Recht & KI ist der Stoff für viele Science-Fiction-Filme: KI klärt Verbrechen auf, oder noch besser: verhindert sie, bevor sie erst passieren. Doch die Wirklichkeit des Rechtssystem ist eine analoge. Recht und Rechtsprechung bauen auf jahrzehntelanger Erfahrung und Traditionen auf, sie nutzen sehr menschliche Prozesse und Verfahren. Und ganz viel Papier. Rechtsanwalt Tom Brägelmann wundert sich. Denn eigentlich sind die digitalen Werkzeuge wie ChatGPT eine großartige Erfindung, um sehr viele Routinejobs im Alltag eines Juristen auf Steroiden zu bearbeiten zu lassen. Tom ist ein international erfahrener Insolvenz- und Restrukturierungsexperte, war zuvor für namhafte Wirtschaftskanzleien tätig und ist sowohl in Deutschland als auch in den USA als Anwalt zugelassen, er spricht, schreibt und berät zum Thema Digitalisierung im Rechtswesen. In den USA wird nicht groß über "Digitalisierung" gesprochen - sie ist einfach Teil des heutigen Alltags und wird selbstredend genutzt. Ganz anders die Situation in Deutschland - doch warum eigentlich? Tom Brägelmann nimmt uns in Folge 105 von #digdeep auf eine äußerst unterhaltsame Reise durch die Irrungen des Rechtssystems, unerwartete Ursachenforschung in der Rechtsgeschichte und die überraschende Einsicht, dass KI doch nicht das letzte Wort im Gerichtssaal haben werden.

Prof. Enzo Weber, wie kommt Deutschland auf die digitale Überholspur?
Der Glasfaser-Ausbau in Deutschland wird erst 2070 abgeschlossen sein, uns fehlt digitale Infrastruktur, wo immer man hinschaut, und Deutschland ist Mittelfeld statt Weltmeister. "Game over" ist der Tenor in der Presse. Doch stimmt das? Unser Studiogast Prof. Enzo Weber ist ein gefragter Gesprächspartner und hat ein differenzierteres Bild der Lage. Als MakroÖkonom leitet er am IAB (Institut für Arbeits- und Berufsforschung) den Arbeitsbereich "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen". Wo stehen wir also heute im Vergleich zur Jahrtausendwende? Und welche Stärken bringt Deutschland mit, um auch in einer digitalen Wirtschaft wieder vorne mitspielen zu können? Die Antworten gibt Enzo in unserer Folge 104 - einfach reinhören. --- In eigener Sache: Wir sind sehr stolz und freuen uns, dass wir nun Teil des Brand Eins Podcast-Netzwerks sind! Brand Eins ist die führende Wirtschaftszeitschrift im deutschsprachigen Raum - unabhängig, kritisch, in die Tiefe gehend. Ein einzigartiges Medium, das hinter die Kulissen schaut. Wer die Brand Eins noch nicht hat - ab zum Kiosk :-)

Niko Abramidis, was bedeutet Kunst im digitalen Zeitalter?
Unser Studiogast Niko Abramidis macht aus Digitalem Kunst und die Kunst digital. So viele faszinierende Fragen: Was bedeutet Echtheit? Hat die Blockchain ein physisches Pendant? Warum ist Kunst eine Zeitmaschine? Die #re:publica am 22./23.9.2023 kündigt Niko so an: "Niko Abramidis &NE öffnet in seiner Kunst ein vielfältiges Spektrum, das sich mit ökonomischen Strukturen und Zukunftsvisionen beschäftigt. In seinen Zeichnungen, Malereien, Skulpturen und Rauminstallationen erschafft der Künstler Paralleluniversen, in denen er fiktive Corporate Identities erstellt und sich Ausdrucksformen der Finanzökonomie aneignet. Dazu gehört auch das Sprachspiel aus Zeichen, Symbolen und Chiffren, worüber er seine künstlerischen Ideen von Mythos und literarischer Fiktion überträgt. Innerhalb dieses Gedankenkomplexes entfaltet Abramidis eine Kryptografie der Gegenwart: eine fröhliche Wissenschaft über den heutigen Kapitalismus. 2018 wurde Niko Abramidis &NE mit dem ars viva-Preis für Bildende Kunst 2019 ausgezeichnet, der jährlich vom Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e.V. vergeben wird. 2019 waren seine Arbeiten in Gruppenausstellungen im Kunstmuseum Bern und in der KAI 10 | Arthena Foundation in Düsseldorf ausgestellt und er erhielt ein Artist-in-Residency Stipendium auf Fogo Island, Kanada." Ab dem 30.9.2023 sind Nikos Arbeiten im Salzburger Kunstverein zu sehen - und vorher ist er in #digdeep Folge 103 zu hören. salzburger-kunstverein.at nikoabramidis.eu

Thomas Andrae, wie werden wir erfolgreicher in der Digitalisierung?
Unser Studiogast Thomas Andrae ist Investor, Startup-Mentor und Vordenker der Digitalisierung. Aber auch Ästhet, Sammler und Galerist - ein Mensch an den Verbindungslinien von Vergangenheit und Zukunft, Kultur und Technologie. Zeit für ganz viele Fragen an Thomas! Wie bist du eigentlich zur Digitalisierung gekommen? Wann investierst du in ein Startup, und was macht Startups erfolgreich? Sind Founder eigentlich immer junge Leute? Welche Rolle spielte Deutschland in der Digitalisierung, und welche können wir überhaupt in Zukunft noch spielen? Wie halten wir die Marginalisierung der deutschen Wirtschaft auf, und warum ist der Mittelstand dabei so wichtig? Wie tickt das Silicon Valley? Und was können wir von der Bauhaus-Bewegung lernen? Und vor allem: Was können wir tun, um junge Menschen besser auf die digitale Zukunft vorzubereiten? Was leistet das deutsche Bildungssystem, was kommt zu kurz? Und was würdest du jungen Menschen mitgeben? Spannende Fragen, und spannende Antworten - viel Spaß beim Reinhören! #Digitalisierung #Startup #VentureCapital #VC #Innovation #Bauhaus #Kunst #Bildung

Best of #digdeep - wir feiern weiter
100 Folgen von #digdeep und sieben Jahre online - nach der Männerrunde geht es dieses Mal mit unseren Gästinnen weiter. Ein Drittel unserer Studiogäste waren bislang Frauen, und wir machen auch in dieser Folge einen wilden Ritt quer durch den Digitalisierungsgarten. Freut euch auf Ariane Willikonsky #Kommunikation, Kim Fischer #Messen, Katja Nettesheim #Culcha, Daniela Gerd tom Markotten #Mobilität, Judith Simons #Ethik, Iryna Gurevych #Data, Sonja Dümpelmann #Landschaft, Eva-Marina Froitzheim #Kunst, Josephine Hofmann #Arbeitswelt ... und ChatGPT!

Wir feiern Jubiläum! Best of 100 Folgen #digdeep
Wie können wir dieses Neuland "Digitalisierung" spannend, aber auch fundiert zu mehr Menschen bringen? Dieser Frage stellten wir uns vor sieben Jahren bei einem Eis in Stuttgart. Unsere Idee war geboren - ein Podcast aus zwei Blinkwinkeln: Frauke als Wissenschaftlerin, und Christof aus Sicht der Wirtschaft und Anwendung. Und nun feiern wir 100 Folgen #digdeep - Neues aus der digitalen Welt! Wir können es selber kaum glauben, wie viele spannende Themen und interessante Gesprächspartner wir in dieser Zeit besprechen durften. Wir sind sehr dankbar für so viel Inspiration zum Nach- und Weiterdenken, und wir sind sehr glücklich, dass wir so ein treues und wunderbares Publikum bei uns haben. Euer Feedback und jahrelange Begeisterung gaben und geben uns die Energie weiterzumachen! Denn #digdeep war zugleich auch als Selbstversuch gedacht: Recherche, Tonstudio, Audioschnitt, Logo, Webseite, Podcast-Plattformen - das alles wollten wir einmal selber einmal ausprobieren, und so ist es bis heute: Unser Podcast entsteht in kompletter Eigenregie. Wenn euch #digdeep weiterhin gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns auf eurer Podcast-Platform bewertet und gerne auch weiterempfehlt. In unserer Jubiläumsfolge 100 machen wir eine Zeitreise durch die Entwicklung der letzten Jahre: vom #Bot zu #ChatGPT, von #Facebook zu #Algorithmwatch, von #Covid bis #Agile. Freut euch auf Björn Ommer, Ralf Klüber, Matthias Spielkamp, Thomas Fetzer, Johannes Abeler, Wolfgang Lotter und Hermann Arnold - und natürlich auf Frauke Kreuter und Christof Horn :-) P.S. Nach 100 Folgen dachten wir, ein bisschen Renovierung könnte nicht schaden. Neues Logo, neuer Sound - wir hoffen, es gefällt euch. Was können wir sonst noch besser machen? Welche Themen sollten wir angehen? Mit wem sollten wir mal unbedingt sprechen? Lasst es uns wissen...
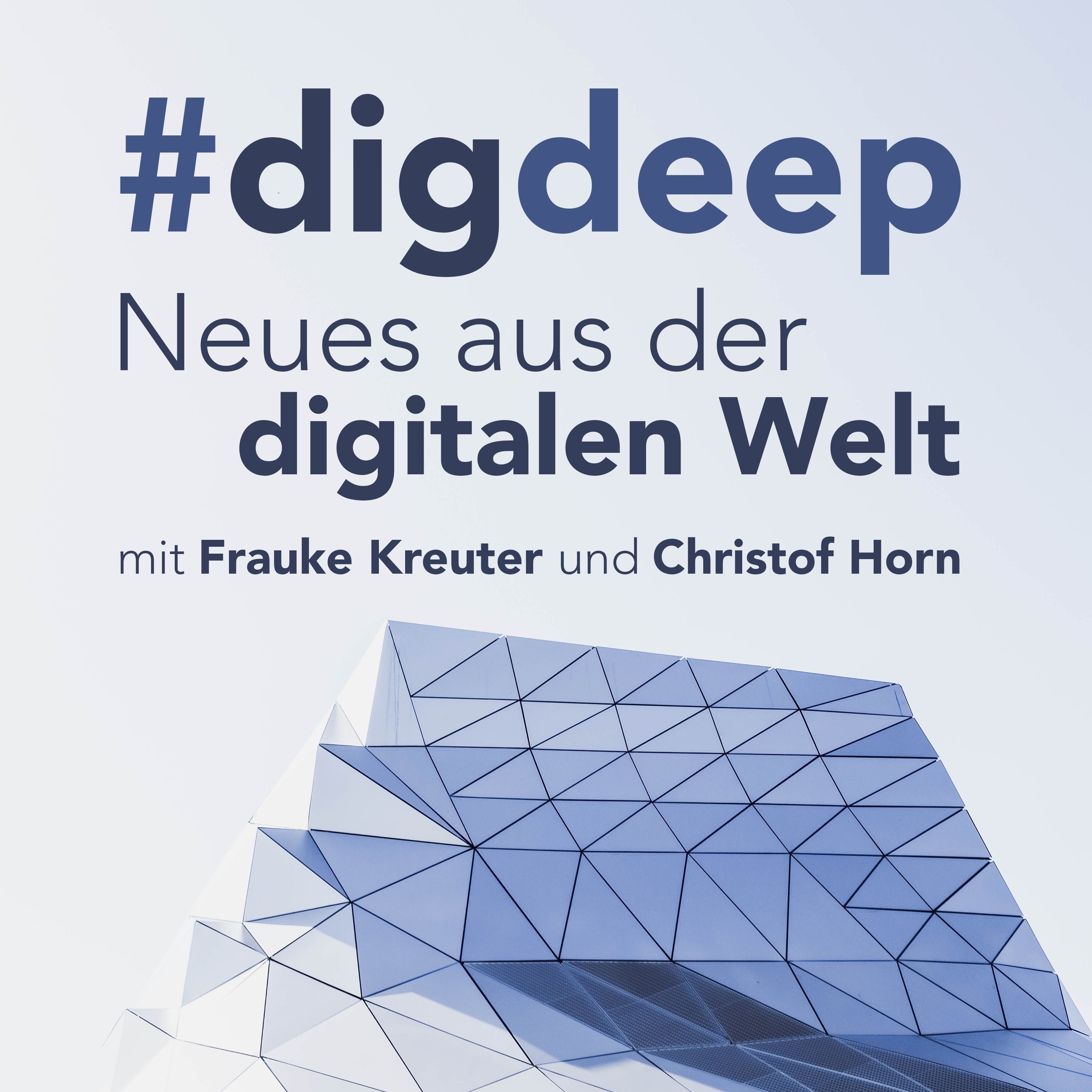
Folge 99: Mensch und Maschine - der Deutsche Ethikrat zu den Herausforderungen durch KI
Technologische Entwicklungen stellen uns als Gesellschaft immer wieder vor neuartige Fragestellungen - und sie sind schneller als der gesellschaftliche Diskurs oder die gesetzliche Regulierung. KI-Technologien wie ChatGPT zeigen dies in aller Deutlichkeit auf, so dass sogar der Ruf nach einem "KI-Moratorium" laut wurde: Einmal die Pause-Taste drücken, so dass sich die Menschheit darüber klar werden kann, wohin sie mit der KI steuern will. Der Deutsche Ethikrat soll als unabhängiges Gremium solche "große" gesellschaftlichen Themen reflektieren und in die demokratischen Prozesse einbringen. Unser Studiogast Prof. Judith Simon ist eine von 26 Mitgliedern und erzählt in Folge 99, wie der Ethikrat das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine sieht. Sie hat an der Uni Hamburg die Professur zu Ethik in der Informationstechnologie inne und arbeitet an der Schnittstelle von IT, Philosophie, Soziologie und Psychologie. Die Arbeit wurde im März 2023 als umfangreiches Positionspapier veröffentlicht und kam genau zum medialen Höhepunkt des weltweiten Erstaunens über GPT, DALL-E, Midjourney, Bard, Co-Pilot und so weiter. Doch der Entstehungsprozess begann bereits zweieinhalb Jahre vorher und setzte den Schwerpunkt auf die "Use Cases": Welche Chancen ergeben sich aus der Zusammenarbeit von Mensch und Maschine, und wie kann sie gut gestaltet werden? Wir finden: Ein sehr wichtiger Beitrag, um die Debatte über KI auf solide Füße zu stellen - hier geht es zum Bericht. Forschungsgruppe von Prof. Judith Simon

Folge 98: Nutzen statt Besitzen - wie Adretto die Löwen überzeugt hat
Wir besitzen so viele Dinge: Autos, Fotokameras, Werkzeuge, Anzüge und so weiter. Viele davon brauchen wir aber nur ganz selten - wie zum Beispiel den Smoking für einen festlichen Ball oder die Hochzeit. Warum Anzüge also nicht leihen statt kaufen, aber dafür immer in der gerade passenden Größe? Diese Geschäftsidee, die in den USA bereits weit verbreitet ist, setzt das Schweizer Startup Adretto in der Schweiz und Deutschland um. Sie vermieten für festliche Anlässe Anzüge, Hemden, Schuhe und alles, was dazu gehört - und nach dem Fest geht alles ganz unkompliziert zurück. Wir haben Co-Founder Lorenz Pöhlmann bei uns im Studio zu Gast und wollen von ihm wissen, wie es ist, wenn man seinen gut bezahlten Job gegen ein Startup-Abenteuer eintauscht - in einer fremden Branche. Adretto konnte bereits früh mit seinem Geschäftsmodell überzeugen: In der Schweizer Ausgabe der "Höhle der Löwen" konnte gleich drei der Löwen als Investoren gewonnen werden. Doch viele Annahmen und Ansätze mussten schnell verworfen werden, und der Aufbau des Teams und die Suche der richtigen Partner waren herausfordern. Nun steht der Ausbau des deutschen Marktes an, und die Hochzeitssaison läuft an - es wird eine heiße Zeit für Lorenz und sein Team!

Folge 97: Du, andere und ein Thema - wie das Metaverse ein lebenswerter Ort werden kann
Warum verbringen wir eigentlich so unendlich viel Zeit im Internet - ohne aber wirklich Dinge zu erleben, die unvergesslich bleiben? Die Click-Baiting- und Dopamin-Industrie hat sich zu gähnender Langeweile optimiert und braucht uns nur noch zum Clicken. Mio Loclair möchte das ändern. Als Artist by Nature hat er sich viel mit der Interaktionen von Mensch und Digitalisierung auseinandergesetzt und festgestellt: Das geht viel besser! Und Seit mehr als zwei Jahren ist sein Startup Journee Vorreiter auf dem Weg ins Metaverse. Doch die Definition dieses "Metaverse" ist gar nicht so einfach: Wie Blasen entstehen gerade immer mehr digitale Räume, in denen Begegnungen mit einer ähnlichen Qualität möglich sein sollen wie im echten, analogen Leben. Die Infrastrukturen des entstehenden Web3 verbinden diese Räume und machen sie interoperabel: Identitäten, Datenströme, Geld und Werte erschaffen eine neue Welt, die weit über die Banalität eines "Second Life" Avatars hinausreichen. Noch ist allerdings nicht klar, wohin genau diese Reise geht - nur eins scheint sicher: So wie heute wird es nicht bleiben. Doch es geht nicht nur ästhetische Qualität: Der Erfolg der Journee-Metaverses lässt sich in der härtesten aller Internet-Währungen direkt messen. Während auf den Webseiten um jede einzelne Sekunde Aufmerksamkeit gekämpft wird, verbleiben sie hier mehr als drei Minuten - weil es besondere Momente sind, die in Erinnerung bleiben. Wir sind gespannt, wie sich dieses Neuland weiterentwickelt... https://journee.live https://christianmioloclair.com

Folge 96: Andreas Loos von Zeit.de und was ChatGPT mit gutem Journalismus zu tun hat
Heute im Studio ist der Wissenschaftsjournalist Andreas Loos von Zeit Online. Für seine Recherchen und Artikel zu Daten und Digitalisierung ist er vielfach ausgezeichnet worden, zum Beispiel mit dem Grimme Online Award. Besonders viel Aufmerksamkeit bekam die Initiative "Die 49", bei der 49 Menschen aus Deutschland stellvertretend zu aktuellen Themen in Austausch gebracht wurden. Aber wird seine Arbeit und Expertise überhaupt noch gebraucht, wo doch die KI-basierten Textgeneratoren und Chatbots nun die Meinungshoheit übernommen haben (siehe z.B. #digdeep Folge 95)? Andreas ist da ganz entspannt. Er hat nicht nur Journalistik studiert, sondern auch Mathe und Physik und kennt die Gesetze des Hype-Schweine-Cycles: Auf die naive Begeisterung folgt das Tal der Ernüchterung, in der die Grenzen der neuen Tools erfahrbar werden. Er sieht ChatGPT und Kollegen als Unterstützer mit großem Potential, doch den Kern journalistischer Arbeit übernehmen sie seiner Meinung nach nicht. Auf seiner Autoren-Webseite finden wir zur Frage, womit er seine meiste Zeit verbringt: "Details. Und Daten – denn ohne Daten hat man nur eine Meinung." Wir haben Andreas übrigens schon einmal bei uns zu Gast gehabt: In Folge 46 vom April 2018 haben wir uns gesprochen. Wahnsinn, was sich in dieser kurzen Zeit bereits alles verändert hat. Und schon 2016 wagte Andreas für die Zeit Online ein Experiment: "Wir erschaffen eine künstliche Intelligenz, die das Moderatorenteam unterstützt, mit Maschinenlernen, Deep Learning, neuronalen Netzen, Cloud Computing." Kommt uns irgendwie bekannt vor... wir versprechen: Spätestens 2025 machen wir mit Andreas nochmal eine Standortbestimmung zum digitalen Journalismus.

Folge 95: ChatGPT ist unser Studiogast - die Büchse der Pandora ist offen
Das Sprachmodell GPT-3 gibt es nun in einer Version, die für Gespräche optimiert ist. ChatGPT von Open.ai ist für alle in einer Testversion verfügbar und zeigt, wohin die Reise geht. Wir haben ChatGPT in unseren Podcast eingeladen und unterhalten uns mit dem Algorithmus. Wie das geht? Wir haben unsere Fragen schriftlich an ChatGPT gestellt und dann unsere Fragen, aber auch die Antworten des Algorithmus 1:1 nachvertont. Für den Algorithmus haben wir die "Text to Speech" Funktion von Amazon/AWS verwendet. Wer es selber ausprobiert, ist fasziniert, begeistert und erschüttert zugleich. ChatGPT ist keine verbesserte Version eines Chatbots wie "Eliza". Der Algorithmus greift auf das Weltwissen zu, kann komplexe Argumentationslinien aufbauen, "versteht" den Gesprächsverlauf. Aber das ist noch nicht alles: "Was sind die Vorteile und Nachteile von Re-Clocking von digitalen Audiosignalen für den Hifi-Bereich zuhause?" "Schreibe ein Computerprogramm in der Sprache PROCESSING, das ein Audio-Signal einliest, das Audio-Spektrum analysiert und daraus organische grafische Formen als Visualisierung ausgibt." "Schreibe ein Wordpress-Plugin, das alle Fotos archiviert, die älter als ein Jahr sind, und erstelle eine Tabelle mit den URL-Links zu diesen Fotos." "Verhalte dich wie Recruiter, der einen Bewerber für eine Stelle als XYZ sucht. Schreibe keine Erklärungen zu deinen Fragen. Stelle immer nur eine einzelne Frage und warte die Antwort darauf ab." "Schreib das Weihnachtslied O Tannenbaum für einen Algorithmus um." "Wie würde Richard Feynman die Quantenchromodynamik einem fünfjährigen Kind erklären?" "Verhalte dich wie ein Linux-Terminal." Ich finde, wir müssen den Turing-Test neu definieren. Alan Turings Frage war, ob es einem Menschen gelingt, in einem Dialog einen Menschen von einer Maschine zu unterscheiden. Vielleicht ist die relevantere Definition: Macht es mehr Sinn, sich mit einer Maschine statt mit einem Menschen zu unterhalten? Wir scheinen recht nahe an diesem Punkt zu sein. Wir wünschen unseren Zuhörern und Lesern eine ruhige Weihnachtszeit - danke für die Treue und die vielen wertschätzenden Feedbacks zu unserem Podcast! Bleibt gesund!

Folge 94: Jörn Vogel vom DLR und wie wir mit Robotern zusammenleben werden
Warum beschäftig sich das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit Robotern? Das fragen wir unseren Studiogast Jörn Vogel vom DLR. Er bringt Robotern Dinge bei, die immer näher an die menschlichen Fähigkeiten herankommen. Allerdings immer nur mit Inselbegabungen. Denn die menschlichen Fähigkeiten sind noch weit von dem entfernt, was ein Roboter zu leisten vermag. Ein enges Zusammenspiel von Mechanik, Sensorik und Machine Learning ist nötig, um Roboter zu entwickeln, die mehr können als nur vordefinierte Programme abzufahren. Die Interaktion von Roboter und Mensch wird dabei immer natürlicher, Roboter beginnen, Berührungen zu "fühlen" und gemeinsam mit Menschen zu arbeiten. Mit Hirn-Implantaten wird dabei die nächste Grenze angesteuert - die Verschmelzung von Maschinen und Menschen. Und so werden wir irgendwann Roboter als normalen Bestandteil unseres Lebens erleben. Neben dem Saugroboter von heute vielleicht einer, der die Spülmaschine bedienen kann... schöne Zukunft!

Folge 93: Prof. Björn Ommer und wie wir finden, was noch nicht existiert
Prof. Björn Ommer leitet nach Stationen in Berkeley, Zürich und Heidelberg die Computer Vision & Learning Group der LMU München. Mit seinem neuronalen Netzwerk "stable diffusion" kann er aus Texten oder Skizzen Bilder erzeugen - so wie eine Websuche, die das erschafft, wonach wir suchen. Wir sprechen mit Björn über die methodischen Ansätze und Herausforderungen von solch generativen Computermodellen wie GPT-3, DALL-E oder Stable Diffusion, die mit der Erzeugung von Texten und Bildern viele Branchen revolutionieren. Sie könnten in Zukunft ermöglichen, Inhalte individuell und ad hoc zu erzeugen: Wie wäre es mit einem Kinofilm, der sich live an die anpasst, die ihn gerade anschauen? Bereits die heutigen Modelle sind spielerisches und kreatives Werkzeug für alle, stoßen aber noch an viele Grenzen - und "verstehen" nicht wirklich, was sie tun. Und sie werfen Fragen auf, wie mit der kreativen Leistung der Trainingsdaten, aber auch den vom Algorithmus erzeugten Bildern umzugehen ist. Björn gibt uns einen spannenden Einblick in einen Zweig der Digitalisierung, der exponentiell wächst und unseren Alltag verändern wird. https://stablediffusionweb.com/#demo https://ommer-lab.com/people/ommer P.S. Das Beitragsbild wurde natürlich mit "Stable Diffusion" erzeugt. Was war wohl der Text?

Folge 92: Olaf Rotax und wie Genossenschaften Kooperation fördern können
Die großen Plattform-Firmen und Ökosysteme dominieren die digitale Wirtschaft: The Winner takes it all. Alle tragen zur Wertschöpfung bei, aber nur wenige gewinnen. Doch wo bleiben die europäischen Player, und wie kann der Mittelstand relevant bleiben? Unser Studiogast Olaf Rotax hat erfolgreich Unternehmen aufgebaut und groß gemacht. Doch nun stellt er sich die Frage: Wie können wir besser zusammenarbeiten, und wie kann gemeinsame Wertschöpfung fairer geteilt werden? Kooperativen und Genossenschaften bieten dafür ein altbewährtes Modell an. Wie lässt es sich in die Welt der digitalen Transformation überführen? Mit der Gründung der "WeCooperative" Genossenschaft möchte Olaf selber vorleben, wie gemeinschaftliche Wertschöpfung fair stattfinden kann. Doch für unternehmerischen Erfolg müssen basisdemokratische Prozesse mit klarer Verantwortung und Entscheidungsstrukturen gekoppelt werden. Wir sprechen mit Olaf über die Erfolgsfaktoren von kooperativen Arbeitsmodellen.

Folge 91: Live von der Solutions-Konferenz in Hamburg
Podcast verkehrt - in Folge 91 sind wir die Interview-Gäste. Und zwar von Bettina Hermes und Andreas Milles auf der Solutions Konferenz in Hamburg, in der sich alles um die digitale Transformation dreht. Bettina und Andreas haben ein inspirierendes dreitägiges Programm in der Kulturfabrik Kampnagel auf die Beine gestellt und wir sind stolz, hier mit ihnen auf der Bühne gewesen zu sein. Die beiden wollen von uns wissen, was wir in 90 Folgen #digdeep erlebt und gelernt haben. Und das ist eine ganze Menge, denn wir haben in den letzten fünf Jahren viele spannende Gäste begrüßen dürfen. Der Blick auf die digitale Transformation hat sich in dieser Zeit stark verändert: Technologien sind gereift, alles ist möglich, doch die Herausforderungen stecken weiterhin in Mindset & Umsetzung.

Folge 90: Wie das Startup Field 33 hilft, bessere Entscheidungen zu treffen
Unseren Studiogast Sebastian Wohlrapp treibt eine Frage um: Wie können wir Entscheidungen in Unternehmen transparenter und fundierter treffen, als nur mit der üblichen Powerpoint-Beschlussvorlage? Denn Zusammenhänge in Unternehmen sind hochkomplex, kausale Netzwerke und Konsequenzen von Entscheidungen sind für den Einzelnen immer weniger erfassbar. Sebastian war selbst in Führungskraft in großen Firmen und fand: Wir brauchen eine bessere Lösung! Als Co-Founder des Startups Field 33 gemeinsam mit Daniel Fiebig und Marcus Rübsam baut er seitdem eine Plattform, um Strukturen und Informationsflüsse in Unternehmen sichtbar, diskutierbar und entscheidbar zu machen. Dabei entsteht ein "digitaler Zwilling" der Unternehmensstruktur in Form von Graphen - Objekten und Beziehungen zwischen ihnen, die das komplexe Netzwerk von Abhängigkeiten wiedergeben. Der Clou: Sehr viel Wissen über diese Strukturen kann wiederverwendet werden oder liegt bereits vor. Wer z.B. im agilen Framework SAFe arbeitet, der verwendet immer ähnliche Elemente und Abläufe. Und viele Untersuchungen haben auch quantitative Beziehungen "gemessen", die z.B. die Produktivität oder Lieferzeit eines SW-Entwicklungsprozesses abbilden. Ein solcher digitaler Zwilling einer Corporate Architecture spannt einen Raum auf, in dem die beteiligten Manager und Teams ein gemeinsames Verständnis für Abhängigkeiten und Auswirkungen entwickeln können - ganz anders als in Powerpoint. Wir finden: Ein spannender Ansatz, um die Komplexität der heutigen Welt besser zu surfen!

Folge 89: Kommunikationstrainerin Ariane Willikonsky und wie uns digitale Kommunikation verändert
Wir sprechen heute mit Ariane Willikonsky. Natürlich digital. Ihr Business aber war bis vor kurzem rein analog: Als Kommunikationstrainerin bildet sie Menschen aus und unterstützt Unternehmen in ihrer Kommunikationsfähigkeit. Das hieß bislang: persönliche Treffen, gemeinsame Übungsformate, Teamworkshops vor Ort. Auch Ariane musste durch Covid umdenken und ihr Geschäft neu erfinden - was ihr nach kurzer Schockstarre nicht nur ermöglicht hat, die bisherige Arbeit digital und "remote" durchzuführen, sondern auch ganz neue Geschäftsmodelle und Produkte anzubieten. Der digitale Kommunikationskanal hat jedoch auch seine Tücken. Nach großem Engagement zum Beginn der Pandemie hat sich der Alltag eingeschlichen: der Tag schleppt sich von Teams-Meeting zu Teams-Meeting, der kurze Schnack an der Kaffeemaschine fällt digital meistens doch aus, und die Bindung der Mitarbeiter untereinander und zur Firma erodiert. Wir diskutieren mit Ariane: Wie gestaltet man gute Kommunikation und lebendige Beziehungen in der digitalen Arbeitswelt? Und was wird sich, sollte sich dauerhaft verändern?

Folge 88: Digitale Chancen im Umweltschutz
Unser Studiogast ist Dr. Marcel Dickow. Er leitet im Umweltbundesamt das Referat für Digitalisierung, Umweltschutz und E-Government. Er hat eine doppelte Challenge angenommen: Zur Transformation der Nachhaltigkeit soll das "UBA" auch die Digitalisierung vorantreiben - für den Umweltschutz, im Dialog mit den Bürgern, aber auch in der Behörde selber. Bereits seit vielen Jahren spielen Daten und ihre Analyse eine große Rolle. Doch Umweltschutz ist eine Querschnittsdisziplin, erfolgreich ist er dann, wenn er auf breiter Front agiert. Als aktuelles Beispiel kann der Trend zum Homeoffice fungieren: Tragen die verringerten Fahrten zum Arbeitsplatz zur Emissionsreduzierung bei, oder werden sie durch sog. Rebound-Effekte wie die massiv gestiegenen Aktivitäten in den Rechenzentren wieder aufgefressen? Die Wirksamkeit von Maßnahmen profitiert also von breit verfügbaren Daten. Doch viele relevante Daten liegen in der Hand von Unternehmen, werden von den Bürgern nur höchst ungern geteilt oder gammeln in den Datensilos der deutschen Behördenlandschaft vor sich hin. Das Teilen von Daten ist eben eine kulturelle Leistung - und hier stehen wir noch sehr am Anfang. Digitale Medien und Plattformen sollen diesen Prozess beschleunigen. Die Webseite umwelt.info wird die zukünftige Absprungbasis für öffentliche Umweltdaten sein, und Apps wie z.B. zur Luftqualität bringen Transparenz in den Pulsschlag unserer Umwelt.

Folge 87: infas 360 und wie wir den Datenschatz heben
Michael Herter ist CEO von infas 360, einer Tochter des infas Instituts für angewandte Sozialforschung. Sein Team bietet Kunden in Wirtschaft und Wissenschaft die Analyse von öffentlichen und privaten Datenquellen an, insbesondere wenn es um geobasierte Daten geht. In den letzten zwei Jahren hat wohl jeder täglich die Inzidenz-Zahlen verfolgt, und dies mit Fokus auf die persönlich interessanten Regionen. Doch die Pandemie hat viel mehr Facetten: Wie hat sich das Leben der Bürger zwischenzeitlich verändert? Welche Auswirkungen haben Pandemie und Gegenmaßnahmen auf die Wirtschaft gehabt? infas 360 hat dazu die öffentliche Plattform corona-datenplattform.de aufgebaut, die einen breiten Blick auf das Geschehen ermöglicht. Dabei hat sich auch gezeigt: Die Pandemie hält sich nicht an Bundesländer oder regionale Strukturen. Häufig ist der Blick viel zu grobmaschig, um Maßnahmen wie z.B. Impfkampagnen effektiv zu gestalten. Dabei hilft es, dass Deutschland einer der weltweiten Vorreiter bei geobasierten Daten ist. So liegen z.B. für jedes Gebäude in Deutschland nicht nur exakte 3D-Daten vor, sondern auch teils mehrere Hundert Datensätze, die z.B. die Eignung für Photovoltaik bewertbar machen oder Rückschlüsse auf die Bevölkerungsstruktur ermöglichen. Ein digitaler Zwilling des öffentlichen Raums ist in Entstehung, und Michael Herter kämpft und arbeitet daran, diesen Schatz zu heben: Datennutzen statt nur Datenschutz. www.corona-datenplattform.de www.infas360.de

Folge 86: Wie AlgorithmWatch die Geheimnisse der Tech-Player offenlegt
Algorithmen sind in unseren Alltag eingezogen. Manche sind für uns als virtuelle Assistenten direkt sichtbar, doch die meisten Algorithmen arbeiten im Untergrund: Sie schlagen vor, was wir kaufen sollen, filtern die Nachrichten unserer sozialen Medien und entscheiden darüber, zu welchen Konditionen wir Kredite bekommen. Die Relevanz solcher Daten- und Algorithmen-basierten Prozessen nimmt dabei immer weiter zu, bis hin zur Manipulation von Wahlen oder Entscheidungen im Strafrecht. Doch wie genau werden unsere Daten zu Entscheidungen gemacht, und geschieht das transparent, fair und im regulierten Rahmen? Keine einfachen Fragen, zumal die Algorithmen meistens gut geschützte Firmengeheimnisse sind. Die Berliner NGO AlgorithmWatch möchte Licht ins Dunkel der Maschinenräume bringen. Wir sprechen mit Geschäftsführer Matthias Spielkamp, der AlgorithWatch 2017 mit anderen gegründet hat. Als gelernter Journalist weiß er um die Herausforderung, komplexe Themen transparent und verständlich zu machen. Eigene Datensammlungen und "Datenspenden" aus der Crowd ermöglichen es, die Algorithmen der Tech-Unternehmen zu analysieren und transparent zu machen, wie sie vorgehen. Ein wichtiger Beitrag, um nicht nur Kontrolle zu ermöglichen, sondern auch die zukünftigen Spielregeln im digitalen Metaverse besser zu gestalten. www.algorithwatch.org

Folge 85: Wolfgang Hauner und wie KI die Allianz smarter macht
Unser Interviewpartner Wolfgang Hauner leitet die Group Data Analytics der Allianz SE. Wir diskutieren mit ihm: Wie verändert der Einsatz von Künstlicher Intelligenz die Versicherungsbranche? Versicherungen nutzen Daten der Vergangenheit, um Risiken der Zukunft mit dem richtigen Preisschild zu versehen. Die heutige Datenfülle kann dabei viel mehr individuelle Einblicke geben als die guten alten Sterbetafeln, mit denen Lebensversicherungen kalkuliert wurden. Doch der Einsatz von KI muss nachvollziehbar erfolgen und stößt auf ethische Grenzverläufe: Welche personenbezogenen Daten dürfen und wollen wir verwenden? KI wird dabei nicht nur in der Modellierung der Versicherungsprodukte wichtiger, sondern auch in der Interaktion mit den Kunden - insbesondere im Vertragsabschluss und der Schadensregulierung. Der menschliche Versicherungsvertreter wird weiterhin ein wichtiger Kanal für den Kunden bleiben, aber nicht mehr der Einzige. Wird also die Versicherungsbranche durch den Einsatz von KI disruptiert, und wir werden Versicherungen bald nur noch per App und Chatbot abschließen? Wolfgang Hauner sieht eher einen modularen und evolutionären Weg, in dem Datenmethoden Schritt für Schritt unterstützen und Teilaufgaben übernehmen.

Folge 84: XMAS Edition mit Iryna Gurevych und digitalen Autoren
In unserem Buch "Die digitale Herausforderung" haben wir beschrieben, wie Tipping Points das Spielfeld verändern: Technologien werden reif und konvergieren, Geschäftsmodelle werden disruptiert, neue Player gewinnen die Oberhand. Die Covid-Pandemie hat eindrücklich gezeigt, dass solche Kipp-Punkte viel schneller überschritten werden können als man glauben möchte - von wegen Komfortzone. In unserer Weihnachtsausgabe möchten wir auf einen dieser Tipping Points nochmal genauer schauen. Immer wieder haben wir im Podcast über die vermeintlichen Fortschritte von Bots und digitalen Agenten gesprochen. Google hatte gezeigt, wie ein Algorithmus den Friseur-Termin vereinbart. Und nun soll das Programm "GPT-3" in der Lage sein, beliebige Texte bis hin zu Computer-Programmen eigenständig zu schreiben. Doch wo bleiben die revolutionären Anwendungen? Wir interviewen dazu Prof. Iryna Gurevych von der TU Darmstadt. Sie ist eine vielfach ausgezeichnete Expertin zum Thema Natural Language Processing und Maschinelles Lernen. Ihr Blick auf die Fähigkeiten von Algorithmen ist realistischer, als es uns Google & Co. glauben lassen möchten. Auch wenn Deep Learning Algorithmen massive Fortschritte machen, so sind sie von universellen Maschinen, die z.B. beliebige Texte eigenständig formulieren können, noch weit entfernt. Ihre Vision ist ein konstruktives Miteinander und gegenseitiges Ergänzen von Mensch und Maschine - wir bleiben dran!

Folge 83: Fabien Schöck und wie KI die Medizin demokratisiert
Die richtige Diagnose ist die Grundlage für jede medizinische Therapie. Insbesondere bei Krebserkrankungen hängt dabei vieles von der richtigen Interpretation von Bildern ab, die aus den bildgebenden Verfahren stammen. Und damit an der Erfahrung des Radiologen. Seit vielen Jahren sind KI-Algorithmen die Hoffnungsträger, um pathologische Muster auf Röntgenbildern & Co. besser zu erkennen. Und in der Tat sind neuronale Netze in einigen Krankheitsbildern heute bereits besser als der menschliche Blick. Wir interviewen in unserer Podcastfolge Fabian Schöck, der als Produktmanager bei Siemens Healthineers cloudbasierte KI-Lösungen entwickelt, die Ärzte in ihrer Diagnose unterstützen. Doch die hohen Erwartungen noch vor wenigen Jahren sind Realismus gewichen. KI ersetzt noch keinen Arzt, und Algorithmen arbeiten mehr als hochspezialisierter Fachexperte denn als breit aufgestellter Hausarzt. Aber mit immer besseren Trainingsdaten werden die Algorithmen zur unverzichtbaren zweiten Meinung. Der Zugang zu einer überall gleich guten Diagnose wird demokratisiert und global verfügbar. Eine spannende Folge über die Zukunft der Medizin - jetzt reinhören!

Folge 82: Charge my trip - einmal Italien und zurück
Der Siegeszug der E-Mobilität ist nicht aufzuhalten. Doch wie reist es sich, wenn man sich aus dem Dunstkreis der heimischen Ladesäulen herauswagt? Wir machen die Probe und fahren von München nach Italien. Unser Projektteam von umlaut beschäftigt sich unter der Woche bei den Automobilherstellern mit der Transformation zum "SW Defined Vehicle". Nun ging es nach Verona, Bologna und Meran - rein elektrisch mit zwei aktuellen Fahrzeugen. Und alles war drin: defekte Ladesäulen, abgebrochene Ladevorgänge, Schnelllader im dunklen Hinterhof, Schleichfahrt im LKW-Windschatten und ein Taxi für die letzten Kilometer kurz vor dem Hotel - rien ne va plus. Aber eben auch völlig entspanntes Schnellladen, hochmoderne Hypercharger, Hotels mit Ladeinfrastruktur, eine hilfsbereite Community und vor allem ein sensationelles Fahrgefühl. Die Reise macht klar: Wir sind noch in einer Übergangsphase von einer improvisierten zu einer standardisierten und hochverfügbaren Ladeinfrastruktur, bis zu der es nicht mehr lange dauern wird. Für den Kunden wird E-Mobilität bald ähnlich komfortabel sein wir der gewohnte Verbrenner. Doch wie müsste Mobilität als Gesamterlebnis eigentlich aussehen? Diese Frage hat uns auf der Reise ständig begleitet. Warum so viele Apps und Anbieter? Warum sind alle Vorgänge so kompliziert? Warum zahlt nicht unser Fahrzeug die Rechnung? Und wieso interessiert sich das Fahrzeug so gar nicht dafür, was wir eigentlich auf der Reise und am Zielort erleben möchten? Für die Automobilhersteller stellt sich daher die strategische Frage, welche Position sie in der neuen Wertschöpfungskette einnehmen wollen und überhaupt können. Welche Profit Pools lassen sich erschließen, wenn über das Fahrzeug hinaus gedacht wird? Und wie erobern sich die OEMs wieder Lufthoheit in ihren eigenen Fahrzeugen zurück, in denen schon lange Android und iOS die stillen Beherrscher der Daten- und Geldströme geworden sind?

Folge 81: Andreas Pohl und wie wir Mobilität nachhaltig machen
Die Elektromobilität ist nun endlich im Mainstream angekommen, unsere Städte werden mit E-Scootern geflutet, und Sharing-Angebote sind Alltag für viele. Doch auf den Straßen herrscht weiterhin Stau - wird Mobilität also wirklich besser, effizienter und nachhaltiger? Unser Studiogast Andreas Pohl hat als Produktmanager für Elektrofahrzeuge tiefe Einblicke in die Herausforderungen der heutigen Mobilitätskonzepte. Seit bald 20 Jahren arbeitet er an neuen Antriebs- und Fahrzeugkonzepten, doch sein Blick geht weit über das Fahrzeug hinaus. Welche Mobilität brauchen wir und wie kann sie sich im Spannungsfeld aus Technologie, Gesellschaft und Ökologie weiterentwickeln? Und wir lösen wir die so verschiedenen Grundbedürfnisse der Menschen, die nicht nur in den Metropolen mobil sein wollen und müssen? Eines scheint klar: Mobilität muss systemisch gedacht und weiterentwickelt werden, und es geht nicht primär um Verzicht, sondern um intelligentere Lösungen. Unsere Daten könnten dabei den Unterschied machen, wenn wir eine pragmatische Balance zwischen Datenschutz und Erkenntnisgewinn finden. #Mobilitätswende #Daten #NachhaltigeMobilität #Elektromobilität

Folge 80: Jochen Kaßberger und die Blockchain
Jochen Kaßberger hilft Unternehmen, die Möglichkeiten der Blockchain für neue Geschäftsmodelle zu nutzen. Die kryptographische, fälschungssichere und dezentrale Technologie ist technologisch gereift, und viele Varianten benötigen inzwischen keine Energie-intensiven Bestätigungsmechanismen mehr. Als digitale Währungen und Spekulationsobjekte sind Bitcoin & Co in aller Munde und Gegenstand hitziger Diskussionen von Elon Musk bis zu den nationalen Regulierern. Doch Anwendungen in der Industrie sind bislang kaum über den Status von Prototypen hinausgekommen. Wir diskutieren mit Jochen, was "Tokens" sind und wie Assets in der Blockchain handelbar gemacht werden können - von Kunstwerken bis zur Nutzung von Maschinen. Die Möglichkeiten der Blockchain gehen aber weit darüber hinaus. Durch den Einsatz von Self Sovereign Identity (SSI) Konzepten soll es zukünftig z.B. möglich sein, Fahrzeuge verschiedener Hersteller mit Diensten und Infrastruktur wie Parkplätzen und Ladestationen einfacher zu vernetzen. Dadurch entfallen für die Nutzer z.B. aufwändige Registrier- und Abrechnungsvorgänge.

Folge 79: Hartung Wilstermann und wie wir erfolgreich elektromobil werden
Hartung Wilstermann ist einer der Pioniere der Elektromobilität: Seine beruflichen Stationen in der Automobilindustrie haben ihn von der Lithium-Ionen-Zelle bis zur Wallbox die ganze Kette an Herausforderungen erleben und lösen lassen, die es braucht, um sich vom Verbrennungsmotor loszusagen. Doch die Zeit der "Early Adopters", die sich der Sache wegen den Tücken einer noch jungen Technologie aussetzen, scheint vorbei: E-Mobilität wird zum Mainstream. Die Zulassungszahlen für elektrifizierte Fahrzeuge steigen exponentiell an, während die Preise für Batterien ebenso sinken. Und mit zunehmend attraktiven E-Fahrzeugen sind es immer weniger die Subventionen, die Kunden zum Umstieg verlocken. Aber E-Mobilität ist mit dem Blick auf das Auto zu kurz gedacht. Eine Vielzahl von emissionsärmeren Fortbewegungsmitteln kämpft um Passagiere. Als Hobbypilot interessiert Hartung vor allem, wie die Luftfahrt elektrifiziert werden kann. Doch während das Batteriethema für Fahrzeuge in wesentlichen Punkten gelöst scheint, ist die Kombination aus hoher Leistung und Energiedichte, geringem Gewicht und absoluter Zuverlässigkeit eine große Herausforderungen für die Luftfahrt. Technologie spielt in unserem Gespräch eine wichtige, aber nicht die einzige Rolle. Die Transformation der Antriebstechnik gelingt nur, wenn auch die Transformation der Unternehmen, Kompetenzen und Geschäftsmodelle im Gleichtakt mitzieht - und manchmal ist schnell auch zu schnell.

Folge 78: Adrian Thoma - Gründermotor mit Pioniergeist
Wir brauchen eine starke Gründer-Szene mit Innovationskraft - doch wie gelingt das in Regionen, die nicht Berlin oder München heißen? Unser Interviewpartner Adrian Thoma hat in der Stuttgarter Startupszene schon viel erlebt und bewegt. Sein Startup-Hub STEYG im Herzen der Stadt ist Heimat für zahlreiche Innovationsformate und befeuert ein vielfältiges Netzwerk. Doch wie kann "Startup" lernen? Zusammen mit Partnern aus der Industrie bringt Adrians Format "Gründermotor" bereits in der 5. Meisterklasse junge Menschen mit denen zusammen, die als Unternehmer bereits erfahren sind. Wir fragen Adrian, was ihn und sein Team dazu gebracht hat, sich um die Befähigung zum Startup zu kümmern und welchen Weg er für die manchmal belächelte "schwäbische Provinz" sieht. Er engagiert sich stark für den Aufbau eines lokalen Ökosystems und sieht viele Chancen für Startups in Baden-Württemberg - weit über den Maschinenbau hinaus. gruendermotor.io startupbw.de Pioniergeist.xyz

Folge 77: Prof. Andreas Peichl vom IfO und Krisenmanagement im Blindflug
Die anhaltenden Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie machen vielen Wirtschaftszweigen zu schaffen. Prof. Andreas Peichl misst mit dem IfO Geschäftsklima-Index monatlich den Pulsschlag von über 9000 Firmen. Er leitet das IfO Zentrum für Makroökonomik und Befragung und lehrt an der LMU in München. Die Krise beschleunigt den Wandel hin zu digitalen Geschäftsmodellen massiv. Doch ein Drittel der befragten Firmen schickt die Umfrage weiterhin per Fax. Verschlafen wir also die historisch einmalige Chance? Während andere Staaten über intelligente Datennutzung die Pandemie durchdringen, verzichten wir mutwillig auf Wissen, das wir DSGVO-konform sammeln könnten. Ein spannendes Interview, das aufzeigt wie konkret sich Makroökonomie im Alltag niederschlägt und welche Aufgaben Wirtschaft und Gesellschaft auf dem Weg in die Digitalisierung noch vor sich haben.

Folge 76: Prof. Katja Nettesheim und das Ende der Schutzbehauptungen
Katja Nettesheim ist Professorin für Digitales Medienmanagement an der Steinbeis-Hochschule Berlin und bringt mit ihrem Startup Culcha das Führungskräfte-Coaching ins digitale Zeitalter. Dabei geht es weniger um Technologie als vielmehr um digitale Mindsets: Kundenzentrierung, Datenzentrierung, Anschlussfähigkeit an neue Technologien, und alles umfassend eine neue Mitarbeiterzentrierung. Führungskräfte wie Mitarbeiter müssen sich also bewegen. Culcha liefert dazu einen "digitalen Coach für die Westentasche" und unterstützt den Wechsel zu neuen Verhaltensweisen - Coaching, Training und freundliches Nudging inbegriffen. Doch leider sieht es in vielen Firmen noch anders aus. Kein Homeoffice trotz Corona, weil Kontrollverlust droht? Katja fordert in einem leidenschaftlichen Plädoyer ein Ende der analogen Schutzbehauptungen und endlich mehr Mut im digitalen Zeitalter. https://steinbeis-smi.de/dozenten/katja-nettesheim/ https://culcha.com/

Folge 75: Wolf Lotter und Gunter Dueck - die Neujahrsansprache
Ein neues Jahr steht vor der Tür: Zeit, unseren Dialog mit Wolf Lotter und Gunter Dueck fortzusetzen und auszuleuchten, welche grundlegenden Veränderungen anstehen – trotz oder wegen Corona. Eine Grundvoraussetzung für echte Veränderung kommt schnell zur Sprache: die Realität anzuerkennen. Eine erwachsene Gesellschaft sozusagen, die auch das zulässt, was im Narrativ nicht sein darf und die Zumutungen der Realität erträgt. Und so plädieren Wolf und Gunter auch für mehr Klarheit und weniger „Hidden Agendas“: differenzierend ausleuchten und tun, was man sagt. Dafür braucht es Selbstverantwortung und eigenes Denken. Doch Homeoffice ist noch keine Selbstbestimmung, und was digital abläuft, kann noch besser gemessen werden. Omnimetrie – die Sucht, alles zu messen – ist schon lange in der Wirtschaft verbreitet. Aber KPIs gegen den Kontrollverlust sind keine Wertschöpfung; die Verwaltung von Wissen keine Wissensarbeit; Freiräume, die man gewährt, sind keine. Und wer ist verantwortlich? Wir – nein: ich. Jeder Einzelne macht den Unterschied, und wenn es Mikro-Verantwortlichkeiten sind. Vielleicht fehlt die wohlstandsbegleitende Bildung und Haltung, die uns nicht den Wohlstand schützen, sondern seine Ressourcen sinnvoller nutzen lässt: Schiffe bauen statt Deiche. Wolf Lotter und Gunter Dueck – ein fulminanter Schlagabtausch in der 75. Folge unseres Podcasts. Gönnt euch 1,5h Inspiration für den Start in ein neues, anderes, vielleicht besseres Jahr.

Folge 74: Wolf Lotter und Gunter Dueck - sind wir noch zu retten?
Wolf Lotter ist Gründungsmitglied des Wirtschaftsmagazins Brand Eins und ein scharfsinniger Beobachter der gesellschaftlichen Zusammenhänge, Gunter Dueck legt als ehemaliger Top-Manager bei IBM den Finger in die Wunden der Selbstbezogenheit und des Management-Wahnsinns. Zwei sprachgewaltige, erfolgreiche Autoren in einem Podcast, und eine große Frage: Sind wir noch zu retten? Ist das Vorzeigeland Deutschland noch anschlussfähig an die digitale Zukunft, ja ist es heute überhaupt noch irgendwo angeschlossen angesichts maroder Infrastrukturen und Digitalisierungsignoranz? Wir sondieren zu viert das Terrain. Welchen Beitrag kann der Bildungsbereich leisten, um zu mehr Selbständigkeit zu erziehen? Woher stammt die Mutlosigkeit in Gesellschaft und Wirtschaft, wo doch jede vernünftige Startup-Idee mit Geld zugeschüttet wird? Und was könnte ein sinnvoller Beitrag der Politik sein? Podcast Nr. 74 ist der längste in unserer Geschichte - doch bei weitem nicht lange genug, um die Antworten zu fassen. Fortsetzung folgt!

Folge 73: Nick Traber - Beton & Bytes
Nick Traber ist CEO von Holcim in der Schweiz, einem der größten Baustoffhersteller der Welt. Wir sprechen mit ihm darüber, warum der Bau ohne Digitalisierung heute nicht mehr funktionieren würde. Die digitalen Zwillinge GIS (Geoinformationssysteme) und BIM (Building Information Modeling) werden zur Normalität und vernetzen die komplexen Schnittstellen von Gelände und Gebäuden. Doch die Produktion von Baustoffen ist ressourcenintensiv. Prädiktive Algorithmen erhöhen die Verfügbarkeit, verringern den Energiebedarf und machen Bauen nachhaltiger. Doch wie schafft man es, einen traditionsreichen Konzern zum digitalen Champion zu machen? Wir diskutieren mit Nick, was die Bestandteile einer erfolgreichen Transformation sind und wo die Stolpersteine liegen. Soviel vorab: ohne die Mitarbeiter und ihre Fachkompetenz geht's nicht.

Folge 72: Prof. Thomas Fetzer - wie reguliert man Digitalisierung?
Facebook, Google, Twitter & Co geraten immer mehr in die Kritik. Sie spielen weltweit eine dominante Rolle, wenn es um Informationen, soziale Netzwerke oder digitale Marktplätze geht. Doch gehen sie mit ihrem Einfluss auch verantwortungsvoll um? Eine Regulierung scheint notwendig: DSGVO, Netzneutralität und Upload-Filter sind hitzig diskutierte Beispiele dafür. Doch kann die digitale Ökonomie überhaupt effektiv reguliert werden, wenn die Anbieter in den USA oder China sitzen? Gehören Monopolisten zerschlagen? Oder behindern wir damit Innovationen und Kundennutzen? Wir diskutieren mit Jura-Professor Thomas Fetzer aus Mannheim über die Regulierung der digitalen Welt. Eines scheint bereits klar: Die informationelle Selbstbestimmung ist eine Illusion.

Folge 71: Laserhub - Platform made in Germany
Kann man sich einen Maschinenbauer ohne eine einzige Maschine vorstellen? Wir sprechen mit Christoph B. Rössner, Co-Founder und Geschäftsführer des Stuttgarter Startup Laserhub - einem Unternehmen für Metallverarbeitung ohne eigene Produktion. Laserhub bündelt als vertikal integrierte Plattform B2B-Aufträge, optimiert die Abarbeitung und kümmert sich um einen digitalen Workflow. Anders als Plattformen, die nur als Makler zwischen Anbieter und Lieferant vermitteln, übernimmt Laserhub dabei die komplette Lieferverantwortung. Dies ist für beide Seiten vorteilhaft: Der Auftraggeber erhält innerhalb von Minuten ein kalkuliertes Angebot und profitiert vom automatisierten Workflow, der Zulieferer, der im Auftrag die Blechteile herstellen, optimiert seine Auslastung und konzentriert sich auf seine Kernkompetenzen. Gelingt der ehrgeizige Wachstumsplan, dann könnte Laserhub eine Blaupause für den deutschen Werkzeug- und Maschinenbau 2.0 werden: digital, skalierbar, automatisiert, serviceorientiert und mit einzigartiger technologischer Kompetenz.

Folge 70: Live von der 12hrs.us Society Disrupted
Heute gibt es einen Live-Podcast von uns zu hören: Wir haben auf der Konferenz 12hrs.us aufgenommen und unseren Zuhörern ein kleines Best-Of präsentiert: Wir reden mit Eva-Marina Froitzheim über die Zukunft der Museen, mit Hermann Arnold über die Zukunft von Führung, mit Frank Rinderknecht über die Zukunft der Mobilität, mit Kim N. Fischer über die Zukunft der Messen und mit Josephine Hofmann über die Zukunft der Arbeit.

Folge 69: Daniela Gerd tom Markotten und die Metarmophose der Mobilität
Wie muss die Mobilität der Zukunft aussehen, damit wir auch in Zukunft noch mobil sein können? Wie nutzen Menschen "Mobility-as-a-Service" und was heißt das für die Anbieter? Wir fragen Daniela Gerd tom Markotten. Sie war CEO der moovel group, der Mobilitätsallianz von Daimler und BMW, und kennt die Herausforderungen digitaler Geschäftsmodelle. Digitalisierung ist für sie mehr Metarmorphose als Transformation: Deutsche Ingenieurskunst mit digitalem Pragmatismus könnte "Made in Germany" neu erfinden.

Folge 68: Dr. Josephine Hofmann und die Arbeitswelt nach Corona
Josephine Hofmann forscht am Fraunhofer IAO an der Zukunft der Arbeit. Die Corona-Krise scheint den Wandel von hierarchischen Organisationen hin zu flexibleren Zusammenarbeitsmodellen zu beschleunigen. Wenn das Homeoffice der neue Arbeitsmittelpunkt ist, dann werden die zentralen Firmengebäude zu Event-Lokations für Vernetzung. Virtuelle Zusammenarbeit kann aber auch Verdichtung und Kontrolle bedeuten. Wir diskutieren mit Josephine Hofmann, was sich für Unternehmen und Beschäftigte verändern wird - und was trotz Krise bleibt.

Folge 67: Prof. Sabine Döring, Fritz Feger und weiße Schwäne
"Ein Paradox dieser Tage: Während die Wirklichkeit immer komplexer wird, sind wir immer weniger bereit, Komplexität zu akzeptieren", schreibt der italienische Physiker und Auto Paolo Giordano. Wir diskutieren mit der Tübinger Philosophie-Professorin Sabine Döring und Dr. Fritz Feger über die wichtige Rolle, die Ethik und philosophische Konzepte bei der gesellschaftlichen Bewältigung der Corona-Krise spielen können. Und von wegen "schwarzer Schwan": Die Pandemie war alles andere als unvorhersehbar. Doch während wir beim Autofahren selbstredend den Sicherheitsgurt anlegen, geraten die Maßnahmen, die uns so erfolgreich geschützt haben, immer mehr unter Druck. Die stumpfe Erregung der "Coronidioten", Impfgegner und Verschwörungstheoretiker ist dabei wenig hilfreich. Die Krise zwingt uns, viele Spielregeln neu zu verhandeln: Wo ist die Grenze zwischen persönlicher Freiheit und gesellschaftlicher Vernunft? Welche ethischen Grundsätze helfen uns im Spagat zwischen zwischen unbedingter Würde und finanziellem Wert des Lebens? Die Philosophie hilft uns, die komplexe Wirklichkeit unseres Lebens diskutierbar zu machen.

Folge 66: Mobilitätspionier Frank Rinderknecht - wie Innovation ensteht
Frank Rinderknecht definiert Mobilität neu. Bereits seit den 1970er Jahren ist seine Ideenfabrik Rinspeed ein Pionier in der Mobilitätsbranche - zunächst als Tuner, dann mit Innovationen im Fahrzeug, und morgen mit ganz anderen Mobilitätskonzepten. Sein aktuelles Showcar "Snap" zeigt, wie sich Lieferketten mit modularen E-Fahrzeugen effizienter betreiben lassen. Frank ist seit 42 Jahren "Design Thinker" - wir wollen daher von ihm wissen: Wie entstehen solche radikalen Innovationen? Was befähigt ein Team, außerhalb der Box zu denken? Welche Rolle spielen Werte und Visionen dabei? Herausgekommen ist ein spannender Austausch über Innovationskultur und die Zukunft der Mobilität.

Folge 65: Kim Fischer - wie sich Messen neu erfinden
Brauchen wir überhaupt noch Messen? Schon vor Corona hat sich die Messe-Landschaft tektonisch verschoben - die CeBIT wurde abgesagt, die IAA nach München verlegt und die klassischen Produktmessen entwickeln sich in Richtung Festivals. Die Zwangspause aufgrund des Corona-Virus zwingt Messen stärker in Digitalisierung, doch können digitale Formate tatsächlich das physische Treffen ersetzen? Wir diskutieren mit unserem Studiogast Kim N. Fischer. Sie hilft Messen wie der IFA Berlin, neue Formate zu entwickeln und Online mit Offline erfolgreich zu verzahnen. Messen werden zu Plattformen, die Themen kontinuierlich bespielen und mit ihren Besuchern weltweit und ganzjährig in Kontakt bleiben. Doch trotz aller digitalen Kommunikation - den phyischen Ort hält Kim auch in Zeiten von "Social Distancing" weiterin für unverzichtbar.

Folge 64: Wie Facebook zur Corona-Früherkennung beitragen will
Wie gebannt folgen wir täglich dem Verlauf der Corona-Zahlen - aber wir wissen: Die Datenlage ist in Wirklichkeit mehr als dürftig. Wieviele Menschen sich tatsächlich infiziert haben weiß niemand, und selbst die "Corona-Todesfälle" werden höchst unterschiedlich definiert. Mehr, bessere und frühzeitigere Daten könnten helfen, die Kollektivmaßnahmen gegenüber gezielteren Eingriffen in das Leben von Milliarden von Menschen abzulösen. Wer digitale Reichweite erzielen will, kommt an den Platzhirschen aber nicht vorbei. Und so hat auch Facebook begonnen, seine Nutzer für Umfragen zu Corona-Symptomen zu motivieren - und nebenbei noch wertvolle Metadaten zur Stichprobe mitzuliefern. Wie das funktionieren soll und ob wir mehr Statistiker neben den Epidemiologen in den Talk-Shows brauchen klären wir in unserer Podcast-Folge 64. Bleibt gesund!

Folge 63: App vs. Virus
Prof. Johannes Abeler lehrt Wirtschaftsökonomie in Oxford und arbeitet unter Hochdruck an der Frage, wie Tracking-Apps zur Besiegung des Corona-Virus beitragen können. Viele Staaten werten massiv die Bewegungsdaten ihrer Bürger aus und können damit die Ausbreitung des Pandemie reduzieren. Doch der Preis dafür ist die Preisgabe der persönlichen Aufenthaltsorte und sozialen Kontakte. Der europäische Ansatz des PEPP-PT-Frameworks versucht die Quadratur des Kreises: Sichere Identifizierung von Infektionswegen bei gleichzeitig hoher Anonymität. Um damit wirksam gegen den Virus zu sein, ist jedoch eine Installationsrate einer solchen App bei 60-75% der Bevölkerung notwendig. Wird uns dies auf freiwilliger Basis gelingen und damit die Auflösung der Kontaktsperren ermöglichen?

Folge 62: Digital durch die Corona-Krise
Unser heutiger Interview-Gast kennt sich bestens mit Digitalisierung und Konnektivität aus: Hartmut Kremling war viele Jahre der CTO von Vodafone. Mit ihm diskutieren wir, wie die Virus-Krise die Welt verändert und wie sie die Digitalisierung weiter vorantreiben könnte. Die Corona-Pandemie hat die Spielregeln in Gesellschaft und Wirtschaft dramatisch verändert. Mit der notwendigen Reduzierung der physischen Kontakte wird die digitale Kommunikation zum sozialen Rettungsanker. Für viele Firmen zeigt sich nun, ob die "Dematerialisierung" ihrer Geschäftsmodelle und Prozesse genügend Substanz hat, und ob die Lieferketten auch mit einer Welt im Home Office funktionieren. Und in den Schulen wird auf einmal der Einsatz digitaler Medien selbstverständlich und notwendig - was viele Jahre nicht sein sollte, geht nun innerhalb von Tagen.

Folge 61: Unser Buch zum Podcast ist fertig!
#Digdeep lebt weiter! Unsere lange Pause hatte einen einfachen Grund: Wir haben ein Buch geschrieben. Im Januar 2020 erscheint es im Haufe-Verlag und fasst zusammen, was wir zur digitalen Herausforderung zu erzählen haben. Es geht um die Tipping Points, die ganze Industriezweige verändern werden - mehr bald in gedruckter und digitaler Form. Und es war auch sonst wahnsinnig viel los. Wir haben also viel zu erzählen und freuen uns auf die neuen Folgen. Hört rein & folgt uns auf iTunes, Spotify & Co.

Folge 60: Der Tesla-Moment der Organisationsentwicklung
Hermann Arnold ist Ko-Gründer von Haufe Umantis. 2013 gab er seinen Geschäftsführer-Posten ab – und schrieb ein Buch über Organisationskonzepte, in denen die Mitarbeiter wieder in die Verantwortung gehen. Hermann Arnold sagt: „Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir immer mehr teilen: Neuigkeiten, Mitfahrgelegenheiten, Apartments. Einzig Führung scheint unteilbar. Doch diese Vorstellung ist schon lange eine Illusion: Wir teilen Führung, ohne dass wir es bemerken. Was fehlt, sind klare Spielregeln, die passende Infrastruktur und die erforderlichen Kompetenzen. Führung muss neu gedacht werden. Kein Mensch kann die Herausforderungen des wirtschaftlichen Umbruchs alleine meistern – auch kein Chef. Jeder muss führen und jeder muss folgen – und jeder muss wissen, wann was angebracht ist.“ Wir meinen: Der Umbruch in den Firmen hat schon lange begonnen und ist auch nicht mehr aufzuhalten – die Schnellen fressen die Langsamen. Der Beitrag Folge 60: Der Tesla-Moment der Organisationsentwicklung erschien zuerst auf #digdeep.

Folge 59: Die Highlights vom Mobile World Congress in Barcelona #MWC19
Auf dem Mobile World Congress #MWC19 in Barcelona trifft Mobilfunk auf die digitale Welt. Die einstige Mobilfunkmesse wird zum Stelldichein für alle Branchen, die online gehen. Vor allem für die Automobilindustrie ist der MWC bereits zu einer Leitmesse geworden, und alle sind da. Heißes Thema ist natürlich 5G - während viele Länder schon ausrollen, muss Deutschland noch die Weichen stellen, um zu einer performanten Kommunikationsinfrastruktur zu kommen. Autonomes Fahren, massives IoT und vieles mehr werden ansonsten nicht funktionieren. Wir interviewen daher Markus Jordans zu den neuesten Trends und fragen ihn, wie sich der Markt bewegt. Ein Hingucker des MWC19 waren faltbare Handys - so ganz haben sie ihn jedoch noch nicht überzeugt. Wir werden sehen, wie der Markt entscheidet.

Folge 58: Wie können wir Mobility Services vor Hackern schützen?
"Es gibt keine Safety ohne Security", sagt der Sicherheitsexperte Marc Peter Althoff. Er arbeitet für die Auto- und Telekommunikationsindustrie und berät Behörden zu Security-Fragen. Wir diskutieren mit ihm, warum Cyber-Security ein ganz wesentliche Herausforderung für die Fahrzeug-Hersteller geworden ist. Denn die neuen Mobility Services verkaufen kein Fahrzeug mehr. Wer Mobilität anbietet, muss ein ganzes Ökosystem mitliefern - und miteinander vernetzen. Autonome Taxis wollen bestellt und bezahlt werden, sie kommunizieren mit dem automatischen Parkhaus und den Ampeln und warnen sich gegenseitig vor Gefahren. Ein Paradies für Hacker. Denn jede V2X-Schnittstelle nach draußen bietet Einfallstore, und eine komplett vernetzte Fahrzeugarchitektur bietet dem Eindringling bequeme Fortbewegungsmittel. Was aber, wenn ein Hacker eine ganze autonome Fahrzeugflotte kapert? Neben Gefahr für Leib und Leben steht auch das gesamte öffentliche Leben im Risiko. Denn die bisherigen Security-Konzepte sind nicht darauf ausgelegt, Einbrüche sicher zu erkennen und das Gesamtfahrzeug zu schützen. Das erhöht den Druck auf die Hersteller, mehr das Gesamtsystem im Blick zu haben und schnellere Update-Prozesse "over the air" zu implementieren, um im kontinuierlichen Wettlauf gegen Hacker nicht zu verlieren. Vieles widerspricht dabei den heutigen Fahrzeugentstehungsprozessen. Security geht daher nur, wenn auch Prozess, Organisation und Mindset ein grundlegendes Update bekommen.

Folge 57: Best of CES in Las Vegas
Die #CeBIT ist tot, neuer Platzhirsch ist die Consumer Electronics Show #CES in Las Vegas – die Leitmesse selbst für die Automobil-Industrie. Das Großgewicht mit mehr als 180.000 Fach-Teilnehmern zeigt alles, was die digitale Welt zu bieten hat. Wir waren dabei und erzählen von den heißen Trends.

Folge 56: Wie wir exponentielles Denken lernen
Das Executive Programm der Singularity University #SUEP im Silicon Valley bringt eine Woche lang Führungskräfte mit den Vordenkern der exponentiellen Technologien zusammen. Ob Gentechnik, Energiewende oder AI: Wir unterschätzen systematisch, wie schnell sich exponentiell entwickelnde Technologien zum Gamechanger entwickeln, sobald sie die anfängliche Phase der Kinderkrankheiten überwunden haben. Das stellt Unternehmen, Gesellschaft und jeden Einzelnen vor große Herausforderungen. Wie wollen wir verantwortlich mit den neuen mächtigen Werkzeugen umgehen? Das Beispiel der mit #CRISPR genmanipulierten Zwillinge in China zeigt, dass wir unser Verständnis von Ethik und Moral dringend anschauen müssen.

Folge 55: Big Data meets Survey Science
Wir fragen Prof. Daniel Oberski von der Uni Utrecht: Ist der Mensch wirklich so vorhersehbar? Die aktuelle BigSurv18 Konferenz in Barcelona zeigt, dass sich selbst Google, Facebook und Co. schwer tun, aus noch mehr Daten noch bessere Prediction-Modelle zu bauen. Vielleicht auch eine gute Nachricht. Wobei die Frage nach der Vorurteilsfreiheit von Algorithmen weiterhin schwierig bleibt: Können wir vielleicht automatisiert den Bias von Algorithmen erkennen? Oder müssen wir anerkennen, dass die Verzerrungen der Maschinen nur unsere eigenen Vorurteile widerspiegeln? Bislang scheint es, dass der Lösungsweg kein technischer sein wird.

Folge 54: Schafft Open Government eine offenere Gesellschaft?
Oliver Rack ist eine der Hauptfiguren der deutschen Open-Data-Szene. In den Kommunen und der Politik kämpft er für einen neue Zusammenarbeit von Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlicher Verwaltung. Dazu sollen die Rohdaten unserer Gesellschaft frei zugänglich und nachnutzbar werden. Doch weder in Gesellschaft noch in Verwaltung ist selbstverständlich, dass öffentliche Daten auch erreichbar sind. Zur digitalen Souveränität braucht es Wissen, Zugang und bessere Nutzungsregeln. Die Open-Data-Initiativen möchten daher einen Beitrag zur leisten, unser „gesellschaftliches Betriebssystem“ upzugraden.

Folge 53: Survival in der digitalen Transformation
Ömer Atiker ist Autor, Speaker und Berater. In seinem „Survival-Handbuch“ zur Digitalen Transformation beschreibt er, worauf es jenseits der Berater-Floskeln ankommt. Wir sind uns einig: Vieles an der Digitalen Transformation ist doch sehr analog und hat mehr mit gesundem Menschenverstand zu tun als mit Technologie-Hype. Und ganz zu Beginn steht die Frage: Mehrwert ist das, was der Kunde dafür hält. Wer sehr genau hinschaut und seine Kunden versteht, kann sich seine Nische selbst gegen Amazon & Co aufbauen. Nie gab es mehr Möglichkeiten für Innovation, und nie gab es mehr Risiko, sein altes Geschäftsmodell zu verlieren.

Folge 52: Mixed Realities im Kunstbetrieb
Die Digitalisierung hat die Kunst seit langem erreicht – nicht nur in der Herstellung, auch in der Rezeption. Wir interviewen Dr. Eva-Marina Froitzheim vom Kunstmuseum Stuttgart. Ihre Ausstellung Mixed Realities hat die Besucher mit virtueller Realität konfrontiert. Neben AR- und VR-Anwendungen zum Eintauchen gab es auch computer-generierte Bilder zu sehen – und immer eine enge Zusammenarbeit zwischen Kunst und Technik, bis hin zum Höchstleistungsrechner. Wir wollen wissen, was das bei den Besuchern ausgelöst hat und was die Digitalisierung für Künstler und Museen bedeutet. Hier geht es zum analogen Kunstmuseum Stuttgart.

Folge 51: e-Estland – Willkommen im digitalen Staat
Wer wissen will, wie eine komplett digitalisierte öffentliche Verwaltung aussieht, der besucht heute Estland. Auch die Kanzlerin war schon da, um sich e-Government von der Wiege bis zur Bahre anzuschauen. Die Esten machen ihre Steuererklärung in 10 Minuten, und die Behörden kennt man eigentlich nur aus dem Internet. Das funktioniert, weil mit der „X-Road“ genannten Austauschplattform alle Daten im Netz bereits vorliegen. Und der Datenschutz? Bei genauem Hinsehen ist er nicht nur schärfer als in Deutschland formuliert, auch die Datenhoheit ist für jeden Bürger umgesetzt. Wer welche Daten von mir hat, und vor allem: Wer wann auf welche zugreift, das ist transparent und wird abgesichert. Die Erfolgsfaktoren für e-Estonia: eine frühzeitig formulierte Vision, Vertrauen in den Staat und viel Pragmatismus. Und so wurde der Neustart vor bald 30 Jahren, bei dem aus der UdSSR-Vergangenheit wenig zurückgeblieben war, zu einem Glücksfall für das kleine Volk der Esten. Genau hinschauen lohnt sich jedoch: Nicht alles ist so perfekt, wie es der e-Estonia-Showroom darstellen möchte.

Folge 50: Less is more – Large Scale Scrum
Scrum ist der seit langem etablierte Standard in der SW-Entwicklung, LeSS und SAFe machen es nun in hoffähig für Großprojekte. Immer mehr Firmen probieren quer durch alle Branchen aus, ob sie die Vorzüge von agilen Methoden nicht doch in ihrer Organisation nutzen können. LeSS und SAFe sind dabei die beiden bekanntesten Vorgehensmodelle und Denkschulen, um Scrum auch mit hunderten von Entwicklern zum Laufen zu bringen. Doch Scrum, LeSS und SAFe sind nicht einfach ein moderneres Projektmanagement: Wer sich darauf erfolgreich einlassen will, muss Teamstrukturen, Managementrollen und jede Menge alter Glaubenssätze entsorgen. Der Lohn kann die selbstlernende Organisation sein, frühzeitiges Feedback, extrem schnelle Releasezyklen und Teams, die wieder die volle Verantwortung für ihr Teilprodukt übernehmen. Dafür braucht es einen jahrelangen Atem, um die neuen Denkmuster und regelmäßigen Anpassungen produktiv zu machen. Oder wie es ein Manager am Ende formulierte: „It’s hard, but it’s magnificent!“

Folge 49: Man in the Loop
Japan, Australien, China – für uns geht diesmal gen Osten. Frauke übernachtet in Tokyo in einem Roboterhotel, findet aber auch hier den „Man in the Loop“. Viele Startups werben mit AI Services, am Ende müssen es aber menschliche Click-Worker richten – Pseudo AI statt starker künstlicher Intelligenz. Und so wird digitaler Service oft zum Ärgernis, weiß auch Wolf Lotter in der Brand Eins zu berichten. Pepper steht sich in den Hotel-Lobbys die Füße platt, kann aber sonst nicht viel – und auch Google Duplex hat wohl eher eine Inselbegabung. Und weiterhin gibt ein Land ganz besonders Gas auf dem Weg in die digitale Zukunft: China führt die Quote für autonome Fahrzeuge ein und sichert sich nebenbei die 3D-Modellierung des gesamten Landes. Nihao!

Folge 48: Google Duplex, der Sputnik-Schock 4.0
Google Duplex hat die Welt verblüfft – ein digitaler Assistent, der beim Friseur anruft und kompetenter als sein menschliches Gegenüber wirkt. Es folgt ein großer Aufschrei: Können wir bald Mensch und Maschine nicht mehr auseinander halten? Die Vision ist klar: Maschinen werden weitere menschliche Aufgaben übernehmen, diesmal mit hoher sozialer Interaktion. Und sie sprechen wie echte Menschen, eben: nicht perfekt. Parallel dazu entwickeln sich die Fähigkeiten, Stimmen und Gesichter durch Machine Learning zu synthetisieren. Stehen wir an der Schwelle zu einer Welt, in der Mensch und Maschine Hand in Hand leben werden?

Folge 1: Wo wir tief graben
In der ersten Folge von #digdeep erzählen wir, warum wir diesen Podcast starten - und was euch so erwartet. Wir greifen die aktuelle Themen zu Digitalisierung und Data auf, berichten von Events und teilen Themen, die wir für relevant oder interessant für euch halten.