
Im turi2 podcast erzählen Medien-, Marken- und Meinungsmacher*innen, wie sie die Herausforderungen der Digitalisierung angehen und was sie persönlich antreibt. Zusätzlich zum Podcast gibt es die kompletten Gespräche auch als Video bei YouTube: http://youtube.com/turi2tv
Alle Folgen
Geschichten schreiben, die die KI nicht kann: "NOZ"-Chefredakteur Burkhard Ewert im Interview.
Die “Neue Osnabrücker Zeitung” und die Blätter der Medienholding Nord schaffen es inzwischen, ihre Redaktionen durch die Einnahmen aus digitalen Abo-Modellen zu finanzieren, freut sich Chefredakteur Burkhard Ewert im turi2 Podcast. Für ihn ist das ein “wichtiger Meilenstein” und Beleg für die Zukunftsfähigkeit des digitalen Lokaljournalismus. Unsicher äußert er sich im Gespräch mit turi2-Chefredakteur Markus Trantow darüber, ob sich ausschweifende politische Kommunikation als Chance oder Bedrohung für den Lokaljournalismus entpuppt. Er wundere sich etwa darüber, dass es hingenommen werde, dass Rathäuser, Behörden und Verbände steuerfinanziert für ihre Positionen werben. Dazu warnt er vor einem Szenario, dass künftig womöglich AfD-Bürgermeister von den gleichen Mitteln Gebrauch machen könnten. Ewert will gegen solche Tendenzen einen Journalismus setzen, der “frei, unabhängig und vielfältig” ist. Auch der Umgang der Zeitung mit der AfD ist Thema. Anfang des Jahres war Ewert in einem “taz”-Artikel ein Rechtsruck bei der “NOZ” vorgeworfen worden. Dazu betont der Journalist, dass er für “Vielfalt und Breite” stehe und die Positionen, “die in unserer Leserschaft vorhanden sind”, respektiere. Er erklärt, dass seine Redaktion auch mit der AfD spreche, weil sie “einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung” repräsentiere und nicht jeder ihrer Punkte unberechtigt sei. Er wolle nicht in “pauschale Diffamierungen abgleiten”, sondern fragwürdige Positionen der Partei diskutieren. Die zunehmenden KI-Zusammenfassungen u.a. bei Google beobachtet Ewert als “schwierig, herausfordernd, bedrohlich, kritisch”. Dennoch könnte auch diese Entwicklung zu einer Chance für den Lokaljournalismus werden: “Wir müssen Geschichten schreiben, die eine KI nicht kann.” Dazu müssten die Journalisten da hingehen, wo die KI noch nicht war. Das bedeute, schnell, mutig und früh an Themen dran zu sein. Auf vorhandene Trends aufzuspringen, sei noch nie erfüllend oder innovativ gewesen. Weiteres Thema des Gesprächs sind historische Vergleiche, etwa mit der späten Weimarer Republik, die der studierte Historiker mit wenigen Einschränkungen als “schief” ablehnt. (Foto: NOZ/mh:n)

Vermarktungskick: Wie der "Kicker" lauter und sichtbarer werden will.
“Wir hatten immer eine gesunde Demut in unserer DNA, aber jetzt treten wir selbstbewusster auf”, sagt Lukas Ringer im turi2-Podcast. Zusammen mit Taygun Karakas ist er seit Anfang des Jahres Sales Director beim “Kicker” und hat es sich zur Aufgabe gemacht, “stärker über das zu sprechen, was unsere Redaktion tagtäglich leistet”. Für viele Fußballfans ist der “Kicker” immer noch Pflichtlektüre, kann inzwischen aber weit mehr kann als nur Männer-Fußball. “Unser Ziel ist, das, was der ‘Kicker’ im Fußball geschafft hat, auch in anderen Sportarten umzusetzen. Die Community dafür gibt es schon lange – wir müssen nur deutlicher kommunizieren, was wir anbieten”, erklärt Karakas im Gespräch mit turi2-Redakteur Björn Czieslik. Im Podcast erzählen Ringer und Karakas auch, warum Sport in einer Welt voller Krisen ein sicheres Werbeumfeld darstellt, warum die Unterteilung in Sportjahre- und Nicht-Sportjahre inzwischen hinfällig ist, und warum sie glauben, dass es den “Kicker” auch in 105 Jahren noch geben wird. Der Podcast ist der Auftakt der turi2-Themenwoche Sportkommunikation.

Markus Knall über KI-Content nach Maß
“Ich kenne keine große journalistische Entwicklung, die Technologie verändert hat. Ich kenne nur Technologien, die danach Journalismus verändert haben”, sagt Markus Knall, Chefredakteur von Ippen Media im turi2-Podcast. Im Gespräch mit turi2-Redakteur Björn Czieslik erzählt Knall, wie Ippen mit KI-Unterstützung ganz neue, journalistische Produkte schafft, etwa 1.000 lokale Wahlberichte zur Bundestagswahl. “Der Megatrend, der auch nach zwei Jahren KI für mich bleibt, ist die Individualisierung von Content”, sagt Knall. Da letztlich alle Medienhäuser ähnliche KI-Toools nutzen, sei die Herausforderung, “Anwendungen so zu verkoppeln, dass man einen USP findet, mit dem ich mich unaustauschbar mache”. Dieser Podcast ist Teil der turi2-Themenwoche KI&Innovation. Alle Beiträge: https://www.turi2.de/community/podcast-markus-knall/

“Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat eine Bringschuld” – Zeitverlag-Chef Rainer Esser im Interview.
Zeitverlag-Chef Rainer Esser formuliert im großen Interview von turi2 deutliche Forderungen und Erwartungen an den durch Gebühren finanzierten ÖRR. "Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der durch Gebühren gut finanziert ist, hat eine Bringschuld denjenigen gegenüber, die auch in dem Boot der Qualitätsmedien sitzen", sagt er im Gespräch mit turi2-Chefredakteur Markus Trantow. Der ÖRR müsse dafür sorgen, dass das Medienumfeld stark ist. Esser erwartet von den Sendern mehr Initiativen in der Zusammenarbeit mit Verlagen. Gleichzeitig erkennt er, dass auch die Sender unter finanziellem Druck stehen, weil die Gebühren nicht im selben Maße wie die Kosten steigen. Die Sender müssten nun eine Transformation durchlaufen und ihre "Lehmschicht", die sie in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaut hätten, abbauen. Klagen, um höhere Gebühren durchzusetzen, sieht Esser, der gewöhnlich eher die Gemeinsamkeiten zwischen Verlagen und ÖRR betont, als den falschen Weg. Gleichzeitig kritisiert er Forderungen, den ÖRR in Deutschland weiter einzuschränken, und verweist etwa auf Österreich, wo für den ORF deutlich weniger strenge Regeln gelten. Das betreffe u. a. die Werbung und Veröffentlichungen im Internet. Weitere Themen des Gesprächs sind das wachsende Engagement der "Zeit" auf Social Media – die Plattformen wolle der Verlag nicht den Populisten von links und rechts überlassen. Außerdem geht es um die Bedeutung von Linked-in für Essers Kommunikation als CEO. Das Gespräch gibt es auch als Video: https://youtu.be/MOApbcDb_ec?si=MjBO-gmOZfxAdQRE Ihr wollt mehr über das Geschäftsmodell der "Zeit" erfahren? Christian Röpke, Chief Product Officer des Verlags, ist am 23. und 24. Juni zu Gast beim European Publishing Congress in Wien. Hier geht's zu den Speakern des EPC: https://www.publishing-congress.com/themen-sprecher/ Und hier zu den Tickets: https://www.publishing-congress.com/tickets/

Ist Objektivität im Journalismus ein “Phantom”? Barbara Junge, Antje Sirleschtov und Christian Maertin diskutieren
Wie viel persönliche Agenda erlaubt journalistische Arbeit? Und wo verlaufen die Grenzen zwischen Journalismus und Aktivismus? Diese Fragen diskutieren im turi2 Podcast Antje Sirleschtov, Mitherausgeberin von "Table Media", Barbara Junge, Chefredakteurin der "taz" und Christian Maertin, Head of Corporate Communications von Bayer. Sirleschtov plädiert etwa dafür, sich als Journalist oder Journalistin immer wieder bewusst zu machen, dass man eine persönliche Sicht auf die Themen habe. Dennoch sei es wichtig, die Objekte der Berichterstattung von allen Seiten zu betrachten. Das Ziel sei eine möglichst große Objektivität. Für Junge ist Objektivität dagegen ein "Phantom". Die "taz" mache ihre Haltung sehr viel klarer als andere Medien. Maertin fordert dagegen vom Journalismus, "dass er objektiv ist". Er wünsche sich "das gleiche aufrichtige und unvoreingenommene Interesse an den Positionen aller zu haben, die Gegenstand einer Recherche sind". Er kritisiert etwa Redaktionen, bei denen die Geschichten schon fertig geschrieben seien und die – nur um sich rechtlich abzusichern – am Ende noch mal ein Statement einholen. Vor allem zwischen Maertin und Junge zeigen sich dabei deutliche Unterschiede. Junge widerspricht etwa dem Vorwurf, an einem ehrlichen Austausch mit dem Bayer-Konzern nicht interessiert zu sein. Aber auch zwischen Junge und Sirleschtov zeichnen sich Konfliktlinien ab. Die Diskussion ist die Aufzeichnung eines Panels beim Medien Camp des Medienfachverlags Oberauer von Freitag, 11. April 2025, moderiert von turi2 Chefredakteur Markus Trantow.

Podcasts mit Preisschild: Enrique Tarragona über die Podcast-Strategie von "Zeit Online"
"Zeit Online" geht in Sachen Podcasts einen neuen Weg und führt ein Bezahl-Abo speziell für Podcasts ein. Wer künftig alle Podcasts der Wochenzeitung "Zeit" und ihres Online-Ablegers hören will, muss dafür 4,99 Euro im Monat zahlen, erklärt "Zeit Online"-Geschäftsführer Enrique Tarragona im turi2 Podcast und im "Meedia"-Interview. Dennoch will er bei den vielen Stammhörerinnen und -hörern, die bisher kostenlos einschalten, nicht den Eindruck erwecken, dass ihnen etwas weggenommen wird: "Alles hinter die Bezahlschranke zu stellen, ist überhaupt keine Option für uns. Dafür ist es viel zu spannend, viele Menschen zu erreichen, die wir sonst nirgendwo adressieren können", sagt Tarragona im Gespräch mit Rupert Sommer. Hinter der Bezahlschranke stehen bereits jetzt das Podcast-Archiv und exklusive Doku-Serien, dazu kommen Sonderfolgen bestehender Podcasts. Aktuell sind diese Produktionen nur mit einem Zeit+-Abo abrufbar, das deutlich teurer ist als das neue Podcast-Only-Abo. Tarragona visiert damit eine Zielgruppe an, die ausschließlich Podcasts hören will, aber bereit ist, dafür zu zahlen. Womöglich ergebe sich darüber auch die Möglichkeit, die Abonnenten später an das große "Zeit Online"-Abo heranzuführen. Die "Zeit" und "Zeit Online" sind heute einer der erfolgreichsten Podcast-Produzenten Deutschlands. Hier entstehen etwa "Zeit Verbrechen" mit Sabine Rückert, der unendliche Podcast "Alles gesagt?" mit Jochen Wegner und Christoph Amend und der News-Podcast "Was jetzt?", die regelmäßig die Podcast-Charts stürmen.

Markus Spangler und Marion Rathmann über Olympia, Doku-Soaps und Helden bei Warner Bros. Discovery.
Fertig, los: In dieser Woche beginnt mit der Fußball-EM der Sportsommer 2024. Das sind gute Zeiten für TV-Sender, vor allem, wenn sie Sportrechte haben. Markus Spangler, zuständig für Ad Sales, und Marion Rathmann, verantwortlich für das Programm der Sender von Warner Brothers Discovery, freuen sich im turi2 Podcast über die kommenden Lagerfeuer-Momente – vor allem im Rahmen von Olympia. Im Gespräch mit turi2-Chefredakteur Markus Trantow erklären sie ihre Strategie: "Wir sind die erste Anlaufstelle für die wahren Sportfans", sagt Spangler, dessen Eurosport alle Medaillen-Entscheidungen im Free-TV zeigen will, in der "Medal Zone", einer Art Olympia-Konferenz. Wer sich in die einzelnen Wettbewerbe vertiefen wolle, müsse den Streaming-Dienst Discovery+ abonnieren. Damit beschreibt Spangler auch, wie sich der Sender von ARD und ZDF abhebt, die mehr Sport im Free-TV zeigen: Man setze auf Emotionen, auf Nähe zu den Athleten und eine Kooperation mit dem DOSB. Mit Blick auf den Werbemarkt sieht Ad-Sales-Mann Spangler wieder bessere Zeiten nach dem schwierigen Jahr 2023. So performten seine Sender "vielleicht noch ein bisschen besser" als von der Privat-Medien-Lobby Vaunet zuletzt für die Branche prognostiziert. "Sportjahre waren in der Vergangenheit immer sehr, sehr positive Jahre", sagt Spangler, hofft aber darauf, dass der Schwung, den der Sport bringt, noch zunimmt. Er ist zuversichtlich, denn man befinde sich noch am Anfang der Saison. Marion Rathman blickt auf das übrige Portfolio von Warner Brothers Discovery, auf Sender wie Dmax, TLC und Tele 5 und holt schon mal ein paar Highlights, die sie am Donnerstag bei den Screenforce Days der Werbekundschaft präsentieren wird, hinter dem Vorhang hervor. Sie verweist auf den 18 Geburtstag des Männersenders Dmax, der in der Jubiläumssaison viele neue Staffeln bekannter Blaulichtformate bringen wird. Dazu freut sie sich auf die neue Doku- Angesprochen auf die wachsende Streaming-Konkurrenz ist Rathmann davon überzeugt, dass es noch lange ein Nebeneinander von Streaming und linearem TV geben wird, auch weil das Angebot von Netflix und Co dem Fernsehen immer ähnlicher werde: "Der Content funktioniert meist auf beiden Wegen". Bei Tele 5 geht denn auch noch in diesem Jahr die dritte Staffel der ursprünglich fürs Streaming produzierten Serie "Star Trek Picard" über den Sender.

Musikwissenschaftler "Dr. Pop" über die Entwicklung des Musikgeschäfts.
Musik-Enthusiast: “Was uns als Menschen immer noch berührt, ist das Menschliche, was nicht kalkulierbar ist”, sagt Musikwissenschaftler Markus Henrik, alias Dr. Pop, im turi2-Podcast. “Die Leute sehnen sich sehr nach handgemachter Musik”, was auch den Erfolg von Stars wie Ed Sheeran oder Taylor Swift erkläre. Im Radio, in Videos und auf der Bühne analysiert er die Methoden der Musikindustrie und nimmt Popsongs auseinander. In seinem Studio hat er mehr als 20 teils historische Keyboards, um etwa typische 80er-Jahre-Sounds nachzustellen. Im Gespräch mit turi2-Redakteur Björn Czieslik erklärt Dr. Pop, warum Musiktitel aufgrund der Streaming-Prinzipien immer kürzer werden und wie Bands mit Krimskrams-Fanboxen ihre Chart-Position verbessern. Er plädiert dafür, Popmusik den gleichen Stellenwert einzuräumen wie Klassik und Kinder schon früh musikalisch zu bilden. Links: Text-Zusammenfassung https://www.turi2.de/community/podcast-dr-pop/ Beiträge der turi2 Themenwoche Audio https://www.turi2.de/community/themenwoche-audio/ Website von Dr. Pop https://www.dr-pop.de/ Radio-Report "The Power of Radio" von XPLR Media in Bavaria https://www.xplr-media.com/de/radio-report.html

Podcast-Macher Khesrau Behroz über Geschichten und Geschäfte.
Geschichtenerzähler: "Eine aufsehenerregende Person allein reicht für uns nicht", sagt Podcast-Macher Khesrau Behroz im turi2-Podcast über die Suche nach guten Geschichten für Doku-Podcasts. Die Story sollte "eine weitere Dimension, eine weitere Ebene mitbringen, nämlich die der gesellschaftlichen Relevanz". In "Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?" thematisiert er Verschwörungsideologien, in "Wer hat Angst vorm Drachenlord?" befasst er sich mit Cybermobbing. Seine jüngste Produktion "SchwarzRotGold: Mesut Özil zu Gast bei Freunden" erzählt vom Aufstieg und Fall des Fußball-Superstars Mesut Özil – aber auch von der deutschen Gesellschaft, in der das passiert. Im Gespräch mit turi2-Redakteur Björn Czieslik erzählt Behroz, was ihn am Storytelling reizt, warum er auch unsympathischen Protagonisten mit Empathie begegnet und warum sich auch Doku-Podcasts gut zur Vermarktung eignen. Dieser Podcast ist Teil der Agenda-Wochen 2024. Bis 17. Dezember blickt turi2 in Interviews, Podcasts und Gastbeiträgen zurück auf 2023 und voraus auf 2024. https://www.turi2.de/community/agenda-wochen-2024/ Zusammenfassung des Podcasts als Text: https://www.turi2.de/community/podcast-khesrau-behroz/

Oliver Kalkofe über TV-Liebe und TikTok-Hass.
Unter Medienjunkies: “Ich habe mich schon als Kind zu allem hingezogen gefühlt, was auf Bildschirmen geschieht – egal ob Fernseher oder Kinoleinwand”, sagt TV-Kritiker und Satiriker Oliver Kalkofe im turi2 Jobs-Podcast. Mit Chefredakteur Markus Trantow spricht Kalkofe über seine Karriere, die beim Radio begann und ihn inzwischen regelmäßig in politische Talkshows wie “Maischberger” führt. Er erklärt, dass das Kultformat “Kalkofes Mattscheibe” aus dem Gefühl heraus entstanden sei, dass er sich vom Fernsehen verarscht fühlte. Nach nun zwei Jahren “Mattscheiben”-Pause kann sich der TV-Terminator vorstellen, das Format wiederzubeleben: “Das Fernsehen braucht sowas wie die Mattscheibe”, sagt er, ergänzt aber das die Sendung vergleichsweise teuer, weil technisch aufwändig sei. Viele Sender würden sich eine solche Produktion heute nicht mehr leisten. Kalkofe teilt auch seine Sicht auf die Inflation der Streamingdienste und äußert sich enttäuscht von Netflix: Eine kurze Zeitlang hätten die Streamer die Spitze der Kreativität dargestellt, heute sei das anders. “Wenn ich früher bei Netflix etwas geguckt habe, dann war das ein Gütesiegel, heute sind drei Viertel der von Netflix in Auftrag gegebenen Serien und Filme das, was früher in der Videothek ganz hinten stand: Mogelpackungen.” Grundsätzlich beobachtet Kalkofe ähnliche Entwicklungen wie schon bei Radio und TV. Wenn ein Sender etwas Kreatives, Cooles erfunden habe, habe das immer sein Publikum gefunden und Geld verdient. Wenn dann Konzerne darauf aufmerksam wurden, sei man gierig geworden, habe Kosten reduziert und sich nicht mehr auf die eigene Kreativität, sondern auf Marktforschung verlassen. Kritisch sieht der Satiriker auch die Influencer-Ökonomie: “Einfach stumpf jeden Scheiß zu präsentieren und die Leute anzulügen – ich würde mich vor mir selbst schämen”, sagt er und hofft, dass er, müsste er seine Karriere heutzutage starten, niemals Influencer werden würde. Er erinnert sich an die “Influencer” seiner Jugend – Werbefiguren wir “Herr Kaiser” von der Hamburg Mannheimer oder “Klementine” von Ariel. “Wir wären nie auf die Idee gekommen, denen eine Postkarte zu schicken: ‘Klementine, ich finde dich so süß. Deine Latzhose ist so geil.’” Dass es gelinge, junge Menschen so zu täuschen, dass sie “Influencer, die ihnen nur Scheiße verkaufen”, mögen und ihnen folgen, findet Kalkofe “gruselig”. Gegen den Kurzvideo-Dienst TikTok hat Kalkofe eine regelrechte Abneigung, auch wenn er findet, dass dort viel Kreatives passiert. Das schnelle “Zack-Zack-hintereinander- Wegkonsumieren” sei für ihn allerding wie “eimerweise Popcornfressen, irgendwann wird einem davon schlecht. Im Bauch und im Kopf”. Abseits des Entertainment-Bereichs findet Kalkofe es sogar gefährlich, dass die Aufmerksamkeitsspanne vieler Menschen immer kürzer wird. Etwa wenn nur noch eine Schlagzeile gelesen werde, nicht aber der längere, kompliziertere Text darunter. Im Podcast spricht Kalkofe außerdem über seine enge Freundschaft zum verstorbenen Entertainer und Schlager-Sänger Achim Mentzel, die sich daraus entwickelt hatte, dass erst Kalkofe Mentzel und dann Mentzel Kalkofe auf die Schippe genommen hat. Er erklärt, dass er bei seinem Kultformat “Die schlechtesten Filme aller Zeiten” einen Unterschied macht zwischen Filmen, die mit Leidenschaft an die Wand gefahren wurden, und Streifen, die einfach ein “böses” oder “erbärmliches Menschenbild” propagieren. Zudem geht es um eine mögliche Fortsetzung der Kino-Reihe “Der Wixxer” und Kalkofes Umgang mit der Wut des Publikums. Dieser Podcast ist Teil der Screen-Wochen bei turi2. Bis 8. Oktober beschäftigen wir uns auf turi2.de mit Entwicklungen und Trends für Bildschirme – von der Smartwatch bis zum großen Werbescreen. Foto: Picture Alliance Mehr zum Thema: Das große Buch vom Bildschirm: Smartphones, Flatscreens

Tijen Onaran über den Aufbau einer Personenmarke.
Diversity-Flüsterin: Tijen Onaran weiß, dass sich viele Menschen an ihr reiben – “sowohl positiv als auch negativ”, sagt sie im turi2 Wissen-Podcast mit Redakteurin Pauline Stahl. Hinzu komme, dass die Unternehmerin, Autorin und Gründerin mit Diversität oder Frauen und Karriere für Themen steht, die eine große Angriffsfläche bieten. Ihr politischer Hintergrund sei ihr da zugute gekommen. Im Alter von 20 Jahren hat Onaran für die FDP im Landtag kandidiert und “von der Pike auf gelernt”, mit Kritik von allen Seiten umzugehen. “Da kam alles zusammen, was provoziert: FDP, Frau und Migrationsgeschichte”, sagt Onaran. Auch das vergangene Jahr habe sie sehr geprägt. Durch ihre gestiegene Sichtbarkeit seien auch immer mehr Menschen auf sie aufmerksam geworden, “die das alles nicht so toll finden”. Mittlerweile hat die 38-Jährige ihre eigenen Tools entwickelt, mit Kritik umzugehen. Das wichtigste Learning sei, “nie in der Emotion auf etwas zu reagieren”. Weil ihr Job jedoch häufig auf Emotionen beruht, “darf das Fell auch nicht zu dick sein”, sagt Onaran. Ihre Unternehmen Global Digital Women und ACI Consulting “leben durch mich als Person”. Wäre Onaran “eiskalt”, würde das nicht funktionieren. Das führe allerdings dazu, dass Angriffe und Kritik auch immer sie als Person treffen. Geholfen habe ihr, dass sie in ihre Personenmarke hineingewachsen ist. “Ich war nicht von heute auf morgen präsent, sondern habe mir meine Sichtbarkeit langsam aufgebaut”, sagt Onaran. So konnte sie sich genau überlegen, wofür sie stehen will. Ihrer Meinung nach sollte man sich immer überlegen, wie man wahrgenommen werden will, “egal, ob man in der Öffentlichkeit steht”. Eine gewisse Sichtbarkeit haben schließlich alle – sei es nur in einem kleinen Kreis aus Familie, Freunden oder Kolleginnen. Frauen sind dabei immer “anderen Maßstäben” ausgesetzt als Männer, weiß Onaran. In ihren Beratungen erlebe sie häufig, dass Frauen sich eine erhöhte Sichtbarkeit nicht antun wollen, weil vermehrt beobachtet und beurteilt wird. “Dann wagst du es als Frau vielleicht noch, deine Haare zu kämmen oder etwas nettes anzuziehen und dann ist es gleich ganz schlimm.” Frauen müssten sich sowieso schon durchsetzen, “dann möchten sie sich nicht noch dieser Bewertungs-Matrix aussetzen”. Auch für Onaran ist es täglich eine bewusste Entscheidung, aufzufallen, weil es immer in einer erhöhten Angreifbarkeit resultiere: “Das erfordert Mut”. Onaran erzählt außerdem, was sie von ihrem peinlichsten Moment auf einer großen Bühne gelernt hat und erklärt, warum Instagram-Stories über vergessene Wäsche anderen Frauen besonders viel Mut machen kann. Dieser Podcast ist Teil der turi2 Markenwochen – bis 11. Juni beschäftigen wir uns auf turi2.de mit starken Marken und den Menschen dahinter.

Kai Diekmann über "Bild", Boulevard-Mechanismen und den Tod.
Kai got the Feeling: “Mitunter schmerzt” Kai Diekmann die Entwicklung, die “Bild” unter seinen Nachfolgern genommen hat. “Ich würde mir wünschen, dass Bild mit eigenen Schlagzeilen glänzt und nicht ständig in nicht so hübschen Schlagzeilen steht”, sagt der Rekord-Chefredakteur von Springers Boulevard-Blatt zum Auftakt der turi2 Markenwochen im Podcast-Interview. Mit öffentlichen Ratschlägen hält sich der Mann, der seine Autobiografie mit “Ich war ‘Bild'” überschrieben hat, im Gespräch mit turi2-Chefredakteur Markus Trantow aber zurück. Das gilt auch für Ratschläge in Richtung seines früheren Konzernchefs, der zuletzt damit leben musste, dass peinliche SMS- und Chat-Nachrichten veröffentlicht wurden. “Mathias Döpfner braucht meinen Rat nicht. Aber wenn mein Rat gefragt ist, stehe ich zu Verfügung.” Für den Chef des Konzerns, in dem “Bild” erscheine, sei es schwieriger, zu argumentieren, dass Privates privat bleiben müsse. Manchmal sei “Privates eben auch politisch”. In seinen über 30 Jahren bei Springer und 16 Jahren als “Bild”-Chefredakteur habe er keine “solchen Nachrichten” erhalten oder Einflussnahme des Verlags auf seine Arbeit erlebt – mit einer Ausnahme: Damals wollte ein neuer Anzeigenleiter ein unfallfreies Werbeumfeld für einen neuen Automobil-Kunden schaffen. Diekmann berichtet, wie er diesen Wunsch mit einer ganzen Seite voller Autounfälle gekontert hat. Außerdem geht es in dem Gespräch um die Mechanismen des Boulevards, etwa Absprachen zwischen Redaktion und Protagonistinnen über die Freigabe von Zitaten hinaus, Diekmanns Liebe zur Marke “Bild” und seine Freundschaft mit Helmut Kohl. Die Begegnung mit dem Leichnam des Altkanzlers habe sein “Verhältnis zum Tod komplett verändert”. “Wir machen als Gesellschaft einen Fehler, indem wir den Tod aus unserem Alltag wegindustrialisiert haben”, findet Diekmann heute. Früher als Reporter, als “Bild”-Chef und im Privaten habe er den Anblick von Toten immer vermeiden können. Über die Feinde, die er sich in seinem Journalistenleben gemacht hat, wolle Diekmann sich nicht definieren: “Ich bin kein Streithammel”, sagt er und nennt sich “im Grunde meines Herzens harmoniesüchtig”. Dennoch habe er sich “für die richtige Sache” und für die Marke “Bild” gerne gerauft. Auch müsse er als Gesicht der mächtigsten Medienmarke in Deutschland damit leben, dass es immer Menschen gebe, die ihm “in herzlicher Abneigung verbunden” seien. Heute blickt Diekmann als PR-Unternehmer auf die Medienlandschaft. Er wundert sich, dass manche bekannte Mandate seiner Agentur Storymachine, die üblicherweise über ihre Kunden schweigt, skandalisiert würden: Unternehmen, die sich bei ihm melden, bräuchten eben oft Hilfe. Er vergleicht seine Arbeit mit dem Beruf seines Vaters, der als Strafverteidiger “Mörder und Verbrecher” verteidigt hat, und mit dem oft blutigen Job eines Unfallchirurgen.

Anja Rützel über gutes und schlechtes Trash-Fernsehen.
Scharfe Zunge: Trash-TV ist nicht gleich Trash-TV, erklärt Anja Rützel im turi2 Jobs-Podcast. Im Gespräch mit turi2-Redakteurin Pauline Stahl sagt die TV-Kritikerin, dass es "verschiedene Stufen" gibt. "Germany's Next Topmodel" etwa sei in bestimmten Momenten "Trash-TV von seiner schlimmsten Seite". Wenn den Teilnehmerinnen beim gefürchteten Umstyling "gegen ihren eigentlichen Willen" und "mit so viel Genuss am Grausamen" die Haare geschnitten werden, "wird einem beim Zuschauen fast schon die Perspektive aufgedrängt, sich zu freuen, dass es anderen schlechter geht als einem selbst", sagt Rützel. Oftmals seien Streit und Drama abendfüllender, als wenn sich Leute "ganz distinguiert" über ein Thema unterhalten. Doch die Beliebtheit von Reality- und Datingshows lässt sich laut Rützel auch an einem erhöhten Bedürfnis nach leichter Unterhaltung erklären. Das "Dschungelcamp" zum Beispiel habe sie 2023 als besonders gut empfunden, weil es "einfach tröstlich war, für zwei Wochen in einen überschaubaren Kosmos abtauchen zu können". Das Publikum kennt die Regeln, weiß ungefähr, wie es ausgeht und es passiert nichts Unvorhersehbares. "Ich glaube schon, dass die Weltlage das Bedürfnis nach einer solchen Kurzzeitflucht nochmal vermehrt hat", sagt Rützel. Was in die Kategorie Trash-TV fällt, lässt sich laut der Fernseh-Liebhaberin gar nicht so einfach sagen: "Es gibt da keine klassische Definition." Früher habe es den "bösen, wirklich klassistischen Begriff" vom "Unterschichten-Fernsehen" gegeben. Dem kann Rützel mit Blick auf das Feedback ihrer Leserschaft "extrem widersprechen". Sie glaubt, dass es auch in Formaten wie "Wetten, dass..?" oder in Rosamunde-Pilcher-Filmen "trashige Momente" geben kann. "Das ist eher ein Gefühl als etwas, das man kategorisieren kann." Im Podcast erzählt Rützel außerdem, warum sie vom "ZDF Fernsehgarten" in den vergangenen Wochen "richtig erschüttert" war, warum sie kein Fan davon ist, dass man etwa den "Bachelor" schon eine Woche vorab streamen kann und was sie beim "Eurovision Song Contest" über ihre internationalen Kolleginnen gelernt hat.

Digitalexperte Dennis Horn über die Redaktion der Zukunft.
Keine Zukunftsmusik: Die Chancen der Künstlichen Intelligenz sieht Dennis Horn vor allem dort, "wo Kreativität zum Einsatz kommt". ChatGPT etwa sei ein "super Tool, mit dem ich mich wie mit einem Assistenten beschäftigen kann", sagt der Journalist und Digital-Experte der ARD im turi2 Wissen-Podcast mit Redakteurin Pauline Stahl. Online-Redakteurinnen beispielsweise können KI-Tools für die Bebilderung von Texten nutzen, wenn sie mit Symbolfotos arbeiten müssen. Bisher werde KI im Journalismus jedoch noch "erstaunlich wenig" angewandt, sagt Horn, der mit dem WDR Innovation Hub versucht, technische Innovationen vorauszusehen, statt nur auf neue Entwicklungen zu reagieren. Bereiche, in denen KI schon genutzt wird, seien etwa automatisierte Spiel- oder Wetterberichte und Artikel, die auf Lückentexten basieren. "Das kann man überall anwenden, wo eine gute Datenlage herrscht", sagt Horn. Die Gefahr, dass KI künftig die Jobs der Medienschaffenden übernimmt, sieht Horn nicht. "Man hat mit GPT4 erstmal das Gefühl, das kann alles, aber ich bin mir da nicht sicher." Im Feuilleton etwa beziehen sich die Themen häufig auf aktuelle Ereignisse oder ein neues Buch: "Da bin ich mir nicht sicher, ob so ein Tool wirklich zum Einsatz kommen kann." Horn sieht KI nicht als Automatismus, der komplette Artikel schreiben kann, sondern als "Assistenztool", das viele Arbeitsschritte einfacher und effizienter macht. Damit Medienschaffende diese technologischen Innovationen auch wirklich gut nutzen können, rät Horn, jetzt schon mit KI zu experimentieren. Das Eingeben der Prompts in Tools wie ChatGPT sieht er als einen "wichtigen Skill für Journalistinnen in der Zukunft". Dabei sollte man die Funktion "richtig in die Pflicht nehmen" und die Eingaben möglichst kompliziert und mit vielen Vorgaben machen. Horn rät allerdings auch, die Mechanismen im Hintergrund zu kennen. Das heiße nicht, dass alle Journalistinnen künftig Programmiererinnen sein müssen, dennoch schade es nicht, eine "technologische Grundlage" zu haben. Im Podcast erklärt Horn außerdem, wo er die Grenzen von Künstlicher Intelligenz sieht, welche neuen Berufsbilder durch KI entstehen könnten und gibt weitere Tipps, wie Medienschaffende sich die technologischen Innovationen zunutze machen können.

Barbara Massing über New Work bei der Deutschen Welle.
Ressourcen-Planerin: "Es war immer schon ein Antrieb für mich, dass ich ein großes Gerechtigkeitsempfinden habe", sagt Barbara Massing, Verwaltungsdirektorin der Deutschen Welle, im turi2 Jobs-Podcast. Ihr Titel klinge für manche abschreckend, reizvoll sei für sie jedoch, über die Verteilung der Ressourcen der Deutschen Welle mitzuentscheiden und Menschen in Verantwortung zu bringen, erzählt sie im Gespräch mit turi2-Redakteur Björn Czieslik. Die Sichtweise von manchen Arbeitskräften, dass Work-Life-Balance und Führungsverantwortung nicht miteinander vereinbar seien, hält Massing für einen "Trugschluss". Das alte Führungsbild des meist männlichen Managers, der bis spätabends im Büro ist, sei nicht mehr das Zielbild. Der Podcast erscheint im Nachgang zur turi2 Themenwoche Future of Work, in der wir uns eine Woche lang mit neuen Formen des Arbeitens beschäftigt haben. Text-Zusammenfassung: https://www.turi2.de/aktuell/podcast-barbara-massing-deutsche-welle/

Antje Hundhausen über Gaming und Gleichberechtigung.
Game-Changerin: "Sobald du dich bei einem Spiel mit einem Mädchennamen anmeldest, wird es schwer", sagt Antje Hundhausen im turi2 Jobs-Podcast. Sie ist Vice President Brand Experience bei der Deutschen Telekom und setzt sich mit der Initiative Equal Esports für Gleichberechtigung im Gaming ein. Im Jobs-Podcast spricht sie mit Redakteurin Pauline Stahl über die Diskriminierung und "große Toxicity", die bei Online-Spielen noch immer herrsche. Häufig versuchen sich Mädchen mit einem männlichen Namen anzumelden, doch das fliege dann irgendwann auf "und dann wird es wieder schwierig", sagt Hundhausen. In diesem "anonymen Raum" passieren "viele Hasstiraden" und es herrscht eine gewisse "no-girls-allowed-Mentalität". Sie führt das auf den Stolz der Männer zurück, dass das Gaming ihr Bereich ist, in dem Frauen nichts zu suchen haben. Hundhausen, die sich selbst als passive Zuschauerin beschreibt, findet es erschreckend, dass bei Online-Spielen häufig "ganz alte, tradierte Rollen wieder auftauchen". Dabei gebe es im Esports keine Unterschiede zwischen Mann und Frau: "Die Ausgangsvoraussetzung ist die gleiche, ähnlich wie beim Schach." Zwar gebe es Spiele, die "relativ tolerant und aufgeschlossen" seien, bei anderen jedoch "laufen Jungs in Rüstungen den Frauen in Ketten-Bikinis hinterher". Um daran etwas zu ändern, muss vor allem Visualität geschaffen werden, sagt Hundhausen. Durch Mentoring-Programme und ein "Female-Counsil" will ihre Initiative "Vorbilder-Heldinnen" zeigen, die ihren Weg schon gegangen sind. Außerdem veranstaltet sie regelmäßig Show-Matches. "Da stehen dann staunende Jungs hinter spielenden Mädchen und sagen: 'Boah, die kann ja richtig gut spielen'." Spielerinnen rät Hundhausen, sich auch privat öfter mit Jungs zu treffen, selbstbewusst und mutig zu sein. Doch gerade die Männer können auch etwas tun, um einen "Safe-Space" für Frauen im Gaming zu schaffen: "Sie sollten Empathie und ein Gespür dafür bekommen, was gerade für ein Klima herrscht." Im Podcast geht es außerdem um hybrides Arbeiten, das bei der Telekom laut Hundhausen schon vor der Pandemie gang und gäbe war, mittlerweile aber noch flexibler und praxistauglicher geworden ist. Außerdem erklärt sie, warum die Telekom trotz Online-Shopping ihre Läden weiterhin offen halten will, und spricht über Angebote, die moderne Unternehmen ihren Angestellten heutzutage unbedingt machen sollten. Dieser Podcast ist Teil der Agenda-Wochen von turi2: Bis zum 18.12. blicken wir jeden Tag auf die Themen, die die Kommunikationsbranche zum Jahreswechsel bewegen. Am 11. Januar erscheint die turi2 edition #20 – Agenda 2023 als Jahrbuch der Kommunikation mit den Schwerpunkten Vielfalt, Nachhaltigkeit und Resilienz.

Paul Ronzheimer über Ausnahmesituationen und journalistische Ausdauer.
Krieg und Alltag: "Man kann in diesem Krieg kaum im klassischen Sinne neutral sein", sagt Paul Ronzheimer im turi2 Jobs-Podcast über den Ukraine-Krieg. Der Kriegsreporter und Vize-Chefredakteur von "Bild" findet, dass die Berichterstattung "truthful" sein sollte. Im Gespräch mit turi2-Chefredakteur Markus Trantow sagt er, das bedeute "unbedingt auch, die ukrainische Sichtweise und Darlegungen kritisch zu hinterfragen". Nur weil er mit den Ukrainern fühle und "glaubt, dass sie jedes Recht haben, sich zu verteidigen", müsse er als Journalist dennoch "genau hinschauen". Ronzheimer hat schon aus vielen Kriegs- und Krisengebieten berichtet – der Krieg in der Ukraine sei jedoch "ganz anders". Das liege vor allem daran, dass er das Land schon vor Kriegsbeginn häufig besucht und dadurch eine "große persönliche Bindung" habe. Gerade ist Ronzheimer zurück in Deutschland – solche Kriegs-Auszeiten sind ihm extrem wichtig: "Wenn man teilweise mehrere Wochen und Monate dort verbringt, wird man verrückt im Kopf." Während seiner Heimatbesuche merkt Ronzheimer oft, "wie viel ich zu verarbeiten habe". Selbst der Profi, der schon seit Jahren als Kriegsreporter arbeitet, unterschätzt das häufig. Gerade in diesem Jahr, in dem er insgesamt sieben Monate unterwegs war, "ist das immer nur ein kurzes Ankommen". Ronzheimer nimmt im Gespräch auch Stellung zu den Streichungen des Live-Programms von Bild-TV: "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das nicht weh tut", sagt der "Bild"-Vize, und lobt die "Startup-Stimmung" im dritten Stock des Springer-Hochhauses. Gleichzeitig äußert er Verständnis für die Verlagsentscheidung und geht davon aus, dass die Berichterstattung auf Bild.de und in Breaking-News-Situationen weitergeht. Der Sender sei ja nicht komplett weg. Im Podcast gibt Ronzheimer auch Tipps für den Journalismus-Nachwuchs: Wer diesen Job machen will, brauche eine "massive Ausdauer" – das gelte grundsätzlich für Journalistinnen. Ronzheimer habe den Journalismus viele Jahre lang "als absolute Prio über alles gestellt" – darunter gelitten haben Familie und Freunde. "Vielleicht muss es nicht so extrem sein", lenkt er ein – dennoch sei es eben kein 9-to-5-Job. Dieser Podcast ist Teil der Agenda-Wochen von turi2: Bis zum 18.12. blicken wir jeden Tag auf die Themen, die die Kommunikationsbranche zum Jahreswechsel bewegen. Am 11. Januar erscheint die turi2 edition #20 – Agenda 2023 als Jahrbuch der Kommunikation mit den Schwerpunkten Vielfalt, Nachhaltigkeit und Resilienz.

Özden Terli über Klima-Berichterstattung und Kritik.
Trotzt Wind und Wetter: "In erster Linie sind wir Journalisten und stellen dar, ordnen ein und zeigen, was die Realität ist", sagt Özden Terli im turi2 Wissen-Podcast. Dem Diplom-Meteorologen fällt es schwer, bei Temperaturen von 40 Grad und monatelanger Trockenheit von "schönem Wetter" zu reden. Kritik und Shitstorms erntet er regelmäßig, weil er nicht nur das Wetter ansagt, sondern einordnet und gezielt den Klimawandel und seine Folgen anspricht. Im Gespräch mit turi2-Redakteurin Pauline Stahl sagt er, dass der Vorwurf, Klimaaktivismus zu betreiben, "ein ganz übler" ist. Bei dem Thema gehe es um die "Lebensgrundlage aller Menschen". Die Kritik an seiner Berichterstattung komme häufig "aus einer gewissen Ecke, die noch nicht verstanden hat, was der Klimawandel bedeutet". Davon lasse sich Terli jedoch nicht beeinflussen – schließlich könne er sich immer wieder auf die physikalischen Gesetze berufen: "Da kann mir jeder vorwerfen, was er will, aber die Physik gilt für alle." Solange sich Journalisten darauf berufen und diese Fakten in den Vordergrund stellen, könne nichts passieren. Deshalb rät Terli allen, die über Klimafakten berichten möchten: "Macht das einfach. Steht da mit beiden Beinen fest auf dem Boden und wehrt euch." Terli weiß aus eigener Erfahrung, dass das nicht immer einfach ist. Beim ersten Shitstorm gegen ihn, habe er "nicht mehr gewusst, was los ist". Mittlerweile weiß er, damit umzugehen: "Wer den Shitstorm auslöst, in die Öffentlichkeit zerren und zeigen, dass er falsch liegt." Allerdings kenne er auch "bestimmte Journalisten", die "bewusst Unsinn streuen" – auch das könne man nicht stehen lassen. "Das ist gefährlich und in dem Moment wird auch das Medium als Desinformations-Schleuder genutzt", sagt Terli. Er ist deshalb der festen Überzeugung: "Wir sind Journalisten, wir müssen das einordnen und kommentieren." Im Podcast gibt Terli weitere Tipps für die Klimaberichterstattung und erklärt, warum es für ihn auch dazu gehört, die Politik "scharf" zu kritisieren. Dieser Podcast ist Teil der Agenda-Wochen von turi2: Bis zum 18.12. blicken wir jeden Tag auf die Themen, die die Kommunikationsbranche zum Jahreswechsel bewegen. Am 11. Januar erscheint die turi2 edition #20 – Agenda 2023 als Jahrbuch der Kommunikation mit den Schwerpunkten Vielfalt, Nachhaltigkeit und Resilienz.

Michael Trautmann über persönliche Krisen und Erfüllung.
Traut sich was: "2022 war ein großes Umbruch-Jahr", resümiert Michael Trautmann. "Da hat sich einiges kumuliert." Dabei wollte der Thjnk-Mitgründer und Podcaster im Januar mit einem "guten Flow" auf Mallorca ins neue Jahr starten. "Doch da habe ich meinen eigenen Körper und alles, was vorher passiert ist, unterschätzt", erzählt Trautmann im turi2 Jobs-Podcast mit Chefredakteur Markus Trantow. Das Resultat: Zwei "echt schwere Monate", in denen sich Trautmann wegen psychischer Probleme zurückzieht und viel Zeit mit Selbstreflektion verbringt. Diese Erfahrung habe ihm gezeigt, dass "selbst jemand wie ich, der das Glas immer mindestens drei Viertel voll sieht, mal so eine Phase haben kann". Insgesamt sei er aus der persönlichen Krise gestärkt hervorgegangen: "Ich habe mich mit mir selbst beschäftigt und gemerkt, wo ich mich noch verändern und verbessern kann." Sein Ratschlag ist daher, sich immer wieder Zeit für Selbstreflektion zu nehmen: "Was kannst du gut, wie kannst du deine Stärken in deine Tätigkeiten einbringen, guck dir deine Blindspots an – das ist eine gute Voraussetzung, um Resilienz aufzubauen". Auch beruflich erlangt Trautmann neue Perspektiven: Sein Podcast On the Way to New Work wird zum Unternehmen New Work Masterskills GmbH, mit dem er und seine Geschäftspartnerin Swantje Allmers New-Work-Seminare für Unternehmen anbieten. Außerdem schreiben Allmers, sein Podcast-Co-Host Christoph Magnussen und Trautmann ein 400-Seiten-Buch über das neue Arbeiten. New Work umfasse weit mehr, als "Mate-Tee-Kühlschränke und keine Meetings nach 17 Uhr", sagt Trautmann. Viel mehr ginge es darum, dass "es mehr Menschen gelingt, in einen Zustand zu kommen, in dem sie ihre Arbeit wirklich erfüllt". Das betreffe nicht nur diejenigen, die im Büro sitzen "und sowieso schon eine hohe Eigenmotivation haben", sondern auch Berufe, "die auf den ersten Blick vielleicht nicht so viel Freude vermitteln". Im Podcast erklärt Trautmann, wie New-Work-Konzepte selbst Menschen helfen können, die nicht ihren Traumjob machen. Außerdem verrät er, warum er all seine News-Apps gelöscht hat und warum eine gewisse "Diversität Richtung Alter" das "absolute Killer-Rezept" für Unternehmen ist. Dieser Podcast ist Teil der Agenda-Wochen von turi2: Bis zum 18.12. blicken wir jeden Tag auf die Themen, die die Kommunikationsbranche zum Jahreswechsel bewegen. Am 11. Januar erscheint die turi2 edition #20 – Agenda 2023 als Jahrbuch der Kommunikation mit den Schwerpunkten Vielfalt, Nachhaltigkeit und Resilienz.
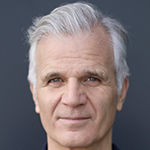
Henning Beck über das Hirn in Krisenzeiten.
Bleibt neugierig: "Wir verspotifysieren unser Leben im positiven und im negativen Sinne", sagt Henning Beck im neuen turi2 Wissen-Podcast. Der Neurowissenschaftler, Autor und Science-Slammer findet es "wundervoll", wenn er seine Lieblingsmusik hört und die Algorithmen genau das anbieten, was er mag. Allerdings zielen auch "alle modernen digitalen Medien" darauf ab, "dass sie höchst individuell und granular das anbieten, was zu mir passt". Im Gespräch mit turi2-Redakteurin Pauline Stahl sagt Beck, dass das bei Kultur und Kunst angenehm sei, gerade in Krisenzeiten kann das bei Nachrichten aber "gefährlich sein, weil ich nur in Bereiche komme, die zu mir passen". Um aus dieser Blase herauszukommen, rät der Wissenschaftler etwa, ab und an mal eine Zeitung zu kaufen. "Ich gebe zwei Euro dafür aus und bekomme Artikel, die ich im Internet nie gefunden hätte – das erweitert meinen Horizont." Zudem helfe es, anderen Menschen zuzuhören und deren Meinungen und Ansichten als "Ideenfutter zu verwenden". Auch Reisen trage sehr dazu bei, andere Perspektiven einzunehmen. "Ich persönlich unterhalte mich zum Beispiel immer mit Taxifahrern", erzählt Beck. Für ihn sei das eine sehr unmittelbare Art, mit anderen in Kontakt zu kommen. "Außerdem sollte man sich nicht scheuen, auch mal den Smalltalk zu verlassen und in den Deeptalk zu gehen." Im Podcast erklärt Beck außerdem, was der Endlos-Feed auf Social Media mit unserem Hirn macht und verrät, wie kleine Tricks dabei helfen, mit dem Doomscrolling aufzuhören. Beck spricht zudem von einer Art "Gegenbewegung zur Wissenschaft", die er momentan beobachtet und erklärt, warum Stress und Krisenzeiten auch immer zu Verschwörungstheorien führen. Dieser Podcast ist Teil der Agenda-Wochen von turi2: Bis zum 18.12. blicken wir jeden Tag auf die Themen, die die Kommunikationsbranche zum Jahreswechsel bewegen. Am 11. Januar erscheint die turi2 edition #20 – Agenda 2023 als Jahrbuch der Kommunikation mit den Schwerpunkten Vielfalt, Nachhaltigkeit und Resilienz.

Konstantin Seidenstücker über Chef-Dasein und Audio-Leidenschaft.
Audio-Nerd: "Ich glaube, mit 28 Jahren Geschäftsführer zu sein, ist nicht viel anders als mit 40", sagt Konstantin Seidenstücker im turi2 Jobs-Podcast. Der CEO von Studio Bummens war gerade einmal 25 Jahre alt, als er gemeinsam mit Co-Geschäftsführer Tobias Bauckhage die Podcast-Produktionsfirma gegründet hat. Heute produziert er dort Formate wie Weird Crimes, Apokalypse und Filterkaffee und Baywatch Berlin. Im Gespräch mit turi2-Redakteurin Pauline Stahl sagt Seidenstücker, das Unternehmen sei "natürlich zusammengewachsen" und "von Schritten begleitet, die alle Sinn ergeben haben". Geholfen habe ihm etwa, dass er zuvor lange als freiberuflicher Podcast-Producer gearbeitet hat. So hatte er Zeit, sich "einzufinden, zu checken, was gehört alles dazu und was bekomme ich vielleicht selbst nicht so gut hin". Bis zur Gründung 2018 habe er in der Produktion alles allein gemacht: "Wie ein guter Hotelier, der durch jedes Gewerk ein mal durchgegangen ist, habe ich jeden einzelnen Schritt der Podcast-Produktion schon mal gemacht." Auf seinem Weg zu einem der erfolgreichsten Podcast-Producer Deutschlands spielt auch Seidenstückers große und frühe Leidenschaft für Audio eine wichtige Rolle. Als Kind und Jugendlicher gibt er als Synchronsprecher u.a. dem grünen Bärchen in der Kindersendung "Käpt'n Blaubär" eine Stimme. Die ersten Schritte im Audio-Producing geht er als 14-Jähriger, macht während seines Studiums Techno-Musik, legt in Clubs auf und produziert gemeinsam mit seinem Bruder eigene Platten. "All diese Sachen haben mein Verständnis für die Audio-Produktion extrem geschärft", sagt Seidenstücker. Sorgen, dass das Interesse an Podcasts stark abflaut, hat Seidenstücker nicht. "Aus der Hype-Phase sind wir raus, denn Hypes haben immer ein schnelles Ende." Der Podcast-Markt jedoch wachse seit sechs Jahren und "ich glaube, dass wir auch weiterhin einen Wachstum sehen und neue Formate und Stimmen hören". Im Jobs-Podcast spricht er außerdem über die Produktion und Kosten vom Erfolgsformat Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen, erinnert sich an seine ersten Podcast-Produktionen zurück und gibt Einblicke in die Arbeit von Studio Bummens. Weitere Interviews, Podcasts, Profi-Tipps und Hör-Empfehlungen zum Thema Audio gibt es in der turi2 edition #19.

John Ment über den Wandel der Morningshows im Radio.
Kein zwanghaftes Witze-Feuerwerk: "Es ist wahnsinnig erleichternd, wenn man nicht nach jeden Song zwei oder drei Gags machen muss", sagt John Ment im turi2 Jobs-Podcast. Seit 1989 moderiert er die Morningshow bei Radio Hamburg und ist damit der dienstälteste Moderator im deutschen Privatradio. "Niemand kommt jeden Tag mit der gleichen Laune rein, außer er spielt es. Und wir glauben, dass der Hörer das einfach merkt, wenn wir ihm irgendwas vorspielen", sagt er im Gespräch mit turi2-Redakteur Björn Czieslik. Die Marktforschung habe gezeigt, dass es Hörerinnen gar nicht wichtig ist, dass das Morningshow-Team immer lustig ist, sondern lieber sympathisch und erwachsen – und keinesfalls albern. Für Ment war klar: "Wir müssen die Witze runterschrauben." Die Corona-Pandemie habe den Wandel zu mehr Relevanz und Wortinhalten im Programm noch verstärkt. John Ment erinnert sich an Sendungen, in denen Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher, der Schulsenator oder die Gesundheitssenatorin eine Stunde lang, komplett ohne Musik, Rede und und Antwort standen. "Die Leute haben uns vertraut", freut sich Ment mit Blick auf die Image-Werte in der Media-Analyse. Die wachsende Zahl an Morgen-Podcasts sieht John Ment nicht als Konkurrenz zu seiner Show, sondern als Ergänzung. Apokalypse und Filterkaffee etwa höre er oft nach der Sendung, auf dem Weg nach Hause. "Micky Beisenherz ist ein großartige Mensch und er macht das wirklich sehr lustig, aber es ist nicht regional." Gerade in der Regionalität sieht Ment die große Stärke von Radio, ein Gefühl zu schaffen, "zu Hause zu sein" – oder mit Programm-Aktionen zum Stadtgespräch zu werden. Aktuell sucht Radio Hamburg mit einer Casting-Aktion ein neues Team-Mitglied für die Morningshow. Es geht um einen richtigen Job. Generell sei der Weg ins Radio heute leichter als früher, glaubt John Ment, "weil die Nachfrage nicht mehr ganz so groß ist". Durch YouTube, Podcasts, Tikok oder Instagram brauchen Menschen kein klassisches Medium mehr, um medial stattzufinden – fürs Radio nicht unbedingt ein Nachteil: "Die Leute gewinnen an Erfahrung, verlieren die Angst vor der Öffentlichkeit, vor einer Kamera, vor dem Mikrofon", sagt Ment und hofft: "Wer so extrovertiert ist, wird vielleicht doch aufs Radio aufmerksam." Dem Radio-Nachwuchs rät er: "Heute zählt Personality mehr als das, was Du theoretisch kannst." Wissenslücken ließen sich leichter beheben, als fehlende Persönlichkeit bei Superschlauen. Wichtig seien auch große Empathie und die Fähigkeit, zuzuhören: "Die schwerste Disziplin im Radio ist das Miteinanderreden." Von sich selbst sagt Ment: "Ich bin eine Rampensau!" Schon in der Schule habe er es geliebt, in Theatergruppen vor Leuten zu "performen". Mit Leidenschaft inszeniert er seine Sendung mit Musik und Geräuschen, so dass "jede Moderation wie eine Perle klingt". Seit 2002 ist er auch stellvertretender Programmchef, soll sich künftig stärker um die Volos von Radio Hamburg kümmern, außerdem berät und coacht er Sender in Österreich und der Schweiz. Über die Jahre gab es immer mal wieder auch Versuche anderer Sender, ihn als Programmchef abzuwerben, nie als Moderator. Heute sagt Ment: "Wenn der Moment gekommen ist, und der muss irgendwann kommen, dann würde ich auch sagen: 'Ich kann auch hinter den Kulissen arbeiten, Spaß haben und andere glänzen lassen." Noch sei dieser Moment aber nicht gekommen: "Aktuell bin ich dem Sender als Moderator noch zu kostbar, als dass ich irgendwo in einem Büro verschwinde und irgendwelche Zahlen von rechts nach links schiebe." Im Podcast erzählt John Ment außerdem von der Aufbruchsstimmung zu Beginn des Privatradios und wie er bei einem kurzen Ausflug zum NDR selbst seine Kündigung provoziert hat. Er verrät, was hilft, wenn die Stimme wegbleibt und warum er die Schweiz so liebt, wo er fast einmal Programmchef geworden wäre.

Silvana Katzer und Ivy Haase über die Arbeit in Bertelsmanns Audio Alliance.
Es muss nicht immer Video sein: "Dadurch, dass man nicht gesehen wird, sind die Leute in Podcasts dazu bereit, mehr von sich zu zeigen und zu geben, was sie vor einer Kamera niemals sagen würden", sagt Silvana Katzer, Redaktionsleiterin der Audio Alliance von RTL, im turi2 Jobs-Podcast. Auch ihre Stellvertreterin Ivy Haase sieht die intime Situation als große Stärke des Mediums: "Mit Kamera geht zu viel von der Atmosphäre des Gesprächs verloren." Im Doppel-Interview mit turi2-Redakteur Björn Czieslik erzählen sie, dass TV-Produktionen Podcasts als Ergänzung inzwischen mitdenken. "Bei 'Let's Dance' war es am Anfang sehr befremdlich, dass während der Werbepause noch jemand vom Podcast übers Parkett läuft", erinnert sich Silvana Katzer. Inzwischen wüssten die TV-Kollegen bei RTL jedoch, "was wir durch den Podcast gewinnen können". Im "GZSZ"-Podcast etwa, den sie hostet, gibt es Fan-Wissen, Backstage-Berichte und Gespräche mit Darstellerinnen. Seit Mai 2019 bündelt die Audio Alliance die Audio- und Podcast-Aktivitäten von Bertelsmann, angesiedelt unter dem Dach von RTL. Elf Mitarbeitende in Berlin, Hamburg und Köln betreuen die rund 60 aktiven Podcasts redaktionell, hinzu kommen Fachkräfte für Audio-Produktion und Business Development. "Wir hören schon sehr viele Podcasts und helfen, sie zu verbessern. Das ist eigentlich ein Traumjob", schwärmt Ivy Haase. Sie selbst hostet die Podcasts Unnützes Wissen und Geolino Spezial, arbeitet inzwischen aber noch lieber hinter den Kulissen. Bei der Suche nach neuen Mitarbeitenden ist ihr wichtig, "dass sie das Medium lieben". Silvana Katzer achtet vor allem auf das Zwischenmenschliche: "Man kann alles lernen, aber mir ist wichtig, dass wir im Team zusammenpassen." Zu dem Aufgaben der Redaktion gehört etwa die Portfolio-Planung und Konzeption neuer Podcasts. Wichtig sei ein glaubwürdiger Host mit Meinung: "Reden kann jeder von uns, aber was zu sagen zu haben, ist gar nicht so einfach", weiß Ivy Haase. Auch die Zielgruppe sollte klar sein: "Du kannst einen Podcast machen, der am besten alle anspricht. Und dann ist er für keinen Werbekunden relevant." Besonders am Herzen liegt es Ivy Haase und Silvana Katzer, mehr Frauen in Podcasts hörbar zu machen. Nicht nur in Genres wie True Crime, sondern auch für Nachrichten-, Politik- und Wirtschaftsthemen. Chasing Marsalek etwa, der Wirecard-Podcast von Audio Now, erzählt eine Geschichte, in der es um Männer geht, nur mit Frauenstimmen. Auch erfolgreiche Comedy-Podcasts mit Frauen vermisst Haase noch. Die bisherige Plattform Audio Now geht künftig im Bezahl-Angebot RTL+ auf. Silvana Katzer erhofft sich dadurch mehr Aufmerksamkeit für Podcasts. Ivy Haase sieht die Chance, auch große Podcast-Projekte umzusetzen, "ohne dabei in erster Linie an die Vermarktbarkeit zu denken". Das Gespräch ist Teil der turi2 Podcast-Wochen: https://www.turi2.de/podcastwochen Zum Launch der turi2 edition #19 sind wir am 12. Oktober zu Gast im RTL-Audio-Center in Berlin: https://www.turi2.de/der-turi2-clubraum-podcast-live-on-stage/. Im Live-Podcast nehmen Aline von Drateln und Markus Trantow auf der Bühne Nina Gerhardt, Geschäftsführerin von RTL Radio Deutschland, und Christian Schalt, Geschäftsführer der Audio Alliance, ins Kreuzverhör.

Alexander Krawczyk über Laber-Podcast und Startup-Feeling bei ProSiebenSat.1.
Podcast-Junkie: "Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht", sagt Alexander Krawczyk im turi2 Jobs-Podcast. 2007, beim Studium in den USA, kommt er erstmals mit Podcasts in Berührung, heute hört der Senior Vice President von Seven.One Audio sechs bis acht Stunden Podcasts am Tag. Mit Startup-Mentalität hat er die Podcast-Sparte von ProSiebenSat.1 aufgebaut: "Nicht fragen, einfach machen, Tatsachen schaffen", ist Krawczyks Devise. "Es ist viel schwieriger für Bedenkenträger, 'Nein' zu sagen, wenn etwas bereits in der Welt ist und erste Erfolge vorweist", sagt Krawczyk im Gespräch mit turi2-Redakteur Björn Czieslik. Anfangs wurden seine Podcast-Aktivitäten im Konzern noch belächelt, doch inzwischen "sind wir ganz oben angekommen auf der Agenda, man nimmt uns wahr im Haus, merkt dass unsere Podcasts gut laufen". Rund 35 Menschen arbeiten inzwischen im Team von Seven.One Audio: Mindestens ein Arbeitstag in der Woche ist Office-Pflicht, wobei das nicht am Konzernsitz im Münchner Vorort Unterföhring sein muss, sondern auch an den P7S1-Standorten in Berlin, Hamburg, Frankfurt oder Düsseldorf möglich ist. Durch diese Flexibilität hat sich die Zahl der Bewerbungen fast verfünffacht im Vergleich zu früheren Stellen, die an Unterföhring gebunden waren, erinnert sich Krawczyk. Ein tägliches, digitales Morgen-Meeting, "das wir jeden Morgen religiös durchziehen", schafft ein Verbundenheitsgefühl. Gesucht sind Menschen, die Erfahrungen mit digitalen Medien haben: "Wir sind auch total offen für Quereinsteiger. Es gibt ja niemanden, der zehn Jahre Podcast-Erfahrung hat." Einen Radio-Background dagegen findet Krawczyk fürs Podcasten nicht hilfreich: "Meiner Meinung nach ist Podcast was ganz anderes als Radio. Es ist kein Abfallprodukt von Radio, es ist was eigenes mit eigenen Gesetzmäßigkeiten." Wenn Alexander Krawczyk auf Podcasts blickt, dann tut er das immer auch durch die Brille der Vermarktbarkeit: Die Personality-getriebenen und oft gescholtenen Laber-Podcasts eigneten sich dazu am besten. "Du baust mit deinen Podcastern eine sehr intime Beziehung auf über die Zeit." Deshalb seien die Hörerinnen von Laber-Podcasts auch die loyalsten: "Wenn man es schafft, einen Laber-Podcast im Leben von einem Hörer oder einer Hörerin zu etablieren, dann wollen die den auch nicht wieder gehen lassen. Man kündigt ja auch nicht seine Freundschaften." Der Markt der Laber-Podcasts mit Männern ist teilweise schon übersättigt, Potenzial sieht Krawczyk vor allem für Laber-Podcasts mit Frauen, etwa Bauerfeind + Kuttner. "Wir merken einfach, dass weibliche Hosts sehr viel stärker nachgefragt werden von der Werbebranche." Krawczyk wünscht sich, dass Podcasts noch mehr zum Massenmedium werden und neue, auch ältere Zielgruppen erreichen. Ein gutes Beispiel dafür sei Lanz & Precht. Durch den Podcast von ZDF-Talker Markus Lanz und Philosoph Richard David Precht hätten manche Menschen überhaupt erst zum Medium Podcast gefunden. "95 % der Deutschen haben ein podcast-fähiges Gerät immer in ihrer Tasche. Wir müssen sie dazu kriegen, dass sie das entdecken." Außerdem erzählt Krawzcyk, warum Video-Podcasts aus seiner Sicht viel Geld kosten, aber wenig Nutzen bringen, und für welche Zwecke sich Podcast-Werbung besonders eignet. Das Gespräch erscheint im Rahmen der turi2 Podcast-Wochen. Weitere Interviews, Podcasts, Profi-Tipps und Hör-Empfehlungen gibt es täglich bis zum 9. Oktober: https://www.turi2.de/podcastwochen Am 12. Oktober erscheint außerdem die gedruckte turi2 edition #19 Audio: https://www.turi2.de/edition19/ Jetzt schon das kostenlose E-Paper vorbestellen: https://www.turi2.de/bestellen/

"Möglichst diverse Leute" – Saruul Krause-Jentsch Arbeiten und Anderssein bei Spotify.
Auffälliger Aufstieg: "Es hat mir nie geschadet, irgendwie aufzufallen oder anders zu sein", sagt Saruul Krause-Jentsch im Jobs-Podcast mit turi2-Verlegerin Heike Turi. Mit Blick auf die steile Karriere der gerade einmal 33-Jährigen trifft das augenscheinlich zu: Nach Stationen bei Condé Nast und Bertelsmann geht Krause-Jentsch zu Spotify und ist dort seit 2020 als Head of Studios DACH verantwortlich für alles, was mit Podcasts zusammenhängt – von der Entwicklung neuer Formate über die Betreuung der mittlerweile über 70.000 deutschsprachigen Podcasts bis hin zum Entdecken neuer Talente. Seit 2022 erfreut sich Krause-Jentsch zusätzlich an der Schlagfertigkeit und dem schwarzen Humor der Briten, da sich ihr Zuständigkeitsbereich um UK und Irland erweitert hat. Durch Remote-Arbeit lassen sich die unterschiedlichen Regionen gut nebeneinander managen, erzählt sie. Generell schreibt Spotify das flexible Arbeiten groß. Zum Beispiel sind die Arbeitsplätze im Berliner Großraumbüro nicht fest zugeteilt. Persönliche Utensilien vermisst Krause-Jentsch an ihrem Schreibtisch nicht. Dass eines Tages mal ein Bild von ihrem Hund darauf steht, wäre ohnehin ihr größter Albtraum, lacht sie: "Diese Person bin ich nicht." Während der Corona-Zeit führt Spotify Work from Anywhere ein und bekommt dadurch Mitarbeitende, "die wir sonst nicht bekommen hätten". Das seien etwa Menschen, "die vielleicht eher von physischer Präsenz ausgeschlossen sind, weil sie Care-Arbeit zu Hause leisten". Mit regelmäßigen Get-togethers und Workshops vor Ort gibt es dennoch wichtige Anker: "Strategisch und kreativ arbeitet es sich in Person schon noch besser." Als Chefin legt Krause-Jentsch Wert darauf, einen klaren Fokus zu setzen – und dass jeder die langfristige Marschrichtung verinnerlicht. Dabei legt sie eine Geschwindigkeit an den Tag, die "teilweise ein bisschen überfordernd" sein kann, wie sie selbst zugibt. Dann müssen sie ihre Kolleginnen gelegentlich bremsen und sagen: "Das geht jetzt ein bisschen schnell, wir brauchen noch ein, zwei Überlegungen." Wer bei Spotify anfangen will, sollte neben einer Leidenschaft für das Thema Podcast eine "gewisse Macher-Mentalität" mitbringen, also keine Angst vor dem Scheitern haben. "Lieber machen, als reden", rät Krause-Jentsch allen Bewerbenden. Auch die Bereitschaft, "gerne etwas mehr geben" zu wollen, sei wichtig. Internationales Know-How kommt ebenso gut an, ist aber kein Muss. Denn gerade unterrepräsentierte, marginalisierte Gruppen hätten gar nicht die Möglichkeit, so viele Praktika zu machen. Schließlich sei es das Ziel, "möglichst diverse Leute" zu Spotify zu bringen. Wer beruflich weiterkommen will, sollte vor allem Fragen stellen, um aufzufallen: "Wer nicht fragt, wird doch häufig übersehen." Darüber hinaus erzählt Krause-Jentsch, was sie geworden wäre, hätte es nicht bei Spotify geklappt, ob sie sich selbst als Role Model sieht und warum ihr die Frage danach, ob es nicht schon genug Podcasts gibt, auf die Nerven geht. Das Gespräch erscheint im Rahmen der turi2 Podcast-Wochen. Weitere Interviews, Podcasts, Profi-Tipps und Hör-Empfehlungen gibt es täglich bis zum 9. Oktober. Am 12. Oktober erscheint außerdem die gedruckte turi2 edition #19 Audio – jetzt schon das kostenlose E-Paper vorbestellen. https://www.turi2.de/podcastwochen https://www.turi2.de/edition19/ https://www.turi2.de/bestellen/

Vincent Kittmann über Podcast-Boom und Potenziale.
Learning by doing: "Es gab niemanden, der richtig im Podcast-Business gearbeitet hat", erinnert sich Vincent Kittmann im Jobs-Podcast mit turi2-Redakteurin Pauline Stahl an die Anfänge seiner Podcast-Karriere, die mit einem Sprung ins kalte Wasser begonnen hat. Der heutige Chef von Podstars by OMR spielt von 2012 an als Profi in der 2. Basketball-Liga und übernimmt zwischenzeitlich die Marketingabteilung des Paderborner Vereins. 2016 hängt der schon damals nur privat passionierte Podcast-Hörer seine Schuhe an den Nagel und startet seine Karriere im Marketing-Bereich. Ohne Audio-Background bewirbt er sich auf eine Podcast-Stellenanzeige und steigt in das damals noch relativ überschaubare Podcast-Business ein. "Es gab vielleicht zwei bis drei Leute, die das Vollzeit gemacht haben", blickt Kittmann zurück. "Viele Sachen mussten wir neu denken und das müssen wir auch jetzt immer noch" – weil es damals noch keine vergleichbaren Vermarktungs-Unternehmen im Podcast-Sektor gegeben habe, an denen man sich hätte orientieren können. Angst vor einem abflauendem Podcast-Boom hat Kittmann nicht. Das Wort "Hype" versucht er in diesem Zusammenhang bewusst zu vermeiden. Anders als z.B. Clubhouse, das vor rund eineinhalb Jahren "schnell oben und dann auch sehr schnell wieder unten war", würde der Podcast-Markt "mehr oder weniger langsam und stetig wachsen" – und habe als On-Demand-Medium "einen ganz guten Platz in der Medienlandschaft" gefunden. Eine Konkurrenz unter den Podcasts sieht Kittmann nicht, vielmehr stünden die Mediengattungen an sich in Konkurrenz. Man konkurriere im Endeffekt auch mit Netflix, TikTok und Tageszeitungen: "Wir können alle nur eine begrenzte Mediennutzungs-Zeit pro Tag haben." Generell sieht Kittmann bei Podcasts noch viel Entwicklungspotenzial: "Man kann sich sehr gut abschauen, was in anderen Medien funktioniert", sagt er mit Verweis auf die vielen Dating- und Quiz-Shows im Fernsehen. Zudem stecke in der Zielgruppe 40+ noch viel Reichweite. Dem älteren Publikum müsse noch mehrfach erklärt werden, wie Podcasts funktionieren. Kittmann erzählt außerdem, was einen guten Podcast ausmacht und welche Faktoren nötig sind, damit er sich gut vermarkten lässt. Wichtig sei z.B. die Bekanntheit der Hosts, eine gewisse Regelmäßigkeit und eine ständige Weiterentwicklung des Formats: "Wenn ich die Hörer langweile und die das Gefühl haben, immer das gleiche zu hören, würden sie abspringen." Kittmann selbst nervt es, wenn Podcast-Macher das Medium und die Zuhörenden nicht ernst genug nehmen: "Ihr macht das doch für jemanden, dann gebt euch doch wenigstens Mühe." Am meisten fasziniert Kittmann die Mischung aus Unterhaltung und Information: "Durch Podcasts habe ich in den letzten Jahren auch extrem viel gelernt." Darüber hinaus erläutert Kittmann, warum die Werbeakzeptanz bei Podcasts generell sehr hoch ist und warum es gut ist, dass sich Radio-artige Spots bisher in Grenzen halten. Außerdem erklärt er, warum sich Podcast-Anfänger weder zu viele, noch zu wenige Gedanken machen sollten und weshalb sich eine Vermarktung im Idealfall schon für Nischen-Podcasts lohnt. Das Gespräch erscheint im Rahmen der turi2 Podcast-Wochen. Weitere Interviews, Podcasts, Profi-Tipps und Hör-Empfehlungen gibt es täglich bis zum 9. Oktober. Am 12. Oktober erscheint außerdem die gedruckte turi2 edition #19 Audio – jetzt schon das kostenlose E-Paper vorbestellen.

Podcast-Pionierin Larissa Vassilian über Schluss-Striche und Flausch aus dem Netz.
Nichts ist für die Ewigkeit: "Ich finde, man sollte mehr aus dem Internet wieder löschen", sagt Journalistin Larissa Vassilian im turi2 Jobs-Podcast. Von 2005 bis 2014 hat sie unter dem Pseudonym "Annik Rubens" den Podcast "Schlaflos in München" gemacht. Zu hören sind die Episoden ihres Audio-Tagebuchs heute nirgendwo mehr. Im Gespräch mit turi2-Redakteur Björn Czieslik erzählt sie auch, wie ihr der Deutschlern-Podcast Slow German "so viel Flausch" und ein "passives Einkommen" von 800 bis 1.000 Euro im Monat bringt. Und warum sie es liebt, wenn jemand für sein Thema brennt.

Armin Hierstetter über den Sprecher-Markt und gefragte Stimmen.
Armin sucht den Super-Sprecher: "Es ist nicht nur die Stimme allein, ihr müsst auch wissen, wie Ihr Euch vermarktet", sagt Armin Hierstetter im Jobs-Podcast mit turi2-Redakteur Björn Czieslik. Seine Casting-Plattform Bodalgo bringt Sprech-Profis und Auftraggeber zusammen. 12.000 Stimmen in 80 Sprachen hat er in seiner Datenbank. Bis 2008 war Hierstetter Verlagsleiter beim Männer-Magazin "FHM". Auf dem Höhepunkt der Finanz-Krise bekommt er die Kündigung und macht sich mit der Abfindung selbstständig. Bis heute ist Bodalgo eine One-Man-Show: Bei jeder neuen Stimme überprüft er persönlich, ob sie seinen Ansprüchen genügt. Eine Chance haben bei Bodalgo nur ausgebildete Sprech-Profis: Das kann eine Schauspielausbildung sein, die Arbeit beim Radio oder private Sprecherziehung. "Es reicht nicht, nur die gute Stimme zu haben, Du musst auch wissen, wie Du sie richtig einsetzt", sagt Hierstetter und warnt: "Ein Wochenendkurs macht Dich nicht zum Sprecher". Sprech-Profis dürfen nicht monoton klingen, "jeder Satz braucht einen eigenen Subtext, den man hören kann", sie sollten von Anfang an mit der Stimme präsent sein und keine Wort-Enden verschlucken. Die Aufnahme muss zudem technisch absolut sauber sein: Kein Einatmer, kein Hall, kein Hintergrundrauschen. Gerade für Neulinge gilt zudem: "Ohne Heimstudio geht gar nichts." Darauf zu hoffen, einen Sprech-Auftrag zu bekommen und sich dann ein Profi-Studio zu suchen, sei "Unsinn". Die gute Nachricht: Schon für unter 1.000 Euro lässt sich ein Aufnahme-Setting einrichten, "das sehr, sehr gut klingt". Wer diese Hürden genommen hat, sollte ein paar Sprach-Demos aufnehmen, sich auf Castings bewerben und Ausdauer haben: "Man muss schon ein bisschen resilient sein, denn 'Ablehnung' ist der zweite Vorname von 'Casting'." Gefragt sind weiterhin vor allem tiefe und dunkle Stimmen, beobachtet Hierstetter, wenn auch nicht mehr ganz so extrem, wie noch in den 1980er Jahren. Aus den USA komme der Trend zu nonbinären Stimmen, bei denen nicht eindeutig ist, ob sie männlich oder weiblich sind. Bei der Sprechweise sei in den USA "Conversational" sehr gefragt – also keine aufgesetzte Sprecher-Stimme, sondern Sprechen wie in einem Gespräch unter Freunden. Firmen und Agenturen, die eine Stimme suchen, empfiehlt Hierstetter ein möglichst präzises Briefing: Wofür kommt die Stimme zum Einsatz? Welche Art von Stimme soll es sein? Welche Ausdrucksweise soll sie haben: Frech und rotzig, gelassen oder mystisch? Sein Tipp: Wer schon eine konkrete Vorstellung hat, kann auch Beispiel-Stimmen angeben, z.B.: Klingt so wie die Synchronstimme von Morgan Freeman. "Es dauert vielleicht eine Minute, das Briefing zu schreiben, und es spart Dir so viel Zeit." Eine Vermittlungsgebühr kassiert Bodalgo weder von den Sprechern noch von den Auftraggebern. Hierstetters Geschäftsmodell sind die rund 2.000 Mitglieder, die eine monatliche Gebühr bezahlen. Im Jobs-Podcast spricht Armin Hierstetter außerdem darüber, wie die Sprecher-Branche auf sein disruptives Geschäftsmodell reagiert hat, warum Stimmen für Werbung am teuersten sind und was er am Arbeiten als Selbstständiger besonders schätzt. Das Gespräch erscheint im Rahmen der https://www.turi2.de/podcastwochen. Weitere Interviews, Podcasts, Profi-Tipps und Hör-Empfehlungen gibt es täglich bis zum 9. Oktober. Am 12. Oktober erscheint außerdem die gedruckte https://www.turi2.de/edition19/ Audio – jetzt schon das kostenlose E-Paper vorbestellen: https://www.turi2.de/bestellen/.

Arno Fischbacher über die Macht der Stimme – im Podcast, auf der Bühne und im Leben.
Der Ton macht die Musik: "Die Stimme ist ein Wunderwerk der Natur", schwärmt der Wirtschafts-Stimmcoach und Rhetoriktrainer Arno Fischbacher im turi2 Jobs-Podcast. Viele Dinge lassen sich allein an der Sprechweise ablesen, erklärt er im Gespräch mit turi2-Redakteurin Pauline Stahl. So sei etwa hörbar, "was du im Laufe deines Lebens getan hast, um dich zu entfalten". Besonders über den Führungswillen gebe die Stimme Auskunft: "Die Stimme drückt immer aus, inwieweit du bereit bist, den Prozess zu lenken." Verbergen lässt sich so gut wie nichts: "Ob du willst oder nicht: Du verrätst im Grunde ununterbrochen neu, mit welcher Einstellung du dem Anderen gegenübersitzt." Fischbacher gehört zwei Jahrzehnte lang zum Stamm-Ensemble des heutigen Schauspielhauses Salzburg, leitet das Theater von 1985 bis 1996 als kaufmännischer Direktor. Auch heute helfe es ihm noch, auf diese Erfahrungen zurückzugreifen. Schon damals sei die Stimme ein zentrales Element seines Daseins gewesen, aber auf der Bühne war es eben nur ein Element von vielen. Im Laufe der Zeit steht er immer öfter in Tonstudios, um Hörbücher oder Werbung einzusprechen: "Man hat offensichtlich etwas in mir entdeckt, was geldwert war." Eine schöne Stimme allein habe dafür nicht genügt, auch das Handwerkszeug des Schauspielers sei wichtig gewesen, betont Fischbacher. Fischbacher, der 2020 mit Stimme wirkt! unter die Podcaster geht, verrät außerdem, wie sich eine voluminöse Stimme trainieren lässt und wie junge Menschen stimmlich selbstbewusster werden können. Außerdem erklärt er, was gegen einen Blackout in einer Interview-Situation, u.a. im Podcast hilft, etwa das Ändern der Sitzposition: "In diesem Moment ist der Verstand mal auf Urlaub geschickt und regeneriert sich." Grundsätzlich gelte: "Wie du klingst, hängt 1:1 von dem ab, wie du gerade sitzt oder stehst." Außerdem erklärt Fischbacher, weshalb die Stimme ein "wesentlicher Futterkrug für die Menschen", ist: "Wir wollen von der Energie der anderen gefüttert werden." Sprechen Menschen aber träge, ziehen sie Energie von uns ab – "und der Autopilot in uns schaltet sofort die Aufmerksamkeit ab". Nur 0,4 Sekunden dauert es, bis Zuhörende aus den "Laut-Salaten" Worte im Sprachzentrum erkennen und verstehen. In dieser Zeit spielt sich eine Menge ab: In Sekundenschnelle werden z.B. "alle Dominanzen geregelt", "soziale Strukturen eingerichtet" sowie Antipathien oder Sympathien erzeugt. Das Gespräch mit Arno Fischbacher findet im Rahmen der turi2 Podcast-Wochen statt. Weitere Interviews, Podcasts, Profi-Tipps und Hör-Empfehlungen gibt es täglich bis zum 9. Oktober. Am 12. Oktober erscheint außerdem die gedruckte turi2 edition #19 Audio – jetzt schon das kostenlose E-Paper vorbestellen.

Dominik Sedlmeier über schlechte PR und Performance.
Quereinsteiger: "Dadurch, dass so wenig neuer Wind in die PR-Agenturen kommt, bleibt es relativ altmodisch", sagt Dominik Sedlmeier im turi2 Jobs-Podcast. Der CEO der PR-Agentur El Clasico Media findet, dass zu Public Relations mehr gehört, als Pressemitteilungen "durch den Verteiler zu jagen". Bei seinem Unternehmen liege der Fokus darauf, "Brands aufzubauen und Reichweite zu generieren für Experten, die es wirklich verdient haben". Im Gespräch mit turi2-Redakteurin Pauline Stahl erzählt er, dass ein Selbstexperiment ihm dabei geholfen hat, das dafür notwendige Netzwerk aufzubauen. Der 26-Jährige versucht innerhalb eines Jahres mit Interviews und Gastbeiträgen so oft wie möglich selbst in den Medien zu erscheinen. Das Endergebnis: "Über 100 Mal". Dadurch kenne er bei "den meisten großen Medien" mittlerweile "mindestens drei bis vier Journalisten". Die klassische Pressemitteilung gibt es für ihn deshalb nur für "extreme Nischen, wo wir keine Kontakte haben". Seine Kontakte in der Medienwelt baut sich Sedlmeier in relativ kurzer Zeit auf, denn auf dem Weg in die PR-Branche geht er einige Umwege. Sein Abitur bricht er ab, die Ausbildung zum KFZ-Mechaniker nimmt nach drei Monaten ein Ende, dann bewacht Sedlmeier mit seinem Hund nachts Gelände. Einigen Jahren im Bundeswehr-Dienstleistungszentrum und einer Flaute im Network-Marketing folgt der Einstieg ins Online Marketing. Als ein Kunde ihn fragt, ob er die PR für ihn übernehmen kann, sagt Sedlmeier zu – er will es lernen. Er erinnert sich zurück, wie oft er bei Veranstaltungen im Network Marketing Geschichten nach dem Motto "Vom Tellerwäscher zum Millionär" gehört hat: "Ich hab immer gedacht, das passt nicht zu mir". Mittlerweile erzähle er seine Geschichte, "die eins zu eins da rein passt". Der ungewöhnliche Werdegang beeinflusst seinen jetzigen Führungsstil stark, erzählt der CEO. "Am Anfang meiner Selbstständigkeit war ich relativ hart und bestimmt nicht fair". Doch bald habe er gemerkt, "dass es auch für die Unternehmens-Performance besser ist", wenn seine Kolleginnen glücklich sind. Seine Mitarbeitenden duze er und mache sogar gemeinsame Urlaubsreisen. Gleichzeitig kommuniziere er dennoch klipp und klar, was er von ihnen erwarte. In den meisten Fällen sei Sedlmeier mittlerweile aber "eher der Kumpeltyp".

Noah Leidinger über Aktien-Anfänger und Aktien-Analysen.
Aktien-Anhänger: "Aktien sind ein super Weg, um Menschen für Wirtschaft zu begeistern", sagt OMR-Redakteur Noah Leidinger, Podcast-Host bei "Ohne Aktien wird schwer" im turi2 Jobs-Podcast mit turi2-Redakteur Björn Czieslik. Schon allein wegen der kommenden "großen Rentenlücke" sei es sinnvoll, in Aktien zu investieren. Ihn selbst hat der YouTube-Algorithmus in die Aktien-Welt hineingezogen. Mit 13 Jahren kauft Leidinger seine erste Einzel-Aktie von Bayer – sein bisher schlechtestes Investment. Seine Eltern hatten gar keinen Bezug zu Aktien, erinnert er sich – seiner Mutter würde er deshalb auch nicht empfehlen, ins Aktien-Business einzusteigen, weil sie das "psychologisch eher nicht aushalten würde". Der Aktien-Markt sei nichts für Menschen, die bei Verlusten schnell nervös und panisch werden. Interessierten rät er, "nur in Sachen zu investieren, von denen man Ahnung hat". Erstes Wissen eignet sich Leidinger u.a. durchs Schreiben eigener Aktien-Analysen für Facebook-Gruppen an. Durch die Auseinandersetzung mit Unternehmens-Kennzahlen und Bilanzen lernt er, wie der Hase läuft. Zwischenzeitlich legt Leidinger in seiner Schulzeit ein "eng kapitalistisches Denken" an den Tag – und erfreut Lehrerinnen und Mitschülerinnen mit langen Diskussionen. In seinem Podcast ist es Leidinger wichtig, auch Risiken anzusprechen, also "offenzulegen, dass nicht in jede Firma und alles, was gehypt wird" eine Investition wert ist. Der Sponsoring-Partner Trade Republic und eigene Investments führen nicht zu einer Schere im Kopf, betont Leidinger: "Wir sind redaktionell komplett unabhängig und gehen auf die Themen ein, die wir spannend finden." Generell findet Leidinger es schade, dass sich "viel zu wenig Menschen" Gedanken übers Unternehmertun machen – selbst die größten Wirtschaftszeitungen in Deutschland hätten nur "ein paar Hunderttausend Auflage, obwohl es 80 Mio Menschen gibt". In seinem Podcast versucht Leidinger den Spagat, Neulingen Finanz-Themen schmackhaft zu machen, ohne dabei Stammhörerinnen mit Vorahnung zu verschrecken: "Die täglichen Hörer langweilen sich, wenn sie zum tausendsten Mal hören, wie sich der Firmenwert einer Firma zusammensetzt." Wert legt Leidinger vor allem für die Neulinge auf eine einfache Sprache und möglichst unkomplizierte Formulierungen. Noah Leidinger gibt eines von zehn Finanz-Fachinterviews in der aktuellen turi2 Edition #18 zum Thema Kapital.

Susan Moldenhauer über Geld, Gehalt und Gefühle.
Menschenkennerin: "Männer sind gut darin, Dinge zu kaschieren und sich zu verkaufen", sagt Susan Moldenhauer im turi2 Jobs-Podcast. Frauen hingegen gehen offener mit ihren Schwächen um und "sind viel selbstkritischer". Im turi2 Jobs-Podcast mit Redakteurin Pauline Stahl erklärt die Finanz- und Karriereberaterin die Gender Pay Gap nicht "per se mit einer absichtlichen ungleichen Bezahlung". Das Problem sei zum einen, dass sich viele Frauen "unter Wert verkaufen". Teilweise schätzen sie ihr Gehalt 20 bis 30 % niedriger ein als Männer. Zum anderen beobachtet Moldenhauer bei Frauen im Alter von Mitte bis Ende 30 eine "Art Familienknick". Während dieser Zeit bleiben sie zuhause, gehen in Elternzeit "und fordern danach die Weiterentwicklung im Job nicht mehr ein". Wer über eine Gehaltserhöhung verhandeln möchte, sollte grundsätzlich erstmal "mit sich selbst ins Gericht gehen", meint Moldenhauer. Während sie Themen wie Inflation oder Drohungen in dem Gespräch vermeiden sollten, gehe es eher darum, die "individuellen Mehrleistungen" hervorzuheben. Die Erfahrungen und das Wissen, das Moldenhauer aus mittlerweile grob über 2.000 Beratungen gesammelt hat, fasst sie in ihrem Buch Kenne deinen Wert! Der Gehaltsratgeber für Frauen zusammen, das im April 2022 erschienen ist. Einen solchen Guide brauche es, weil die Geschichte des Umgangs mit den eigenen Finanzen bei Frauen vergleichsweise jung sei. "Bis in die späten 70er Jahre konnte der Ehemann noch ohne Erlaubnis der Frau deren Arbeitsverhältnis kündigen", erzählt Moldenhauer. Häufig stelle sie in ihren Coachings fest, dass viele Frauen noch immer mit diesem "alten Bild" aufwachsen. Geld, Gehalt und Finanzen seien in Deutschland ohnehin ein "riesiges Tabuthema". Als Frau gebe es somit "zwei schwerwiegende Hindernisse" in ihren Köpfen, die den Umgang mit Finanzen erschweren. Moldenhauer studiert Kunstgeschichte, Slawistik und Sprachwissenschaften, als eine Kommilitonin sie in die Finanzwelt einführt. Das habe Moldenhauer so fasziniert, dass sie das Studium abbricht und schließlich eine Ausbildung zur Finanzwirtin macht. Als sie für ihren damaligen Arbeitgeber ein eigenes Team aufbauen und leiten darf, merkt Moldenhauer, "dass es mir Spaß macht, ganz intensiv mit Menschen zu arbeiten". Ein guter Coach braucht ihrer Meinung nach eine "gute Beobachtungsgabe" und "echtes Interesse an meinem Gegenüber". Nur so könne sie herausfinden: "Was ist da für ein Rohdiamant, den der Mensch feinschleifen kann." Susan Moldenhauer gibt eines von zehn Finanz-Fachinterviews in der aktuellen turi2 Edition #18 zum Thema Kapital.

Simon Schöbel über Investitionen und Instagram.
Fin-Experte: "Wenn man schnell reich werden will, ist das der schnellste Weg, genau das Gegenteil zu erreichen", sagt Simon Schöbel im turi2 Jobs-Podcast. Der Finfluencer klärt auf YouTube, TikTok und Instagram über Finanzthemen auf und beobachtet: "Gerade junge Leute wollen schnell reich werden." Die Gefahr dabei sei, dass sie "auf die falschen Leute hören" oder zum Beispiel in "spekulative Dinge" investieren. Im Gespräch mit turi2-Redakteurin Pauline Stahl sagt Schöbel, dass es der jüngeren Generation nicht mehr zwingend "um die Karriere der Karriere wegen" gehe, sondern "um Selbstverwirklichung" – und dabei helfe Geld. Wer den "Faktor Geld nach oben setzt", könne auch den "Faktor Zeit" erhöhen, sagt Schöbel. Der "klassische Karriereweg bis zur Selbstausbeutung ist in unserer Generation nicht mehr so stark gegeben". Den Traum, reich zu werden, zerstöre Schöbel seinen Followern auf Social Media nicht ganz, sage aber, dass es "länger dauert". Grundsätzlich wolle er seinem Publikum vermitteln, "weniger kurzfristig zu denken" und "eher langfristige Verhaltensmuster anzupassen". Dazu gehöre auch, sich von aktuellen News "nicht völlig aus der Fassung bringen zu lassen". So schrecklich der Krieg in der Ukraine sei – "solche Krisen wird es immer wieder geben". Für langfristige Anlagen über zehn bis 15 Jahre seien sie "ganz normal". In seinen 30- bis 40-sekündigen Videos greift Schöbel solche Themen eher nicht auf, weil er sie nur oberflächlich behandeln könnte. Lieber versucht er, seiner jungen Zielgruppe einen "konkreten Mehrwert" mitzugeben, etwa, warum sie ihr Geld nach einer Gehaltserhöhung nicht direkt für Designer-Klamotten ausgeben sollten oder wie sie beim Bewerbungsgespräch richtig über das Gehalt verhandeln. "Je konkreter der Tipp, desto interessanter", sagt Schöbel. Seine 230.000 Follower auf TikTok und 43.000 auf Instagram zeigen: Das Interesse an Finanzthemen ist da und größer als je zuvor: "Das war in der Vergangenheit eher ein Thema für Finanzberater." Mittlerweile werde in den Medien nicht nur viel mehr Info publiziert, auch die Zugänge dazu seien einfacher. Selbst die Einstiegsbarrieren beim Investieren sind gesunken, sagt Schöbel: "Man kann per Mausklick oder am Smartphone quasi für null Euro ETFs kaufen." Reich wird Schöbel mit seinen Videos nicht, "das ist mir aber auch nicht wichtig und nicht planbar". Von der Tätigkeit als Finfluencer kann er seit zirka einem halben Jahr leben. Bis er überhaupt die ersten Euro damit verdient habe, seien allerdings "anderthalb Jahre ins Land gestrichen". Simon Schöbel gibt eines von zehn Finanz-Fachinterviews in der aktuellen turi2 Edition #18. Das Buch zum Thema Kapital erscheint am 29. Juni.

Andrea Rexer über Perspektivwechsel und die Neugier auf Neues.
Seitenwechslerin: "Es macht Spaß, ein echter Teil von Veränderung zu sein", sagt Andrea Rexer, Kommunikations-Chefin der Hypo-Vereinsbank, im turi2 Jobs-Podcast. Nach Führungspositionen u.a. bei der "Süddeutschen Zeitung" und dem "Handelsblatt", hängt sie ihre Karriere als Wirtschaftsjournalistin 2020 an den Nagel. Im Journalismus musste Rexer immer darauf hoffen, dass "irgendeiner von den Unternehmen die Artikel liest und dann etwas ändert", erzählt sie im Gespräch mit turi2-Verlegerin Heike Turi. Jetzt könne Rexer selbst Dinge anstoßen und verändern. Kurz nach dem Seitenwechsel hatte Rexer zwischenzeitlich die Sorge, sich womöglich zu langweiligen: "Als Journalistin dachte ich immer, es gibt keinen tolleren Job, weil kein Tag wie der andere ist." Jetzt erfreut sie sich an ihren "unglaublich breit" gefächerten Aufgaben, bei denen ihr vor allem das strategische Denken Freude macht: "Früher habe ich nur geschrieben, heute kann ich Videos und Podcasts machen, Events organisieren und moderieren." An die "berühmten Abstimmungsschleifen" im Unternehmen habe sie sich aber erst einmal gewöhnen müssen. Statt wie als Journalistin das "schreiben zu können, was man denkt", muss sie nun mehrere Stakeholder in der Firma auf dem Zettel haben, die ein Wörtchen mitzureden haben. Eine berufliche Karriere ist für Rexer zwar wichtig, aber nicht alles: "Es muss auch Raum für ein Leben neben dem Job geben", sagt sie – und versucht, genau das ihrem Team vorzuleben. Außerdem verrät sie, dass sie weniger das Geld, sondern vielmehr die Neugier auf Neues antreibt, "sonst wäre ich im ersten Schritt vermutlich keine Journalistin geworden". Als Kommunikatorin bei der Hypo-Vereinsbank sei frischer Wind ausdrücklich erwünscht: Rexer hat dabei das Glück, einen Chef zu haben, der einen "kritischen Blick nicht nur erlaubt, sondern einfordert". Mit dem Begriff "Powerfrau" kann Rexer indes nichts anfangen. Sie findet es "komisch, dass man betonen muss, dass eine Frau Energie hat".

Sina Mainitz über Investitionen und Lampenfieber.
Keine Zockerin: "Ich glaube, dass sich in Punkto Geld verdienen und wofür man sein Geld einsetzt, ein Mentalitätswechsel vollzieht", sagt Sina Mainitz im turi2 Jobs-Podcast. Die ZDF-Börsenreporterin beobachtet, dass Geld heutzutage nicht mehr die Rolle spielt wie noch vor 50 Jahren. Mit turi2-Redakteurin Pauline Stahl spricht Mainitz außerdem über eine "gewisse Verschiebung" bei der Geldanlage. Vor ein paar Jahren hätten vor allem Investitionen in alternative Energien eine große Rolle gespielt, "und plötzlich kommen durch den Krieg in der Ukraine wieder Rüstungskonzerne empor". Trotz aller Unsicherheiten und Schwankungen im Finanzmarkt rät die Journalistin, sich mit der Geldanlage zu beschäftigen: "Es lohnt sich immer, anzufangen." Gerade an der Börse sei es jedoch gut, "wenn man einen langen Atem hat und nicht beim ersten Sturm die Flucht ergreift". Für Kryptowährungen hingegen "muss man geboren sein und eine gewisse Risiko-Bereitschaft mitbringen", sagt Mainitz. Obwohl Bitcoin & Co für sie keine Optionen sind, weiß sie, dass die digitalen Währungen am Finanzmarkt mittlerweile "eine große Rolle spielen". Es war nicht der kein Kindheitstraum von Sina Mainitz, dass sie sich mal hauptberuflich mit Finanz-Themen beschäftigt und live im TV darüber berichtet. Nach dem Abi wollte die heute 45-Jährige "etwas mit Medizin" machen und hat Pharmazie studiert. "Ich war aber zu schlecht in Chemie", sagt sie. Weil sie Stärken im "sprachlichen Bereich" entdeckt, studiert sie schließlich dual Medien- und Kommunikationswissenschaften mit der Vertiefung Journalismus und PR – eine Entscheidung, "die ich immer wieder so machen würde". So landet sie beim ZDF, testet für das "Mittagsmagazin" Autos – "eine ganz tolle Zeit" – und kommt 2008 schließlich an die Börse. Seitdem berichtet Mainitz für alle aktuellen ZDF-Sendungen live vom Frankfurter Börsenparkett. Nach 14 Jahren habe sie zwar kein Lampenfieber mehr, "eine gesunde Anspannung und ein gewisser Pegel an Adrenalin gehören aber dazu", sagt die Reporterin. Da sei es von Vorteil, "wenn man eine Rampensau ist". Um beim Job abzuliefern, braucht Mainitz einen Ausgleich. Vor einem Gespräch beim ZDF jogge sie häufig durch den Wald und versuche, sich mit "ganz anderen Dingen zu befassen". Auch Yoga kann die zweifache Mutter empfehlen. Grundsätzlich "darf man nie vergessen, was einem selbst gut tut". Sina Mainitz ist eine von 11 Porträtierten in der neuen turi2 edition #18. Das Buch zum Thema Kapital erscheint am 29. Juni 2022.

Hans-Jürgen Jakobs über Morning-Briefing und Mitmach-Journalismus.
Bleibt am Boden: "Journalistisch habe ich noch nie mit so vielen Menschen konstant in Verbindung gestanden", sagt Hans-Jürgen Jakobs im turi2 Jobs-Podcast. Der ehemalige "Handelsblatt"-Chefredakteur schreibt mittlerweile als Senior Editor fünf Mal wöchentlich das Handelsblatt Morning Briefing und erreicht damit via E-Mail knapp 100.000 Menschen täglich. Im Gespräch mit turi2-Verleger Peter Turi sagt Jakobs, dass die Zeitung damit nicht viel Gewinn macht – aber das sei auch gar nicht nötig: Das Ziel des Newsletters müsse ein Kanal für "Mitmach-Journalismus" sein, sagt Jakobs. Dazu gehören seiner Meinung nach – vor allem um jüngere Menschen zu erreichen – auch Podcasts: "So wie man früher die Zeitung zusammen im Bett gelesen und einzelne Teile ausgetauscht hat, so ist das jetzt mit Podcasts." Damit das Morning Briefing pünktlich vor 6 Uhr morgens im Postfach der Leserinnen landet, arbeitet Jakobs bis spät in die Nacht. Sowohl die Deadline um 1.30 Uhr als auch die maximale Anzahl von 5.500 Zeichen pro Newsletter überschreitet der Journalist häufig. Denn manchmal, wenn er gerade denkt, er sei fertig, "werfe ich einen letzten Blick auf internationale Websites und dann ist da doch noch was". Dass er gleichzeitig sowohl Autor als auch Schlussredakteur ist, gibt Jakobs ein "maximum an Freiheit, aber auch ein maximum an Verantwortung". Ein Kindheitstraum ist sein Werdegang nicht: "Journalismus war nicht meine erste Wahl." Der gelernte Diplom-Volkswirt will promovieren, dafür werden dann jedoch die Gehälter gestrichen. Weil er parallel als Handball-Reporter für das "Wiesbadener Tagblatt" arbeitet, bekommt er schließlich ein Volontariat angeboten – das er annimmt. Über diese Entscheidung ist er heute vor allem dann froh, wenn er mit seinem Team lange recherchiert und "dann eine Geschichte hat, die neu und wichtig ist, weil sie etwas bewirkt". Ein gutes Team braucht laut Jakobs "gute Leader und Schreib-Stars, aber auch Prima Donnas". Es gehöre dazu, dass verschiedene Rollen existieren. Wichtig sei, "dass man die Unterschiedlichkeiten gut zusammenbringt". Journalismus-Einsteigerinnen rät er, "sich jeden Tag eine Stunde für gezieltes Lesen zu reservieren". Ein weiterer Tipp des Redakteurs: "Nicht abheben." Er wisse wie es ist, das erste Mal den eigenen Namen in der Zeitung zu lesen: "Man hat das Gefühl, man kann fliegen." Dennoch sollten Medienschaffende seiner Meinung nach demütig sein und immer überlegen: "Was hat dein Artikel bei anderen bewirkt?"

Peter Hogenkamp über die Zukunft der Newsletter.
News-Kurator: Verlässlichkeit ist beim Newsletter-Versand "das Allerwichtigste", sagt Peter Hogenkamp im turi2 Jobs-Podcast. Diese eine Mail müsse sich in der Inbox der Empfängerinnen "gegen 100 oder 1.000 andere Mails durchsetzen". Der Journalist und Digitalexperte leitet seit 2014 die Scope Content AG in Zürich. Mit seinem Unternehmen bietet er eine Software für die Nachrichten-Kuratierung – die populärste Anwendungsform sind laut Hogenkamp Newsletter. Mit turi2-Verleger Peter Turi spricht er u.a. darüber, was einen guten Newsletter ausmacht. Er müsse etwa in einer "relativ verlässlichen Frequenz" erscheinen. Das könne täglich, wöchentlich oder zweiwöchentlich sein – alles darüber hinaus sei kein "klassisches Newsletter-Format" mehr. Hogenkamp selbst mag eine "persönliche Stimme" zu Beginn des Newsletters. Dieses Format à la Gabor Steingart oder Florian Harms sei "bei fast jedem Thema ein guter Ansatz" und helfe vor allem dabei, etwas neues aufzubauen. Grundsätzlich geht es bei einem Newsletter immer darum, Zeit zu sparen, meint Hogenkamp. Indem eine andere Person, die "sachkundig ist" und Themen einordnen kann, eine Zusammenfassung liefert, müsse sich die Leserin nicht selbst dem "Nachrichtenstrom" aussetzen. "Deswegen sind kuratierte Newsletter aller Art so erfolgreich", sagt Hogenkamp. Er sieht das Format als ein "Transport-Medium", mit dem "alles mögliche" über verschiedene Wege verschickt werden kann. Trotz "aller moderner Tools" sieht Hogenkamp nicht, "dass E-Mail in absehbarer Zeit ausstirbt". Der "Brief in elektronischer Form" sei ein Standard, den "jeder liest, jeder braucht". Auch die jüngere Generation komme nicht daran vorbei, "ob sie will oder nicht". Seiner Einschätzung nach, wird sich am Erfolg des Newsletter auch deshalb so schnell nichts ändern – auch nicht in Zeiten von Kurzvideos auf TikTok. "So lange das Smartphone noch da ist, glaube ich nicht, dass wir eine riesige Verschiebung im Medienkonsum sehen werden", meint Hogenkamp. Text – und damit auch der Newsletter – "wird uns noch eine Weile erhalten bleiben".

Thorsten Schabelon über Krankenhaus und Kommunikation.
Bleibt flexibel: "Wir sind eine Art Übersetzer, ein bisschen wie die Sendung mit der Maus", sagt Thorsten Schabelon im turi2 Jobs-Podcast. Der Kommunikations-Leiter des Uniklinikums Essen sagt, dass die Medizin komplex ist und die Sprache daher "sehr präzise" sein muss. Im Gespräch mit Björn Czieslik und Pauline Stahl von turi2 erklärt er, dass es u.a. die Aufgabe seines Teams ist, diese komplexen Themen für die Medien zu "übersetzen und aufzubereiten". Das habe sich seit der Pandemie extrem verstärkt: "Corona war kommunikativ und medial ein unglaublicher Beschleuniger." Hatte das Uniklinikum 2015 noch 2.000 Medienartikel, waren es 2021 schon 17.000. Auch überregional habe es etwa von "Focus", "Bild" oder T-Online plötzlich viel mehr Medienanfragen gegeben. Verstärkt kommen seitdem auch TV-Teams in das Krankenhaus. Kürzlich hat etwa Eckart von Hirschhausen für die ARD eine Doku über Long- und Postcovid in der Neurologie gedreht, erzählt Schabelon. Sein journalistischer Hintergrund hilft Schabelon dabei, mit all diesen Medienanfragen umzugehen. Das Erkennen eines Themas zum Beispiel "lernt man nirgendwo so gut wie im Journalismus". Außerdem kenne der langjährige "WAZ"-Redakteur die redaktionellen und zeitlichen Abläufe und wisse, welche Themen für welches Medium geeignet sind. Ein Muss ist eine journalistische Ausbildung für seinen Job allerdings genauso wenig wie ein medizinischer Hintergrund. Zu Schabelons Team gehört eine ausgebildete Pflegekraft, zwei Kolleginnen kommen aus der Kommunikation und eine habe ein klassisches Zeitungsvolontariat gemacht. Wichtiger sei es es, gut kommunizieren zu können: "Man sollte keine Angst haben, ans Telefon zu gehen und mit Menschen zu sprechen", sagt Schabelon. Schließlich "kommen da die Geschichten her". Auch Neugier und ein gutes Netzwerk hält er für wichtig. Grundsätzlich ist in Schabelons Team niemand nur für einen bestimmten Bereich zuständig. Sie kümmern sich um die interne und externe Kommunikation, bereiten Veranstaltungen vor, gestalten neue Beschilderungen und bespielen Social Media – "das ist schon relativ bunt". Für ihn zähle daher, "dass Leute flexibel einsetzbar sind". Dazu gehört auch die Vielfalt der Kanäle, die Schabelon zur Kommunikation nutzt. Immer mehr laufe über Social Media und einen wöchentlichen Newsletter oder E-Mails. Gleichzeitig arbeite sein Team aber auch noch ganz Analog mit Plakaten. "Man muss halt flexibel und beweglich bleiben", meint Schabelon. "Wir sollten nicht zwischen digital und analog entscheiden, sondern überlegen, wie wir möglichst viele Leute erreichen."

Lorenz Maroldt über "Checkpoint" und Community.
Nachteule: Wenn sich Lorenz Maroldt an die Anfänge seines Checkpoint-Newsletters im Jahr 2014 erinnert, "habe ich viele skeptische Stimmen in Erinnerung", sagt er im turi2 Jobs-Podcast. Im Gespräch mit Verleger Peter Turi erzählt der "Tagesspiegel"-Chefredakteur, damals seien Kolleginnen besorgt gewesen, der Newsletter "kannibalisiert die Zeitung", E-Mail sei zu alt und es stecke zu wenig "Tagesspiegel" drin. Maroldt hängt sich trotzdem rein und kommentiert jeden Tag mit spitzer Feder Berlins Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Damit er pünktlich um 6 Uhr morgens die E-Mails versenden kann, riskiert er Freundschaften: "Abends konnte ich entweder gar nicht oder saß auf heißen Kohlen." Anders als viele Abonnentinnen denken, stecke in dem Newsletter viel Energie und harte Arbeit, die sich Maroldt mittlerweile mit einem Team teilt. Leichtigkeit zu vermitteln, ist jedoch genau sein Ziel: "Die Leser und Leserinnen haben das Gefühl, das erzählt mir einer mal kurz." Hätte er anfangs genau gewusst, was auf ihn zukommt, "hätte ich einen Ticken zu lange überlegt und es doch nicht gemacht". Der "Checkpoint", der mittlerweile eine Community sei, ist eines von nun mehr als 50 Produkten des "Tagesspiegels". Die "bunte Produkt-Palette" reicht laut Maroldt von verschiedenen Newslettern über Veranstaltungen zu Podcasts. Vor einigen Jahren habe es nur die Printausgabe und den Online-Auftritt gegeben – die auch in Zukunft Bestand haben, meint Maroldt. Trotz der vielfältigeren Formate rechnet der Chefredakteur damit, dass sich der Journalismus in Zukunft wieder in Richtung Expertise bewegt. Demnach werde es wichtiger, "dass man versucht, einen Ticken mehr zu wissen, als die Experten in ihren Berufen". Auf "gute Allrounder" sei etwa eine Lokalredaktion zwar weiterhin angewiesen, "Spezialisierung ist aber der richtige Weg". Für all das braucht es vor allem "Leidenschaft und Neugier", sagt Maroldt. Nichts nerve mehr, als Kolleginnen "die einfach nicht mehr neugierig sind". Außerdem sollten sich Medienschaffende immer wieder selbst hinterfragen, "sich neu inspirieren lassen". Auf diese Fähigkeiten und Einstellungen achtet Maroldt auch bei Nachwuchs-Journalistinnen. Er sei nicht "grundsätzlich überzeugt, wenn ein*e 25-Jährige*r wahnsinnig schnell viel gemacht hat nach der Schulzeit". Da fehle ihm häufig die "Unfall-Erfahrung", die alle im Leben irgendwann sammeln müssten. Der Podcast erscheint im Rahmen der Newsletter-Wochen zum 15. Geburtstag der Gattung Morgen-Newsletter.

Christoph Hartlieb über die Suche nach guten Führungskräften.
Auf der Jagd: "Ein Chefredakteur, der sich nicht mit Digitalthemen auseinandersetzt, wird es schwer haben", sagt Christoph Hartlieb im turi2 Jobs-Podcast. Der Headhunter für Führungskräfte in der Medien- und Digitalbranche spricht mit turi2-Autor Roland Karle darüber, wie sich Jobanforderungen in der Branche in den vergangenen Jahren verändert haben. Seit der Gründung 2008 habe sein Unternehmen Hartlieb Partner Executive Search etwa 900 Positionen besetzt. Angefangen im Medienbereich, sei die Beratung "schnell in digitale Themen" übergegangen. Das liege u.a. daran, dass sich "viele Positionen in den Anforderungen sehr stark digitalisieren". Dadurch haben es auch Kandidatinnen schwer, "wenn sie digital gar nicht stattfinden". Ein "gut gepflegtes Linked-in Profil" und "ein bisschen in der Öffentlichkeit stattzufinden", kann laut Hartlieb nicht schaden. Andererseits sollten Job-Anwärterinnen nicht ihr "ganzes Privatleben auf Social Media offenlegen". Auch er als Headhunter nutzt Plattformen wie Xing und Linked-in, um mit interessanten Menschen Kontakt aufzunehmen. Dann gehe es darum "sie in den Prozess zu holen und zu begeistern". Hartlieb persönlich mache es am meisten Spaß, wenn jemand am Anfang gar nicht interessiert ist. "98 % der Kandidatinnen suchen ja gar keinen Job", sagt er. Häufig rufen die Kandidatinnen dann nach drei Monaten im neuen Job an und "bedanken sich, weil es genau das richtige war". Um das zu erreichen, hilft es laut dem ehemaligen CEO, eigene Management-Erfahrung zu haben, "weil man Strukturen und Positionen versteht". Außerdem brauchen Headhunter ein "gutes Gefühl für Menschen" und sollten in der Lage sein, ein "nachhaltiges Netzwerk" aufzubauen. Er müsse immer "sauber arbeiten" – auch gut begründete Absagen gehören zum Alltag. Das Headhunter-Geschäft ist diskret, sagt Hartlieb. Auch deshalb, weil er Angestellte aktiv aus Firmen heraushole. "Das nicht ganz transparent werden zu lassen, ist Usus in dem Markt." Lorbeeren für neu besetzte Stellen kann er also nicht ernten. Trotzdem muss Hartlieb schmunzeln und ist stolz, wenn er "turi2 liest und weiß, hinter wie vielen der neuen Personalien man steckt". Christoph Hartlieb ist eines von 100 Jobs-Vorbildern aus der turi2 edition #17. Das Buch zum Thema "Arbeiten in der Kommunikation" gibt es hier als kostenloses E-Paper. Die Podcast-Reihe turi2 Jobs begleitet die Buch-Veröffentlichung und die neue Jobs-Plattform turi2.de/jobs. turi2.tv (XY-Min-Podcast auf YouTube), turi2.podigee.io, spotify.com, podcast.apple.com, deezer.com, audionow.de Text: Pauline Stahl

Michael Bröcker über Newsletter, Podcast und Video als medialen Dreiklang.
Digital-Pioneer: Viele Tageszeitungen haben das Problem, "dass sie zu viel Kapazitäten, Gehirnschmalz und Technik immer noch in Strukturen geben, die nicht zeitgemäß sind", sagt Michael Bröcker im turi2 Jobs-Podcast. Der ehemalige Chefredakteur der "Rheinischen Post" steuert nun als Chefredakteur von The Pioneer das Redaktionsschiff "PioneerOne" von Gabor Steingart. Im Gespräch mit Peter Turi kündigt er einen Vorstoß in digitalen Lokal-Journalismus an. Er sagt, dass "ein guter Newsletter" für eine Stadt als "digitale Tageszeitung" dienen kann und Print nicht mehr nötig sei. Außerdem verrät er, dass Bewegtbild bald eine größere Rolle auf dem Schiff spielt, etwa in Form eines politischen Formats in Kooperation mit Netflix oder verschiedenen TV-Sendern. Für Entlastung soll dann ein zweites Pioneer-Medienschiff dienen, das zurzeit gebaut wird. Die "PioneerTwo", laut Bröcker ein "multimediales Technik-Wunder", soll ab 2024 europäische Wasserstraßen befahren. Mit verschiedenen Live-Events will Media Pioneer seinen Abonnentinnen einen "Mehrwert" bieten. Es gehe nicht mehr nur darum, "Sender von Information, Kommentaren und Analysen" zu sein. "Journalismus muss Community-building sein", sagt Bröcker. Das wichtigste seien jedoch nach wie vor die Inhalte: "Am Ende jeden journalistischen Models muss es guter Content sein". Für eine gedruckte Tageszeitung sieht Bröcker keine Zukunft, dennoch sei Print nicht grundsätzlich tot. Es gebe "viele tolle Magazine und Bücher". Trotzdem ist der Journalist sicher, dass die Zukunft des Journalismus "konsequent digital, live und mobil" ist. Medienunternehmen, die Geld in Technologie, dateninformierten Journalismus, Newsletter und Podcasts stecken, seien "zukunftsfester aufgestellt". Durch all die verschiedenen Formate können Journalistinnen heutzutage eine Vielfalt erleben, "die hat es in meinem Volontariat nie gegeben", meint Bröcker. Gerade jetzt könne er jungen Journalistinnen den Einstieg in die Medienwelt besonders empfehlen. Sie sollten dabei allerdings beachten, dass es nicht mehr genüge, einen sehr guten Text zu schreiben: "Du musst in der Lage sein, den Content an den Mann und an die Frau zu bringen." Eine "kleine graue Maus" werde es im Journalismus der Zukunft daher schwer haben. Der Podcast erscheint im Rahmen der Newsletter-Wochen zum 15. Geburtstag der Gattung Morgen-Newsletter. turi2.tv (45-Min-Podcast auf YouTube), turi2.podigee.io, spotify.com, podcast.apple.com, deezer.com, audionow.de

Katherina Reiche: "Hierarchie-Stufen sind mir ziemlich schnuppe.”
Tough Cookie: In Zeiten, in denen "die Politik der Wirtschaft misstraut" und umgekehrt, ist es umso wichtiger, "dass man in einem stetigen Austausch ist", sagt Katherina Reiche im turi2 Jobs-Podcast. Deswegen ist die Chefin der E.on-Tochter Westenergie und ehemalige CDU-Politikerin froh, beide Seiten zu kennen. Im Gespräch mit turi2-Verleger Peter Turi sagt sie, es sei nicht gut, wenn sich jeder in "Filterblasen" zurückzieht, "wie wir das auch in der Gesellschaft sehen". Einigung sieht sie hingegen in Sachen Klimaschutz. Obwohl Reiche die Bilder aus der Ukraine "tief treffen", beschleunige der Krieg zumindest eins: "Die Überzeugung, dass wir die Energiewende und den Klimaschutz vorantreiben müssen". Auch die bisherigen Sanktionen gegen Russland im Zuge des Kriegs unterstütze Reiche: "Das schrittweise Vorgehen der Regierung ist gut und klug". Es müsse bedacht werden, dass Gas in Deutschland nicht nur zum Beheizen von Wohnungen und Krankenhäusern genutzt werde, "sondern für deutlich mehr als ein Drittel der Industrieprozesse". Der Schaden eines unmittelbaren Wegfalls von Gaslieferungen wäre daher "sehr groß". Nicht nur in Krisenzeiten ist es für Reiche wichtig, zu kommunizieren – sowohl intern als auch nach außen. "Kommunikation ist ein absolut wichtiger Baustein, ein Unternehmen erfolgreich zu führen", sagt sie. Eine gute Mitarbeiterbindung sei nur möglich, "indem man spricht, sich austauscht, zuhört und wertschätzend argumentiert". Auch Fehler sollten diskutiert werden – "nicht, um jemanden bloßzustellen, sondern um besser zu werden". Um all das gewährleisten zu können, braucht es laut Reiche Leidenschaft für Themen, Disziplin, Organisation und "eine gewisse Stressresilienz". Die 48-Jährige kommuniziere sehr offen und direkt, "Hierarchie-Stufen sind mir ziemlich schnuppe". Ihre Mitarbeitenden würden sie wahrscheinlich als "tough cookie" bezeichnen. Ihr sei vor allem ein "menschliches Unternehmen" wichtig, "wo man gerne arbeitet". Als weibliche Führung eines technischen Unternehmens betont Reiche, dass auch Bewerberinnen gerne gesehen sind. "Wir sind ein Unternehmen, wo du als Mädel gut aufgehoben bist." Reiche, selbst Mutter von drei Kindern, möchte Kolleginnen die Chance geben, "Familie und Beruf zu vereinbaren". Katherina Reiche ist eines von 100 Jobs-Vorbildern aus der turi2 edition #17. Das Buch zum Thema "Arbeiten in der Kommunikation" gibt es hier als kostenloses E-Paper. Die Podcast-Reihe turi2 Jobs begleitet die Buch-Veröffentlichung und die neue Jobs-Plattform turi2.de/jobs. [turi2.tv](https://youtu.be/hxhDNRAvFjg) (42-Min-Podcast auf YouTube), turi2.podigee.io, spotify.com, podcast.apple.com, deezer.com, audionow.de Text: Pauline Stahl

Andreas Fischer-Appelt: “Wer gut schreiben kann, hat einen riesigen Fundus.”
Unternehmer-Herz: "Ich wollte nie konservativ sein", sagt Andreas Fischer-Appelt im turi2 Jobs-Podcast. Im Gespräch mit turi2-Verleger Peter Turi verrät der Gründer und Vorstand der Agenturgruppe FischerAppelt, dass er es in manchen Situationen dennoch ist. Grundsätzlich versuche er, "für das neue zu sein" und "etwas auszuprobieren". Allerdings gebe es auch Dinge, "die muss man sein lassen, weil man die Lebenserfahrung hat, dass man damit nicht arbeiten kann". Progressivität wollen er und sein Bruder und Mitgründer Bernhard Fischer-Appelt auch bei der Mitarbeiterinnen-Suche zeigen. Ihnen gehe es eher darum, "Top-Talente zu kriegen" und diese an passenden Stellen einzusetzen, als sich auf strikte Stellenbeschreibungen zu versteifen. Dabei muss der Unternehmer mittlerweile "echt dafür werben und etwas bieten", um passende Mitarbeitende zu finden. Wer in der Kommunikation arbeiten will, sollte sich die Branche anschauen, Kontakt aufnehmen und "herausfinden, was für eine Kultur in der Firma herrscht", rät Fischer-Appelt. Job-Portale allein reichen seiner Meinung nach nicht aus. Wichtiger sei es, mit bestehenden Mitarbeitenden zu sprechen. Großen Respekt habe er vor jungen Bewerberinnen, die schon wissen, was sie können und wollen: "Darauf kannst du aufbauen". Auch "sprachliche Kompetenz" spielt für Fischer-Appelt eine große Rolle. "Wer gut schreiben und erzählen kann, hat einen riesigen Fundus." Das könne sowohl als Journalistin als auch in der Kommunikations-Branche eingesetzt werden. Einsatzmöglichkeiten gebe es in der Agentur viele: "Wir haben inzwischen bestimmt 50 Berufsbezeichnungen in der Firma". Fischer-Appelt, der selbst schon als Kind vom Handel fasziniert war, will genau das auch bei seinen Mitarbeitenden sehen. "Die Inspiration unternehmerisch zu denken, Bereiche auszubauen und soziales Engagement zu bringen, wird gefördert." Im Vordergrund stehe bei Fischer-Appelt immer, "moderne PR zu machen, Menschen direkt zu erreichen und Verhaltensveränderungen durchzuführen". Andreas Fischer-Appelt ist eines von 100 Jobs-Vorbildern aus der turi2 edition #17. Das Buch zum Thema "Arbeiten in der Kommunikation" gibt es hier als kostenloses E-Paper. Die Podcast-Reihe turi2 Jobs begleitet die Buch-Veröffentlichung und die neue Jobs-Plattform turi2.de/jobs.

Christof Ehrhart über Journalismus und PR: “Eine Karriere ist ein Marathonlauf”
Blick auf die Zielgerade: Junge Menschen in der Kommunikationsbranche sollten frühzeitig ihr "Ambitionsniveau" festlegen, rät Christof Ehrhart, Chefkommunikator von Bosch im turi2 Jobs-Podcast. Er fragt den Nachwuchs immer: "Wo sehen Sie sich im Scheitelpunkt Ihrer Karriere?" – und ist überrascht, "wie selten jemand eine Vision hat", erzählt er turi2-Gründer Peter Turi. Ehrhart betrachtet seine eigene Karriere als Marathonlauf. Ihm sei früh bewusst gewesen, was er erreichen will und was er bereit ist, dafür zu tun. Und: "Ich muss auch für die hinteren Kilometer noch Energie übrig haben." Ehrhart, ein "klassisches Lower-middle-class-Kid“, studiert Politikwissenschaft und arbeitet als TV-Journalist, bevor er sich in die raue Welt von Tabak und Arzneimitteln begibt, um auch Kommunikation im Gegenwind zu beherrschen. Seit 2019 ist er Leiter der Unternehmenskommunikation beim Technik-Konzern Bosch. Peter Turi will von ihm, der beide Seiten kennt, wissen, wer denn im Journalismus, wer in der PR besser aufgehoben ist. "Wenn jemand Lust hat, die Welt mit guter Kommunikation zu einem besseren Ort zu machen, dann muss er nicht unbedingt Journalist werden", ist Ehrhart überzeugt. Er kann in seinem Job an vielen Stellen darauf verweisen, welche Folgen eine wirtschaftliche oder politische Entscheidung hat. In der Unternehmenskommunikation könne er zudem etwas "mit aufbauen". In dieser Rolle fühle er sich wohler als in der des Beobachters, die er als Journalist hatte. So oder so: Jede Erfahrung sei wertvoll gewesen für seine Karriere. "Alte Zirkuspferde erschrecken nicht so schnell, wenn es knallt und blitzt", sagt er. Auf Trends springe er nicht hastig auf, was aber nicht bedeutet, dass er die PR bei Bosch nicht weiterentwickeln will. Das bloße Fokussieren auf Zielgruppen habe ausgedient, "Beziehungsmanagement" sei nun gefragt: Nicht nur große Kampagnen, auch direkte Gespräche zählen. Das funktioniere besonders gut in einer Firma, die auch intern auf Augenhöhe kommuniziert. Sein neuer Chef Stefan Hartung sei der erste, den er von Anfang an duze. Und: "Bei Bosch habe ich die Krawatte für immer ausgezogen." Was nicht bedeute, dass sich Ehrhart nicht gerne schick anziehe, betont er. Während des Studiums habe er immerhin in einer Herrenmodenabteilung gejobbt. "Wenn man Fragen wie 'Steht mir das?' beantworten kann, kann man auch die Kommunikation eines Weltkonzerns leiten", witzelt er. Christof Ehrhart ist eines von 100 Jobs-Vorbildern aus der turi2 edition #17. Das Buch zum Thema "Arbeiten in der Kommunikation" gibt es hier als kostenloses E-Paper. Die Podcast-Reihe turi2 Jobs begleitet die Buch-Veröffentlichung und die neue Jobs-Plattform turi2.de/jobs.

Christine Scheffler über den Wandel im Job-Markt: “Das Thema Haltung hat eine unglaubliche Relevanz”
Optimistin: Christine Scheffler hatte "Glück im Leben" und ist "in den richtigen Momenten durch die richtigen Türen gegangen", sagt sie im turi2 Jobs-Podcast. Die Personalchefin von ProSiebenSat.1 möchte nun Menschen, die "nicht so viel Glück hatten", dabei unterstützen, ihren Weg zu gehen. Im Gespräch mit turi2-Verlegerin Heike Turi verrät sie, dass es aber auch in ihrem Leben Dinge gibt, "die nicht geglückt sind". Doch sowohl die Absage der Journalistenschule als auch der mehrfache Studienfach-Wechsel seien für sie Schritte gewesen, um herauszufinden, "was mir wirklich Spaß macht". Grundsätzlich findet Scheffler: "Wer nie gescheitert ist, hat vielleicht nicht genug ausprobiert." Nach diesem Motto führt sie auch ihre Bewerbungsgespräche. Es gehe weniger um den "super-straighten Lebenslauf" als darum, was die Bewerberinnen für Menschen sind: "Wissen sie, wo sie hin wollen? Haben sie aus Fehlern gelernt und sich weiterentwickelt?" Scheffler höre vor allem auf das, "was nicht gesagt wurde" und spreche direkt Stationen an, welche die Bewerberinnen schnell überspringen. "Es ist spannender, Menschen zu haben, die sich ihren Weg selbst bauen und ihn dann auch gehen", sagt die Personalvorständin. Aber auch Dinge wie Auslandserfahrungen seien wichtig: "Da lernt man unglaublich viel über sich und über das, was einem wichtig ist." In den vergangenen Jahren beobachtet Scheffler, dass Themen wie Personal und Nachhaltigkeit immer wichtiger werden. "Der Bewerbermarkt hat sich komplett gedreht." Für Arbeitgeber sei es "unglaublich wichtig, für Menschen attraktiv zu sein, sie zu halten, sie weiterzuentwickeln, sie zu binden". Für Arbeitnehmer habe auch die Haltung eines Unternehmens eine "unglaubliche Relevanz". In Zeiten "in denen man schnell die Orientierung verliert, will man einen Arbeitgeber, der Position bezieht". Christine Scheffler ist eines von 100 Jobs-Vorbildern aus der turi2 edition #17. Das Buch zum Thema "Arbeiten in der Kommunikation". Die Podcast-Reihe turi2 Jobs begleitet die Buch-Veröffentlichung und die neue Jobs-Plattform turi2.de/jobs.

“Hater kann ich unter ‘Spinner’ ablegen” – Awet Tesfaiesus über ihre Arbeit als Bundestagsabgeordnete.
Meilenstein-Setzerin: Awet Tesfaiesus hat öfter mit dem Gedanken gespielt, Deutschland zu verlassen, sagt die Bundestags-Abgeordnete im turi2 Jobs-Podcast. Als Abiturientin habe sie das erste Mal gedacht: "Ich habe keine Chance in diesem Land, in dem Asylbewerber-Heime angezündet werden und Menschen drumherum applaudieren." Mit Aline von Drateln spricht die gebürtige Eritreerin über die Einsicht, die sie letztendlich hatte: "Vor Rassismus kann man nicht weglaufen." Also beschließt Tesfaiesus "daran mitzuwirken, etwas zu verändern". Ihrer politischen Karriere helfe es, dass sie Juristin ist. Die Arbeit mit den Gesetzen sei ihr bekannt, "ich kann mich damit schnell anfreunden". Ansonsten brauche sie vor allem die persönliche Erfahrung als schwarze Frau, "um zu erkennen, wo Veränderung nötig ist". Seit September sitzt Tesfaiesus für die Grünen als erste schwarze Frau im deutschen Bundestag. Sie habe nicht jahrelang auf das Mandat hingearbeitet: "Das war eine kurzfristige Entscheidung." Grundsätzlich sei sie aus "recht unpolitischen" Gründen in der Partei gelandet und habe sich aus Zeitmangel anfangs wenig eingebracht. Erst 2016, mit dem Einzug der AfD ins Kasseler Stadtparlament, wird Tesfaiesus aktiver. Als schwarze Frau möchte sie der AfD gegenübersitzen und "den Gegenpart bilden". Der Anschlag in Hanau 2020 rüttelt Tesfaiesus schließlich wach. "Das hat mich emotional so getroffen, dass ich das System verändern wollte." Den Hass im Netz, den sie in ihrer Position als schwarze Politikerin erfährt, blendet Tesfaiesus aus. "Hater kann ich unter 'Spinner' ablegen." Worüber sie sich wirklich ärgere, sei der Rassismus im Alltag. Menschen, "die meinen, es sei nicht so schlimm", oder die "selbst nicht erkennen, wenn etwas rassistisch ist" – das präge ihren Alltag und "erniedrigt unsere Chancen". Awet Tesfaiesus ist eines von 100 Jobs-Vorbildern aus der https://www.turi2.de/edition17/ (kostenlose E-Paper). Die Podcast-Reihe turi2 Jobs begleitet die Buch-Veröffentlichung und die neue Jobs-Plattform https://www.turi2.de/jobs/.

"Podcasts sind das neue Radio" – Philip Banse über die Zukunft journalistischer Audio-Produkte.
Pionier-Arbeit: Als Philip Banse 2005 seinen ersten Podcast Küchenradio startet, entstehen "unglaublich grauenhafte, langweilige, scheppernde" Aufnahmen, sagt der Journalist und Podcast-Pionier rückblickend im turi2 Jobs-Podcast. Im Gespräch mit turi2-Chefredakteur Markus Trantow und Redakteurin Pauline Stahl erzählt er, dass aber auch "ein paar richtig schöne Folgen" dabei waren, die "im normalen Setting" nicht möglich gewesen wären. Zu dieser Zeit arbeitet Banse beim öffentlich-rechtlichen Radio – eine Institution, die er "toll und wichtig" findet. Allerdings gibt es Regeln: "Die haben ihre Formate, Längen, Rhythmen und Vorgaben." Beim "ungeregelten Labor-Podcast" hingegen "konnten wir machen, was wir wollten". Vor allem der Austausch mit Zuhörerinnen hat ihn fasziniert. "Das Feedback hat alles übertroffen, was ich bisher kannte", sagt Banse. Der Charme von Podcasts sei, "dass sie leben". Gemeinsam mit Jurist Ulf Buermeyer hostet Banse mit der Lage der Nation einen der beliebtesten deutschen Podcasts. Mit einem Geschäftsmodell, das auf Spenden, Werbung, Live-Events und Abos basiert, rentiert sich das Format mittlerweile auch wirtschaftlich. Anfangs habe das Podcasten vor allem zur "Markenbildung" gedient, sagt Banse. An sich selbst als Personen-Marke habe er sich erst gewöhnen müssen: "Lange Zeit war es mein innerer Kampf, zu dem zu stehen, was ich mache." Sich nicht mehr in einer Gruppe oder hinter einem Projekt zu verstecken, "war für mich der größte Schritt". Mittlerweile hat er seine eigenen Vorstellungen und "manchmal einen dicken Kopf". Weil sein Co-Host ähnlich ticke, gebe es ab und zu auch mal Streit. Doch nach sechs Jahren gemeinsamer Arbeit "kennen wir uns, wissen was uns wichtig ist und nehmen Rücksicht darauf". Dass die Zuhörerinnen irgendwann keine Lust mehr auf zwei Männer haben, die sich unterhalten, kann sich Banse vorstellen. "Das passiert wahrscheinlich jeden Tag", sagt er, "dafür kommen dann neue dazu". Der Zukunft des Formats ist er sich aber sicher und bezeichnet es als "das neue Radio". Audio-Produkte journalistischer Art werde es weiterhin geben, "solange Leute etwas ohne Bild hören wollen". Ob das Podcast heißt und wie es sich weiterentwickele, sei eine andere Frage. Philip Banse ist eines von 100 Jobs-Vorbildern aus der turi2 edition #17. Das Buch zum Thema "Arbeiten in der Kommunikation" erscheint am 6. April. Die Podcast-Reihe turi2 Jobs begleitet die Buch-Veröffentlichung und die neue Jobs-Plattform turi2.de/jobs.

“Moderator nach innen, Übersetzer nach außen” – Florian Scholbeck über die Arbeit als Kommunikator bei Aldi Nord.
Tacheles reden: Der Job eines Kommunikators hat sich in den vergangenen Jahren verändert, sagt Florian Scholbeck im turi2 Jobs-Podcast. Der Kommunikations-Chef von Aldi Nord erklärt im Gespräch mit turi2-Verlegerin Heike Turi, dass sein Job heutzutage "mehr als eine Schreibstube" sein muss. Es gehe nicht mehr nur darum, der Welt die Vorteile des Unternehmens zu erklären. Scholbeck sieht seine Rolle eher als "Moderator nach innen" und "Übersetzer nach außen". Dabei hilft ihm das Handwerk, das der studierte Bauingenieur in seiner Zeit als Journalist gelernt hat: "Fragen stellen, Dinge verstehen, komprimiert darstellen und übersetzen." Um "Sachen besser zu machen", helfe es außerdem, "auch mal die Gegenposition einzunehmen". Aldi Nord ist zurzeit in einer "sehr großen Transformation", sagt Scholbeck. In "rasender Geschwindigkeit" werde das Unternehmen modernisiert. Hauptaufgabe der Kommunikation sei es dabei, "Kontext herzustellen" und die Auswirkungen der Digitalisierung darzustellen. Dass Aldi Nord nicht immer so kommunikativ und transparent gewesen ist, weiß Scholbeck: "Die 40 Jahre des Schweigens funktionieren in unserer Medienwelt nicht mehr." Das Unternehmen wolle ein "sichtbarer Teil der Gesellschaft" sein und müsse sich daher einem öffentlichen Diskurs stellen. Dazu müsse es Aspekte wie Tierwohl, CO2 Reduzierung oder Mindestlohn thematisieren. Das Interesse an verschiedenen Themen ist das A und O für Menschen, die in der Kommunikation arbeiten wollen, findet Scholbeck. Außerdem sollten sie sich "intern schnell vernetzen" und auf hoher fachlicher Ebene mich Menschen sprechen können. Während ihn Social-Media-Expertise und die Anzahl an Followern weniger interessiert, achtet Scholbeck bei Bewerbungsgesprächen vor allem auf die Persönlichkeit. "Wenn man im Unternehmen helfen will, braucht man eine Meinung." Er wolle auf keinen Fall nur hören, dass Aldi Nord "alles super" mache – denn das sei nicht der Fall. Florian Scholbeck ist eines von 100 Jobs-Vorbildern aus der turi2 edition #17. Das Buch zum Thema "Arbeiten in der Kommunikation" erscheint am 6. April. Die Podcast-Reihe turi2 Jobs begleitet die Buch-Veröffentlichung und die neue Jobs-Plattform turi2.de/jobs.

“Politiker sind auch Menschen” – Wigan Salazar über die Arbeit als Lobbyist.
Menschenleser: "Kontakte herzustellen, ist das eine, das Seelenleben einer Partei zu verstehen das andere", sagt Wigan Salazar im turi2 Jobs-Podcast. Mit turi2-Gründer Peter Turi spricht der CEO der Kommunikationsagentur MSL über seine Arbeit bei der Publicis-Tochter. Neben dem Netzwerken geht es als Lobbyist vor allem darum, ein "Gespräch und Aufmerksamkeit" herzustellen, sagt Salazar. Dazu gehöre auch, herauszufinden, "wie ich eine Person besser lesen kann, um mit meinem Lobby-Anliegen auch anzukommen". Der Politikflüsterer spreche etwa über den Lieblings-Fußballverein – so komme eine Unterhaltung viel besser zustande. Politikerinnen seien auch Menschen: "Die freuen sich, wenn das Gespräch erst einmal etwas persönlich ist". Er muss aber nicht nur mit der Regierung, sondern auch mit der Opposition Kontakt halten. Schließlich baue sich eine Beziehung nicht nur dann auf, wenn es gut läuft, meint Salazar. Auch Nein sagen gehört in seinem Job dazu: "Das ist ein Großteil der Arbeit", sagt Salazar. Das komme zwar nicht immer gut an, "es wird dann aber doch immer gehört". Dann müsse er als Berater aber auch erklären, warum etwas nicht geht und Alternativen nennen. Andererseits "braucht es manchmal unrealistische Annahmen, um Veränderung herbeizuführen". Bei alldem nimmt er als Berater eine "dienende Rolle ein", sagt Salazar. Das sollten vor allem Journalistinnen beachten, die in die PR wechseln. Dort gehe es nicht mehr um eine "persönliche Marke" und die Arbeit finde eher "im Hintergrund" statt. Freunde aus der ehemaligen Redaktion "freuen sich dann nicht mehr unbedingt auf den Anruf". Was immer bleiben sollte, ist die Neugier – "das bringt einen sowohl im Journalismus als auch in der PR weiter". Wigan Salazar ist eines von 100 Jobs-Vorbildern aus der turi2 edition #17. Das Buch zum Thema "Arbeiten in der Kommunikation" erscheint am 6. April. Die Podcast-Reihe turi2 Jobs begleitet die Buch-Veröffentlichung und die neue Jobs-Plattform turi2.de/jobs.

Andreas Arntzen über die Arbeit im Wort & Bild Verlag und sein Engagement für Geflüchtete.
Verantwortung übernehmen: Der Wort & Bild Verlag in Baierbrunn baut um, um zu helfen. In pandemiebedingt leerstehenden Räumen sind in den vergangenen Tagen 25 ukrainische Geflüchtete eingezogen, Unterkünfte für 20 weitere Menschen entstehen gerade. Im Jobs-Podcast von turi2 spricht CEO Andreas Arntzen zum ersten Mal öffentlich über das Engagement des "Apotheken Umschau"-Verlags. Arntzen und Mitarbeitende hatten sich zuvor einem Konvoi angeschlossen, an der Grenze zur Ukraine Flüchtende aufgenommen und nach Deutschland gebracht. Mit ihrem Engagement wollen Arntzen und der Verlag ein Vorbild sein und auch andere Menschen "mobilisieren und motivieren, etwas zu machen". Es sei okay angesichts des Krieges und der Not, sprachlos zu sein, "das sollte aber nicht dazu führen, dass wir tatenlos sind". Im Podcast turi2 Jobs spricht der Medien-Manager außerdem über das Arbeiten im Gesundheitsverlag Wort & Bild und seinen Führungsstil. Viele Eigenschaften, die für "Arntzi" schon als Hockey-Torwart in der Nationalmannschaft wichtig waren, prägen ihn noch heute. Im Teamsport und im Management gehe es etwa um "Vorbereitung, Disziplin, Motivation, den Biss". Damit sein Führungsstil nach dem "Trial and Error"-Prinzip auch in einem traditionsreichen Unternehmen funktioniert, sei es wichtig, "mit gewissen Traditionen auch mal zu brechen". Es brauche einen Ausgleich "zwischen alten Werten und der Moderne". Dazu gehören flexible Arbeitszeiten, Home Office und Teilzeit-Möglichkeiten auch in Führungs-Positionen. Bei Wort & Bild arbeiten mehr Frauen als Männer – in Führungspositionen ist das Verhältnis inzwischen ausgeglichen, berichtet Arntzen. "Ich glaube, dass es sehr viele Mütter gibt, die Top-Ausbildungen haben und extrem motiviert sind." Ihnen passende Angebote zu machen, ist Arntzen wichtig. Grundsätzlich sei für ihn weniger der Lebenslauf wichtig, als dass Bewerberinnen "Charakterstärke zeigen" und "wissen, was sie können und was sie nicht können". Andreas Arntzen ist eines von 100 Jobs-Vorbildern aus der turi2 edition #17. Das Buch zum Thema "Arbeiten in der Kommunikation" erscheint am 6. April. Die neue Podcast-Reihe turi2 Jobs begleitet die Buch-Veröffentlichung und die neue Jobs-Plattform turi2.de/jobs.

“Man muss kein Techie sein” – Karin Schlautmann über die Arbeit in der Bertelsmann-Kommunikation.
Mehr als nur Worte: Das Setting, die Optik, Kleidung, die Dekoration – "am Ende kann alles eine Botschaft sein", sagt Karin Schlautmann. Kommunikation sei mehr als das geschriebene oder gesprochene Wort. Im neuen Podcast "turi2 Jobs – Arbeiten in der Kommunikation" sagt die Bertelsmann-Kommunikationsleiterin, dass genau das eins der wichtigsten Dinge ist, "die man sich in dem Beruf klar machen muss". Auch Neugierde und ein offener Blick für Technik und neue Formate spielen eine große Rolle, denn nichts verändere sich so schnell, wie die Kommunikationsarbeit. "Dafür muss man aber kein Techie sein", sagt Schlautmann im Gespräch mit Peter Turi. Es gehe eher darum, zu erkennen, welche Technik zur Vermittlung der Botschaft passt. Auch Schlautmann selbst ist kein Technik-Freak und kommt aus dem Journalismus. Fast 20 Jahre lang war sie für verschiedene Medien in Deutschland unterwegs. Nach einem Volontariat beim "Westfalen-Blatt" in Bielefeld arbeitet sie unter anderem bei der "Bild" im Chemnitz und wird Redakteurin bei der ersten deutschen Late-Night-Show mit Thomas Gottschalk in München. Auch, wenn sich diese Stationen von ihrem jetzigen Job unterscheiden, konnte Schlautmann in jedem Bereich etwas lernen. Bei Gottschalk etwa "ging es sehr stark um Inszenierungen". Das hilft ihr auch heute noch, wenn die Bertelsmann-Party geplant oder der Image-Teil des Geschäftsberichtes erstellt wird. Vor allem aus ihrer Zeit als Lokaljournalistin hat Schlautmann viel mitgenommen. Sie ist fest davon überzeugt: "Wer keine Freude hat an Lokalthemen, der findet auch schwer Zugang zu großen, internationalen Geschichten." Eine Journalismus-Vergangenheit ist dennoch keine Voraussetzung, um in der Unternehmenskommunikation zu arbeiten, sagt Schlautmann. In ihrem Team gibt es "alle Hintergründe" vom Politik- oder Wirtschaftsstudium bis zur Historikerin. Wichtiger sei es, zu überlegen: "Was finde ich spannend und wie kann ich mich einbringen?" Karin Schlautmann ist eines von 100 Vorbildern in der turi2 edition #17. Das Buch zum Thema "Arbeiten in der Kommunikation" erscheint am 6. April und stellt die 100 wichtigsten Arbeitgeber aus Werbung, Marketing, PR und Medien vor. Die neue Podcast-Reihe turi2 Jobs begleitet die Buch-Veröffentlichung und die neue Jobplattform turi2.de/jobs.

"Es gibt nur diesen einen Planeten mit Kaffee, Sex und Schokolade" – Eckart von Hirschhausen über "Wissen vor acht"
Neues Klima im Ersten: Heute Abend startet im Ersten die Reihe "Wissen vor acht – Erde" als etwas verspätete Antwort der ARD auf die Initiative "Klima vor acht". Im Video- und Podcast-Interview von turi2 stellt Moderator und Mediziner Eckart von Hirschhausen das neue Format vor und zeigt viele Ausschnitte aus der neuen Sendung. Außerdem erklärt er, dass das Format, anders als bisher bekannt, nicht nur 15 Ausgaben bekommt, sondern während des ganzen Jahres mit neuen Folgen erscheinen wird. Zudem soll es weitere Sendungen zum Klima geben. "Die ARD hatte das Thema in den letzten Jahren nicht so präsent wie die Wissenschaft", sagt von Hirschhausen, freut sich aber gleichzeitig, dass "jetzt richtig Schwung reinkommt", auch durch die Unterstützung von Programm-Verantwortlichen wie WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn und ARD-Programmdirektorin Christine Strobl. Angesichts des Krieges in der Ukraine kann von Hirschhausen verstehen, dass Klima-Berichterstattung in den Nachrichten aktuell nicht die höchste Priorität hat. "Wer die Nachrichten schaut, sieht aber sofort, dass wir in mehreren Kriegen zugleich sind", sagt der Wissenschafts-Journalist. Es gehe auch um Öl und Gas. Selbst in höchsten politischen Kreisen sei es inzwischen verstanden, dass "Erneuerbare Energien keine Öko-Spinnerei sind, sondern zu einer friedlicheren, freieren Welt" beitragen. Die Grund-Idee von "Wissen vor acht - Erde" beschreibt der Mediziner als "Kommt 'ne Erde zum Arzt". In den bisher produzierten Folgen geht es etwa um Fleischkonsum, die Todeszone Ostsee oder den Zusammenhang zwischen Regenwald und Regen. "Es gibt nur diesen einen Planeten mit Kaffee, Sex und Schokolade. Es wird nirgendwo besser", sagt von Hirschhausen.

Diverser als ihr Ruf – Herausgeber Carsten Knop über die Arbeit der “FAZ”.
Frankfurter Allgemeine Zeitungsjobs: "Für mich war Journalismus immer ein Traumberuf", sagt Carsten Knop. Im neuen Job-Podcast von turi2 verrät der Herausgeber der "FAZ", dass er schon im Alter von 17 Jahren Journalist werden wollte und das auch heute dem Nachwuchs nur empfehlen kann. Für ihn ist das der "abwechslungsreichste Beruf", ein tägliches "Studium generale". Im Gespräch mit Peter Turi sagt Knop auch, dass die "FAZ" längst diverser ist, als viele glauben. So sind 95 % der aktuellen Neueinstellungen der Zeitung Frauen, ein Teil mit Migrationsgeschichte. Schon heute hätten in vielen Ressorts Frauen das Sagen – die Frage, wann erstmals eine Frau einen der vier Herausgeber-Posten der "FAZ" übernimmt, werde sich daher mit der Zeit von allein beantworten. Auf die Job-Situation von Journalistinnen schaut Knop positiv: Die "Dienstleistung" der Medienschaffenden, die Welt zu erklären und zu ordnen, werde weiter gebraucht. Die Jobs in den Redaktionen würden zudem vielfältiger. So brauche es heute u.a. auch Programmiererinnen und Audio-Spezialisten. An der Voraussetzung, nur Menschen mit abgeschlossenem Studium zu beschäftigen, will Knop allerdings nicht rütteln. "Die 'FAZ' gibt den Leserinnen und Lesern ein Qualitätsversprechen", sagt Knop. Das müsse die Redaktion bedienen, dafür brauche sie einen hohen Bildungsgrad in Breite und Tiefe. Knop und Turi sprechen außerdem über die Konkurrenz-Situation mit ARD und ZDF: "Die Angebote tagesschau.de und hessenschau.de der Öffentlich-Rechtlichen sind eine Zumutung für privat finanzierten Journalismus", sagt der "FAZ"-Herausgeber. Er vergleicht die Zeitung mit einer Fabrik, die ein Produkt herstellt - und vor dem Fabrik-Tor steht ein Konkurrent, der dieses Produkt kostenlos anbietet. Dennoch gelinge es der Zeitung immer besser, Verluste im Print-Geschäft digital auszugleichen. So zähle die "FAZ" aktuell mehr als 200.000 Digital-Abonnentinnen, 80.000 von ihnen nutzten das Basis-Angebot F+. "Wir wachsen", freut sich Knop. Carsten Knop ist eines von 100 Vorbildern aus der turi2 edition #17. Das Buch zum Thema "Arbeiten in der Kommunikation" erscheint am 6. April und stellt die 100 wichtigsten Arbeitgeber aus Werbung, Marketing, PR und Medien vor. Die neue Podcast-Reihe turi2 Jobs begleitet die Buch-Veröffentlichung und die neue Jobplattform turi2.de/jobs. turi2.tv (48-Min-Podcast auf YouTube), turi2.podigee.io, spotify.com, podcast.apple.com, deezer.com, audionow.de

“Der Kampf um die Ressource Kreativität ist härter geworden” – Florian Haller über die Arbeit bei Serviceplan.
mit Peter Turi und Florian Haller Die Agentur als Marke: "Die Zeit, in der man bis Mitternacht in der Agentur gesessen hat, ist wirklich vorbei." Im neuen Podcast "turi2 Jobs – Arbeiten in der Kommunikation" spricht Agentur-Inhaber Florian Haller über den Kultur-Wandel in der Agentur-Branche. Der betrifft für den Chef der Agentur-Gruppe Serviceplan nicht nur die Arbeitszeiten, sondern auch die Aufgaben. So arbeiten in seinen Agenturen heute nicht nur Kreative, sondern auch immer mehr Data Scientists, Media- und Programmatic-Strateginnen. Im Gespräch mit turi2-Gründer Peter Turi zählt Haller 100 unterschiedliche Profile. Egal, um welchen Job es geht: Lust an Kommunikation, Neugier und Offenheit für andere Kulturen und Spaß an Internationalität sind für Haller die wichtigsten Voraussetzungen. Seit Haller die Agentur-Gruppe 2002 von seinem Vater übernommen hat, ist die Zahl der Serviceplan-Beschäftigten von 300 auf heute rund 4.500 gewachsen. Seine Vision ist es, "die global führende Independent-Agentur" zu werden. Er sieht wachsenden Kommunikationsbedarf und kann sich vorstellen, die Zahl der Beschäftigten in den kommenden Jahren zu verdoppeln. "Unser größtes Thema ist es, dass wir unser Wachstum mit neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abfedern." Allein 2021 habe die Agentur 700 neue Beschäftigte eingestellt – deutlich mehr als die Agentur verlassen haben. Haller spricht von einer Fluktuation von 15 % und von einer durchschnittlichen Verweildauer von sechs Jahren. Mit Blick auf den Agentur-Nachwuchs stellt Haller fest, dass der Wettbewerb um die klügsten Köpfe härter geworden ist. "Für die junge Generation ist ein sicherer, gut bezahlter Arbeitsplatz die Grundvoraussetzung", sagt Haller. Die wichtigste Frage sei die nach dem Sinn. Unternehmen müssten ihren Beschäftigten heute einen Purpose bieten. Serviceplan selbst bemüht sich in unterschiedlichen Programmen um die Themen Fürsorge, Diversität und Nachhaltigkeit. So sei es der Gruppe gelungen, in Deutschland den CO2-Fußabdruck auf Null zu fahren, nun weitet Haller die Bemühungen auf andere Standorte aus. In Sachen Diversität gibt Haller Nachholbedarf zu: Zwar sei der Aufsichtsrat zu jetzt 50 % mit Männern und Frauen besetzt, in den Agenturen läge die Frauenquote auf den ersten beiden Führungsebenen immerhin bei 40 %. Die Agentur-Holding ist allerdings rein männlich – Haller sagt: "Das werden wir ändern". Florian Haller ist eines von 100 Vorbildern aus der turi2 edition #17. Das Buch zum Thema "Arbeiten in der Kommunikation" erscheint am 6. April und stellt die 100 wichtigsten Arbeitgeber aus Werbung, Marketing, PR und Medien vor. Die neue Podcast-Reihe turi2 Jobs begleitet die Buch-Veröffentlichung und die neue Jobplattform turi2.de/jobs.

BR-Intendantin Katja Wildermuth über Vielfalt, Spardruck und mobiles Arbeiten.
"Das Wichtigste ist, dass die Kolleginnen und Kollegen innerhalb des Senders Vielfalt nicht als eine Pflichtübung verstehen, sondern als Bereicherung", sagt BR-Intendantin Katja Wildermuth im Interview bei turi2.tv und im turi2 Podcast. Seit einem Jahr steht sie als erste Frau an der Spitze des Bayerischen Rundfunks und räumt ein: "Wir haben viele Jahre vergleichsweise homogen rekrutiert". Förderprogramme wie Puls Talente sollen den BR diverser machen, 40 Redaktionen im Haus beteiligen sich an der von der BBC initiierten 50:50-Challenge. Sie hat das Ziel, Männer und Frauen gleichermaßen als Gesprächspartnerinnen ins Programm Programm zu holen. Vielfalt versteht Wildermuth nicht nur im Hinblick auf Geschlecht oder kulturelle Herkunft, sondern auch auf soziale Herkunft, Haltung, Bildungswege und Lebensentwürfe. Die Vielfalt der Gesellschaft könne der BR im Programm nur abbilden, "wenn wir die Polyperspektivität auch bei uns haben". Diversität nach Quote hält sie nur für die "Ultima Ratio". Im Gespräch in ihrem Büro im 15. Stock des Münchner Funkhauses erzählt Katja Wildermuth auch, wie sich Corona auf die Arbeit im BR auswirkt. "Ich arbeite wahnsinnig mobil, ich habe meinen Laptop oder mein iPad dabei. Sie können mich überall hinsetzen", sagt sie. Zu Hause am Küchentisch arbeite sie selbst jedoch eher selten. Ginge es nach Wildermuth, hätte sie mobiles Arbeiten oder Home-Office ohne tägliche Präsenz im Sender schon viel früher eingeführt: "Eigenverantwortung ist der Schlüssel für das Überleben im 21. Jahrhundert. Ich bin mir sicher, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können am besten einschätzen, wie sie ihre Arbeit gut erledigen." Dabei sei es Aufgabe der Führungskräfte, darauf zu achten, dass Beschäftigte "im Home-Office nicht vereinsamen", die Grenze zwischen Arbeit und Privatleben nicht verschwimmt und die Teams "auch mal Spaß miteinander haben", was in ergebnisorientierten Videokonferenzen oft zu kurz komme. Wie die gesamte ARD steht auch der BR unter Spardruck – obwohl der Rundfunkbeitrag 2021 gestiegen ist. Vorbei seien die Zeiten, in denen ein Programm für alle reicht: "Jeder möchte am liebsten auf ihn zugeschnittenes Programm", sagt Wildermuth. "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur innerhalb des Bestehenden sparen", irgendwann habe das Prinzip "Schnall den Gürtel enger" seine Grenzen. Dann stelle sich die Frage: "Welche Inhalte, welche Programme sind uns wirklich wichtig?" Diese müsse der BR dann finanziell so ausstatten, dass Macherinnen und Produktionsfirmen "davon auch wirklich leben können". Es gehe darum, "nicht mit dem Rasenmäher zu sparen, sondern strategisch". Weitere Themen im Interview sind u.a. der Umgang mit geschlechtergerechter Sprache, die federführende Rolle des BR innerhalb der ARD bei Wissenschaft und Bildung, Dokus und ökologischer Nachhaltigkeit sowie die Bedeutung von unabhängigem, professionellen Journalismus in Zeiten, in denen jeder und jede Inhalte erstellen und verbreiten kann.

Steffen Klusmann über Reichelt, Relotius und Diversität beim “Spiegel”.
Rück-"Spiegel": "Die Rolle des 'Spiegels' ist die Opposition gegenüber den Mächtigen", sagt "Spiegel"-Chefredakteur Steffen Klusmann. Genau drei Jahre nach dem Fall Relotius und kurz vor dem 75. Jubiläum des Nachrichtenmagazins spricht er im Video- und Podcast-Interview mit turi2-Chefredakteur Markus Trantow über das Selbstverständnis des "Spiegel" in gesellschaftlich bewegten Zeiten. Gefürchtet werden, möchte Klusmann nicht. Doch wenn ein Fragen-Katalog des "Spiegel" bei einem Unternehmen zurecht Alarmglocken auslöse, "finde ich das gut". Es sei wichtig, Missstände aufzuklären und Dinge kritisch zu hinterfragen. "Das ist Teil der Spiegel-DNA", auch wenn die immer wieder modern interpretiert werden müsse. Für 2022 kündigt Klusmann den Aufbau eines "kleinen, schlagkräftigen Newsteams" an. Auch die Diversität in der Redaktion macht der Chefredakteur als Baustelle aus. Zwar läge die Frauenquote in Führungspositionen im einstigen "Männerladen" bei 44 %, "das reicht aber noch nicht". Grundsätzlich ist der Job härter geworden, sagt Klusmann über juristische Anfechtungen. "Wenn man mit kritischen Geschichten kommt, werden die sofort angegriffen." Unterlassungen für "alles und nichts" seien an der Tagesordnung. Bei investigativen Geschichten seien Dokumentare und Justiziare dabei, alles werde "zig mal" überprüft. Das gelte auch für die Berichterstattung in den Fällen Julian Reichelt und Luke Mockridge. Die juristischen Prozesse kämpfe der "Spiegel" nun bis zum Ende durch. Traditionellen Werten bleibe das Nachrichtenmagazin treu und unterscheide streng zwischen Aktivismus und Journalismus: "Aktivismus wäre ja, was wir gern hätten, nicht 'sagen, was ist'." Wirtschaftlich blickt Klusmann positiv in die Zukunft: Zwar sinken auch beim "Spiegel" die Print-Auflagen, doch die Digital-Abonnements wachsen – aktuell sogar so stark, dass sie Print-Rückgänge überkompensieren. Auf den 75. Geburtstag des Magazins am 4. Januar werde die "Spiegel"-Belegschaft digital anstoßen, in der Hoffnung, die Feier im Frühjahr nachzuholen und "es krachen zu lassen".
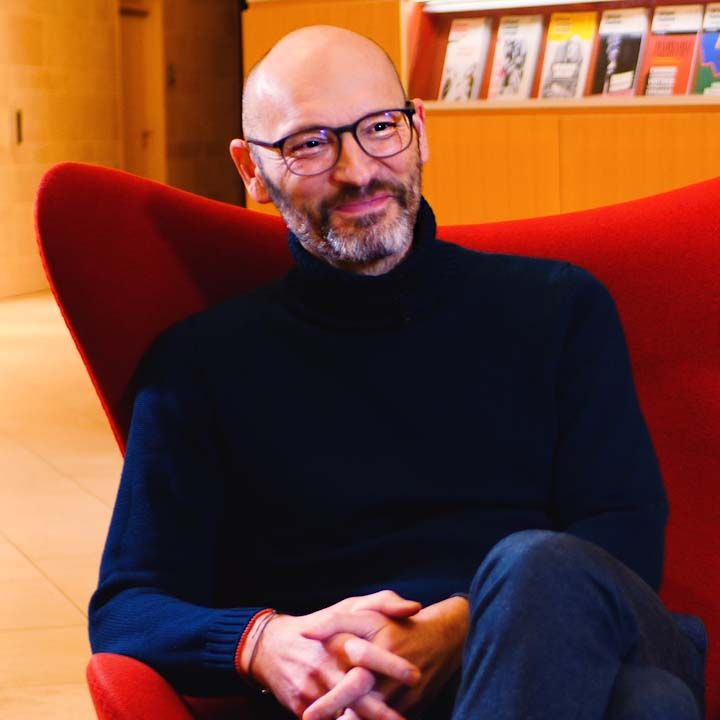
Chefingespräch: Beat Balzli geht straff auf die 100 zu – und holt mit Podcasts Abos für die "Wiwo".
Seniorentalk: Beat Balzli, Chefredakteur der 95 Jahre alten "Wirtschaftswoche", geht straff auf die 100 zu. So viele Podcasts mit spannenden Köpfen der Wirtschaft hat der geborene Hamburger für seine Reihe "Chefgespräch" fast schon geführt. Und dabei neue Erkenntnisse gewonnen: "Die Deutschen sprechen sehr ungern übers Geld." Aber viele Bosse haben erkannt, dass sie sich "nahbar und menschlich" zeigen sollten. Balzli ist Gast in der Podcastreihe "Chefingespräch", die Peter Turi, 60, gerade zum Restart gebracht hat. Für ein "kleineres Medium" wie die "Wirtschaftswoche", seien Podcasts eine "super Möglichkeit, die Sichtbarkeit zu erhöhen" – vor allem bei jüngeren Leuten. Es würden sogar Abos abgeschlossen mit der Begründung "Ich will die 'Wiwo' mal kennen lernen." Der Verlag werde Podcasts als Teaser in der Subscription-First-Strategie "sicher noch forcieren". Die Werbeplätze seien "durchgebucht", die Preise hätten noch Luft nach oben. Individuellen Nutzwert will Balzli mit dem forcierten "WiWo-Coach" bieten, in dem Expertinnen individuell, aber anonym die Fragen der zahlenden "Wiwo"-Leser zu Steuern, Altersvorsorge und Immobilien Coaching beantworten. Der "WiWo-Club" wird hingegen heruntergefahren: Der wurde zu viel "von immer denselben Leuten genutzt – du überzeugst nur die Überzeugten". Das bringe "kaum neue Leser, wenn der konkrete Mehrwert nicht ersichtlich ist". Balzli spricht im Podcast mit Turi auch darüber, was in Schweizer Bankschließfächern alles so schlummert, warum die Lieferketten gefährdet sind und die Inflationsgefahr nicht gebannt ist. Auch was sein großer Traum ist, verrät Balzli im Podcast – ganz am Ende, wie in seinem eigenen "Chefgespräch": Er würde gern mal ausführlich durch Japan reisen, das Heimatland seiner Frau.

“Umsteigen im Kopf”: Wie Bahn-Vorständin Stefanie Berk Geschäftsreisende auf die Schiene holen will.
Bahn to business: Die Bahn will mehr Geschäftsreisende auf die Schiene holen und kündigt für Unternehmen, die auf den Zug statt den Firmenwagen oder das Flugzeug setzen, 50 % Rabatt beim Kauf von BahnCards 100 für Beschäftigte an. Stefanie Berk, Vorständin für Marketing im Fernverkehr, erklärt die Initiative im Podcast-Interview mit turi2. Sie hofft darauf, dass sich 1 % der bisher 5 Mio Firmenwagen-Fahrerinnen für das Angebot entscheiden und so 50.000 neue geschäftliche Vielfahrer in den Zug umsteigen. Die Aktion ist Teil des sogenannten Glasgow Commitments der Bahn. Um sie bekannt zu machen, schreiben Bahn-Chef Richard Lutz und Fernverkehrs-Vorstand Berthold Huber den CEOs großer Unternehmen Briefe, die auch in Zeitungen erscheinen. "Wir können die Leute nicht nur auffordern, was zu tun, sondern wir müssen auch was mitbringen zur Party", sagt Berk mit Blick auf die bisher einmalige Rabatt-Aktion. Unternehmen, die sich beteiligen und ihre Dienstreise-Richtlinien zugunsten klimafreundlicher Reisen ändern, verewigt die Bahn in einer "Hall of Fame" und "feiert" sie auf Social Media. Mit Blick auf das in der Pandemie massiv gesunkene Fahrgast-Aufkommen erklärt Berk, dass die Züge wieder gut genutzt werden. Die Auslastung liege inzwischen bei 50 % – vor Corona waren es 56 %. Die Marketing-Vorständin erwartet, Mitte 2022 das Vor-Krisen-Niveau zu erreichen und dann weiter zu wachsen.

"Politiker haben Angst, ein Meme zu werden" – So lief der Social-Media-Talk zur Bundestagswahl.
Teilen, um zu herrschen: "Wenn Instagram die Müllkippe von Social Media ist, dann ist TikTok die Müllkippe der Müllkippe", sagt Niko Kappe im Social-Media-Talk zur Bundestagswahl des Frankfurter PresseClubs und von turi2. Wie sich Instagram, TikTok, Facebook & Co auf die Wahl auswirken, haben die Diskussions-Teilnehmerinnen am Mittwochabend via Zoom und im turi2 Clubraum diskutiert. Der Lehrer und erfolgreiche TikTok-Creator Kappe beschreibt, dass Zweit- und Dritt-Verwertung auf der Kurzvideo-Plattform gar nicht gehen. Amelie Marie Weber, Social-Media-Chefin der Hauptstadt-Redaktion der Funke-Zeitungen, hat Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz für TikTok interviewt – Hunderttausende schauen sich die 60- bis 80-Sekündigen Clips an. Bei ihr erfahren die Jungwählerinnen nicht nur, wie die Polit-Promis ticken, sondern auch, was sie gerne essen und welche Emojis sie versenden. Sie bemerkt aber auch Vorsicht und Zurückhaltung: "Politiker haben Angst, ein Meme zu werden." Helge Ruff, Gründer und Chef der Agentur OneTwoSocial, findet, dass viele Parteien Social Media oft falsch nutzen. So bringe es niemandem etwas, wenn Olaf Scholz postet, dass er heute einen Auftritt in Lüneburg hat. Ausgerechnet die rechte AfD ist in Social Media erfolgreich – das liege aber auch am Gegenwind, den die Partei bekomme – Algorithmen unterscheiden nicht zwischen Zustimmung und Ablehnung. turi2-Moderatorin Tess Kadiri beobachtet, dass es politische Inhalte oft schwer haben gegen TikTok-Tänze. Die Kunst sei es, Bildung und Unterhaltung zu verbinden, findet Niko Kappe. Das habe es auch früher schon gegeben, etwa wenn die Bundeszentrale für politische Bildung Wahl-Aufrufe bei "GZSZ" platziert hat.

Klaus Dittrich über die “Innovation Journey” der Messe München und die IAA.
Auf neuen Wegen: "Die IAA Mobility ist ein Leuchtturm für die gesamte Messewirtschaft – auch international." Im Video- und Podcast-Interview von turi2 erklärt Klaus Dittrich die Bedeutung des Neuzugangs IAA für den Messe-Standort München. Er berichtet, dass die ganze Branche auf die Umsetzung blickt – vom Hygiene-Konzept bis zur Integration der Mobilitäts-Messe ins Stadtbild. "Zum ersten Mal wird ein Thema auf den schönsten Plätzen der Stadt einem breiten Publikum zur Kenntnis gebracht." Die Messe München beteiligt sich zudem mit einem eigenen Programmpunkt, der Innovation Journey. Die Bildungsreise für Führungskräfte führt zu wichtigen Events auf dem Messegelände aber auch darüber hinaus dorthin, wo im Großraum München ganz konkret an der Zukunft der Mobilität gearbeitet wird. Warum macht ein Messeveranstalter sowas? "Wir sind nicht mehr nur Vermieter von Quadratmetern Ausstellungsfläche", sagt Dittrich. Er sieht die Messe auch als inhaltlich bewegten Plattform-Betreiber – und das nicht erst seit der Pandemie. Die Messe München geht bereits seit 2016 auf Innovation Journey. Die Reisen gingen bisher ins Silicon Valley und auf die South by Southwest in Austin, Texas, aber auch nach Deutschland. Die Führungskräfte-Reise fasst er als "mobiler Think Tank für einen Tag" zusammen. Die Teilnehmerinnen sollen miteinander und voneinander lernen und sich zu Themen wie Automatisierung, Digitalisierung und nun im Falle der IAA zum Thema Mobilität austauschen. "Messen und Messeveranstalter werden digitaler", ist Dittrich überzeugt, auch wenn die Pandemie überwunden ist. Im ausführlicheren turi2 Podcast erklärt er, dass er die Messe München in der Rolle des Kurators und Plattform-Anbieters sieht. Ein weiteres Projekt, dass in diese Zukunft weist, ist etwa das Netzwerk Frauen verbinden, das von Margit Dittrich gegründet wurde, sie ist Führungskräfte-Coach und Ehefrau von Klaus Dittrich. Inzwischen tauschen sich hier mehr als 1.000 weibliche Führungskräfte aus – nicht nur in München, sondern auch in Berlin und Hamburg. Außerdem spricht Dittrich über die Auswirkungen von Corona auf sein Geschäft. In der turi2 edition #15 porträtieren wir Klaus und Margit Dittrich als weitgereistes Power-Paar. Das Buch erscheint am 7. September – Sie können das kostenlose E-Paper hier bestellen.

"Diese Zeitung ist kein bisschen Verzicht" Dagmar Rosenfeld stellt die neue 16-Seiten-Welt vor.
Neue "Welt"-Ordnung: Am 6. September legt Springer das erste Mal seine neue, um acht Seiten geschrumpfte Wochentags-"Welt" an den Kiosk – Chefredakteurin Dagmar Rosenfeld erklärt im Podcast und zeigt im Video von turi2, wie die 16-Seiten-"Welt" künftig aussehen wird. "Diese Zeitung ist kein bisschen Verzicht", wird sie nicht müde, zu erklären. Das Gegenteil sei der Fall, "es geht nichts an Stoff, nichts an Inhalten verloren". Die Zeitung sei künftig pointierter, das Blatt so dynamisch wie der Start in den Morgen. Und eine zweite Neuigkeit teilt Rosenfeld im Interview: Die 2020 eingestellten Hamburg-Seiten der "Welt" kommen zurück. Jeden Freitag erscheinen im norddeutschen Raum vier zusätzliche Seiten mit regionalen Inhalten. "Wir sind eben nordisch by nature", sagt Rosenfeld scherzhaft und berichtet, dass Sie viel Feedback aus Norddeutschland erhalten habe, dass die regionale "Welt" im Norden vermisst werde. Die reanimierten Seiten für Hamburg und Umgebung seien die Antwort darauf. Die Zeitung, erklärt Rosenfeld, starte künftig mit den beiden wichtigsten News des Tages und einem Kommentar. Die Seiten 2 und 3 beschreibt sie als "Zeitung in der Zeitung" mit einem schnellen Überblick über die Top-Themen aus allen Ressorts. Zudem setzt die Seite 2 das Thema des Tages mit einem Kommentar, einem Interview oder einer Reportage. Herausgeber Stefan Aust bekommt eine eigene Rubrik, in der er täglich Fragen beantwortet – zunächst zur Bundestagswahl. Mit dem Umbau will Rosenfeld die Zeitung an geänderte Lese-Gewohnheiten anpassen. Am Wochenende 7./8. September kommt auch zum ersten Mal die neue "Welt am Sonntag", die künftig eine Vorab-Ausgabe am Samstag erhält und am Sonntag aktualisiert erscheint.

“Wenn der Hype vorbei ist, wird es erst spannend” – so sehen Medienmacherinnen die Zukunft von Clubhouse.
Ernüchterung und Euphorie: "Die Clubhouse-Macher haben keine Idee, wie sie Social Audio aufs nächste Level heben können", resümiert Mark Heywinkel von Zeit Online die Probleme der einstiegen Hype-App. Der Frankfurter PresseClub hat am Montagabend über die Zukunft von Clubhouse diskutiert – turi2 veröffentlicht die Runde mit Heywinkel, Alina Fichter von der Deutschen Welle, Felix Kovac von Antenne Bayern und turi2-Gründer Peter Turi als Podcast. Radio-Mann Kovac erinnert sich gerne an die ersten Wochen mit der Audio-App und kann sich nicht erklären, warum die Clubhouse-Macher es zugelassen haben, dass der Hype so schnell wieder abflaut. Wenn es nach ihm geht, müsste ein Teil der "vielen Milliarden", die die App Wert ist, in guten Content fließen. Als Beispiel dienen ihm Netzwerke die Linked-in, die ganze Redaktionen betreiben. Alina Fichter von der Deutschen Welle ist sich nicht sicher, ob der Clubhouse-Hype hierzulande über die Medienbranche hinaus gereicht hat. Wer nicht zur Journalisten-Blase gehört, habe von der App vielleicht mal in der Zeitung gelesen. Sie will den Blick über Clubhouse hinaus weiten und glaubt, dass Social Audio in etablierteren sozialen Netzwerken mehr Menschen erreichen kann. Mit Blick auf den Wahlkampf und die Berichterstattung spielt Clubhouse kaum eine Rolle: Mark Heywinkel hat mit der Morgenkonferenz von Zeit Online wochenlang jeden Tag den Clubhouse-Nutzerinnen den Puls gefühlt. Inzwischen ermittelt die "Zeit" die Stimmung im Land durch das repräsentativ zusammengestellte Panel Die 49. Auch Peter Turi kann die Enttäuschung über Clubhouse verstehen: Er ist der Meinung, dass wer bei Clubhouse erfolgreich sein will, seine eigene Community mitbringen muss. Für ein Fachpublikum gehe das, bei einem Massenmedium werde das schwierig. Turi beobachtet aber auch, dass die Gesprächs-Räume von Twitter Spaces nicht voller sind, als beim Original. Bei der Anschluss-Diskussion auf Clubhouse melden sich vor allem diejenigen zu Wort, die Clubhouse auch heute noch intensiv nutzen. Radioszene-Chef Ulrich Koering etwa genießt die Runden mit wenigen Zuhörerinnen, weil die Gespräche dann intensiver sind und sogar Freundschaften entstehen. Auch Schauspielerin Alexandra Kamp lobt den Netzwerkeffekt der kleinen Runden und die Kontakte, die sich daraus ergeben. Sängerin und TV-Produzentin Tine Wittler sagt, dass alle Künstlerinnen das Sommerloch kennen. Sie hofft darauf, dass die Clubhouse-Nutzung im Herbst wieder anzieht.

“Die Sehnsucht, sich persönlich zu treffen, ist da.” Bahn-Sprecher Jens-Oliver Voß über 30 Jahre ICE.
Geburtstagskind auf Schienen: Die Deutsche Bahn feiert in diesem Monat 30 Jahre InterCity Express und macht dafür ein siebenstelliges Media-Budget locker. Im Video- und Podcast-Interview erklärt Jens-Oliver Voß, Leiter Kommunikation Eisenbahn in Deutschland, dass der Konzern in seiner Kampagne die Menschen in den Mittelpunkt stellt, die den ICE am Laufen halten, und zeigt viele Fotos und Videos aus 30 Jahren Hochgeschwindigkeits-Verkehr. Außerdem teilt Voß eigene Bahn-Erinnerungen, etwa dass er in den 1990er Jahren aus dem ICE Faxe verschicken und in einer Telefonzelle im Zug telefonieren konnte – schon bevor es Handys gab. Und Voß blickt in die Zukunft: Er ist überzeugt, dass die Reiselust der Menschen nach Corona wieder wächst. Aktuell wirbt die Bahn mit dem Zug als Verkehrsmittel für die Urlaubsreise innerhalb Deutschlands. Auch die Geschäftsreisen und die Zahl der Job-Pendler werden wieder zunehmen, glaubt Voß, denn "die Sehnsucht sich persönlich zu treffen, ist nach wie vor da". Schon jetzt sieht er: "Die Buchungszahlen klettern jeden Tag wieder ein Stückchen nach oben." Ein weiteres großes Ziel sind Ausbau und Modernisierung des Schienen-Netzes: Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen 170 Mrd Euro ins Netz fließen. "Viele Jobs in der Bau-Industrie hängen hier bei uns", sagt Voß und kündigt an, dass auch die ICE-Flotte weiter wachsen soll – von jetzt 330 Züge auf fast 600.

“Copy & Paste reicht nicht” – Doris Brückner über die neue Frauen-Online-Redaktion bei G+J.
Gemeinsam stärker? Vor einem halben Jahr hat Gruner + Jahr die Online-Redaktionen von "Gala", "Brigitte" und "Eltern" fusioniert, im Video- und Podcast-Interview von turi2.tv zieht Doris Brückner Bilanz des Umbaus unter Pandemie-Bedingungen. Die Chefredakteurin erklärt, dass die Großredaktion mit aktuell ca. 65 Menschen "keine Sparmaßnahme" und für den Verlag auch nicht günstiger sei als die Einzelredaktionen. Es gehe darum, Kräfte zu bündeln und so mehr Zeit und Freiheiten für Leuchtturmprojekte zu haben. Als Beispiel nennt sie den Pride-Monat Juni, in dem sich die Webseiten mit Aktionen rund um die LGBTQ-Community abwechseln. Im Video zeigen wir, viele Beispiele der Kampagne. Die Zahlen geben Brückner recht: So erreicht Gala.de heute deutlich mehr Nutzerinnen als früher – im April zählt die Website 73 Mio Visits, vor zwei Jahren waren es nicht mal halb so viele. Für die Chefredakteurin ist das ein Resultat von "ganz viel Fleißarbeit". So ist die Redaktion nun 24 Stunden am Tag besetzt und nimmt sich Zeit für eigene Recherchen. Zudem gibt es ein Team, dass sich um SEO kümmert und Texte, Videos und Bild-Strecken auch nach der ersten Veröffentlichung noch optimiert. Im ausführlicheren Podcast-Gespräch erklärt Brückner auch die Zusammenarbeit mit den TV-Kolleginnen von RTL. Inzwischen gebe es täglich Kontakt und Abstimmungen. Es sei etwa vorstellbar, dass Homestorys von Prominenten bei Gruner + Jahr erscheinen und auch bei RTL laufen – "der Bertelsmann-Kosmos ist groß", sagt Brückner. Und die Chefredakteurin kündigt Zuwachs an: Auch das "Guido"-Magazin rund um Guido Maria Kretschmer soll bald eine eigene inhaltlich getriebene Website erhalten. Außerdem gibt es Paid-Content-Überlegungen bei den Online-Ausgaben der Frauen-Marken von Gruner + Jahr.

"Erst die Fakten, dann die Meinung" – so lief das turi2-Clubfrühstück über Community-Journalismus.
Community-Content is Queen: "Community-Journalismus darf kein Kuscheljournalismus werden", sagt "Journalist"-Chefredakteur Matthias Daniel beim turi2-Clubfrühstück auf die Frage, welche Rolle die Community in der Zukunft der Medien spielt. Im turi2 Clubraum haben am Sonntag neben Daniel "Was mit Medien"-Gründer Daniel Fiene, "Zeit"-Redakteurin Hanna Israel, Sham Jaff, Gründerin des Newsletters "What Happened Last Week", VRM-Chefredakteur Stefan Schröder und Uwe Vorkötter, Herausgeber von “Horizont”, über das Wechselspiel zwischen Journalismus und Publikum und Finanzierungsmöglichkeiten durch die Community diskutiert. "Man muss im Gespräch bleiben", sagt Hanna Israel, die bei der "Zeit" Menschen mit unterschiedlichen Ansichten ins Gespräch bringt. Sie wirft ein, dass die Distanz zur Community nicht zu groß werden darf und glaubt: "Das einfache Abwägen von Pro- und Contra-Argumenten funktioniert nicht mehr." Matthias Daniel ergänzt, dass es "ganz vernünftig" sei, dass Journalistinnen nicht alles wissen. Er wünscht sich Dialogbereitschaft und plädiert: "Wir müssen runter von der Kanzel." Daniel Fiene sagt: "Wenn man heute ein neues Format startet, kommt man nicht ohne Community aus." Wenn die Community Queen sei, gebe das Publikum die Richtung vor. Stefan Schröder hält Erklär-Journalismus für notwendig. Seine empfohlene Vorgehensweise: "Erst kommen die Fakten, dann kommt die Meinung." Newsletter-Publizistin Sham Jaff ergänzt, dass auch Kuratierung von Fakten eine Meinung darstellen kann. Fazit von Peter Turi: "Community-Content ist King und Queen." Es komme auf die Mischung zwischen Erklärjournalismus und einer Integration der Community an. Uwe Vorkötter verweist auch auf Crowdfunding und Genossenschafts-Journalismus und ergänzt: "Wir machen einen Riesenfehler, wenn wir Paid Content und Werbefinanzierung gegeneinanderstellen. Der Journalismus wird alles brauchen."

“Wir sind schon lange keine Gatekeeper mehr” – so lief das Chefgespräch mit Sebastian Matthes.
Abo first: "Die Basis, auf der wir in Zukunft alles aufbauen, werden die Abonnenten sein", sagt Sebastian Matthes im turi2 Clubraum. Im Chefgespräch mit Peter Turi erklärt der "Handelsblatt"-Chefredakteur, dass er und seine Redaktion die Wünsche der Abonnentinnen in den Mittelpunkt stellen. Die Abo-Erlöse seien der Einnahme-Zweig, der am stärksten wachse. Darauf, dass sich die Rolle der Journalistinnen in Zeiten, in denen CEOs via Twitter und Linked-in selbst kommunizieren, hat Matthes sich eingestellt: Er setzt auf exklusive Recherchen, tiefe Analysen und Interviews zu kritischen Themen, die Wirtschafts-Bosse in ihren eigenen Posts lieber umschiffen. Weitere Themen des Gesprächs sind die Rolle der gedruckten Zeitung, die Führungs- und Feedback-Kultur beim "Handelsblatt" und die schlechte Frauen-Quote im Wirtschaftsjournalismus. Aus dem Publikum haben u.a. die frühere Digital-Managerin Katharina Borchert, die "Spiegel"-Journalistin Melanie Ahlemeier und der ARD-Aktuell-Chefredakteur Helge Fuhst mitdiskutiert. 120.000 Abonnentinnen zählt die 75 Jahre alte Wirtschaftszeitung aktuell, berichtet Matthes, knapp 90.000 davon lesen das "Handelsblatt" digital. Das gedruckte Blatt werde dennoch stark nachgefragt und sei hochprofitabel. So lange das so ist, werde es die Zeitung auch gedruckt geben. Ob die Zeitung zum 100. Geburtstag noch gedruckt erscheint, mag Matthes nicht prognostizieren, "in zehn Jahren wird es aber noch eine gedruckte Zeitung geben". Das "Handelsblatt" setzt seit 18 Monaten auf eine Mobile-First-Strategie. Andere Zeitungen, die einen ähnlichen Wandel durchlaufen haben, konnten in der Folge auch ihre gedruckten Auflagen stabilisieren, erklärt der Chefredakteur. In der Fragerunde mit der turi2-Community geht es u.a. um die Führungs- und Feedback-Kultur beim "Handelsblatt": "Die Zeiten, in denen eine kleine Gruppe so einen Laden durch die Welt gepeitscht hat, sind vorbei", sagt Matthes. In der Redaktion der Zukunft komme es auf jeden an. Da aktuell 85 % der Redaktion im Home Office arbeite, ist ein Kulturwandel schwierig, sagt Matthes. Er beruft Feedback- und Gesprächsrunden ein, in der ganz offen über die Transformation gesprochen werde und in denen er sich auch kritisieren lasse. Angesprochen auf die schlechte Frauenquote beim "Handelsblatt" gibt Matthes zu, dass es die Wirtschaftsmedien insgesamt versäumt haben, hochqualifizierte Frauen zu fördern. Das "Handelsblatt" arbeite an dem Problem – es lasse sich aber nicht über Nacht lösen.

Schröders Podcast & Baerbocks Chancen – so lief das Clubfrühstück mit Béla Anda und Ina Tenz.
Hören und wählen: "Der Wahlkampf wird vor allem digital", sagt Béla Anda, früher Regierungssprecher von Gerhard Schröder und heute Politik- und Kommunikations-Berater, im turi2 Clubraum. Beim Clubfrühstück am Sonntag haben Anda, die frühere Antenne-Bayern-Chefin Ina Tenz sowie turi2-Clubhouse-Redakteurin Tess Kadiri und Peter Turi über die Rolle von Audio-Formaten im kommenden Bundestagswahlkampf und die Chancen des Bewerbertrios gesprochen. Weiteres Thema des Talks ist der Podcast "Die Agenda" von Gerhard Schröder, den Tenz und Anda gemeinsam erfunden haben und der ein wachsendes Publikum findet. Tenz, in Andas Agentur ABC Communikation Audio-Chefin, freut sich über mehr als 250.000 Abonnentinnen und fast genauso viele regelmäßige Hörerinnen – "die Konvertierungsrate ist unglaublich". Aber warum macht ein Altkanzler überhaupt einen Podcast? Für Anda ist das Format ein guter Weg zu zeigen, dass Gerhard Schröder für mehr steht als die Themen Putin, Nord Stream und Russland. Der These, dass Schröder mit seinen publizistischen Aktivitäten seinen Eintrag in den Geschichtsbüchern verändern will, widerspricht Anda dagegen. Anders als Helmut Kohl habe Schröder daran kein Interesse. Dass die Schröder-Podcasts als Zeitzeugnisse irgendwann mal für die Wissenschaft interessant werden könnten, kann Anda sich dagegen schon vorstellen. Tenz, die von Haus aus eher konservativ geprägt ist, interessiert sich für Schröders Blick auf die aktuelle Politik und gesteht: "Langsam werde ich zum Schröder-Fan." "Ich glaub, dass sich die Audiowelt im Moment sehr stark verändert", sagt Ina Tenz. Sie beobachtet, dass neben dem Massenmedium Radio die Nischen blühen und wichtiger werden, sei es durch Podcasts, Nischensender oder Streamingdienste. Beide Expertinnen sehen viel Potential für Audio-Formate, auch im aktuellen Wahlkampf, aber nicht für jeden Politiker. So kann sich Anda einen Podcast mit Robert Habeck sehr gut vorstellen, Armin Laschet und Olaf Scholz findet er sperriger. Am Ende der Diskussion sind sich beide einig, dass aktuell Annalena Baerbock die größten Chancen aufs Kanzleramt hat, weil die Popularität der Grünen und die der Kandidatin zusammenkommen. Olaf Scholz würde den Direktvergleich mit Laschet und Baerbock zwar jeweils gewinnen, die Schwäche der SPD bremse den Kandidaten aber aus.

Wie viel Mitschuld tragen Werbungtreibende am Clickbaiting? So lief das turi2 Clubsandwich.
Media und Verantwortung: "Wirtschaft sollte sich nicht zum Richter über guten oder schlechten Journalismus aufspielen", sagt Thomas Voigt im "turi2 Clubsandwich", dem gemeinsamen Media-Talk am Mittag von turi2 und Mediascale. Der Kommunikationschef der Otto Group hat am Mittwochmittag gemeinsam mit Daimler-Kommunikationschef Jörg Howe, Mediascale-Chef Wolfgang Bscheid und – gegen Ende des Talks – auch mit Moderatorin Dunja Hayali über die Frage diskutiert, ob Werbekunden eine Mitverantwortung für Clickbaitung und übergeigte Überschriften haben. "Ich tue mich wahnsinnig schwer damit, zu sagen, wer gut und wer böse ist", sagt auch Howe und fragt sich, wo die Grenze zu ziehen ist. Bscheid hat eine aktuelle Umfrage im Gepäck, in der sich 80 % von mehr als 200 befragten Marketing-Entscheiderinnen einen verantwortungsbewussteren Einsatz von Werbegeldern wünscht. Auch das Thema soziale Nachhaltigkeit, also u.a. der Kampf gegen Hate Speech, werde für die Verantwortlichen wichtiger. Auch Moderatorin Dunja Hayali, die sich gegen Ende des Talks in die Diskussion einschaltet, sieht einen Zusammenhang zwischen Media-Geld und Verantwortung. Es gebe Medien, die einen Auftrag haben und politisch klar verortet sind. Unternehmen, die dort Werbung buchen, müssten sich die Frage stellen lassen, ob die Haltung dieser Medien mit ihren gesellschaftlichen Werten vereinbar ist. Thomas Voigt etwa kann sich eine unabhängige Stiftung vorstellen, die Empfehlungen für bzw. gegen Media-Investitionen gibt – analog zu Presserat und Pressekodex und auf Basis objektiver Kriterien. Zu Beginn des Talks geht es zunächst um die Frage, wie es um die Qualität im Journalismus bestellt ist. Daimler-Kommunikator Howe etwa beklagt sich über Journalistinnen, die ihre Geschichten schon fertig haben, wenn sie sich an die Pressestelle wenden und ihn nur noch als Stichwortgeber brauchen. Andere kämen mit komplexen Fragenkatalogen "im Kasernenhofstil" und absurden Fristen für deren Beantwortung. Otto-Mann Voigt erlebt die Situation weniger negativ: Er erlebt zwar auch ausgedünnte Redaktionen und Hektik, trotzdem gebe es noch einen vertrauensvollen Umgang zwischen Kommunikatorinnen und Journalisten.

Der Trend geht zum Doppelpunkt – so lief die offene turi2 Redaktions-Konferenz bei Clubhouse.
Im Gespräch bleiben: "Ich weiß jetzt, wie sich Frauen fühlen müssen, wenn sie immer nicht mitgedacht werden." So bilanziert turi2-Gründer Peter Turi knapp zwei Monate generisches Femininum in den Medien von turi2. In einer offenen Redaktionskonferenz im turi2 Clubraum haben Redaktion und Community über die Erfahrungen mit der ausschließlich weiblichen Schreibweise diskutiert. Unter dem Strich wird klar: Niemand will zum generischen Maskulinum zurück, gleichzeitig braucht es aber ein Zeichen, das zeigt, wenn alle Geschlechter gemeint sind. Fast alle Gesprächsteilnehmer:innen plädieren für den von Verlegerin Heike Turi ins Gespräch gebrachten Binnen-Doppelpunkt – auch weil er den Lesefluss weniger unterbricht als das Gender-*. CvD Björn Czieslik legt Wert darauf, bei feststehenden Eigennamen wie "Bund der Steuerzahler" nicht zu gendern – es sei denn der Verband ändert seinen Namen offiziell. Peter Turi regt an, die Entscheidung, wie turi2 inklusive Sprache nutzt, an die Community weiterzugeben – in Form einer Online-Umfrage gemeinsam mit unserem Umfrage-Partner Innofact. Weiteres Thema der offenen Redaktionskonferenz war die Entwicklung der Audio-Plattform Clubhouse und die Frage, wie viel Leben angesichts sinkender Nutzer-Zahlen und wachsender Konkurrenz noch in der App steckt. Hier schaltet sich Agenturchef und Clubhouse-Influencer Holger Kahnt ein. Er glaubt, dass die App noch viel Potential hat und hofft auf einen weiteren Schub durch den für Mai angekündigten Android-Release. "Viele Menschen finden die spannenden Räume nicht", glaubt er und sieht die Clubhouse-Macherinnen in der Pflicht, eine bessere Discover-Funktion anzubieten.

Wie Digitalisierung in deutschen Schulen funktionieren kann.
Hefte raus, (digitale) Klassenarbeit: "Momentan ist das ungenutzte Potential ein Notstand", fasst Lehrer Oliver Kracke den Stand der Digitalisierung in deutschen Schulen im Open Innovation Live Podcast zusammen. Der "Lehrer mit Digitalisierungshintergrund", wie er sich selbst nennt, erzählt am Donnerstagabend von Lehrkräften Mitte 30, bei denen die Digitalisierung bei E-Mails aufhört. Das hält er für problematisch, da sie dann nicht einschätzen könnten, warum TikTok für Achtjährige so wichtig ist. Grundschullehrerin Charley Camejo muss sich selbst ständig mit neuen Plattformen auseinandersetzen und wünscht sich, dass es für Schülerinnen nicht nur einen Fahrrad-, sondern auch einen Internetführerschein geben sollte. Moderatorin Tess Kadiri erinnert sich, dass Social Media bei ihr im Unterricht nie angesprochen wurde – dabei ist ihr Abitur gerade einmal zwei Jahre her. Überrascht war Richard Gutjahr vom Stundenplan seiner Tochter in Israel: Bereits in der 1. Klasse stehen dort Fächer wie iPad-Unterricht auf dem Plan. Charley Cameo gefällt das Konzept, in Deutschland stehe aber oft der Lehrplan, der abgearbeitet werden muss. "Digitale Bildung" im Lehrplan wünscht sich auch Anna-Katharina Meßmer, Projektleiterin für Digitale Nachrichten- und Informationskompetenz bei der Stiftung Neue Verantwortung. Die Ergebnisse ihrer Studie zur Einordnung von Nachrichten nennt sie "überraschend": Von 30 möglichen Punkten erreichen die Teilnehmerinnen über 18 Jahren im Schnitt nur 13,3 Punkte. An Medienkompetenz mangele es nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen. Meßmer hofft, dass die Generationen in Zukunft stärker voneinander lernen.

“Unser Feld ist natürlich die Welt”: So lief das turi2-Chefgespräch mit Peter Limbourg.
Auf einer Wellenlänge: “Wer für uns in Afrika, Asien oder Mexiko unterwegs ist, riskiert teilweise sein Leben.” Peter Limbourg, Intendant der Deutschen Welle, tritt im turi2 Clubraum zum Chefgespräch mit Peter Turi an und würdigt die Leistungen seiner 3.300 Mitarbeiterinnen in aller Welt. Auch hier in Deutschland könnten “Journalisten mal Ärger kriegen oder einen Shitstorm”, mit den Gefahren in weniger stabilen Ländern sei die Arbeit aber nicht zu vergleichen. Die Leitung der Deutschen Welle ist für ihn ein Lebenstraum, sagt er. Als Diplomatensohn sei er in vier verschiedenen Ländern aufgewachsen, die Welt sieht er als “sein Feld”. Außerdem berichtet Limbourg, dass der Sender in einigen Ländern mit staatlicher Zensur kämpft. So sei in China kaum ein Durchkommen durch die “Great Firewall”. Die Zensur im Iran lasse sich dagegen umgehen. In vielen Ländern sei der internationale deutsche Sender aber willkommen und produziere für und mit lokalen Partnersendern in Radio und TV. Weitere Themen des knapp einstündigen Gesprächs sind u.a. sensible Sprache – Limbourg will “keine Sprachpolizei, die Häkchen macht”, aber dennoch niemanden ausschließen – und Diversität.

Können Familien-Firmen Nachhaltigkeit besser als Konzerne? So lief der Media-Talk bei Clubhouse.
Senf dazu: “Der durchschnittliche CEO hat eine Halbwertszeit von drei Jahren.” Michael Durach, Chef des Senf- und Ketchup-Herstellers Develey, ist überzeugt, dass Familienunternehmen grundsätzlich langfristiger denken als Konzerne, da u.a. keine Quartalsziele erreicht werden müssen. Im Mittwoch-Media-Talk bei Clubhouse sind sich er und Wolfgang Bscheid einig, dass Familien-Unternehmen beim Thema Nachhaltigkeit die Nase vorn haben. Am Mittwochmittag haben sie gemeinsam mit Christian Faltin von Cocodibu und turi2-Clubchef Peter Turi eine gute Stunde lang diskutiert. Wolfgang Bscheid von Mediascale gibt zu, dass das Thema Nachhaltigkeit in seiner Mediaagentur anfangs "schwer zu greifen" war. Gerade für jüngere Kolleginnen sei Nachhaltigkeit im Job ein Anspruch und nicht nur ein "Zusatzprojekt". Mit der Green GRP-Initiative sollen Unternehmen bei der Serviceplan-Tochter Werbung künftig klimaneutralisiert buchen können. Bscheid plädiert für einen offenen Umgang mit Konsumentinnen, wenn nicht alles auf Anhieb funktioniert. Michael Durach ergänzt: "Der Verbraucher sieht selbst, dass nicht alles von heute auf morgen möglich ist." Er findet, dass seine Firma ihre Nachhaltigkeits-Aktivitäten bisher womöglich nicht gut genug kommuniziert hat. So sei der Senf des 1845 gegründeten Familienunternehmens inzwischen klimaneutral, am nachhaltigen Ketchup arbeite die Firma gerade.

Clubfrühstück #7: “Veränderung muss nicht per se negativ sein.”
Wohlstand neu gedacht: "Veränderung muss nicht per se negativ sein", sagt Klima-Aktivist Quang Paasch von Fridays For Future beim Clubfrühstück zur Klimakrise im turi2 Clubraum. "Jede Ebene unseres Lebens muss neu gedacht, reflektiert und transformiert werden." Das Überdenken der eigenen Lebensweise müsse jedoch nicht zwangsweise Verzicht bedeuten. Als Beispiel führt er an, statt vielen kurzen Reisen lieber eine längere zu machen. Zustimmung erhält Paasch von Wolfgang Bscheid, der sich bei Mediascale für Nachhaltigkeit in der Werbeplanung einsetzt: Marken und Werbung müssten es Konsumentinnen "leichter machen", indem sie "hochattraktive und sozial-akzeptierte Lebenswelten bauen", die es ermöglichen, einen hohen Lebensstandard zu haben, "der versucht, so wenig Schaden wie möglich anzurichten". Bscheid appelliert: "Bitte unterschätzt mir nicht den enormen Einfluss, den der Konsument mit seiner kleinen Entscheidung am Regal auf die ganz großen Marken hat." Die Kaufentscheidungen seien der Treiber dafür, dass Gütesiegel und Aussagen zur Nachhaltigkeit in der Kommunikation an Bedeutung gewinnen. Die Mediascale-Mutter Serviceplan bietet Werbekunden nun an, die CO2-Emissionen ihrer Kampagnen auszugleichen. Klima-Aktivist Paasch warnt aber davor, sich mit Indivudal-Entscheidungen zu begnügen: "Dass Gefährliche ist, dass wir denken, 'Ich lebe jetzt vegan, ich habe mich gegen diese Reise entscheiden und habe ein nachhaltiges Produkt gekauft. Jetzt bin ich eine bessere Person, jetzt muss ich gar keine politischen Forderungen mehr stellen."

OILP #6: Vom Vorbild zum Sorgenkind – so blickt die Welt auf die Corona-Lage in Deutschland.
Internationale Insights: In Ausgabe 6 des Innovation Live Podcast blicken Tess Kadiri und Richard Gutjahr gemeinsam mit Expats und Journalistinnen auf die Corona-Lage weltweit. "Besorgniserregend" nennt Digital Producer Marc Labitzky in New York die Situation in Deutschland. Die Menschen in der Stadt hätten die Deutschen mit ihren leergefegten Straßen erst als Vorbilder gesehen. Das sei jetzt nicht mehr so. Richard Gutjahr meldet sich aus Irland und erzählt, wie sich Dublin innerhalb weniger Tage wegen sprunghaft steigender Infektionszahlen in eine Geisterstadt verwandelt hat. Journalist Karsten Lohmeyer lebt auf Bali 800 Meter vom Strand entfernt, statt Urlaubsfeeling erlebt er einen "ganz komischen Schwebezustand". Der Blick auf Deutschland lässt ihn bei der Mischung aus Impfgegnerinnen und Coronaleugnern "aus der Ferne verzweifeln". Journalistin Lilian Schmitt wünscht sich für Deutschland stärkere Kontrollen der Corona-Maßnahmen, wie es in Marokko üblich ist. Die frühere Türkei-Korrespondentin Senada Sokollu berichtet, dass sich das Land schon seit 2016 von einem Ausnahmezustand zum nächsten hangelt. Sie glaubt, dass die Menschen dort krisenerprobter sind als in Deutschland und sich über die Corona-Maßnahmen wenig wundern. Der Arzt Benjamin Zeier ist Leiter einer Covid-Intensivstation in Peru und hat viele dramatische Verläufe erlebt, weil Infizierte nicht rechtzeitig medizinisch behandelt wurden. Im Vergleich zu Deutschland bewertet er die Lage in Peru "deutlich prekärer", findet einen Vergleich zwischen beiden Ländern jedoch schwierig. Israel avanciert in der Coronakrise zum Vorbild. 90 % der Menschen über 16 Jahren sind bereits geimpft, sagt Bloggerin Jenny Havemann. Deutschland hänge mit Innovationen hinterher, was sich jetzt räche.

“Dummheit als Geschäftsmodell” – so lief das Clubfrühstück mit Henning Beck und Alexander Leinhos.
Algorithmen an der Macht: "Im Netz nichts Neues", diese Erkenntnis, formuliert von Vodafone-Kommunikationschef Alexander Leinhos, steht am Ende des turi2 Clubfrühstücks am Sonntag. Zuvor hatte Hirnforscher und Wissenschaftserklärer Henning Beck u.a. berichtet, dass Google-Mitarbeiterinnen ihm bei der Recherche zu seinem neusten Buch davon abgeraten haben, bei Google nach Informationen zu suchen, wenn er wirklich zu neuen Erkenntnissen kommen will. Als Problem identifiziert die Talk-Runde um Tessniem Kadiri und Peter Turi die Algorithmen von Google, Facebook, Netflix & Co, die jeder Nutzerin auf sie zugeschnittene Inhalte zeigen und den Menschen in gewisser Weise das Denken abnehmen: Die Dummheit der Menschen werde in den sozialen Netzwerken zum Geschäftsmodell, sagt Beck. Er sieht unsere Gesellschaft in einer ähnlichen Situation wie zu Zeiten Immanuel Kants vor 230 Jahren. Beck wünscht sich denn auch "eine neue Form von Mündigkeit und Aufklärung" in Sachen Facebook und Social Media. Die Menschen sollten die Mechanismen der Netzwerke kennen und sich bewusst machen, dass jeder Post für jede individuell optimiert ist. Er verdammt die Netzwerke nicht, sondern plädiert für eine bewusste und kritische Nutzung, etwa gezielte Auszeiten. Denn dem Reiz der Plattformen kann sich auch unser Podium nicht entziehen: Alexander Leinhos sagt, dass er zuletzt TikTok exzessiv erkundet hat, Henning Beck verliert sich gerne mal bei Twitter und Peter Turi gibt zu, zuletzt Clubhouse fast suchtmäßig genutzt zu haben.

"Wir gehen durch die Vordertür" – Chefredakteurin Brigitte Huber zeigt die neue "Gala".
Alles neu macht der März: Das People-Magazin "Gala" liegt seit heute in runderneuerter Form am Kiosk und im Briefkasten der Abonnentinnen – im Video- und Podcast-Interview von turi2 zeigt und erklärt Chefredakteurin Brigitte Huber, was sie und ihr Team verändert haben. So ist das Logo jetzt moderner, die Farben sind frischer und die Bildstrecken großzügiger. Auch inhaltlich baut Huber ordentlich um: Die Schluss-Rubrik "Immobilie der Woche" muss weichen – künftig verrät am Ende immer eine Prominente ein bisher unbekanntes Detail aus ihrem Leben. Auch im Heft gibt es neue Rubriken, die die Leserinnen näher an die Promis heranbringen sollen – ohne aufdringlich zu sein. Die "Gala" geht durch die Vordertür und liegt nicht mit dem Feldstecher auf der Lauer, sagt Huber. Sie ist überzeugt, dass sie in einem Vertrauensverhältnis zu den Prominenten mehr erfährt als durch Gerüchte, die am Ende ohnehin zu 80 % falsch seien. Die Leserinnen wüssten das zu schätzen. Huber erklärt, dass sich die Abo-Zahlen in der Pandemie gut entwickelt haben und dass das Heft auch bei den Werbekunden gut ankommt – die Chefredakteurin freut sich über "60 gebuchte Anzeigen" in der Relaunch-Ausgabe. Im ausführlicheren Podcast spricht Huber darüber, wie sie in die Rolle der Multi-Chefredakteurin hineingewachsen ist. Huber betreut neben der "Gala" die "Brigitte"-Gruppe mit mehreren Magazinen sowie die Personality-Magazine "Guido" und "Barbara". Sie hat das Loslassen lernen müssen, sagt Huber, leicht gefallen ist ihr das anfangs nicht.

In Führerhaus statt im letzten Wagen: So lief das turi2-Chefingespräch mit Patricia Schlesinger.
Menschen und Moneten: "Wir müssen bestimmte Dinge sein lassen, damit wir neue Dinge tun können", sagt Patricia Schlesinger im Chefingespräch mit Peter Turi im turi2 Clubraum. Unter "sein lassen" fällt die Streichung zweier Formate, 75 freie Mitarbeiterinnen sollen nicht mehr im bisherigen Umfang beschäftigt werden. Ein Sender muss die Möglichkeiten haben, sich zu verändern, erklärt Schlesinger. Das gelte auch für die Diversität in den Redaktionen: Bei Arbeiter- und Migrantenkindern "sind wir noch nicht gut genug", gibt sie zu. Auch mit sprachlichem Wandel geht Schlesinger offen um: Mit dem Gendersternchen konnte sie sich anfangs nur schwer anfreunden, inzwischen ist sie aber überzeugt, dass sich die Schreibweise durchsetzen wird. Patricia Schlesinger plädiert dafür, Menschen dort zu erreichen, wo sie sind: im Netz und und im klassischen Radio und TV. Für den Sender bedeute das, mit weniger Geld und weniger Menschen mehr Programm zu machen. Dass dieser Wandel den Menschen im RBB einiges abverlangt, ist Schlesinger bewusst. Wenn der Zug abfährt, steige sie aber "lieber ins Führerhaus anstatt in den letzten Wagon". Vorne könne man nämlich noch mitentscheiden, welche Weiche man nimmt.

Freund oder Feind der Redaktion? So lief die turi2-Montagsrunde über Clubhouse und Social Media.
Es ist kompliziert: Clubhouse könnte ein guter Freund für Redaktionen werden, darüber sind sich die Teilnehmerinnen der Montagsrunde im turi2 Clubraum einig. Doch zu welchem Preis? "Hype hin oder her: Es ist so, dass man sich grämt, dass man es nicht selbst erfunden hat", gesteht Lorenz Maroldt, "Tagesspiegel"-Chef seit 2004. Ein Stichwort zieht sich trotz des Lobs für die App durch die Clubhouse-Runde: Kapazitätsprobleme. "Wofür ein Talk, der nur 50 oder 100 Leute erreicht?", fragt Swen Thissen, Social-Media-Manager bei stern.de. Jörg Rheinländer vom Hessischen Rundfunk ergänzt: "Sinn macht es nur, wenn wir in einer Community Qualitätsvolles mitnehmen können." Wichtig im Social-Media-Alltag über Clubhouse hinaus: "Leidenschaft und Neugier haben, um neue Plattformen auszuprobieren", sagt Enita Ramaj, Cosmopolitan.de-Chefin. Dennoch müsse das Kosten-Nutzen-Verhältnis bedacht werden. Clubhouse sei für Bauer eher Business- als Reichweiten-Plattform. "Ich erkenne noch nicht, wie gut der Freund werden könnte und zu welchem Zwecke", sagt Rheinländer. Bisher sei Clubhouse eher der Feind aufgrund des Aufwands. Und wie ist allgemein der Beziehungsstatus zwischen Redaktionsalltag und Social Media? Thissen: "In jeder Beziehung gibt es Stress und man muss nicht alles wunderbar finden." Für ihn überwiegen die Chancen der sozialen Netzwerke. "Wir begreifen das als Tool - entweder man setzt das Ding richtig an oder es knickt ab", ergänzt Lorenz Maroldt.

“‘Konservativer Knochen’ triff nur einen Teil meiner Person.” So lief das Clubfrühstück mit Sigmund Gottlieb.
Treffen der Generation: Beim turi2 Clubfrühstück auf Clubhouse diskutieren Peter Turi und Tess Kadiri am Sonntagmorgen mit Sigmund Gottlieb, der von 1995 bis 2017 Chefredakteur des Bayerischen Fernsehens war. Gottlieb gilt vielen noch heute als letzte konservative Stimme der ARD. Dass seine Kommentare heute auch von Kollegen, die sich eher auf der linken Seite des politischen Spektrums verorten, vermisst werden, hört er gerne. Ein "konservativer Knochen" will Gottlieb dennoch nicht sein. Zum Abschied 2017 haben ihn Mitarbeiterinnen gar zum "letzten Punk der ARD" erklärt. Eine konservative Haltung besteht für ihn denn auch nicht nur darin, Bewahrenswertes zu bewahren, sondern auch offen für Neues zu sein. Gottlieb glaubt, dass "ideologische Trennungen" in der Politik heute eine deutlich kleinere Rolle spielen als früher – Politikerinnen hätten oft gar keine Zeit mehr, über ihren Kurs nachzudenken, sondern müssten einfach entscheiden. Offen ist Gottlieb auch bei den Fragen nach Gendersternchen und Jugendsprache. So sieht für ihn das geschriebene * zwar wie ein Verweis auf eine Fußnote aus und auch die gesprochene Gender-Lücke findet er "gewöhnungsbedürftig". Gleichzeitig plädiert er dafür, "nicht deutsch-verkrampft" zu diskutieren und findet die Diskussion um eine gerechte Sprache als noch "nicht abgeschlossen". Es sei das Privileg der Jugend, eine eigene Sprache zu generieren. Richtig "ätzend" findet Gottlieb dagegen, wenn sich 60-Jährige bei jungen Leuten anbiedern, in dem sie ihre Sprache übernehmen.

Clubhouse als Tor zur Welt – so lief der Open Innovation Live Podcast #5.
Der Traum vom Tellerrand: "Wozu taugt dieses Clubhouse eigentlich?", fragt Peter Turi im turi2 Clubraum am Donnerstagabend. Im Kern der Runde steht auch die Frage, was die App nach dem anfänglichen Hype zukünftig noch leisten kann. Journalist Jaafar Abdul Karim gibt an, Clubhouse als Recherche-Tool zu nutzen. Er sieht die Plattform auch als politischen Ort, an dem sich Menschen austauschen können, die in autoritären Regimen leben und sonst keinerlei Chance dazu haben. In China wurde Clubhouse jedoch beispielsweise bereits gesperrt. Student Pablo Cienfuegos Klein weist auf antisemitische und rassistische Räume hin. Dort gehe er bewusst auf die Bühnen und versuche, sachliche Gegenargumente hervorzubringen: "Es hören 100, 200 Personen zu und das macht was mit denen." Welche Motive verfolgen die Menschen noch im Clubhouse? Während Mobility-Netzwerkerin Katja Diehl "ein bisschen die Welt verbessern und Menschen Wissen vermitteln" möchte, will Cordt Schnibben in seinem "Writers Pub" mit Autorin Doris Dörrie Zuhörerinnen dazu ermuntern, selbst zum Stift zu greifen. Auch Finanzen sind ein Thema: Karrierebibel-Journalist Jochen Mai berichtet von Personen, die sich längst ein Clubhouse-Geschäftsmodell aufgebaut haben. Die sogenannte Moderatorinnen-Elite werde gut dafür bezahlt, Räume professionell zu moderieren. TV-Moderatorin Carola Ferstl sieht in Clubhouse eine Art Telegram-Fortsetzung – in ihren Räumen gebe sie u.a. Aktien-Neulingen Tipps. Fast-Auswanderer Nicolas Kreutter glaubt trotz der stark abgeflachten Hype-Kurve seit Januar, dass in der App noch einiges passieren wird. Werden Moderatorinnen dann die neuen Influencerinnen? Nicht ganz: Die neuen "Stars" sind, zumindest laut Jochen Mai, die Gastgeberinnen, die mit Themenschwerpunkten und spannenden Gästen auf sich aufmerksam machen.

Über Gendersternchen * und Einsamkeit – so lief das Clubfrühstück mit Diana Kinnert.
Frühstück zum Hören: Beim turi2 Clubfrühstück auf Clubhouse diskutieren Peter Turi und Tessniem Kadiri am Sonntagmorgen mit CDU-Politikerin und Autorin Diana Kinnert. Erstmals gibt es die Sonntagsrunde auch als Podcast und als Video bei turi2.tv. Inhaltlich geht es um Alternativen zum Gendersternchen und das Thema Einsamkeit, über das Kinnert gerade ein Buch geschrieben hat. Peter Turi findet, "das Gendersternchen nervt". Sein Vorschlag: BinnenGroßschreibung oder ein Generisches Femininum. Tessniem Kadiri bevorzugt statt * lieber den Doppelpunkt, der auch für Blinde besser lesbar ist, sagt aber auch: "Wenn Leute das Gendersternchen kritisieren, dann sind sie auch nicht offen für einen Doppelpunkt." Kinnert sieht die Notwendigkeit einer diversen Ansprache, findet "alle Lösungen aber nur so halbelegant". Im Gesprochenen favorisiert sie eine Doppelansprache wie "Bürgerinnen und Bürger", wohl wissend, "dass ich auch damit viele Menschen gar nicht adressiere oder einige ausschließe". Der zweite Punkt auf der Agenda: Einsamkeit. "Kaum ein Thema ist schambehafteter", sagt Diana Kinnert, die für ihr Buch Die neue Einsamkeit mikt vielen Psychiater*innen gesprochen hat. Ursprünglich wollte sie über ältere, verwitwete Frauen ohne Internetzugang auf dem Land schreiben. Im Laufe ihrer Recherchen hat sie aber festgestellt, dass Einsamkeit auch in der Generation Z und bei Millennials ein gravierendes, gesundheitliches Problem darstellt – vor allem in Großstädten, bei denen, die als besonders flexibel und vernetzt gelten. Tessniem Kadiri kennt das Tabu-Thema Einsamkeit, gerade in der Pandemie: "Ich habe das Gefühl, dass man sich mit Einsamkeit irgendwie Schwäche eingesteht. Und ich persönlich will mir nicht Schwäche eingestehen." Interaktion mit anderen Menschen in sozialen Medien könne echte Begegnungen nicht ersetzen: "Das ist für mich nicht echt. Instagram und Twitter konsumiere ich irgendwie mit anderen Menschen, aber das wäre für mich nie soziale Interaktion." Den anfänglichen Clubhouse-Hype schreibt Diana Kinnert der Möglichkeit zu, "in einem Raum von Kontaktvermeidung und Sterilität" von anderen Leuten unmittelbar die Stimme zu hören. "Ich glaube, dass im Vordergrund gar nicht die politischen Inhalte standen, sondern der soziale Austausch."

Ein Versuch gegen Blasenbildung – so lief der Open Innovation Live Podcast #4.
Glorreich gescheitert: Der "Open Innovation Live Podcast", OILP, hat die Zuhörer*innen im turi2 Clubraum am Donnerstagabend auf eine leicht verunglückte Reise in unbekannte Hörwelten mitgenommen. Denn die Idee, die eigene Filterblase zu durchstechen, hat nur bedingt funktioniert. Nach einer 20-minütigen Expedition in parallel stattfindende Clubhouse-Räume kommt etwa Volocopter-Erfinder Alexander Zosel mit Eindrücken aus einem Raum mit Schamanen und Geistern zurück. Der Journalist Marko Schlichting entdeckt einen Raum, in dem die sonst so verschwiegenen Freimaurer für sich werben, und die blinde Microsoft-Mitarbeiterin Franziska Sgoff besucht einen Spiele-Raum, der mithilfe von Instagram möglich wird. "In diesem Raum habe ich das erste Mal nicht offen über meine Blindheit gesprochen", sagt sie, das habe da einfach keine Rolle gespielt. Dass es gar nicht so einfach ist, der eigenen Blase zu entkommen, zeigt, dass viele Besucher*innen in typischen Medienräumen landen, etwa in einem Gespräch mit Dagmar Berghoff über die "Tagesschau"-Vergangenheit oder einem Raum, der den Namen CNN kapert, um so mehr Zuhörer*innen zu gewinnen. Am kommenden Donnerstag unternimmt das OILP-Team einen weiteren Versuch gegen die Blasen-Bildung: Dann sind engagierte, exotische und erfolgreiche Stimmen aus dem Clubhouse-Universum in den turi2 Clubraum eingeladen. Schon jetzt nehmen wir Tipps und Anregungen entgegen – unter der Mailadresse club@turi2.de, je abgefahrener und medienferner, umso besser.

Werbenachwuchs wanted: So lief jobs@turi2 bei Serviceplan.
Werbung im Wandel: Glanz, Glamour und Ausschweifungen aller Art – das war vielleicht früher mal üblich in der Werbebranche. Heute ist das anders: Bei jobs@turi2, der Partnerbörse der Kreativwirtschaft, präsentiert sich Serviceplan, Europas größte inhabergeführte Agenturgruppe, vor allem als auf Nachhaltigkeit bedachter Arbeitgeber. Geschäftsführer und Gesellschafter Ronald Focken berichtet, dass die Agentur ihren Mitarbeiter*innen für Wege in der Münchner Innenstadt Fahrräder zur Verfügung stellt, Papier möglichst beidseitig bedruckt und im Rahmen einer Nachhaltigkeits-Initiative mehr als 1.000 Flüge gespart hat. "Wir sehen uns als Multiplikatoren", sagt Focken, der selbst meist mit dem Fahrrad ins Büro kommt. Sein Kollege Felix Bartels, Head of Business Developement, bestätigt, dass das Prinzip Vorbild funktioniert und auch viele Werbekunden nach nachhaltigen Kampagnen fragen. Auch für Nachhaltigkeitchefin Julia Nicolaisen gehören Werbung und Nachhaltigkeit unter einen Hut. Sie findet das Genre "superspannend, um das Konsumverhalten der Menschen in Richtung Nachhaltigkeit zu beeinflussen". Dass Serviceplan vor diesem Hintergrund nicht jeden Werbe-Job annimmt, betont Focken: Eine Anfrage des Rüstungskonzerns Rheinmetall habe er abgelehnt. Grundsätzlich überlässt er es aber den einzelnen Einheiten, welche Aufträge sie annehmen, bzw. auf welche Etats sie sich bewerben. Wie fast alle Agenturen sucht auch Serviceplan Mitarbeiter*innen in allen Bereichen – rund 700 Menschen stellt die Gruppe pro Jahr ein, berichtet Recruiting-Chefin Julia Schweizer. Wer Interesse an Serviceplan habe, der solle "einfach mit uns ins Gespräch kommen", oft hätten sich erst aus dem Austausch Job-Optionen und -Positionen ergeben. Studierenden in der Kommunikationsbranche ruft sie zu, neben der Uni schon möglichst viel Erfahrungen im echten Berufsleben zu sammeln, etwa über Praktika. Und auch eine Altersgrenze sieht sie nicht: Ein- oder umsteigen könne man eigentlich immer.

Freiwilligkeit hilft nicht: So lief der Diversitäts-Talk im turi2 Clubraum.
Abbild der Realität: Talks wie dieser sollten 2031 lange überflüssig sein, darauf hoffen alle Teilnehmer*innen der Runde im turi2 Clubraum am Montagabend. Das Plenum diskutiert darin den Weg zu mehr Diversität in der Kommunikationsbranche – und der darf für Kémi Fatoba, freie Journalistin und Daddy-Magazin-Gründerin, nicht an vielfältigeren Führungsetagen in Medienhäusern vorbeiführen. Menschenrechtsaktivist Raúl Krauthausen fordert Journalist*innen dazu auf, Menschen mit Behinderung auch in ihrer Rolle als Chirurg*innen oder Linguist*innen anzusprechen. Er glaubt, dass Firmen ihr Recruiting auch deshalb lieber auf People of Color oder LGBTQ-Talente ausrichten, weil sie Kosten für Rampen oder Braille-Tastaturen scheuen. Dabei braucht es genau diese vielen verschiedenen Blickwinkel, um Medien und Gesellschaft voranzubringen, meint Verlegerin Katarzyna Mol-Wolf. Die “FAZ”-Aufsichtsrätin mahnt gleichzeitig, nicht zu spitz zu diskutieren, um mit der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung Schritt zu halten: “Wir kriegen das Sichtbarmachen ja nicht mal bei den Frauen hin.” Auch Generationsbotschafterin Ulrike Krämer wünscht sich in Sachen Diversität mehr gesetzliche Verpflichtungen für Firmen und sagt: “Wir profitieren alle davon, wenn die Gesellschaft abgebildet ist.” Ganz konkret wird es, als RTL-Social-Redakteurin Nora Pfützenreuter verspricht, den Impuls der blinden Ex-RTL-Mitarbeiterin Andrea Eberl mit zu ihrem Arbeitgeber zu nehmen, Sender und Medienhaus auch hinter den Kulissen barrierefreier zu gestalten. Nachholbedarf auf dem Bildschirm gibt es diesbezüglich im internationalen Vergleich übrigens bei allen privaten TV-Sendern, sagt Podcaster Ralf Podszus ganz zum Schluss – und fragt sich, warum Gebärdensprache nicht längst mediale Realität auf allen Kanälen ist. Das tun wir an dieser Stelle auch. Und freuen uns schon auf den nächsten großen RTL-Blockbuster mit eingeblendeter Gebärdensprach-Dolemtscher*in.

Ein Abend für Inklusion – so lief der Open Innovation Live Podcast #3 bei Clubhouse.
Mit allen Sinnen: Zuhören, wie blinde und gehörlose Menschen leben und Social Media nutzen, steht im Mittelpunkt der dritten Ausgabe des Open Innovation Live Podcasts von Richard Gutjahr und Peter Turi im turi2 Clubraum. Bloggerin und Drehbuchautorin Julia Probst, bei Twitter bekannt als @EinAugenschmaus, ist gehörlos, kann über eine Live-Transkription und ihren Gebärdensprache-Dolmetscher aber dennoch an der Diskussion teilnehmen. "Ich war total überrascht, wie viele tolle Themen es hier bei Clubhouse gibt. Das hat die Angst in mir geschürt, Dinge zu verpassen", sagt sie. Die blinde Kinderbuch-Autorin und Microsoft-Mitarbeiterin Franziska Sgoff schätzt an Clubhouse die Möglichkeit, mit der Stimme zu überzeugen: "Hier kann der Mensch einfach sein, wie er ist." Online-Journalist Marko Schlichtung, ebenfalls blind, lobt dass sich die Clubhouse-Entwickler sehr darum bemühen, die App für Blinde nutzbar zu machen: "Das ist für mich gelebte Inklusion." Innerlich zum Köcheln bringt ihn dagegen die häufige Frage zu seiner Blindheit: "Kann man da denn gar nichts machen?" In einen ähnlich Kerbe schlägt Julia Probst, die oft gefragt wird, ob sie nicht gerne hören würde: "Das ist so eine nervige Frage! Das einzige, was ich nicht kann, ist hören. Den Rest kriege ich doch wunderbar hin." Franziska Sgoff wünscht sich, dass Menschen mit und ohne Behinderung mehr miteinander in den Austausch kommen, "um sich gegenseitig besser kennenzulernen und die Lebenserfahrungen des Gegenübers besser zu verstehen". Marko Schlichting warnt jedoch vor ungefragter und ungewollter Hilfe, etwa beim Überqueren der Straße. Außerdem geht es um Cripping up, der Tatsache, dass Schauspieler*innen ohne Behinderung in Filmen Menschen mit Behinderung spielen. Für Julia Probst völlig unverständlich: "Es gibt ganz viele gehörlose Schauspieler*innen, die eine Glanzleistung vollbringen, aber trotzdem nicht angenommen werden." Sie merke, wenn die Behinderung nur gespielt ist, sagt Probst: "Ich habe den Eindruck, dass man da manchmal für doof verkauft wird." Marko Schlichting sagt, behinderte Menschen sollten im Berufsleben ihre Fähigkeiten nicht unter den Scheffel stellen, sondern als Vorteil präsentieren: Er selbst kann bestens in der Nacht arbeiten, weil ihm egal ist, ob es draußen hell oder dunkel ist. Julia Probst ergänzt, Gehörlosen mache in Großraumbüros die Geräuschkulisse nichts aus. Am kommenden Donnerstag will der Open Innovation Live Podcast die eigene Filterblase überwinden und in andere Räume reinhören, "von denen wir am wenigsten Ahnung haben", schlägt Peter Turi zum Schluss vor. turi2.tv (83-Min-Video/-Podcast), turi2.de/podcast, , spotify.com, podcast.apple.com, deezer.com, audionow.de

Aufstieg eines Fitness-Lauchs: So lief der turi2 Clubabend mit Philipp Westermeyer.
Medienmacher unter sich: OMR-Chef Philipp Westermeyer markiert beim Clubabend mit Peter Turi und der turi2-Community am Mittwochabend den Vollbut-Unternehmer. Westermeyer berichtet, dass sein Team und er in der Pandemie ein neues Geschäftsfeld erschlossen haben: Als Dienstleister betreibt OMR Impfzentren in Hamburg, hat dafür personell auf insgesamt 500 Angestellte aufgestockt. Vor Ort übernähmen seine Leute "alles, was nicht medizinisch ist", zum Beispiel die Datenerfassung. Immerhin gibt es finanziell ein bisschen was aufzuholen: Ein bis zwei Millionen Euro habe das gecancelte OMR-Festival die Firma 2020 gekostet. Jetzt soll es die Online-Corona-Rockstars, darauf hofft Westermeyer, höchstens noch bis Ende des Jahres geben, wenn alle geimpft sind und Live-Events wieder möglich sein könnten. "Allerspätestens im Mai 2022" soll es die Flaggschiff-Veranstaltung wieder geben – die Chancen stehen gut, dass das Durchschnittsalter der Gäste dann deutlich unter dem im Impfzentrum liegen wird. Seinen unternehmerischen Erfolg erklärt Westermeyer mit dem "Fitnessstudio-Effekt": Angefangen habe er – wie einst im Sporti – als "dünner Typ", der null Klimmzüge geschafft hat. "Am Anfang hast du auch als Unternehmer keine Ahnung, weiß noch nicht mal, wie man eine Rechnung schreibt. Dieser Muskel wird aber mit jedem Tag und jedem Monat stärker." Gepumpt hat Westermeyer offenbar auch in Sachen VIP-Akquise für seinen Podcast, darauf weist Ex-"Welt"-Journalist Stephan Dörner im Clubraum hin. Den Grundstein für die Promitisierung habe Talk-Gast Dieter Bohlen gelegt, sagt Westermeyer: "Als ich den Verdacht hatte, das könnte was sein, haben wir weitergemacht." Der Marketing-Mann kündigt außerdem eine Nachfolge-Doku zur Middelhoff-Produktion an, outet sich als E-Mail-Sekretär seiner Mitarbeiter*innen und gibt Tipps fürs Körbe-Verteilen. Dazu tritt mit einem überraschenden Gruß aus der Küche noch Podstars-Mitmischer Tim Mälzer vors Mikrofon. Der fragt sich, was 300 Leute zur Feierabend-Zeit in einer App zu suchen haben. Eine Clubhouse-Kochshow, lieber Tim Mälzer, würde sicher auch zur Mittagszeit irre gut laufen. Wir freuen uns drauf!

“Ein Schutzschirm aus Inspiration und Hoffnung” – so feiert die “Zeit” ihren 75. Geburtstag.
Und im Herbst ein Fest: "Wir wollen uns nicht auf den Heldentaten der Vergangenheit ausruhen." Im Video- und Podcast-Interview mit turi2.tv erklären Wencke Tzanakakis und Nils von der Kall, dass sie zum 75. Geburtstag der "Zeit" lieber nach vorne statt nach hinten gucken. Im Laufe des Jahres sammelt das Blatt "75 Ideen für eine bessere Zukunft" – nicht nur bei Expert*innen, sondern bei seinen Leser*innen. Den Auftakt gibt es in der Jubiläums-Ausgabe, die am Donnerstag erscheint. Bis zum Jahresende soll so "ein Schutzschirm aus Inspiration und Hoffnung" entstehen, sagt Tzanakakis, die das Abonnentenprogramm "Freunde der Zeit" leitet. Für Sie hängt der Erfolg der "Zeit" – das Blatt erreicht aktuell so viele Leser*innen wie noch nie – maßgeblich damit zusammen, dass es inzwischen auf alle "Code words eines bürgerlichen Wissenstandes" verzichtet und "voraussetzungsarm" schreibt – ein Verdienst von Chefredakteur Giovanni di Lorenzo, sagt Tzanakakis. Als Verlagsleiter für Marketing und Vertrieb setzt Nils von der Kall vor allem auf die "Zeit"-Community als Wachstumsmotor. Er glaubt, dass es das Blatt in den vergangenen Jahren geschafft hat, sich "ein bisschen den Naturgesetzen des Zeitungsmarktes" zu entziehen. Das Wachstum der "Zeit", gerade was die Abonnent*innen angeht, sieht er noch längst nicht am Ende. "Vor zehn Jahren hatten wir noch 100.000 Abonnenten weniger", heute sei das Blatt eine Wachstumsmarke. Im Interview gibt er sich überzeugt, noch mehr Leser*innen zu gewinnen und neue Geschäftsfelder – auch neben der Zeitung – zu erschließen.

Talentsuche bei Clubhouse – so lief die Premiere von jobs@turi2 mit FischerAppelt.
Klein anfangen, groß rauskommen: Am Dienstagabend hat turi2 seinen Clubraum erstmals für das Projekt jobs@turi2 geöffnet – die Partnerbörse für die Kreativwirtschaft. Als Gastgeber war die Hamburger Agentur FischerAppelt auf dem Podium, vertreten durch Mit-Gründer Andreas Fischer-Appelt und Eugenia Lagemann, Chefin von Fischer-Appelt relations. Lagemann erklärt, dass die PR-Branche und ihre Agentur Leute brauchen, “die sehr digital ticken” und wirbt für ihr Trainee-Programm, das alle neuen Mitarbeiter*innen durchlaufen. Die PR-Branche sei längst kein Sammelbecken für Journalist*innen mehr, sagt Fischer-Appelt. In seiner Agentur hätten nur 50 der insgesamt 700 Mitarbeitenden Wurzeln im Journalismus. Auch der Netzwerker und Fachjournalist Nico Kunkel glaubt, dass die PR mehr Gewerke als den Journalismus braucht. Er wünscht sich mehr Quereinsteiger*innen, etwa Menschen mit Wirtschaftsstudium. Wenn eine große, deutsche PR-Agentur für sich als Arbeitgeber trommelt, hört auch die Konkurrenz mit: Auf dem Podium spricht Zuhörer Lars Cords von Scholz & Friends zunächst von seiner Vergangenheit bei FischerAppelt, um gleich hinterher zu erwähnen, dass auch seine Agentur 50 offene Stellen hat. Eine ähnliche Guerilla-Taktik verfolgt Tilo Bonow von Piabo-PR: Er hat zehn offene Stellen zu bieten und via Clubhouse bereits einige Bewerber*innen gefunden. Auch jobs@turi2 geht weiter – am kommenden Dienstag ist die Agentur Serviceplan akustischer Gastgeber der Job-Plattform.
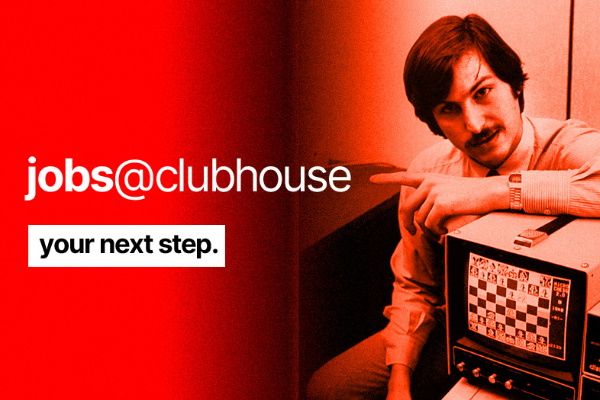
Podcast statt E-Mail? So lief der turi2 Clubabend über Audio-Formate in der PR.
Die Kurve geht runter: Leider nicht mehr bei den Corona-Zahlen, aber beim Clubhouse-Hype, meinen die Teilnehmer*innen der Montagsrunde im turi2-Clubraum. MDR-Sprecherin Julia Krittian sieht dennoch einen anhaltenden Akustik-Trend: "Die Nachfrage nach Kurzinfos hat abgenommen, weil wir alle spüren, dass man mehr und länger erklären muss. Vielleicht ist das der Grund für den Hype um Audio-Formate." Laut RWE-Pressechef Lothar Lambertz ist zumindest das schriftliche Wortlaut-Interview ein rückläufiges Format. Events sind als Kommunikations-Tool schon weggebrochen, daran erinnert Medientage-Marketerin Kerstin Deixler. Steht jetzt auch das geschriebene Wort kurz vor dem Ableben? Einen solchen Shift in der internen Kommunikation beobachtet Patrick Kammerer von Coca-Cola, sein Team und er greifen auf Corona-Distanz inzwischen ganz selbstverständlich zum Hörer statt in die Tasten zu hauen: "Wir haben keine Lust mehr, lange E-Mails zu schreiben." Für die Deutsche Telekom berichtet zudem Podcast-Chefin Lina Brinkschulte von einem gestiegenen Bedarf nach "nahbarer, authentischer" Kommunikation. "Je ehrlicher, desto erfolgreicher"? Diese einfache Wahrheit über PR gibt Moderatoren-Legende Waldemar Hartmann, Cola Zero statt Weißbier schlürfend, in die Runde. Authentizität könne das gesprochene Wort leisten, meint CEO-Flüsterer Michael Manske von Volkswagen: "Audio ist echter, bringt Nähe." Überhaupt sei der "Hollywood-Filter" weg. Im Hause VW würden Podcasts mit dem Boss schon mal mit Ansteckmikro am Handy produziert. Dass Volkswagen seine Konzern-PR in absehbarer Zukunft nur noch per Audio verbreitet, ist trotzdem eher unwahrscheinlich. Etwa auf Clubhouse eine Meldung mit Schlagkraft zu platzieren, sei schwierig, glaubt Manske: "Außer natürlich, es geht etwas schief." Viel wahrscheinlicher ist indes, dass VW-Boss Herbert Diess bald Clubhouse-Premiere feiert. Wir hätten da mittwochs noch einen Interview-Slot frei.

Gutjahr+Turi #2: Der Podcast ohne Namen und Konzept
Diesmal: Der Podcast, der zwei Frauen & immer noch ein Konzept sucht. Nimmt Form an: Richard Gutjahr und Peter Turi geben ihrem Podcast ohne Namen und Konzept zusammen mit der turi2-Community eine neue Richtung, beschließt die Runde im Clubraum am Donnerstagabend. Auf Anregung von Autorin und IT-Managerin Franziska Sgoff, die blind ist, und ZDF-Moderatorin Sandra Olbrich soll die nächste Ausgabe am nächsten Donnerstag auch für hörgeschädigte und gehörlose Menschen zugänglich werden. PR-Stratege Sascha Stoltenow gibt dazu einen einfachen, aber hilfreichen Hinweis: Der Podcast könne als Video live mitgeschnitten werden, während die Kamera die Echtzeit-Untertitel-Funktion von PowerPoint abfilmt. Die Gruppe um Media-Lab-Bayern-Chefin Lina Timm, Medienmanager York von Heimburg, Mediate-Gründerin Katja Nettesheim und die Schweizer Audio-Macherin Bea Jucker spricht sich gemeinsam für den neuen Dreh für das Format aus. "Wenn man hier eine lebendige, vielfältige Community aufbauen möchte, muss man allen Menschen den Zugang ermöglichen", meint Moderatorin Olbrich. Die Hoffnung des Plenums: Das aktuell noch exklusive Inklusiv-Konzept für die Plauder-Plattform könnte – sofern das Untertitel-Feature wie geplant funktioniert – später auch von den Initiatorinnen anderer Räume aufgegriffen werden. Und die App so für mehr Menschen öffnen, noch bevor die Clubhouse-Macherinnen die technischen Voraussetzungen dafür schaffen. Das Experiment geht also weiter. Hinweis: Das Transkript und die Untertitel dieser Folge erscheinen am Freitagnachmittag (19. Februar 2021).

“Lippenstift lässt das Hirn nicht schrumpfen”: So lief der turi2 Clubabend mit Tijen Onaran.
Die Sichtbare: Unternehmerin und Profi-Netzwerkerin Tijen Onaran plaudert beim Mittwochs-Clubabend von turi2 mit Peter Turi über Diversität in der deutschen Unternehmenswelt.

Welches Social Network inspiriert dich? Was nervt? So lief der Social-Media-Talk auf Clubhouse.
Der Mix macht's: Social Media zwischen Inspiration und Nerv-Faktor, darüber hat am Montagabend eine Runde aus Journalistinnen und PR-Frauen im turi2 Clubraum bei Clubhouse diskutiert. Einig sind sich Stephanie Tönjes, Content-Strategin der Telekom, Kristin Dolgner, Operativ-Chefin der PR-Agentur hypr, und die Journalistinnen Nalan Sipar, Tess Kadiri und Yasmine M'Barek darüber, dass es ohne soziale Netzwerke nicht geht. Die Schwerpunkte der Diskussions-Teilnehmerinnen unterscheiden sich aber zum Teil erheblich. Stephanie Tönjes etwa schwört auf Linked-in und "Personal Branding" – für sie ist das mehr als Selbstbeweihräucherung, es gehe um Persönlichkeitsentwicklung und die Frage "Wofür möchte ich stehen?". Diese Frage beschäftigt auch Kristin Dolgner, wenn sie PR für Unternehmen macht: "Die Communitys wünschen sich von den Unternehmen eine Haltung, es geht nicht mehr nur um Glossy Fotos und Kampagnen." Für die Journalistinnen Tess Kadiri, Nalan Sipar und Yasmine M’Barek sind Filterblasen in den Netzwerken ein großes Thema. Die deutsch-türkische Journalistin Nalan Sipar hat Angst vor einer gespaltenen Gesellschaft, wie sie sie in der Türkei erlebt, dort gebe es keine öffentliche Debatte mehr. Sie folge in Social Media bewusst Menschen, über deren Beiträge sie sich ärgert, um ihre eigene Filterblase zu durchbrechen. Für Tess Kadiri ist Input, der von außerhalb der sozialen Medien kommt, deswegen so wichtig: Sie begegnet anderen Meinungen und Weltanschauungen im Radio, Fernsehen oder im persönlichen Gespräch und merkt, "aus den Filterblasen muss man raus". Yasmine M’Barek nutzt alle relevanten sozialen Netzwerke: Auf TikTok erfährt sie, wie die ganz jungen Leute ticken, bei Twitter erlebt sie die Journalist*innen-Blase, die sie als "fern der Lebensrealität" bewertet, und auf Instagram sei "alles soft gewaschen" – "der Mix daraus ist für mich persönlich ganz gut".

Gutjahr+Turi #1: Der Podcast ohne Namen und Konzept
Konstituierende Clubhouse-Session: Mit viel prominent-kollegialere Unterstützung haben Journalist und Blogger Richard Gutjahr und turi2-Gründer Peter Turi am Donnerstagabend ihren "Podcast ohne Namen und Konzept" gestartet. Ihr Ziel: In insgesamt zehn Sessions Inspiration und Ideen für die Nutzung von Audioformaten und Hörräumen zu finden. Die Clubabende laufen jeden Donnerstagabend live auf Clubhouse und tags drauf als turi2-Podcast. Bereits zur Premiere hat sich die turi2-Community aktiv eingebracht – auf dem Podium haben u.a. n-tv-Journalistin Carola Ferstl, der beratende Blogger Thomas Knüwer, die Fotografin Anne Hufnagl, der Neurowissenschaftler Henning Beck und der Immobilien-Unternehmer Konstantin Neven DuMont mitdiskutiert und Einfluss auf das Konzept des Podcasts genommen. So erklärt Henning Beck etwa, dass es bei Clubhouse mehr um Content geht als auf anderen Plattformen, weil kein Bild ablenkt: "Ein Drittel unseres Hirns ist mit der Bildverarbeitung beschäftigt", erklärt der Forscher – das falle hier weg. Zudem sei der Kontakt zu anderen Menschen ein "urmenschliches Bedürfnis", deshalb hält Beck Audio-Räume wie Clubhouse auch nicht für einen kurzlebigen Hype. Fotografin Anne Hufnagl, die u.a. auf der Pioneer One von Gabor Steingart für die Optik sorgt, findet Bilder auf Clubhouse dagegen besonders wichtig, gerade, weil es in der App so wenige davon gibt: "Ich klicke auf Bilder der Leute, die ich ansprechend finde." Auf eine Kritik haben Gutjahr und Turi sofort reagiert: Damit am Ende kein Podcast von alten, weißen Männern entsteht, versprechen sie, sich um die von der Community vorgeschlagenen Frauen als Gäste für die nächsten Ausgaben zu bemühen: Carline Mohr, Sham Jaff, Samira El Ouassil und Maja Göpel. Außerdem soll es, anders als bei der Premiere, keinen rein männlichen Einführungstalk mehr geben.

turi2 Clubabend im Maschinenraum von Storymachine – mit Kai Diekmann.
Peter Turi im Gespräch mit Kai Diekmann und Philipp Jessen. Mann oder Maschine: "Am Ende ist uns nichts Besseres eingefallen." Im schwarzen Steve-Jobs-Rolli erzählt Ex-"Bild"-Boss, PR-Unternehmer und Eis-Bademeister Kai Diekmann beim turi2 Clubabend, wie der Name Storymachine einst nachts um halb zwei nach zwei Flaschen Weißwein bei einem Italiener in Köln geboren wurde. Kollege und Mitgründer Philipp Jessen finde den Namen "so schlecht, dass er schon wieder gut ist". Während diese Startup-Story aus ihm heraussprudelt, führt Diekmann das Publikum durch die Büroräume seiner Agentur und ist sichtlich stolz auf das, was er da zeigt: Das Berliner Schrabbel-Interieur in einem alten Varietétheater mit eingebauter Wellblechhütte und 50-Euro-Kirchenbank von eBay habe er teils persönlich vom Flohmarkt besorgt, teils von seinem Haus auf Usedom recycelt. Von zu wenig Geld für frische Büromöbel zeuge das keinesfalls, so der PR-Mann. Alles sei "aufwändigst konserviert". Seine Rolle als Gesellschafter "ohne exekutive Funktion" bei Storymachine beschreibt Diekmann so: "Ich bin hier der Hausmeister." Über seine Rolle im Wirecard-Skandal sagt er: "Kein anderes Investment hat mich so viel Geld gekostet wie mein Investment in Wirecard." Er habe den "Fehler" gemacht, dem Unternehmen selbst, der Bafin, der Bundesbank, und "den vielen deutschen Journalisten" zu glauben: "Das ärgert mich die Hölle." Von aus den Hemden quellendem Brusthaar und zu viel Testosteron bei Storymachine wollen Diekmann und seine Kolleg*innen übrigens nix wissen. Eine Mehrheit der rund 90 Angestellten seien – entgegen der Außenwirkung durch die Aushängeschilder Diekmann und Jessen – Frauen, sagen die Kolleginnen Claudia Behrendt und Stefanie Weber. Dass von der Macho-Kultur vor Ort weniger zu spüren ist als aus der Ferne, bestätigt Ex-"Bild"-Kollegin und Ex-ntv-Chefin Tanit Koch bei der After-Show-Party auf Clubhouse. Was seine Kundschaft angeht, halten sich die Story-Maschinist*innen gewohnt bedeckt. Bis auf zwei Ausnahmen: Einen Kontakt zu Armin Laschet zwecks kommunikativer Begleitung einer möglichen Kanzlerkandidatur gebe es nicht, sagt Jessen. Und auf die Frage von Peter Turi, wie viel Vorwissen Storymachine-Kundin Ursula von der Leyen in die Agentur mitgebracht habe, antwortet Projektmanagerin Behrendt: "Genug." Diesen Podcast gibt es auch als Video auf turi2.tv Alle Infos zur neuen Event-Reihe turi2 Clubabend: turi2.de/clubabend Rund um die Uhr aktuelle Nachrichten aus der Welt der Kommunikation: turi2.de So können Sie bei turi2 werben: turi2.de/media

Was hilft gegen Kreativitätsabfall im Lockdown? So lief der Kreativ-Talk im turi2 Clubraum
Frischekur für den Kopf: Was die Kreativität befeuert, wenn Reisen und Konferenzen wegfallen, darüber haben sich sechs kluge Gäste im dritten turi2 Clubabend auf Clubhouse Gedanken gemacht. "Jetzt kommt der Moment, wo man merkt, dass Kreative noch etwas anderes brauchen als einen Monitor und viele Gesichter", sagt ADC-Präsidentin und Jung-von-Matt-Kreativchefin Dörte Spengler-Ahrens und spricht von einer schwierigen Zeit für die Agentur-Arbeit. "Man braucht Austausch, Reibung, das Zusammensein, die Zufälle." Vor dem Bildschirm sei die kreative Kraft niedriger als in der physischen Zusammenarbeit. Gabriele Hässig, als Geschäftsführerin bei Procter & Gamble für Kommunikation zuständig, empfiehlt, die Tage im Lockdown nicht durchzuplanen, um Zufälle zuzulassen. Im Clubraum erklärt Hässig zudem, warum ihr Konzern die Büros nicht komplett dicht macht, und weshalb sie auf mittägliche Meetings verzichtet. Eine ihrer persönlichen Maßnahmen gegen den Corona-Blues: tägliches Spazierengehen. Sport-Marketer Michael Trautmann setzt auf dieselbe Ödnis-Prophylaxe – und zieht Energie aus seinen Podcasts. Medien-Multitalent Laura Karasek berichtet aus dem Zug nach Köln von vorwurfsvollen Laptop-Tastaturen, von Glücksgefühlen auf Clubhouse und von der Schwierigkeit, ohne Kneipen-Recherchen Romane zu schreiben. Sie bleibt kreativ, indem sie "viele kluge Texte von vielen klugen Leuten" liest, Serien schaut und manchmal im Hotelzimmer zu lauter Musik tanzt. Digital-Berater und Home-Office-Skeptiker Thomas Knüwer schreitet im Lockdown weiterhin täglich 70 Meter von seiner Wohnungstür ins Büro und schaut dabei zur Kreativ-Inspiration immer mal wieder auf TikTok vorbei. Für neue Ideen, glaubt Vice-Chefredakteur Felix Dachsel, kann es hilfreich sein, sich auch mal explizit über die Lage zu ärgern: "Ich glaube es ist wichtig, die Wut und die Verzweiflung dieser Situation zuzulassen. Dann kommt die Kreativität leichter wieder hervor."
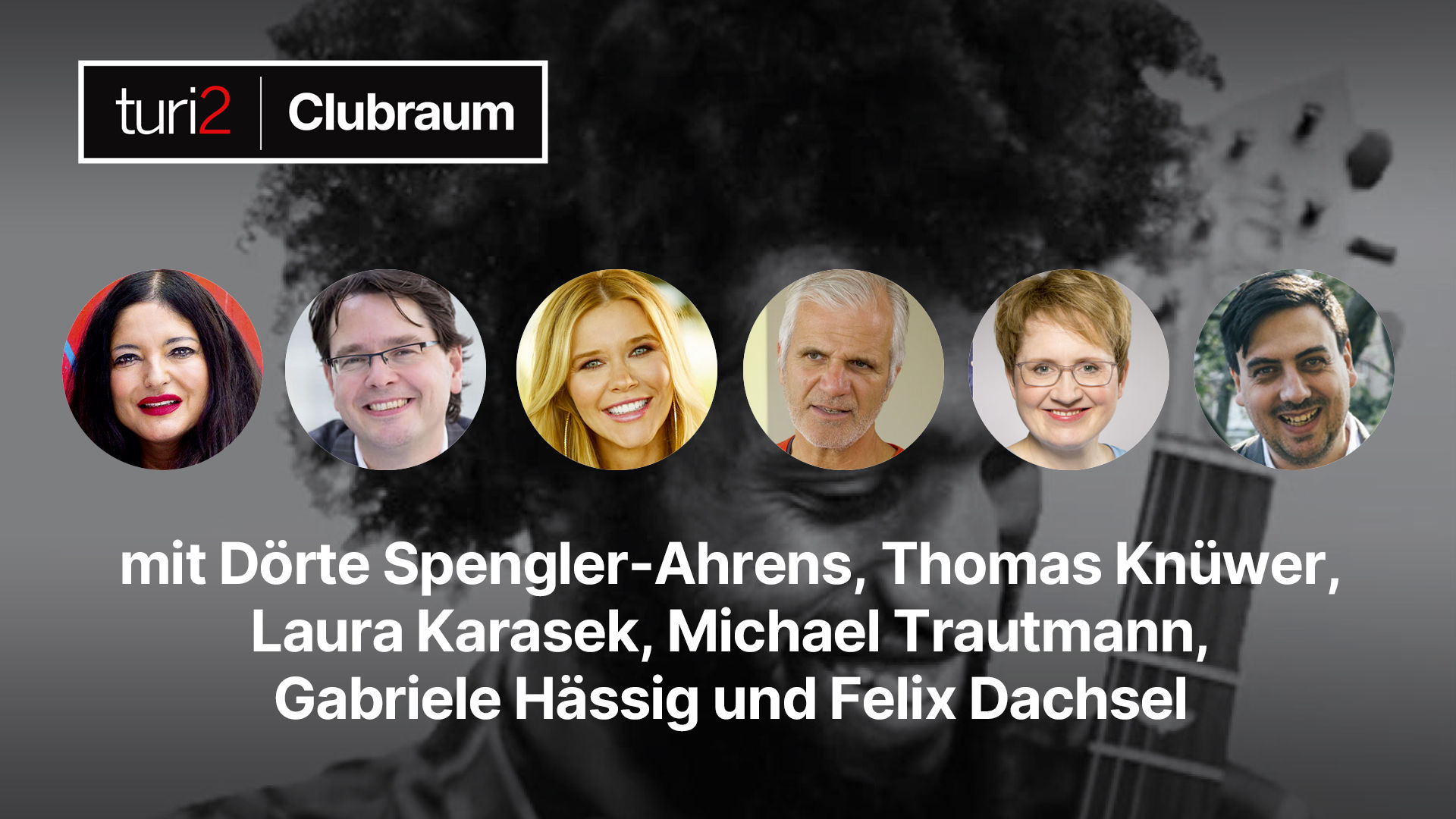
Chef, wir müssen reden! Mit Otto-Group-Chef Alexander Birken.
Clubraum – find' ich gut: Alexander Birken, CEO der Otto Group, stellt sich im turi2 Clubraum den Fragen von Peter Turi und der turi2 Community – nur zwei Stunden, nachdem er der Clubhouse-App beigetreten ist. Birken fühlt sich im Audio-Chat ohne Bild hörbar wohl: "Das ist ein schöner Vorteil, dass ich nicht darauf achten muss, halbwegs intelligent in die Kamera zu schauen." Andere Social-Media-Dienste nutzt er "sehr passiv", vor allem aus Neugierde, um zu verstehen, wie die verschiedenen Kanäle für Meinungsbildung und Marketing funktionieren. Selbst aktiv ist er kaum, von Ghostwritern, die für CEOs twittern, hält er nichts: "Das interessiert oft keinen, weil es nicht authentisch ist." Ganz authentisch erzählt Birken, wie froh er ist, dass sein Personal Coach ihn zweimal pro Woche "unter die Fittiche nimmt und quält". "Ich brauche diesen Zwang", sagt Birken, der mit Muskel-Aufbautraining seine Rückenschmerzen besiegt hat. Sein Tipp für Disziplin im Home-Office: "Frischluft schnappen! Ich habe noch nie so viele Spaziergänge gemacht, wie in den letzten Monaten." Ein bis zwei Tage in der Woche fährt er ins Büro und ist dort momentan oft "einsamer als zu Hause", weil ein Großteil der Otto-Mitarbeiter*innen derzeit im Mobile-Office ist. Die Abkehr von der Präsenz-Arbeit war bei Otto schon vor der Pandemie ein großes Thema, nun zeigt sich: "Wir kommen da auch an unsere Grenzen." Mit Kita- und Schulschließungen bleibe eine große Last insbesondere an Frauen hängen. "Da gibt es auch keine Pauschal-Lösung. Da muss man individuell gucken: Wie kriegen wir Entlastung für diese Zeit hin?" Ein Team bei Otto arbeitet an Lösungen für hybrides Arbeiten, in denen auch der Firmen-Campus eine Rolle spielt: "Es gibt bestimmte Situationen, da brauche ich Präsenz. Ein Campus ist auch identitätsstiftend", sagt Birken und ist überzeugt: "Eine rein virtuelle Welt kann ich mir genauso wenig vorstellen, wie ein Zurück in eine komplette Präsenz-Welt."
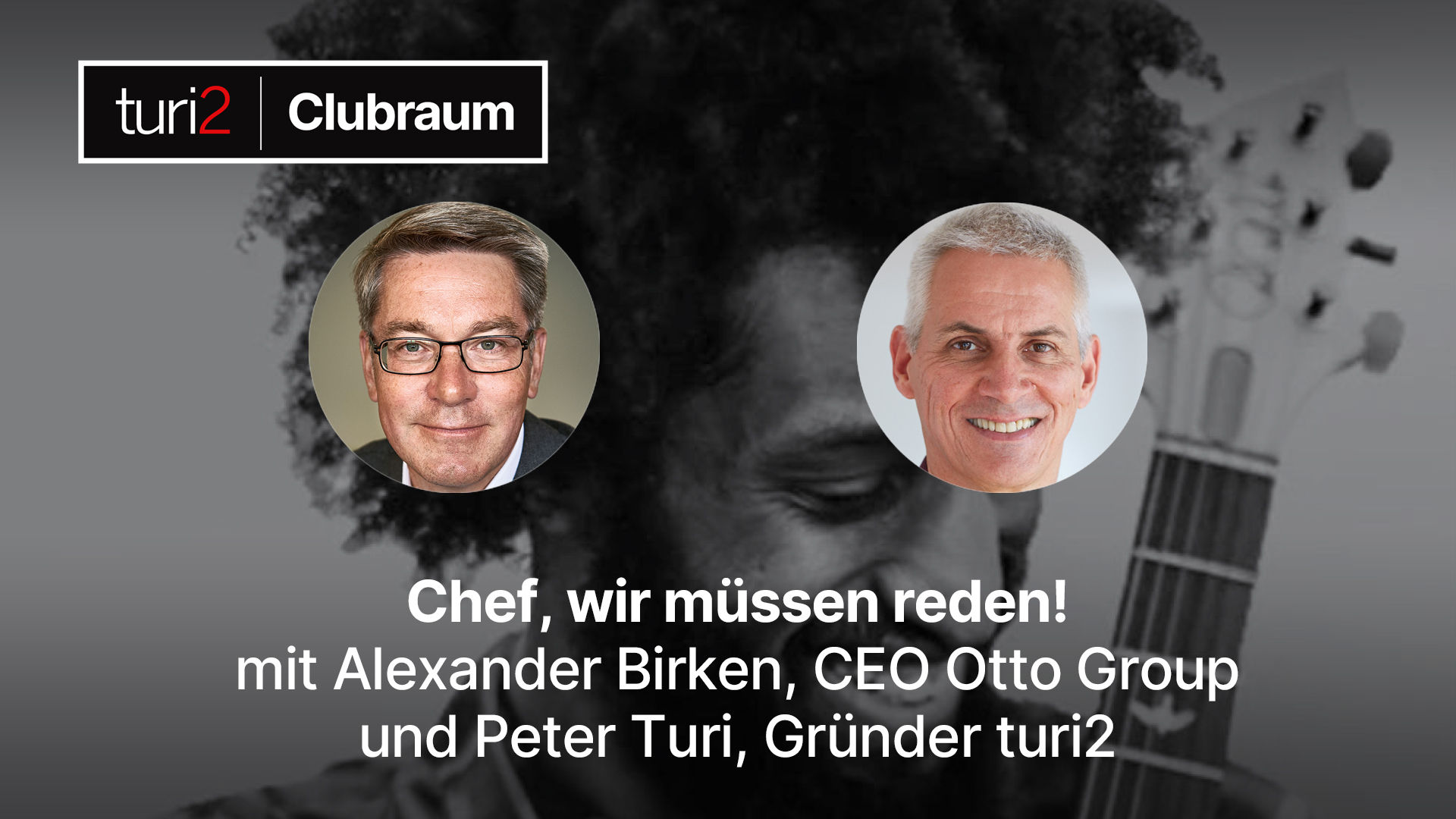
Clubhouse als Hoffnungsträger der Kommunikationswelt? So lief der erste turi2 Clubraum.
Full House im Clubhouse: Dass die gehypte Plattform ein großes Experimentier-Labor für das Medien- und Kommunikationspersonal ist, darüber sind sich in der ersten Ausgabe des turi2 Clubraums alle Gäste einig. Vodafone-Sprecher Alexander Leinhos gewinnt Clubhouse etwas regelrecht Intimes ab: "Sprache ist der persönlichste Kanal, den wir haben." Journalistin Marieke Reimann erinnert sich an das erste handfeste Skandälchen des Netzwerks in Deutschland und glaubt, dass die anfängliche Euphorie in der Politik durch den Fauxpas des thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow einen Dämpfer erhalten haben könnte. Darauf, wie sich Clubhouse im Wahljahr 2021 schlägt, ist Digital- und Netzwerk-Expertin Tijen Onaran gespannt. Wer das eigene Blickfeld nicht nur politisch vergrößern möchte, kann es Onaran dort gleichtun: "Ich achte darauf, in Räume von Leuten zu gehen, die ich nicht kenne. Um einen Perspektiv-Wechsel zu bekommen." Radio-Expertin Ina Tenz taucht auf Clubhouse ebenfalls gerne mal in Welten ab, "in denen man sonst nicht unterwegs ist" – wenn sie nicht gerade in Pferdezucht-Gruppen abhängt. Christian Loefert, Kommunikationschef von Telekom Deutschland, wartet auf eine Android-Version zum Mitreden für alle. Und Marketing-Rockstar Philipp Westermeyer macht sich keine Sorgen, dass die Audio-App ihm das Publikum von Konferenzen und/oder Podcasts abgraben könnte. Die OMR-Konferenz werde sie "vielleicht ein paar Besucher kosten". Er bleibt dennoch skeptisch: "Bis das Ding Mainstream ist, wird es noch sehr lange dauern."

“Wo Neugierde ist, ist auch Geld”: So war der turi2-Clubabend mit Schaller und Steingart.
Nicht nur Likes und Liebe: Gabor Steingart schippert während des digitalen Live-Interviews mit Verleger Peter Turi am Dienstagabend über die Spree in Berlin – und denkt dort laut darüber nach, den "Presseclub" der ARD neu zu erfinden. Wenn es nach ihm geht, soll sich eine Journalist*innen-Runde sonntags nicht mehr "in den Katakomben des WDR", sondern an Deck seines Schiffs treffen, "vielleicht mit einer Dixie-Band". Die Gewinnschwelle will der Medien-Gründer mit seinem Pioneer-Unternehmen 2023 überschreiten, bis dahin sollen jährlich Investments in Millionenhöhe in das Unternehmen fließen, allein 2021 circa 8 Mio Euro. Dass die Einnahmen durch zahlungsbereite Leser*innen oder die Beteiligung namhafter Persönlichkeiten wie geplant sprudeln, daran zweifelt Steingart nicht. Er meint: "Wo Neugierde ist, ist auch Geld". Was andere über ihn denken, blendet er bei seiner Regatta um einen Platz auf dem Medien-Siegertreppchen lieber aus. In Richtung der Leute, denen er 2020 auf die Nerven gegangen ist, sagt er trocken: "Genervt sein ist kein Zustand, da beginnt die Debatte". Richtig "feindliche Gefühle" erlebe er persönlich nur beim Spiegel, gegen den er im Verlauf des Gesprächs gleich mehrfach stichelt. Von seinen eigenen Leser*innen werde er dagegen "in Wärme gebadet". Er glaubt: "Jeder Journalist sollte sich daran messen lassen, dass er Menschen gereizt hat mit dem, was er sagt. Wenn alle ihm nur auf die Schulter klopfen, ist das doch traurig." Anders als Entertainer wie Thomas Gottschalk (der in Media Pioneer investiert hat, wie seit gestern bekannt ist), wolle und müsse er, Steingart, nicht auf Beliebtheit hinarbeiten. Aus seiner Sicht sollten Journalist*innen "wahrhaftig, glaubwürdig, kontrovers und geistreich" sein, "nicht zwingend populär". Monika Schaller, Kommunikationschefin von Deutsche Post DHL, schlägt im Gespräch mit Heike Turi dagegen vergleichsweise ruhige Töne an. Sie berichtet aus ihrem Jahr 2020 und schlägt die Kritik von Globalisierungs-Skeptiker*innen wie Zukunftsforscher Matthias Horx aus: "Mein persönliches Gefühl ist, dass Globalisierung wichtiger ist denn je." Sie erklärt sich als großer Podcast-Fan – und fragt Steingart, was den Kern vom Kern eines richtig guten Podcasts ausmacht. Der antwortet mit einer höher dosierten "Prise Zuversicht", die in anderen Medien aus seiner Sicht zu kurz kommt.
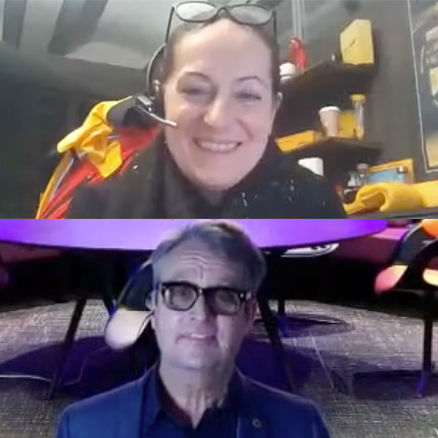
Stephan Schmitter zeigt das Herz der Audio Alliance in Berlin.
Das Auge hört mit: "Die Kurve ist permanent ansteigend." Im Video- und Podcast-Interview von turi2.tv erklärt Stephan Schmitter, dass Podcasts – Corona-Krise hin oder her — derzeit einen Höhenflug erleben. Der Audiochef von Bertelsmann und Geschäftsführer von RTL Radio Deutschland hat 2019 die Audio Alliance mit aus der Taufe gehoben und seitdem in rund 150 eigene Podcasts investiert. Im Laufe dieses Jahres soll der Audio-Ableger profitabel arbeiten. Schon vorher beziehen die Audio Alliance und die Berliner Radiosender von RTL ein neues Zuhause – das RTL Audio Center mit modernen Studios für Radio und Podcast. Stephan Schmitter zeigt Fotos und Videos aus den modernen, großzügigen Räumen, die den Moderator*innen die Arbeit erleichtern und auch auf Remote-Arbeit eingestellt sind. "Wenn Sie mich vor einem Jahr gefragt hätten, ob ich es für möglich halte, dass eine Morning-Show mit bis zu acht Leuten von verschiedenen Orten produziert werden kann, aus Home Offices, Kellern oder Schlafzimmern, da hätte ich Ihnen gesagt: Auf keinen Fall", sagt Schmitter. Das Radio habe im Jahr 2020 viel gelernt – auch von Podcasts, von denen viele schon länger dezentral entstehen. In den neuen Räumen schalten sich Podcast-Produzent*innen von Berlin aus in die Studios bei Gruner + Jahr in Hamburg oder zu RTL in Köln. In Berlin bekommen die Aufnahmen den letzten Schliff und gehen auf die Plattformen. Im ausführlicheren Podcast erklärt Stephan Schmitter, wie Bertelsmann mit seiner Podcast-Plattform Audio Now Spotify etwas entgegensetzen will: Schon jetzt können Nutzer*innen neben Podcasts auch kuratierte Musikstreams und die klassischen Radiosender mit RTL-Beteiligung einschalten – von Radio Hamburg bis Antenne Bayern.

Herz & Hirn: Marketingchef Albrecht Schäfer über die E-Auto-Werbung von Opel.
Unter Strom: "Wir sind elektrisch." Im Video-Interview mit turi2.tv spricht Marketingchef Albrecht Schäfer über den Stand der Elektrifizierung bei Opel und darüber, wie er Menschen für seine Marke und Elektro-Mobilität begeistert. Schäfer erklärt, dass bei E-Autos der Informationsbedarf höher ist als bei Verbrennern. Er will den Kund*innen "nachvollziehbar darlegen", dass E-Autos sich für ihren "objektiven Mobilitäts-Bedarf" eignen, auch wenn man mit ihnen vielleicht noch nicht von Rüsselsheim bis Wladiwostok durchfahren kann. Dafür setzt er auf Emotionen, Fakten und Testimonials wie Jürgen Klopp. Der Erfolgs-Trainer stehe für die gleichen Werte wie Opel, erklärt Schäfer: "deutsch, begeisternd, nahbar". Klopp ziehe durchaus auch bei jungen Leuten, denen das eigene Auto vielleicht nicht mehr ganz so wichtig ist wie in den Generationen davor. Im Video zeigen und besprechen wir TV-Spots von früher und heute und dokumentieren so den Wandel der Werbung. Im etwas ausführlicheren Podcast sagt Albrecht Schäfer, dass er auch die Generation Greta erreichen will – allerdings ohne missionarischen Eifer: "Jemanden, der sagt, dass er kein Auto besitzen möchte, werde ich davon nicht bekehren."

Mathias Döpfner über Musik, Digitalisierung und Paranoia.
Springer-Chef Mathias Döpfner spricht in Berlin mit Peter Turi und turi2.tv. Der promovierte Musikwissenschaftler hat Axel Springer digitalisiert und verrät, wozu er ein erotisches Verhältnis hat. Und warum er eine gewisse Paranoia pflegt. Zusätzlich zum Podcast gibt es das komplette Gespräch auch als Video bei YouTube:




































