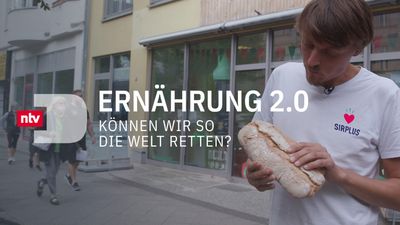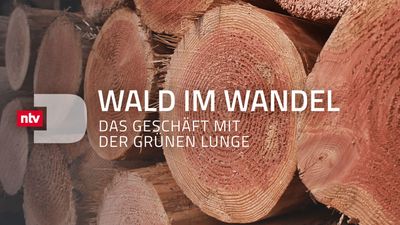In der Podcast Serie „Agrar Science – Wissen kompakt“ der HBLFA Raumberg-Gumpenstein werden regelmäßig spannende Gespräche – mit interessanten Menschen – zu aktuellen Fragen der Landwirtschaft und Lebensmittelversorgung in Österreich geführt. Viele Fragen – Wertvolle Gedanken und Antworten Woran wird in der Landwirtschaft geforscht? Wie können wir uns an den Klimawandel anpassen? Was bewegt die Bäuerinnen und Bauern auf ihren Höfen? Wie optimiert man die Ökoeffizienz und reduziert den CO2-Fußabdruck? Wo liegen die Möglichkeiten und Grenzen der Digitalisierung? Wie sichern wir die regionale Lebensmittelversorgung und Biodiversität? Wer bewirtschaftet in Zukunft unsere extensiven Almen? Warum liegt uns Tierwohl besonders am Herzen? Was denkt die Jugend zur Landwirtschaft? Die Vielfalt an interessanten Themen in der Land- und Lebensmittelwirtschaft zeichnen unsere Podcasts aus. Hinweis: Die Aussagen im Podcast geben die Meinungen der Podcast-Gäste wieder und stellen nicht notwendigerweise die Ansichten oder Meinungen der HBLFA Raumberg-Gumpenstein bzw. der vorgesetzten Dienstbehörde dar. Die HBLFA Raumberg-Gumpenstein bzw. die vorgesetzten Dienstbehörde lehnt hiermit jegliche Haftung für direkte, indirekte, implizite, strafbare, besondere, zufällige oder sonstige Folgeschäden ab, die sich direkt oder indirekt aus der Nutzung der Video-Inhalte oder Podcast-Beiträge ergeben.
Alle Folgen
Folge 161: Grassilage im Fokus: Was Milchsäurebakterien wirklich bringen
Top-Grassilage ist die Basis für hohe Futteraufnahme, Leistung und Wirtschaftlichkeit auf vielen Grünlandbetrieben mit Rinder, Schafen und Ziegen. In dieser Folge von Agrar Science – Wissen kompakt spricht PD Dr. Andreas Steinwidder mit Ing. Reinhard Resch von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein über die Rolle von Milchsäurebakterien in der Grassilage-Konservierung. Wir klären, wann ein ergänzender Zusatz von Milchsäurebakterien über Siliermittel sinnvoll ist, wie sie den Gärverlauf beeinflussen, warum aerobe Stabilität immer wichtiger wird – und wo die Grenzen von Siliermitteln auf Basis Milchsäurebakterien liegen. Ein praxisnahes Gespräch für alle, die Futterqualität nicht dem Zufall überlassen wollen. 🔎 Korrektur zu Minute 23:45: Richtig heißt es „…auf Basis eines homofermentativen Milchsäurebakterien-Prinzips.“

Folge 160: Biolandwirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen – Prof. Sabine Seidel im Gespräch
In dieser Folge von Agrar Science – Wissen kompakt lernen wir Univ.-Prof. Dr. Sabine Seidel kennen, die neue Professorin für Biologische Landwirtschaft an der BOKU Wien. Gemeinsam mit Priv. Doz. Dr. Andreas Steinwidder spricht Univ.-Prof. Dr. Sabine Seidel über ihre Vision einer Landwirtschaft, die Verantwortung übernimmt – für Böden, Klima und Vielfalt des Lebens. Wir erfahren, welche Rolle Mischkulturen, digitale Modelle und KI in der Forschung der Zukunft spielen, und wie Biolandwirtschaft helfen kann, innerhalb der planetaren Grenzen zu wirtschaften. Ein inspirierendes Gespräch über Wissenschaft, Nachhaltigkeit und die Zukunft des Bio-Landbaus.

Folge 159: Absetzdurchfall: (K)Ein Ende in Sicht?! Neue Ansätze für ein altbekanntes Problem
Coli-Erkrankungen zählen zu den größten Herausforderungen in der Tierhaltung, insbesondere bei Jungtieren. In dieser Podcast-Folge mit PD Dr. Andreas Steinwidder erklärt DI Nora Durec vom Bio-Institut der HBLFA Raumberg-Gumpenstein – und Leiterin des Projekts „Zucht auf Coliresistenz“ – welche Faktoren zum Auftreten von Absetzdurchfall beitragen, ob genetische Faktoren die Tiergesundheit beeinflussen, welche Forschungsergebnisse vorliegen und welche Möglichkeiten genetische E.Coli-Resistenz eröffnen könnte. Ein spannender Blick in die aktuelle Forschung rund um ein gefürchtetes Problem.

Folge 158: Tierhaltung im Wandel: Zwischen guten Preisen und großer Unsicherheit
In dieser Folge von „Agrar Science – Wissen kompakt“ spricht PD Dr. Andreas Steinwidder mit PD Dr. Leopold Kirner von der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien über die aktuellen Entwicklungen in der Schweinehaltung und der Rindermast. Trotz guter Einkommen herrscht vielerorts Unsicherheit: steigende Auflagen, volatile Märkte, gesellschaftlicher Druck und hohe Investitionskosten prägen den Alltag der Betriebe. Im Rahmen des Strategieprozesses Vision 2028+ hat Leopold Kirner gemeinsam mit Expert:innen und Landwirt:innen analysiert, welche Zukunftschancen es dennoch gibt – von Tierwohl-Innovationen über regionale Wertschöpfung bis hin zu neuen Kooperationsmodellen. Ein spannender Blick in die Zukunft zweier Branchen, die im Zentrum der öffentlichen Diskussion stehen – und dennoch oft zu wenig Gehör finden.

Folge 157: Digitale Landwirtschaft: Daten, Drohnen und Roboter sinnvoll nutzen
Die Landwirtschaft wird digital – und das nicht irgendwann, sondern jetzt. Im Podcast spricht PD Dr. Andreas Steinwidder mit DI Franz Handler, Projektleiter des Clusters Digitalisierung in der Landwirtschaft 2024–2028 und Mitarbeiter von der HBLFA Francisco Josephinum in Wieselburg, über aktuelle Entwicklungen, Chancen und Herausforderungen der digitalen Transformation. Von Drohnen und Satellitendaten im Grünland über smarte Bewässerung bis hin zu Datenräumen reicht die Bandbreite der Innovationen, die im Digitalisierungsprojekt erprobt und weiterentwickelt werden. Ein spannender Einblick, wie Forschung, Praxis und Technik Hand in Hand arbeiten – damit Digitalisierung am Hof nicht nur Schlagwort, sondern gelebte Realität wird.

Folge 156: Almmosaik: Wie Natur und Landwirtschaft gemeinsam Zukunft schaffen
Im Naturpark Sölktäler arbeiten Naturschutz, Landwirtschaft und Bevölkerung eng miteinander. Das Projekt „Almmosaik“ zeigt, wie gezielte Maßnahmen seltene Arten wie das Birkhuhn schützen, Almen offenhalten und gleichzeitig bäuerliche Kulturlandschaft sichern. In dieser Podcast-Folge spricht PD Dr. Andreas Steinwidder mit Biodiversitätsexpertin Julia Bauer MSc vom Naturpark Sölktäler über Herausforderungen, Erfolge und echte Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Beispielgebend, praxisnah – ein Vorbild für viele Regionen. Also: Wanderschuhe im Kopf anziehen – wir gehen rauf auf die Alm und mitten hinein in die Praxis!

Folge 155: Milch und Fleisch mit Zukunft!
In dieser Episode von „Agrar Science – Wissen kompakt“ spricht PD Dr. Andreas Steinwidder mit PD Dr. Leopold Kirner von der Agrar- und Umweltpädagogischen Hochschule über aktuelle Ergebnisse aus dem Strategieprozess Vision 2028+ des Landwirtschaftsministeriums. Im Mittelpunkt stehen zwei zentrale Bereiche der österreichischen Landwirtschaft: die Milchviehhaltung und die Mutterkuhhaltung. Wir beleuchten, wie sich Einkommen, Betriebsstrukturen und Zukunftserwartungen verändern, warum viele Landwirt:innen Planungssicherheit fordern und wo die Chancen für spezialisierte Betriebe liegen. Ein Gespräch über Herausforderungen – und über Betriebe, die mit Qualität, Weidehaltung und Innovationsgeist neue Wege gehen. Ein Muss für alle, die wissen wollen, wohin sich die österreichische Tierhaltung entwickelt.

Folge 154: Die Grünlandmischung der Zukunft – Forschung trifft Praxis
Wie gelingt eine nachhaltige, standortangepasste und ertragreiche Grünlandbewirtschaftung? In dieser Podcastfolge von „Agrar Science – Wissen kompakt“ spricht PD Dr. Andreas Steinwidder mit DI Lukas Gaier von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein über die neuesten Erkenntnisse rund um Saatgutmischungen, Sortenwahl und Grünlandmanagement. Er erklärt, warum das richtige Verhältnis von Gräsern, Leguminosen und Kräutern entscheidend ist, welche Rolle die Saatgutqualität spielt – und welche Innovationen künftig auf unsere Wiesen kommen könnten. Ein spannender Einblick in die Praxis und Forschung rund um die Grünlandmischung der Zukunft.

Folge 153: Bio aus Überzeugung: Von der Landwirtschaft in die Hotellerie
In dieser Podcast-Folge von „Agrar Science – Wissen kompakt“ trifft PD Dr. Andreas Steinwidder von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein Ulrike Retter, Gastgeberin eines der führenden Bio-Hotels Europas. Frau Retter teilt ihre persönliche Sicht auf die biologische Landwirtschaft – geprägt von jahrzehntelanger Erfahrung und Überzeugung. Schon früh hat sie den mutigen Schritt gewagt, ihren Betrieb konsequent auf biologisch, regional und saisonal umzustellen. Was hat sie damals angetrieben? Warum steht sie so entschieden hinter der biologischen Landwirtschaft? Welche Rolle spielt dabei die Zusammenarbeit mit Bäuerinnen und Bauern? Und welche Chancen sieht sie für die Zukunft? Ein Gespräch über Haltung, Herausforderungen und die eigene Vision – eine persönliche Perspektive, die zum Nachdenken über Landwirtschaft, Genuss und Verantwortung anregt.

Folge 152: Weniger Eiweiß: Schweine- und Geflügelfütterung neu gedacht
Mit der Reduktion von Sojaschrot in der Fütterung können bis zu 50 % der CO₂-Emissionen eingespart werden – ohne Leistungseinbußen. Prof. Dr. Reinhard Puntigam von der Fachhochschule Südwestfalen in Soest erklärt im Gespräch mit Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder, wie Präzisionsfütterung, heimische Eiweißquellen und der gezielte Einsatz freier Aminosäuren den Weg in eine nachhaltigere Tierhaltung ebnen. Praxisnahe Beispiele, neueste Versuchsergebnisse und ein Blick in die Zukunft der Schweine- und Geflügelfütterung – kompakt und verständlich.

Folge 151: Gesund bleiben in der Landwirtschaft – Studie zeigt soziale und psychische Herausforderungen!
Die Landwirtschaft steht nicht nur vor ökonomischen und ökologischen Herausforderungen – sie ist auch ein Berufsfeld mit hohen psychischen und sozialen Belastungen. Eine aktuelle Studie von L&R Sozialforschung unter Leitung von Mag.a Nadja Bergmann zeigt, wie stark Landwirt:innen und ihre Familien betroffen sind, welche Stressfaktoren den Alltag bestimmen und wo Verbesserungen nötig sind. Im Podcast spricht sie über die wichtigsten Ergebnisse, die Rolle von Unterstützungsangeboten und warum psychische Gesundheit in der Landwirtschaft mehr Aufmerksamkeit braucht.
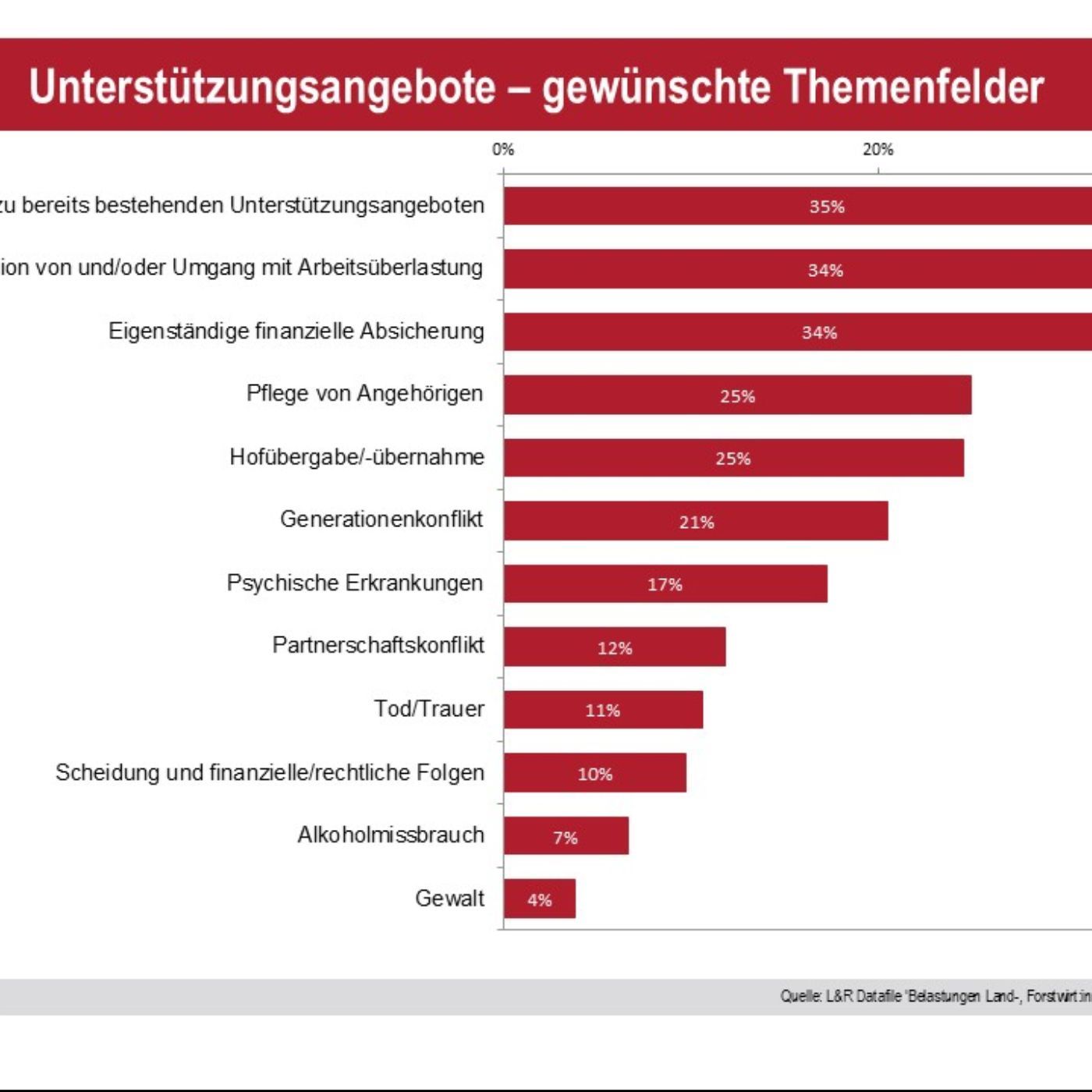
Folge 150: Hinter den Kulissen des BMLUK – Ein Blick in die Verwaltung von heute und morgen
Wie funktioniert eigentlich ein Ministerium? Welche Herausforderungen und Chancen bringt die moderne Verwaltung mit sich? In dieser Episode unseres Podcast „Agrar Science-Wissen kompakt“ wirft Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit DDr. Reinhard Mang, Sektionschef und CDO des Bundesministeriums für Land- & Forstwirtschaft, Umwelt- & Klimaschutz, Regionen & Wasserwirtschaft (BMLUK), einen Blick hinter die Türen eines Ministeriums. Von Personal und Budget über Kommunikation bis hin zu Digitalisierung und Forschung – SC DDr. Mang gibt uns exklusive Einblicke in die dynamischen Strukturen des Ministeriums, seine vielfältigen persönlichen Aufgaben. Er spricht über die Schnittstellen zwischen Verwaltung und Innovation, über die Herausforderungen bei Veränderungen in der Ressortverteilung, über die Budgetverhandlungen, die Bedeutung von Zusammenarbeit in einer großen Behörde und wie der öffentliche Dienst im digitalen Zeitalter neue Wege geht. Begleiten Sie uns auf einer spannenden Reise durch die Welt der Verwaltung. Entdecken Sie, wie das BMLUK heute arbeitet und was die Zukunft für den öffentlichen Dienst bereithält.

Folge 149: Stallbau für Jungvieh – Tierwohl und Praxis im Fokus!
Im aktuellen Podcast „Agrar Science – Wissen kompakt“ spricht PD Dr. Andreas Steinwidder mit Dr. Elfriede Ofner-Schröck von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein über ein oft unterschätztes, aber entscheidendes Thema: Die Haltung der Kälber und des Jungviehs. Von den Bedürfnissen der Tiere über moderne Haltungssysteme bis hin zu wissenschaftlichen Erkenntnissen – wir werfen einen Blick darauf, wie durchdachte Stallkonzepte die Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit der späteren Milchkühe sichern können. Dazu gibt es viele praxisnahe Tipps aus der neuen ÖKL-Beratungsunterlage. Reinhören lohnt sich!

Folge 148: Waldviertler Tofu – regional, gesund & g’schmackig!
Im Waldviertel stellt Isabel Klutz gemeinsam mit ihrem Partner den „Waldviertler Tofu“ her – aus eigenem Sojaanbau, mit viel Handarbeit und in überraschend g’schmackigen Varianten. Im Gespräch mit PD Dr. Andreas Steinwidder erzählt Isabel im Podcast Agrar Science – Wissen kompakt wie sie auf die Idee kam, Tofu zu produzieren, warum er nicht nur für Veganer spannend ist und weshalb Soja unsere Böden klimafitter macht. Ein inspirierender Blick hinter die Kulissen einer jungen Landwirtin, die mit Kreativität und Durchhaltevermögen ein regionales Erfolgsprodukt geschaffen hat.

Folge 147: Wissen vernetzen, Innovation stärken: AKIS und EIP-Projekte im Fokus
In dieser Podcast-Folge spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Elisabeth Gumpenberger vom Netzwerk Zukunftsraum Land und DI Edina Scherzer von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein über das agrarische Wissens- und Innovationssystem AKIS und die Bedeutung von EIP-Projekten. Was auf den ersten Blick technisch klingt, ist in Wahrheit gelebte Innovation: Wenn Landwirt:innen, Forschung, Beratung und Bildung gemeinsam Lösungen für die Herausforderungen der Landwirtschaft und des ländlichen Raums entwickeln, entstehen echte Erfolgsgeschichten. Am Beispiel von EIP-Projekten wie „Bergmilchvieh“ und „Weideinnovationen“ zeigen wir, wie aus Ideen konkrete Verbesserungen entstehen – und wie alle Interessierten Teil dieses Netzwerks werden können. Jetzt reinhören und inspirieren lassen!

Folge 146: Frisch. Regional. Unkonventionell
Was haben Sauerkraut, Selleriesalat und Kartoffeln gemeinsam? Sie alle stammen vom Familienbetrieb Hell’s in Absdorf – und tragen die Handschrift von Rudolf Hell Junior. In dieser Folge von Agrar Science – Wissen kompakt sprechen wir mit dem Gemüsebauern über Innovation in der Direktvermarktung, über die Wegbereitung durch seine Eltern, über Partnerschaften, über Handarbeit als Qualitätsversprechen, über Cole Slaw und darüber, warum Hell’s Salatzubereitungen bei den Kundinnen und Kunden besonders ankommen. Ein Gespräch über Mut, Ideenreichtum und die Zukunft bäuerlicher Lebensmittelproduktion.

Folge 145: Weg mit der Verschwendung! Wie wir Lebensmittel retten können
Jedes Jahr landen in Österreich über eine Million Tonnen essbare Lebensmittel im Müll – und das meist völlig unnötig. In dieser Podcastfolge von „Agrar Science – Wissen kompakt“ der HBLFA Raumberg-Gumpenstein spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Drin Michaela Hickersberger vom Ökosozialen Forum und Drin Alexandra Gruber über das Ausmaß und die Ursachen von Lebensmittelverschwendung. Drin Michaela Hickersberger und Drin Alexandra Gruber leiten gemeinsam, das Projekt „Isst das jemand?“. Sie zeigen uns, warum wir alle Teil des Problems – aber auch Teil der Lösung sein können. Mit vielen praktischen Tipps für den Alltag, spannenden Hintergrundinfos und einem Blick auf wichtige gesellschaftliche Initiativen. Ein Muss für alle, die nachhaltiger leben wollen!

Folge 144: Almfleisch unter der Lupe – Ganzheitliche Qualität sichtbar machen
In Österreich werden jährlich hunderttausende Rinder und Schafe auf die Alm getrieben – doch ihr Mehrwert schlägt sich selten im Produktpreis nieder. In dieser Folge von Agrar Science – Wissen kompakt spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Frau DIin Christina Hell über die Ergebnisse ihrer Masterarbeit. Gemeinsam mit Frau Drin Margit Velik von der HBLFA R-G, Almwirtschaftsberaterinnen, der AMA und Praxisbetrieben wurden Daten zur Schlachtleistung und Fleischqualität von Almtieren ausgewertet und auch Versuche angelegt. Was unterscheidet Almochsen von Stieren aus Stallmast? Wie wirken sich Weidehaltung, Rasse und Fütterung auf Geschmack und Zartheit aus? Und wie könnte die Almwirtschaft künftig besser von Alm-Markenprogrammen profitieren? Ein spannender Blick in die Praxis und Wissenschaft – mit vielen Impulsen für Bäuerinnen und Bauern, Vermarktung, Politik und Konsum!

Folge 143: Aktuelles zur Blauzungenkrankheit
Die anzeigepflichtige Tierseuche Blauzungenkrankheit (Bluetongue Disease, BT) hat sich mittlerweile in Österreich ausgebreitet. Rinder, Schafe und Ziegen erkranken teils schwer und es sind auch Tierverluste zu verzeichnen. Praxisnahes Wissen um Ursachen, Hintergründe, Verbreitung sowie Bekämpfung und Vorbeuge dieser, für Menschen ungefährlichen Tierseuche stellt für Landwirte die Grundlage zum Schutz ihrer Tierbestände dar. In diesem informativen Podcast spricht Dr. Johann Gasteiner mit dem Amtstierarzt des Bezirkes Liezen, Dr. Robert Gruber über das hochaktuelle Thema Blauzungenkrankheit.

Folge 142: Weide Strategien für Steilflächen & Hutweiden
Entdecke in unserem neuesten Podcast-Beitrag von Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder wie die Grünland- und Weideexperten Dr. Wolfgang Angeringer und Stefan Bischof von der LK-Steiermark die Herausforderungen bei Steil‑ und Hutweiden praxisnah lösen. Zum Beispiel mit smarter Weideplanung, dem richtigen Weidesystem, innovativen Nachsaaten und wirkungsvollen Pflegemaßnahmen. Alle Ergebnisse sind auch in einer neuen Info-Broschüre zusammengefasst! Viele Praxistipps und spannende Beispiele aus Österreich sowie faszinierende Einblicke ins EIP-Projekt „Weide‑Innovationen“ runden diesen Podcast-Beitrag ab.

Folge 141: Kann kluges Weidemanagement Parasiten natürlich reduzieren?
Wie können Bio-Betriebe den Spagat zwischen Weidepflicht und Parasitenschutz bei Kleinwiederkäuern schaffen – auch um die chemische Entwurmung zu minimieren? Dieser Frage ist Dr. Leopold Podstatzky von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein im Rahmen eines EIP-Projekts gemeinsam mit einem Ziegenbetrieb auf den Grund gegangen. Im Podcast spricht Priv. Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit ihm über die Wirksamkeit von Kräutermischungen, die Unterschiede zwischen Kurzrasenweide und Top-Grazing und welche Managementmaßnahmen wirklich etwas bringen. Ein Beitrag voller praxisnaher Erkenntnisse und innovativer Ansätze – für alle, die Weidehaltung tiergerecht, nachhaltig und zukunftsfähig gestalten wollen.

Folge 140: Klein aber fein – ein Trend in der Landwirtschaft – die Marktgärtnerei
In dieser Folge sprechen mit dem neuen LK-Stmk. Präsidenten Andreas Steinegger über seine Vision für die bäuerlichen Betriebe – besonders jene in benachteiligten Regionen bzw. kleiner Flächen-Ausstattung. Einen spannenden Einblick in das Konzept der Marktgärtnerei gibt uns Frau DIin Hemma Loibnegger. Ein Podcast über Herausforderungen, Innovation und Mut zur Veränderung! Was braucht es, um die landwirtschaftliche Produktion in Zeiten von Klimawandel, globalem Wettbewerb und Strukturwandel abzusichern? Wie können kleine und benachteiligte Betriebe neue Wege gehen? Welche Beratung braucht es? In dieser Episode von „Agrar Science – Wissen kompakt“ begrüßt Moderator Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder zwei praxisverwurzelte Stimmen der Landwirtschaft: Andreas Steinegger, seit kurzem Präsident der Landwirtschaftskammer Steiermark, spricht über seine Vision und neue Schwerpunkte in der Beratung – insbesondere für Betriebe mit geringer Flächenausstattung. DIin Hemma Loibnegger, Leiterin des Gartenbaureferats der Landwirtschaftskammer Steiermark, stellt Chancen im Konzept „Marktgärtnerei“ vor – eine kleinteilige, diversifizierte Gemüseproduktion mit großer Nähe zum Konsumenten. Gemeinsam diskutieren wir, wie innovative Ansätze helfen können, Landwirtschaft resilient und zukunftsfähig zu gestalten. Hören Sie hinein!

Folge 139: Der Grüne Bericht – Zahlen, Fakten und ihre Bedeutung für die Landwirtschaft
Einblicke in den Grünen Bericht des Bundes – Was die Zahlen über die wirtschaftliche Situation unserer Landwirtschaft wirklich sagen. Der Grüne Bericht ist eines der wichtigsten agrarpolitischen Dokumente in Österreich – jährlich liefert er einen fundierten Überblick über die wirtschaftliche Situation der heimischen Landwirtschaft. In dieser Podcastfolge spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit DI Otto Hofer vom BMLUK, der den gesetzlichen und inhaltlichen Rahmen erläutert, und mit DI Franz Fensl von der LBG Österreich, der die praktischen Aspekte der Datenerhebung durch Buchführungsbetriebe beleuchtet. Warum braucht es den Grünen Bericht überhaupt? Wer steht hinter den Zahlen? Wie wird man Buchführungsbetrieb – und was sagen die aktuellen Daten über die Einkommensentwicklung, Betriebsstruktur und Zukunft der Landwirtschaft? Ein spannender Blick hinter die Kulissen agrarischer Statistik – informativ, verständlich und kompakt. Hören Sie hinein!

Folge 138: Mehr als ein Siegel: Bio als Zukunftsmodell
Was bedeutet Bio eigentlich wirklich – und warum ist es weit mehr als nur ein Etikett im Supermarktregal? In dieser spannenden Folge von Agrar Science – Wissen kompakt der HBLFA Raumberg-Gumpenstein spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit der Bundesobfrau von BIO Austria Mag. Barbara Riegler, über die Kraft der biologischen Landwirtschaft: über Herausforderungen und Chancen, über Politik und Innovation, über junge Menschen und große Visionen. Ein Gespräch über Verantwortung, Qualität – und darüber, warum Bio für uns alle Zukunft hat.

Folge 137: Almen erhalten - aber wie?
Almen sind nicht nur idyllische Landschaften, sondern lebenswichtige Ökosysteme und wichtige Wirtschaftsräume. Doch Klimawandel und falsches Weidemanagement gefährden diese Kulturlandschaften zunehmend. Im Podcast-Gespräch von Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder erklärt DI Siegfried Steinberger, Almweideexperte und Mitarbeiter der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, wie das „magische Dreieck der Almwirtschaft“ mit rechtzeitigem Auftrieb, angepassten Tierzahlen und gelenkter Weideführung zum nachhaltigen Erhalt unserer Almen beiträgt. Kommen Sie mit auf die Alm und hören Sie hinein! Tipp: Die Podcast-Inhalte können auch in einer aktuellen ÖAG-Broschüre nachgelesen werden!

Folge 136: Landschaft sichern und (wieder) beleben
In dieser Sonderfolge von „Agrar Science – Wissen kompakt“ feiern wir 30 Jahre Vegetationsmanagement an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein. Mit drei hochkarätigen Gesprächspartnern werfen wir einen Blick zurück auf zentrale Innovationen der ökologisch hochwertigen Begrünung – und nach vorn auf die kommenden Herausforderungen der Rekultivierung und Renaturierung. Warum regionale Wildpflanzenmischungen die Zukunft sind, wie Biodiversität zur Lebensversicherung unserer Kulturlandschaften wird und welche Rolle technische Verfahren im Naturschutz spielen – all das hören Sie in diesem spannenden Podcast-Special von Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Dr. Bernhard Krautzer (Spezialist für standortangepasste Begrünung, Grünlandmanagement und Wildpflanzenvermehrung und Leiter des Instituts für Pflanzenbau- und Kulturlandschaftsforschung an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein), DI Christian Tamegger (Leiter der Sparte „Neues Grün“ der Kärntner Saatbau) und Dr. Christian Uhlig (Geoökologe und Biodiversitätsforscher mit langjähriger Erfahrung in Norwegen).

Folge 135: Grünland gestern – heute – morgen.
35 Jahre Futterpflanzenzüchtung an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein – ein Anlass zum Feiern, aber auch zum Weiterdenken: Wie können wir unser Grünland fit für Klimawandel, Biodiversität und Ertrag machen? In dieser Sonderfolge von Agrar Science – Wissen kompakt der HBLFA Raumberg-Gumpenstein lädt Moderator Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder vier herausragende Persönlichkeiten aus Forschung, Praxis und Beratung zum Gespräch ein. Bernhard Krautzer, Leiter Institut für Pflanzenbau- und Kulturlandschaftsforschung (HBLFA Raumberg-Gumpenstein), Agrarwissenschaftler mit langjähriger Erfahrung zu standortangepasster Begrünung, Grünlandmanagement und Saatgutproduktion. Univ.-Doz. Dr. Erich M. Pötsch, Wissenschaftlicher Leiter (a.D.) der Abteilung für Grünlandmanagement und Kulturlandschaft an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein, DI Peter Frühwirth, Langjähriger Grünlandreferent an der LK OÖ, Unterstützer des Aufbaus der Internet-Plattform lk-online, Erwerbsimker und einer der Väter der Sämereienvermehrung in Österreich. Giovanni Peratoner, Leiter des Fachbereichs Berglandwirtschaft am Südtiroler Versuchszentrum Laimburg, Gemeinsam werfen sie einen Blick zurück – und vor allem nach vorn: Welche Sorten brauchen wir morgen? Was lehrt uns die Vergangenheit? Und wie gelingt das Zusammenspiel von Innovation, Standortanpassung und ökologischer Verantwortung? Freuen Sie sich auf inspirierende Stimmen, praxisnahe Einblicke und visionäre Gedanken rund um die Zukunft der Grünlandwirtschaft im Alpenraum. Jetzt reinhören – und mitreden, wenn es heißt: Grünland – quo vadis?

Folge 134: Künstliche Intelligenz - Chancen und Herausforderungen
In dieser Episode von „Agrar Science-Wissen kompakt“ spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Univ.-Prof. Dr. Horst Bischof, Rektor der Technischen Universität Graz und ausgewiesener Experte für Artificial Intelligence und KI, über spannende Einblicke in die Welt der KI. Er erklärt verständlich, was sich hinter dieser Technologie verbirgt, diskutiert internationale Entwicklungen und erläutert die wirtschaftlichen Hintergründe von KI-Anwendungen wie ChatGPT. Außerdem erfahren Sie, welche Vor- und Nachteile der KI-Einsatz in der Bildung hat und wie KI bereits heute in der Landwirtschaft verwendet wird. Wir sprechen auch darüber „wo die Reise mit KI hingehen könnte und wie hoch die Reisegeschwindigkeit ist“. Hören Sie hinein!

Folge 133: Top Qualität bei Maissilage sichern
Maissilage wird immer wichtiger für die Fütterung in Rinderbetrieben, doch Qualität und Lagerung stellen oft große Herausforderungen dar. In unserer Podcast-Episode von Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder gibt Ing. Reinhard Resch von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein wertvolle Tipps und Einblicke, wie man durch richtige Sortenwahl, optimale Erntezeiten und -technik, richtige Verdichtung und gezielten Siliermittel-Einsatz höchte Qualitäten erziehlt und Futterverluste minimiert. Aktuelle Ergebnisse aus dem LK-Silageprojekt 2024 zeigen, wo es in der Praxis hakt und wie es besser laufen könnte. Ein Muss für alle, die mehr aus ihrer Maissilage herausholen wollen!

Folge 132: Hofnachfolge neu gedacht
Alle landwirtschaftlichen Betriebe müssen sich früher oder später mit dem Thema Hofnachfolge auseinandersetzen. Immer öfter gibt es keine Nachfolge in der Familie, wer übernimmt also den Hof? Andersherum gibt es viele Landwirt:innen – seien es weichende Erb:innen oder Neueinsteiger:innen –, die gerne eine Landwirtschaft weiterführen wollen. Wo finden sie also Hofübergeber:innen, die eine Nachfolge suchen? Genau hier setzt der Verein Perspektive Landwirtschaft an. Mit innovativen Ansätzen, wie einer digitalen Plattform, die Räume der Begegnung zwischen Suchenden und Übergebenden schafft. Aber auch analog, im Rahmen von Veranstaltungen, bietet er die Möglichkeit des Kennenlernens beim Speed-Dating. Der Verein unterstützt Hofübergebende und Hofsuchende mit Informationen und schafft Räume für Austausch und das Finden zueinander. Die Bildungsarbeit des Vereins wird vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Klima und Umwelt u.a. aus Mitteln des Fonds "Ländliche Entwicklung" finanziert. Geschäftsführerin Margit Fischer erläutert im Podcast „Agrar Science - Wissen kompakt“ der HBLFA Raumberg-Gumpenstein, worauf es bei einer erfolgreichen Hofübergabe ankommt, warum frühzeitige Planung entscheidend ist und wie man das passende „Match“ für seinen Betrieb findet.

Folge 131: Futteranalysen – Der Schlüssel zur optimalen Fütterung!
In der aktuellen Podcast-Folge von 'Agrar Science – Wissen kompakt' dreht sich alles um die Bedeutung von Futteranalysen für die bedarfsgerechte Fütterung von Nutztieren. DI Gerald Stögmüller, Leiter des Futtermittellabors Rosenau und Fütterungsreferent bei der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, erklärt, warum die Analyse von Nährstoffen, Mineralstoffen und Hygienekriterien essenziell ist und wie Landwirte durch gezielte Probenziehung die Futterqualität verbessern können. Erfahren Sie mehr darüber, welche Futterproben wann und wie genommen werden sollten, um Mängel frühzeitig zu erkennen und die Tiergesundheit zu fördern. Jetzt reinhören und wertvolle Tipps mitnehmen!

Folge 130: Neue Wege am Hof entdecken
Jede Veränderung beginnt mit dem Mur, Neues auszuprobieren. Doch wie findet man innovative Ideen, die wirklich zum eigenen Hof passen? Johanna Mostböck, erfahrene Beraterin der lk-projekt niederösterreich I Wien GmbH, zeigt im Podcast-Gespräch mit Priv.Doz. Dr. Andreas Steinwidder von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein, wie landwirtschaftlcihe Betriebe erfolgreich neue Wege einschlagen können. Von der ersten Ideen über die gezielte Planung bis hinzu erfolgreichen Umsetzung und dem Umgang mit Hindernissen gibt sie wertvolle Tipps. Erfahren Sie, wie Veränderungen aktiv gestaltet werden können und welche Unterstützungsmöglichkeiten es dafür gibt. Lassen Sie sich inspirieren, neue Wege auf dem Hof mutig und gut begleitet zu gehen!

Folge 129: Landwirtschaft & EU - wie und was Brüssel wirklich entscheidet
Was hat die EU mit unserem Alltag zu tun? Warum sind die Entscheidungen in Brüssel für die österreichische Landwirtschaft so wichtig? Und wie funktioniert eigentlich der politische Prozess hinter den großen Verordnungen und Richtlinien? In dieser Podcast-Episode von Argrar-Science: Wissen kompakt der HBLFA Raumberg-Gumpenstein spricht Andreas Steinwidder mit Verena Scherfranz, Vertreterin der Landwirtschaftskammer Österreich im EU-Büro in Brüssel. Sie erklärt, wie EU-Gesetze entstehen, welche Rolle Lobbying spielt und warum die Landwirtschaft eine starke Stimme in Brüssel braucht. Außerdem werfen wir einen Blick auf die EU-Wahlen 2024, die neue Zusammensetzung des Parlaments und die Auswirkungen auf die Agrarpolitik der nächsten Jahre. Freut euch auf spannende Einblicke, verständliche Erklärungen und eine Einschätzung dazu, was auf die Land- und Forstwirtschaft in Europa zukommt. Jetzt reinhören!

Folge 128: Saisonale Abkalbung - Chance für die Mutterkuhhaltung?
Global betrachtet setzen viele Mutterkuhbetriebe auf saisonale Abkalbung. Welche Vorteile bringt dieses System für Tiergesundheit, Wirtschaftlichkeit und Arbeitsorganisation? Könnte die saisonale Abkalbung auch in Österreich weiter ausgebaut werden? In dieser Podcast-Folge spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Johann Häusler, Experte für Mutterkuhhaltung an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein und Mitautor der aktuellen ÖAG-Info-Schrift zur saisonalen Abkalbung, über die Hintergründe, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren dieses Managementsystems. Erfahren Sie, wie sich der optimale Abkalbezeitraum bestimmen lässt, welche Rolle der Deckstier spielt und wie saisonale Abkalbung die Vermarktung von Jungrindern beeinflusst. Dieser Beitrag ist besonders praxisnah, fundiert und enthält wertvolle Tipps für alle, die ihre Mutterkuhhaltung effizienter gestalten möchten!

Folge 127: Berglandwirtschaft: Zukunft gut überlegt gestalten!
Bergbauernbetriebe stehen vor besonderen Herausforderungen – vor allem, wenn es um Betriebsentscheidungen und Hofübergaben geht. Welche Erwerbsform passt? Wo liegen die Stärken des Betriebs? Welche Alternativen gibt es, und wie könnten Kooperationen helfen? Wo kann ich mich informieren? Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt der aktuellen Folge von „Agrar Science-Wissen kompakt“ der HBLFA Raumnberg-Gumpenstein. Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder spricht mit Mag. Martin Karoshi, Experte für Betriebswirtschaft, über erfolgreiche Betriebsmodelle, wirtschaftliche Strategien, Voraussetzungen für erfolgreiche Betriebsführung und zukunftsfähige Entscheidungen. Dabei bringt Mag. Karoshi nicht nur sein über Jahre aufgebautes Fachwissen ein, sondern auch wertvolle Erfahrungen aus seinem eigenen Bergbetrieb. Jetzt reinhören und wertvolle Impulse für die Zukunft der Berglandwirtschaft mitnehmen!

Folge 126: Qualität der Einstreu bei Pferden im Auge behalten
Obwohl die Einstreu von Pferdeboxen zur täglichen Routine der Pferdehalter:innen gehört, wird die Frage der Qualität der verwendeten Materialien wie Stroh, Streu, Sägespäne, Waldboden u.a. oft unterschätzt. Aktuelle mikrobiologische Strohanalysen zeigten, dass ein Drittel der untersuchten Proben bedenklich und ein weiteres Drittel mikrobiologisch verdorben waren. In dieser Folge von „Agra Science-Wissen kompakt“ spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Ing. Reinhard Resch von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein. Ing. Resch hat einen neuen Bewertungsstandard für Pferdeeinstreu entwickelt und gibt wertvolle Einblicke in die wichtigsten Kriterien, Gesundheitsrisiken und praktische Tipps zur Qualitätssicherung. Neuer Bewertungsschlüssel für Pferde-Einstreu Die verfügbaren Bewertungsverfahren gingen bisher zu wenig auf wichtige Merkmale wie z.B. Art der Einstreu, Innen-/Außenlager, Partikellänge, Saugfähigkeit, Giftpflanzen, Vorratsschädlinge, Stroh-/Streuaufnahme u.a. ein. Daher wurde für Pferdehalter:innen der neue „ÖAG-Schlüssel Praxisbewertung Stroh/Einstreu für Pferde“ unter Berücksichtigung der grobsinnlichen Bewertung von Eigenschaften wie Staubigkeit, Geruch, Farbe/Aussehen, Griff/Struktur und Verunreinigungen entwickelt. Zusätzlich zur Sinnenprüfung dient die mikrobiologische und die chemische Laboranalyse der genaueren Abklärung von Qualitätsmängeln z.B. in punkto Lagerverpilzung (Schimmelpilze) und mikrobiell gebildeter Giftstoffe (Mykotoxine). Jetzt reinhören und mehr über die optimale Einstreu für Ihr Pferd erfahren!

Folge 125: Süßkartoffel und Kartoffel in der Bio-Landwirtschaft im Vergleich
In dieser Folge von 'Agrar Science – Wissen kompakt' der HBLFA Raumberg-Gumpenstein dreht sich alles um zwei Kulturen, die auf den ersten Blick viel gemeinsam haben, aber sich dennoch wesentlich unterscheiden – Süßkartoffeln und Erdäpfel. Im Gespräch von Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder beleuchtet DI Daniel Lehner vom Bio-Institut der HBLFA Raumberg-Gumpenstein die wesentlichen Unterschiede in der Anbautechnik, die Herausforderungen bei der Kulturführung, Ernte und Lagerung und die wirtschaftlichen Perspektiven im Bio-Anbau. Warum Süßkartoffeln gerade jetzt in Österreich gefragt sind und was es braucht, um beide Kulturen nachhaltig zu kultivieren – das erfahren Sie in diesem spannenden Gespräch!

Folge 124: Social Media und Landwirtschaft – Richtige Kommunikation ist wichtig!
In dieser Folge in unserem Podcast „Agrar-Science Wissen kompakt“ der HBLFA Raumberg-Gumpenstein widmen wir uns dem wichtigen Thema Kommunikation: Welche Effekte haben digitale Medien und Social Media auf das Kaufverhalten der Konsument:innen, insbesondere im Bereich Lebensmittel und Landwirtschaft? Was wünschen sich Konsument:innen und wie können Direktvermarkter davon profitieren? Wie müssen wir mit der Gesellschaft kommunizieren? Wir werfen auch einen Blick auf die Kommunikationsplattform StadtLandTier, die Fakten und Mythen rund um die Nutztierhaltung auf Social Media beleuchtet und spannende Einblicke direkt aus dem Stall liefert. Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder spricht dazu mit Stefanie Zottl, Medienexpertin und Projektleiterin von StadtLandTier. Frau Zottl erklärt uns, warum Social Media besonders bei jungen Konsument:innen so populär ist und wie landwirtschaftliche Betriebe diese Kanäle effektiv nutzen können. Seien Sie dabei und erfahren Sie mehr zur digitalen Kommunikation!

Folge 123: Silagequalität in der Praxis: Ergebnisse & Empfehlungen
Die Qualität der Silage ist ein entscheidender Faktor für eine wirtschaftliche und leistungsstarke Fütterung mit gesunden Tieren. Doch wie steht es um die Silage in der Praxis? Welche Trends zeigen sich in den aktuellen Analysen des LK-Silageprojekts, und welche Maßnahmen können Bäuerinnen und Bauern ergreifen, um Futterverluste zu minimieren und die Silagequalität zu optimieren? In unserem Podcast „Agrar Science – Wissen kompakt“ der HBLFA Raumberg-Gumpenstein spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit dem HBLFA-Experten Ing. Reinhard Resch über die neuesten Ergebnisse und Erkenntnisse daraus. Ing. Resch gibt im Podcast zahlreiche praxisnahe Empfehlungen für die kommende Silierperiode. Jetzt reinhören und von fundiertem Expertenwissen profitieren!

Folge 122: ÖPUL: Nachhaltige Landwirtschaft seit 30 Jahren
Jahren prägt dieses Programm die Landwirtschaft in Österreich und verbindet nachhaltige Bewirtschaftung mit gezielter Abgeltung von Umweltmanagement-Leistungen unserer Bäuerinnen und Bauern. Doch was steckt hinter dem ÖPUL? Warum ist es so wichtig für die österreichische Landwirtschaft? Welche Ziele verfolgt es, wie hat sich das Programm m Laufe der Zeit verändert – und vor allem: Wie sieht die Zukunft aus? In unserer aktuellen Podcast-Folge sprechen wir mit DI Lukas Weber-Hajszan vom Ministerium für Land- & Forstwirtschaft, Klima- & Umweltschutz, Regionen & Wasserwirtschaftüber die Entstehung und Entwicklung des ÖPUL, seine Bedeutung für Umwelt und Landwirtschaft, die Herausforderungen und die mögliche Zukunft. Hört Sie hinein und erfahren Sie mehr über eines der wichtigsten Instrumente für eine nachhaltige Landwirtschaft in Österreich!

Folge 121: Unser Essen, unsere Verantwortung – Ernährungssouveränität als Menschenrecht!
Wie hängen unser Konsum, die Klimakrise und die Rechte von Bäuerinnen und Bauern weltweit zusammen? Warum ist Ernährungssouveränität ein Menschenrecht – und welche Hebel haben wir, um eine nachhaltige Zukunft mitzugestalten? In dieser Folge von „Agrar Science – Wissen kompakt“ der HBLFA Raumberg-Gumpenstein spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Margareta Moser, MA vom Welthaus Graz. Frau Moser leitet das Welthaus-Projekt Alianza Österreich–Argentinien, begleitet Projekte in Brasilien und Senegal und erklärt, warum globale Probleme globale Lösungen brauchen. Erfahren Sie, welche Herausforderungen bäuerliche Betriebe weltweit bewältigen müssen, wie nachhaltige Landwirtschaft funktioniert und warum bewusster Konsum mehr verändert, als viele denken. Jetzt reinhören – für eine zukunftsfähige Landwirtschaft und globale Gerechtigkeit!

Folge 120: Fairness in der Lebensmittelkette: Herausforderungen und Lösungen
Seit drei Jahren setzt sich das Fairness-Büro für gewerbliche Lebensmittelproduzenten:innen, Verbände, Erzeugergemeinschaften, Genossenschaften sowie Bäuerinnen und Bauern ein, die von unfairen Handelspraktiken betroffen sind. Der aktuelle Fairness-Bericht 2024 zeigt, dass es nach wie vor Ungleichgewichte in der Lebensmittelkette gibt. Die Zahl der Beschwerden ist sogar gestiegen! Harte Preisverhandlungen, unfaire Verträge und fehlende Alternativen sind am Lebensmittelmarkt leider weiter ein Thema. Das Fairness-Büro bietet kostenlose und anonyme Hilfe für Betroffene an. Im aktuellen Podcastbeitrag spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mir Dr:in Doris Hold und Mag. Johannes Abentung vom Fairnessbüro über die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Fairness-Berichts 2024, aktuelle Herausforderungen und notwendige Maßnahmen für mehr Gerechtigkeit in der Lebensmittelkette. Hören Sie hinein und erfahren Sie auch, wie jeder von uns zu mehr Fairness im Lebensmittelbereich beitragen kann!

Folge 119: Lahmheiten bei Milchkühen – Ursachen, Folgen, Lösungen
Lahmheiten im Rinderstall zählen zu den häufigsten und wirtschaftlich bedeutendsten Erkrankungen in der Milchviehhaltung. Sie beeinträchtigen nicht nur das Wohlbefinden der Tiere, sondern wirken sich auch negativ auf Milchleistung, Fruchtbarkeit und die Wirtschaftlichkeit des Betriebs aus. Doch wie erkennt man Lahmheiten frühzeitig? Welche Ursachen stecken dahinter, und welche Maßnahmen helfen, das Problem zu minimieren?

Folge 118: Ernährung der Zukunft – Insektenburger & Laborfleisch?
In dieser spannenden Folge des Podcast „Agrar Science-Wissen kompakt“ der HBLFA Raumberg-Gumpenstein spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Dr. Fritz Treiber vom Institut für Molekulare Biowissenschaften an der Karl-Franzens Universität Graz, über revolutionäre Proteinquellen, die unseren Speiseplan in den kommenden Jahren nachhaltig verändern könnten. Warum gelten Insekten als umweltfreundliche Alternative zu Fleisch? Wie wird Laborfleisch eigentlich hergestellt, und sind Insekten oder Laborfleisch wirklich eine Lösung für den Klimaschutz? Welche Herausforderungen gibt es bei der Massenproduktion, und warum haben viele Menschen Sorgen? Gemeinsam beleuchten wir Chancen, Risiken und auch die gesellschaftliche Akzeptanz von alternativen Nahrungsmitteln. Finden wir gemeinsam heraus ob wir in Zukunft wirklich alle Heuschrecken-Snacks oder Petrischalen-Steaks essen sollten bzw. essen werden!

Folge 117: Schwitzen wie ein Schwein? - Hitzestress vermeiden!
Schweine lieben es zu chillen – aber was passiert, wenn die Temperaturen steigen? Anders als wir Menschen können Schweine nicht schwitzen und leiden daher schnell unter Hitzestress. In der biologischen Schweinehaltung sind Außenklimaställe üblich, doch wie sorgt man dafür, dass die Tiere sich trotz Sommerhitze wohlfühlen? In diesem Podcastbeitrag sprechen wir mit der Expertin DI Nora Durec über clevere Lösungen für Stallklimatisierung, von Ferkelnestern bis zur Wasserkühlung. Wie Schweine überschüssige Hitze abgeben, welche Maßnahmen helfen können Hitzestress zu reduzieren und was das alles für Tierwohl und Wirtschaftlichkeit bedeutet – das erfahren Sie in dieser Folge!

Folge 115: Moderne Ausbildung zur Agrarwissenschaft an der BOKU
Sie versorgt uns mit hochwertigen Lebensmitteln, erhält die Kulturlandschaft und leistet einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. Doch dafür braucht es eine exzellente Ausbildung, innovative Forschung und engagierte Bäuerinnen und Bauern. Die Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) bildet seit über 150 Jahren Expertinnen und Experten in den Agrarwissenschaften aus und entwickelt die Lehre kontinuierlich weiter. Wie sieht die moderne Ausbildung an der BOKU derzeit aus? Warum wurden neue Strukturen an der BOKU geschaffen? Welche Entwicklungen sind für die agrarwissenschaftlichen Forschung und Lehre heute besonders relevant? Welche Chancen bietet die BOKU jungen Menschen, die sich für nachhaltige Landwirtschaft interessieren? Diese und viele weitere Fragen bespricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder im Podcast „Agrar Science – Wissen kompakt“ mit DI Josef Plank, einem führenden Experten in der Land-, Forst- und Energiewirtschaft und Vorsitzenden des Universitätsrats der BOKU. Jetzt reinhören und mehr über die Zukunft der Agrarwissenschaften erfahren!

Folge 116: Aktuelle Tierseuchensituation in Österreich – Hintergrundinfos
Stand April 2025 Seit Jahresbeginn 2025 rücken das Auftreten der Maul- und Klauenseuche (MKS) und das Thema Tierseuchen insgesamt vermehrt in den medialen Fokus. Mehrere bestätigte Fälle von MKS in einigen unserer Nachbarländer haben zu strengen Sicherheitsmaßnahmen geführt, um eine Ausbreitung nach Österreich zu verhindern. Auch andere Tierseuchen wie die Blauzungenkrankheit und die Tuberkulose sind wieder zu berücksichtigen. Wie groß ist das Risiko für Österreichs Nutztierbestände? Welche Maßnahmen sollten Landwirtinnen und Landwirte ergreifen, um ihre Bestände zu schützen? Diese und weitere Fragen beantworten wir in unserem spannenden Podcast zur aktuellen Tierseuchensituation in Österreich. Dir. Dr. Johann Gasteiner spricht dazu mit dem Amtstierarzt des Bezirkes Liezen Dr. Robert Gruber.

Folge 114: Digitale Werkzeuge für die Alm
Die Almwirtschaft ist ein jahrhundertealtes Handwerk – doch auch hier hält die Digitalisierung Einzug! Wie können smarte Technologien dabei helfen, Almen zeitsparender und effizienter zu nutzen, Tiere besser zu verwalten und die Gesundheit der Herde im Blick zu behalten? In dieser spannenden Podcast-Folge spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Dr. Thomas Guggenberger und Reinhard Huber von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein über die neuesten digitalen Werkzeuge für die Alm. Von GPS-Tracking über smarte Weidezäune bis hin zu innovativen Gesundheitsmonitoring-Systemen – erfahren Sie, welche Technologien die Arbeit auf der Alm erleichtern und welche Chancen sich daraus für die Zukunft ergeben. Jetzt reinhören und die digitale Zukunft der Alm entdecken!

Folge 113: Kleegras, Wirtschaftsdünger und Wiederkäuer – Nachhaltigkeit, Bodenfruchtbarkeit & Ertrag
Klee ist weit mehr als nur eine Futterpflanze – es ist ein entscheidender Baustein für fruchtbare Böden, nachhaltige Erträge und eine umweltfreundliche Landwirtschaft. In der biologischen Fruchtfolge sichert er die Nährstoffversorgung, verbessert die Bodenstruktur und ermöglicht eine ressourcenschonende Lebensmittelproduktion. In unserem Podcast sprechen wir mit Dr. Walter Starz vom Bio-Institut der HBLFA Raumberg-Gumpenstein über die neuesten Forschungsergebnisse zu Kleegras, Düngestrategien und die Bedeutung von Wirtschaftsdüngern. Erfahren Sie warum eine Landwirtschaft ohne Wiederkäuer kaum denkbar ist und welche Maßnahmen Landwirt:innen ergreifen können, um langfristig produktiv und klimafreundlich zu wirtschaften. Jetzt in den Podcast eintauchen und wertvolles Wissen für die Zukunft der Landwirtschaft mitnehmen!

Folge 112: Streifenanbau – Zukunft der Landwirtschaft?
Der Streifenanbau kombiniert ökologische Vorteile mit einer effizienten Bewirtschaftung – aber wie gut funktioniert das in der Praxis? In unserem Podcast spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Hans-Georg Graf vom Morgentau-Team, der ein EIP-Forschungsprojekt zu dieser innovativen Anbaumethode geleitet hat, wo auch die HBLFA Raumberg-Gumpenstein als Partner eingebunden war. Der Podcast-Beitrag gibt wertvolle Einblicke in die Ziele, Erkenntnisse aber auch Herausforderungen des Streifenanbaus und erklärt, welche Rolle diese Anbaumethode in der Landwirtschaft der Zukunft, insbesondere in Biodiversitätsförderprogrammen, spielen könnte. Hören Sie rein und erfahren Sie, warum gestreifte Felder nicht nur schön aussehen, einen Beitrag zu stabilen Erträgen leisten, sondern auch die Artenvielfalt und die Vielfalt am Speiseplans fördern!

Folge 111: Energiegemeinschaften - Gemeinsam die Energiewende gestalten!
In unserem Podcast erfahren Sie alles über Energiegemeinschaften, ihre Chancen und Herausforderungen. Wie funktioniert eine Energiegemeinschaft? Welche Vorteile bietet sie für jeden Einzelnen und die Region? Worauf ist bei der Gründung zu achten? Wie können wir gemeinsam eine unabhängige und nachhaltige Energieversorgung aufbauen? In diesem spannenden „Agrar Science-Wissen kompakt“ Podcast-Beitrag der HBLFA Raumberg-Gumpenstein spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Kurt Leonhartsberger, MSc., Experte für Energiegemeinschaften, darüber, wie Bürgerinnen und Bürger die Energiewende selbst in die Hand nehmen können. Erfahren Sie, wie Sie eine Energiegemeinschaft aufbauen, wie Sie Teil einer Energiegemeinschaft werden und welche Vorteile diese bietet – von niedrigeren Stromkosten bis hin zu mehr regionaler Wertschöpfung. Freuen Sie sich auf einen spannenden Beitrag!

Folge 110: Zukunft schmeckt – Spitzenkoch Hannes Müller über nachhaltige Landwirtschaft und echte Regionalität
„Gault&Millau Koch des Jahres“, „Grüner Michelin Sterne- und 4 Hauben-Koch“ Hannes Müller vom Genießerhotel Die Forelle lebt mit seinem Team Nachhaltigkeit auf höchstem Niveau – mit kurzen Wegen, saisonalen Zutaten und einer Küche, die nicht nur den Gaumen begeistert, sondern konsequent ganzheitlich handelt. In dieser Podcast-Folge spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Hannes Müller über „Seine Land- und Lebensmittelwirtschaft der Zukunft“, über Bäuerinnen und Bauern, Produktqualität, Regionalität, Kreislaufdenken, Saisonalität und warum wahre Qualität Zeit, Nähe, Kommunikation und Verantwortung braucht. Ein inspirierendes Gespräch über Genuss, Tradition und den Mut, Dinge anzupassen und konsequent andere Wege zu gehen. Hören Sie hinein und entdecken Sie wie die Zukunft der Landwirtschaft schmecken kann!

Folge 109: Was zeichnet erfolgreiche Bäuerinnen und Bauern aus?
Basierend auf einer umfangreichen Analyse von Daten aus Buchführungsbetrieben und ausführlichen Interviews mit besonders erfolgreichen Landwirtinnen und Landwirten wurden in einer Studie besondere Erfolgsfaktoren abgeleitet. Die Studie zeigt, dass neben Betriebsgröße und Ausbildung vor allem auch persönliche und soziale Faktoren entscheidend sind. In diesem Podcast-Beitrag spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit HS-Prof. Dr. Leopold Kirner zu den Ergebnissen dieser österreichischen Studie. Wie wichtig sind Netzwerke? Welche Rolle spielt die Arbeitsorganisation? Und welche Strategien setzen besonders erfolgreiche Betriebe um? Diese und viele weitere spannende Fragen beantworten wir in diesem Podcast-Beitrag mit HS-Prof. Dr. Leopold Kirner. Freuen Sie sich auf interessante Einblicke in die wirtschaftlichen Erfolgsgeschichten landwirtschaftlicher Betriebe in Österreich!

Folge 108: Mercosur – Was kommt auf unsere Landwirtschaft zu?
Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten sorgt für hitzige Debatten. Während wirtschaftliche Chancen für Exportunternehmen und die europäische Wirtschaft erwartet werden, sieht sich die Landwirtschaft besonders unter Druck: Billigere Importe, niedrigere Produktionsstandards und zunehmender Preisdruck könnten insbesondere die Bereiche Rindfleisch, Zucker, Ethanol und Geflügel gefährden. In der aktuellen Folge von Agrar Science Wissen kompakt spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Agrarökonom Priv.-Doz. Dr. Franz Sinabell vom WIFO über seine Einschätzungen zu den Auswirkungen des Abkommens. Welche Chancen und Risiken bringt Mercosur mit sich? Welche Schutzmaßnahmen für die europäische Landwirtschaft gibt es? Wie realistisch sind deren Erfolgswirksamkeit? Welche flankierenden Maßnahmen wären für die Landwirtschaft wichtig? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt der aktuelle Podcast-Beitrag – hören Sie hinein!

Folge 107: Flächenfraß - Jeder Mensch braucht ein Stück Erde!
Über 11 Hektar Land verschwinden täglich unter Beton und Asphalt, während gleichzeitig Gebäude leer stehen, Ortskerne ausgedünnt werden und neue Flächen zu Bauland gewidmete werden. Dies hat Auswirkungen auf die Entwicklung unserer Ernährungssouveränität, die Landwirtschaft, das Ortsbild und unsere Lebensqualität! In dieser Podcast-Folge spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit DIin Caroline Rodlauer – Architektin, Projektentwicklerin und Expertin für Baukultur – über Bodenschutz, Leerstandsaktivierung und nachhaltiges Bauen. Frau DIin Caroline Rodlauer beleuchtet die Ursachen des hohen Bodenverbrauchs in Österreich und diskutieren Lösungen, die dazu beitragen könnten, unsere Landschaft zu bewahren und lebenswerte Räume zu schaffen. Wie können wir bestehende Gebäude sinnvoll nutzen, anstatt immer neue Flächen zu versiegeln? Welche politischen Maßnahmen braucht es, um nachhaltige Siedlungsentwicklung zu fördern? Und welche Rolle spielt jede:r Einzelne in diesem Prozess?

Folge 106: Innovation trifft Nachhaltigkeit – Frutura Obst und Gemüse
Visionen brauchen Mut, und Mut braucht Tatkraft – genau das bewiesen drei Landwirte aus der Oststeiermark, als sie 1999 den Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit legten. Was mit der Modernisierung von Dörranlagen begann, entwickelte sich zu einem in Österreich größten Produzenten von Obst, Gemüse und Kräutern, der täglich bis zu drei Millionen Menschen versorgt. Doch Frutura steht für mehr als nur frische Lebensmittel: Geothermie, Nachhaltigkeit, Artenschutz und der Blick auf morgen prägen ihre Philosophie. In dieser Folge von Agrar Science – Wissen kompakt spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit GF Manfred Hohensinner, einem der Gründer und Vordenker von Frutura. Im Gespräch blickt Herr Hohensinner zurück auf die fordernde und auch beeindruckende Entwicklung des Unternehmens. Warum es keine Zufälle gibt, sondern oft „einem etwas zufällt“. Sie sprechen über innovative Nachhaltigkeitsprojekte wie BeeWild, wo auch mit der HBLFA Raumberg-Gumpenstein zusammengearbeitet wird. Außerdem werfen sie einen Blick in die Zukunft und geben speziell der Jugend Tipps für ein erfülltes und erfolgreiches Leben.

Folge 105: Magerweiden fördern die Biodiversität
Entdecken Sie, wie extensiv genutzte Magerweiden einen wertvollen Beitrag zur Biodiversität leisten! In unserer neuen Podcast-Episode "Magerweiden fördern die Biodiversität" sprechen wir über die einzigartige Pflanzen- und Tierwelt dieser Lebensräume, ihre Bedeutung für den Naturschutz und wie sie trotz ihrer geringen Flächenausdehnung entscheidend zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen. Erfahren Sie außerdem, welche landwirtschaftlichen Praktiken Magerweiden fördern und wie diese zur Schönheit unserer Landschaft beitragen.

Folge 104: Fleischqualität trifft Nachhaltigkeit: Ein neuer Ansatz in der Rindermast?
Die österreichische Rinderwirtschaft bemüht sich, den Export von Kälbern zu reduzieren. Neben dem Ausbau der Kälbermast ist die Belegung von Milchrasse-Kühen wie Holstein Friesian oder Brown Swiss mit Fleischrindern eine Möglichkeit. Hierbei muss man wissen, dass Kälber von Milchrassen zwar in der österreichischen Kälbermast zum Einsatz kommen, in der Stier-, Ochsen- und Kalbinnenmast aber kaum/nicht gefragt sind. Grund dafür ist, dass milchbetonte Rassen langsamer zunehmen, mehr Futter brauchen und die Schlachtkörper schlechter bezahlt werden als Zweinutzungsrassen wie Fleckvieh bzw. Kreuzungen mit Fleischrassen. Mastversuch an der HBLFA In einem Mastversuch an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein wurde diesbezüglich ein innovativer Ansatz gewählt. Holstein Kühe wurden mit der sehr frühreifen Fleischrasse Angus belegt. Ziel war, unter extensiven Bedingungen (Weide bzw. Stallmast mit nur geringem Kraftfuttereinsatz) bei kurzer Mastdauer schlachtreife Tiere zu erreichen, die eine besondere Fleischqualität aufweisen.

Folge 103: EU-Renaturierung-VO: Einvernehmliche Lösungen im Fokus
Was kommt hinsichtlich Renaturierung auf die Landwirtschaft zu und wie kann die Umsetzung gelingen? Mit der EU-Verordnung zur Wiederherstellung degradierter Ökosysteme sollen in der EU bis zum Jahr 2050 geschädigte Ökosysteme – Schritt für Schritt – wieder in einen guten Zustand versetzt werden. Die Maßnahmen dazu betreffen uns alle - besonders aber die Land-, Forst und Wasserwirtschaft. Viele Bäuerinnen und Bauern sind verunsichert, sie fürchten um ihre betriebliche Existenz, nicht wenige sehen sich als Sündenböcke der Gesellschaft, andere beklagen sich über noch mehr Auflagen und Bürokratie. Was kommt auf die Landwirtschaft zu? Wie kann die Umsetzung der Renaturierungsverordnung in Österreich gelingen? Welche Risiken und Chancen gibt es? In unserem 86. Podcastbeitrag mit Dr. Helmut Gaugitsch wurde ein erster Aufriss dazu gemacht. Diese Podcast-Episode setzt die Gesprächsreihe fort. Dazu spricht PD Dr. Andreas Steinwidder mit DI Wolfgang Suske, der ein Naturschutzbüro leitet und auch an der Universität für Bodenkultur lehrt. Gemeinsam mit Projektpartner:innen und seinem Team begleitet er umweltrelevante Projekte in der Land- und Forstwirtschaft. Auch das EU-Gesetz zur Wiederherstellung gefährdeter Lebensräume spielt in der Arbeit von DI Suske eine wichtige Rolle. Dazu gab es in den letzten Monaten auch einige Online-Veranstaltungen (Links siehe unten). Es wurden gesetzlichen Vorgaben vorgestellt, einvernehmliche Biodiveritätslösungen diskutiert und auch Umsetzungskonzepte von und mit Bäuerinnen und Bauern beschrieben.

Folge 102: Zukunft der Almwirtschaft in Österreich
Wir verbinden mit der Almwirtschaft grasenende Tiere gepflegte Landschaften Flächen mit hoher Biodiversität erlebnisreiche Wanderungen und auch gemütliches Almleben. Damit das so bleibt, braucht es die Bäuerinnen und Bauern, die die Almen bewirtschaften. Doch es verändert sich etwas, und darüber wird in diesem Podcast-Beitrag von PD Dr. Andreas Steinwidder mit DI Rudolf Grabner gesprochen. DI Rudolf Grabner arbeitet an der Landwirtschaftskammer Steiermark und leitet dort das Referat für Almwirtschaft. Gerne nehmen die zwei Gesprächspartner „als Alm- und Bergführer“ mit hinauf auf unsere Almen und laden Sie auch zum Nach- und Weiterdenken ein.

Folge 101: Garten am Berg – Von Bio-Gemüse auf 960 m leben!
Michael Windberger hat seinen Traum verwirklicht. Er betreibt in der Nähe von Schladming auf 960 m Seehöhe mit seinem Team eine Bio-Marktgärtnerei. Das auf höchstem Standard produzierte saisonale Bio-Gemüse wird in der Region vertreiben. Dazu werden seit 2021 über 40 Gemüsearten und über 120 Sorten kultiviert, schonend geerntet und über Direktvermarktung angeboten. Michael Windberger ist ein innovativer Quereinsteiger in die Landwirtschaft. Kooperation ist ihm wichtig und „Wachsen oder Weichen“ ist jedenfalls kein Leitgedanke für Michael. Im Podcast-Gespräch mit PD Dr. Andreas Steinwidder gibt Michael Windberger wertvolle Erfahrungen zum Einstieg, Aufbau, zur Kulturführung und auch zur Vermarktung weiter! Er würde sich freuen, wenn möglichst viele seinem Beispiel folgen und auch in ihrer Region eine Marktgärtnerei aufbauen würden - das Potenzial dazu sieht er als sehr groß an! Wir laden Sie ein im Podcast-Gespräch mehr über den Garten am Berg und die Erfahrungen von Michael Windberger zu erfahren – hören Sie hinein!

Folge 100: Jugendliche zur Zukunft der Landwirtschaft!
In dieser Jubiläumsfolge – wir freuen uns über das 100. Podcast-Gespräch J bei „Agrar Science-Wissen kompakt“ der HBLFA Raumberg-Gumpenstein – richten wir den Fokus auf die Perspektive der Jugend. Die Jugendlichen sind es, welche unsere Podcast-Episoden gerne hören. Sie sind es aber auch, welche die Zukunft unseres Landes bzw. der Land- und Lebensmittelwirtschaft in Österreich entscheidend mitgestalten. Viele Gründe „mit unserer Zukunft“ über „unsere Zukunft“ zu sprechen! Wie sehen junge Menschen die Zukunft der Landwirtschaft? Welche Herausforderungen und Chancen erkennen sie? Gibt es Zukunftsängste? Was halten Sie vom Spruch „Wachsen oder Weichen“? Was wünschen Sie sich von der Gesellschaft, den Medien und Politik? In der 100. Podcast-Episode begrüßt Priv. Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Anna-Lena Molterer und Maximilian Meissinger zwei junge Gäste und spricht mit ihnen über ihre Visionen, Herausforderungen und ihre Begeisterung für die Landwirtschaft. Anna-Lena Molterer und Maximilian Meissinger stehen kurz vor der Matura an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein. Sie haben im Rahmen der Europatage den Themenblock „Zukunft der Landwirtschaft“ mit der Jugend erarbeitet und bei der Tagung professionell moderiert. Freuen Sie sich auf ein inspirierendes Gespräch – und lassen Sie uns gemeinsam einen Blick in die Zukunft werfen!

Neue Fütterungsempfehlungen für Milchkühe - 99. Podcast
Eine leistungsangepasste Fütterung von Tieren ist die Basis für Gesundheit, Effizienz, Tierwohl und auch geringe Nährstoffausscheidungen. In der Rationsgestaltung wird dazu auf Fütterungsnormen zurückgegriffen, welche aus Ergebnissen wissenschaftlicher Versuche abgeleitet werden. Im deutschsprachigen Raum wurden die bisherigen Fütterungsempfehlungen der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie (GfE) aus dem Jahr 2001 evaluiert und jetzt deutlich angepasst. Die Neuerungen sind in den „Empfehlungen zur Nährstoff- und Energieversorgung von Milchkühen“, die 2023 von der GfE veröffentlicht wurden, ausführlich beschrieben. Im Podcast-Gespräch von PD Dr. Andreas Steinwidder mit Dr. Georg Terler erfahren Sie welche Anpassungen erfolgten und wie sich das auf die Analytik, die Futterbewertung und den Nährstoffbedarf der Milchkühe auswirken wird. Darüber hinaus wird auch der Umsetzungsprozess der Normen von der Futtermittelbranche bis hin zur Praxis beleuchtet. Dazu leitet Dr. Georg Terler am Institut für Nutztierforschung der HBLFA Raumberg-Gumpenstein ein großes Projekt.

Folge 98: Erfolgreiche rechtliche Umsetzung von Stallbauten
Die Errichtung bzw. der Umbau von bestehenden Stallgebäuden muss gut geplant sein. Neben den zu erwartenden Kosten, spielen auch die rechtlichen Vorgaben im Baubewilligungsverfahren eine zentrale Rolle. Passieren hier Fehler, können Bauvorhaben verhindert, verzögert bzw. die Kosten in der Umsetzung deutlich erhöht werden. Welche rechtlichen Vorgaben es gibt, warum die angestrebte Tieranzahl und der Bestand am Betriebes wichtig sind, welche Bedeutung die Ausgangssituation vor dem Umbau hat, worauf bei der Projektformulierung und Planung zu achten ist – zu diesen und weiteren Fragen erfahren Sie mehr in dieser Podcast-Episode von „Agrar Science-Wissen kompakt“ der HBLFA Raumberg-Gumpenstein. PD Dr. Andreas Steinwidder spricht dazu mit Rechtsanwalt Mag. Wolfram Schachinger – einen Experten, wenn es um Genehmigungsverfahren geht – und Michael Kropsch (BMA), der an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein das Referat „Emissionen aus der Tierhaltung“ leitet. Dieser Podcast-Beitrag gibt einen anschaulichen Einblick in die Rechtsmaterien rund um den Stallbaugenehmigungsprozess. Er ist eine wertvolle Unterstützung vor der Projektierung und während der Umsetzung von Bauvorhaben. Falls Sie an diesen Themen interessiert sind oder mehr darüber erfahren möchten, laden wir Sie herzlich ein, unseren Podcast anzuhören.

Folge 97: E-Mobilität bei Großmaschinen und Landwirtschaft – nur bedingt?
Im PKW-Bereich gewinnt die E-Mobilität an Bedeutung. Bei Großmaschinen, wie sie auch in der Landwirtschaft verwendet werden, begrenzen der hohe Energiebedarf, die Ladedichte und Ladekapazität und damit auch das Gewicht für Akkus deren Einsatz. Im Podcast Gespräch von Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Univ.-Prof. Dr. Helmut Eichlseder geht es um die Mobilität der Zukunft in der Landwirtschaft und auch bei sonstigen schweren Maschinen. Univ.-Prof. Dr. Eichlseder leitet an der TU Graz das Institut für Thermodynamik und nachhaltige Antriebssysteme. Prof. Dr. Eichlseder hat in seiner beruflichen Laufbahn selbst Motortechnologien entwickelt und optimiert, welche dann in großen Serien auf den Markt kamen. Heute beschäftigt er sich in der Forschung und Entwicklung an der TU Graz mit zukünftigen Antriebstechnologien (E-Mobilität, Wasserstoff, Hybridsystemen etc.). Das Forschungsinstitut ist in Europa einer der führenden Player, wenn es um die Transformation zu nachhaltigen Antriebssystemen geht. Für Prof. Dr. Eichlseder steht außer Zweifel, dass auch bei Großmaschinen und in der Landtechnik die fossilen Energieträger in absehbarer Zeit der Geschichte angehören werden. Auf dem Weg dahin brauchte es aus seiner Sicht jedoch einen bunten Mix an Energieträgern und Technologien. Welche das sind, das erfahren Sie in dieser „Agrar Science-Wissen kompakt“ Podcast-Episode aus erster Hand! Univ.-Prof. Dr. Eichlseder leitet an der TU Graz das Institut für Thermodynamik und nachhaltige Antriebssysteme. Prof. Dr. Eichlseder hat in seiner beruflichen Laufbahn selbst Motortechnologien entwickelt und optimiert, welche dann in großen Serien auf den Markt kamen. Heute beschäftigt er sich in der Forschung und Entwicklung an der TU Graz mit zukünftigen Antriebstechnologien (E-Mobilität, Wasserstoff, Hybridsystemen etc.). Das Forschungsinstitut ist in Europa einer der führenden Player, wenn es um die Transformation zu nachhaltigen Antriebssystemen geht. Für Prof. Dr. Eichlseder steht außer Zweifel, dass auch bei Großmaschinen und in der Landtechnik die fossilen Energieträger in absehbarer Zeit der Geschichte angehören werden. Auf dem Weg dahin brauchte es aus seiner Sicht jedoch einen bunten Mix an Energieträgern und Technologien. Welche das sind, das erfahren Sie in dieser „Agrar Science-Wissen kompakt“ Podcast-Episode aus erster Hand!

Folge 96: Gedanken zur Entwicklung und Zukunft der Rinderzucht
Das Leistungs-, Fütterungs-und Haltungsniveau der Nutztiere hat sich in den letzten Jahrzehnten – sowohl global als auch in Österreich – wesentlich verändert. Beispielsweise lag 1950 das Milchleistungsniveau der Milchkühe in Österreich bei etwa 3000 kg. Heute geben die Kontrollkühe im Mittel knapp 8000 kg Milch pro Kuh und Jahr. Zu diesem Leistungszuwachs hat wesentlich die Zucht beigetragen. Im Podcast-Gespräch von Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Univ. Prof. Dr. Johann Sölkner vom Institut für Nutztierwissenschaften der Universität für Bodenkultur wird auf die Entwicklung der Rinderzucht eingegangen. Der international anerkannte und viel zitierte Forscher Johann Sölkner stellt wichtige methodische Meilensteine und Hintergründe in der Züchtung vor. Zusätzlich werden auch die in Afrika laufenden Initiativen zur standortangepassten Tierzucht und die Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen in Österreich diskutiert. Ein Blick in die Zukunft der Rinderzucht rundet die Podcast-Episode ab.

Folge 95: Gülleausbringung: Unterschiede zwischen Bayern und Österreich!
In Bayern gelten zur Gülleausbringung andere gesetzliche Vorgaben als in Österreich. Diese Unterschiede sind vielen nicht bekannt und verursachen daher in der Praxis aktuell große Verunsicherungen. In diesem Podcast werden die Unterschiede zwischen Bayern und Österreich und daraus Empfehlungen und Konsequenzen für uns abgeleitet. Im Anhang finden Sie auch ein Info-Schreiben worin die Unterschiede in den Vorgaben zwischen Bayern und Österreich zur Gülleausbringung dargestellt im Detail dargestellt werden.

Folge 94: Zukunft der Rinderwirtschaft – in Österreich und global
Rinder als Schlüssel für eine nachhaltige Lebensmittelversorgung: Bedeutung, Herausforderungen und Potenziale der Rinderhaltung im Wandel der Zeit Rinder spielen für die Bereitstellung von nährstoffreichen, hochverdaulichen und wohlschmeckenden Lebensmitteln eine ganz zentrale Rolle. Viele Gebiete dieser Welt hätten ohne Rinder, Schafe, Ziegen und Büffel und deren Potenzial, große Mengen an faserreichen Pflanzen-/teilen (Grasbestände) in Milch und Fleisch umzuwandeln, nie besiedelt werden können. Die Hälfte der in Österreich landwirtschaftlich genutzten Fläche ist davon geprägt und bis heute und auch zukünftig von beispielloser Relevanz für die lokale, regionale und urbane Lebensmittelversorgung. Förderungswürdige Nebeneffekte sind: die Aufrechterhaltung der Bewirtschaftung und Pflege aller Grünlandflächen und damit das Hintanhalten der Verbuschung und Verwaldung; die Schönheit einer abwechslungsreichen Landschaft (Wald und Wiesen) und damit ihre touristische Attraktivität. Eine nachhaltige Entwicklung der Rinderwirtschaft verlangt einen ganzheitlichen Blick auf die unverzichtbaren Vorzüge für uns Menschen und eine den Bedürfnissen der Tiere möglichst gerecht werdende Haltung. Handlungsanleitungen basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen schließen Potenziale für eine Reduktion der Methanbildung ein. Im Podcast-Gespräch mit Ao.-Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Knaus, aufgenommen am 17. Okt. 2024, Institut für Nutztierwissenschaften, BOKU University, erfahren Sie mehr über die Entwicklung und Perspektiven der Rinderhaltung im Allgemeinen und über das Potenzial von Milchkühen bei einer grundfutterbasierten Fütterung im Speziellen.

Folge 93: Sonnenalm – Aufbau und Zusammenarbeit einer kleinen Milch-Genossenschaft
In der Gemeinde in Klein St. Paul in Kärnten wurde vor knapp 30 Jahren der bäuerlich organisierten Milchhof Sonnenalm gegründet. In der Genossenschaft wird die Milch von 12 Rinderbetrieben und zwei Ziegenbetrieben veredelt und in ganz Kärnten - und auch den angrenzenden Länder - über unterschiedlichste Schienen vermarktet. Zusätzlich befindet sich am Verarbeitungsbetrieb eine Milcherlebniswelt, werden in der Käseschule Kurse zur Milchverarbeitung angeboten und wird auch besonderer Wert auf das „Erleben“ einer nachhaltigen Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung gelegt. Im Podcast spricht dazu Dr. Andreas Steinwidder mit dem Geschäftsleiter, Bauern und Obmann der Genossenschaft Hannes Zechner. Sie erfahren sehr viel Wertvolles zum Aufbau eines Milchhofes, zu den Herausforderungen und Stärken der Genossenschaft, wichtigen Partnern, der Bedeutung der bäuerlichen Familienbetriebe in der Gemeinschaft und den sich ändernden Kundenwünschen. Hören Sie hinein!

Folge 92: Mit Kennzahlen zum Erfolg: Unternehmensführung im Fokus
Die Arbeitskreisberatung Unternehmensführung bietet landwirtschaftlichen Betrieben unterschiedlichster Produktionssparten wertvolle Unterstützung um ihre betrieblichen Daten zu erfassen, auszuwerten und zu interpretieren. Dies liefert die Basis für standortangepasste und gut abgesicherte Betriebsentscheidungen. AK-Teilnehmer:innen profitieren auch vom persönlichen Austausch mit den Berufskollegen:innen unterschiedlichster Sparten bei den jeweiligen Treffen, von den gemeinsam durchgeführten Exkursionen und auch von der persönlichen Unterstützung durch geschulte Beratungskräfte. In dieser „Agrar Science - Wissen kompakt“ Podcast-Episode der HBLFA Raumberg-Gumpenstein spricht Dr. Andreas Steinwidder mit Frau DI Alina Kofler über den Arbeitskreis Unternehmensführung, den Frau DI Kofler in Kärnten betreut. In dieser Funktion arbeitet Sie mit einer Vielfallt an Betrieben zusammen, kennt die speziellen Herausforderungen in den unterschiedlichen Betriebszweigen und weiß auch wie wichtig Daten, aber auch die menschlichen und familiären Bedingungen, bei Betriebsentscheidungen sind. Erfahren Sie im Podcast welche Daten erhoben werden, was aus diesen abgeleitet werden kann, welche wichtigen Erfolgsfaktoren sich auf den Höfen zeigen, worauf beim Aufbau neuer Betriebszweige geachtet werden sollten und wie wichtig der Mensch und auch die persönlichen Fähigkeiten der Familienmitglieder bei landwirtschaftlichen Entscheidungen sind. Die Arbeitskreisberatung wird von Bund, Land und EU wesentlich finanziell unterstützt und in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft, den ländlichen Fortbildungsorganisationen und den Landwirtschaftskammern in ganz Österreich angeboten. Die AK-Teilnahme ist für alle Betriebe mehrjährig möglich – eine Anmeldung und aktive Teilnahme ist erforderlich.

Folge 91: Zwei Familien übernehmen den Hof: Neue Wege in der Nachfolge bei Familie Ertl
Landwirtschaftliche Betriebe werden traditionell häufig innerhalb der Familie an eine Tochter oder einen Sohn übergeben. Über Jahrzehnte wurden darüber hinaus auf vielen Höfen die Anzahl der Beschäftigten reduziert. In dieser Podcast-Episode wird ein alternatives Betriebsentwickungskonzept vorgestellt. Zwei Geschwister „teilen“ sich mit ihren jungen Familien den elterlichen Hof. Im Podcast spricht dazu Dr. Andreas Steinwidder mit Dr. Paul Ertl. Paul Ertl hat nach seinem Studium an der Universität für Bodenkultur, gemeinsam mit seiner Schwester Karin sowie den jeweiligen Partner:innen sowie den Eltern, an der Hofübergabe und der Gründung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts am Biobauernhof Ertl&Jester in Spital an der Drau gearbeitet. Neben den notwendigen rechtlichen Schritten wurden neue Betriebsstandbeine aufgebaut und auch das Zusammenleben am Hof diskutiert und definiert. Es gab besondere Herausforderungen und es brauchte auch kreative Lösungsansätze – daraus kann man viel lernen! Gute Kommunikation, Aufgabenteilung, das Ausleben lassen von Stärken, klare rechtliche und finanzielle Strukturen, Vertrauen und familiäre Freiräume und Rückzugsgebiete, ähnliche Wertvorstellungen sind jedenfalls Schlüsselfaktoren die zum Erfolg führen.

Folge 90: Standortgerechte Rekultivierung und Begrünung in Hochlagen
Moderne Techniken und nachhaltige Methoden: Erfolgreiche Wiederbegrünung in den österreichischen Alpen In den letzten fünfunddreißig Jahren kam es in den österreichischen Alpen zu einer rasanten Entwicklung der Technik bei der Wiederbegrünung in Hochlagen, also Flächen im Bereich der oberen montanen bis hin zur alpinen Höhenstufe. Wurde bei den ersten großen Erschließungen neuer Schigebiete im Alpenraum vorwiegend mit Dynamit und Planierraupe gearbeitet, ist die Erhaltung des humosen Oberbodens Selbstverständlichkeit geworden. Vorhandene Vegetation wird sorgfältig mit dem Löffelbagger abgetragen und zeitnah wiederverwendet und damit das Artengefüge des Standorts erhalten. Bei großflächigen Eingriffen kann inzwischen zusätzlich auf Saatgut von standortgerechten, subalpinen und alpinen Arten zurückgegriffen werden. Zwanzig verschiedene Gräser, Kleearten und Kräuter wurden auf passenden Spenderflächen quer über den Alpenraum gesammelt und werden inzwischen von Landwirten großflächig produziert. Je nach Höhenlage, Ausgangsgestein und Nutzung werden daraus unterschiedliche Begrünungsmischungen für Almweiden, Schipisten oder Böschungen zusammengesetzt. In Kombination mit Begrünungstechniken, die zuverlässig vor Erosion schützen, entstehen so ausdauernde, standortgerechte, pflegeextensive Begrünungen, wie in vielen nationalen und internationalen Projekten der HBLFA Raumberg-Gumpenstein erprobt und nachgewiesen wurde. Dieses erfolgreiche Zusammenspiel von Techniken, Methoden und Materialien wurde in den letzten Jahren in vielen Fachveranstaltungen an Projektbetreiber, Planungsbüros, Behörden und ausführende Firmen weitervermittelt. In Zusammenarbeit der HBLFA Raumberg-Gumpenstein mit dem Land Tirol und diversen Fachexperten wurde der moderne Stand des Wissens in einer Richtlinie sowie einer ÖNorm zusammengefasst und ist, zumindest in Österreich, inzwischen bereits etablierte Praxis.

Folge 89: Jenseits des Hypes - Verstehen wir KI falsch?
Kritisch und lösungsorientiert im Umgang mit KI in der Landwirtschaft Der öffentliche Diskurs über Künstliche Intelligenz (KI) in der Landwirtschaft ist selten neutral. Der Hype der letzten zwei Jahre hat zu einer gewissen Idealisierung von KI als Antwort auf alle Herausforderungen unserer Zeit geführt, während gleichzeitig große Unsicherheit über die möglichen Auswirkungen auf unser aller Leben herrscht. Das Bedürfnis nach einfachen Erklärungen und konkreten Handlungsanweisungen ist groß. In dieser Folge sprechen wir über grundlegende Missverständnisse im Umgang mit „der KI“, und wie es mit internationaler Forschung zu dem Thema aussieht. Wir reflektieren, was für einen konstruktiven Umgang mit der neuen Technologie wichtig ist, und ob kommende Generationen möglicherweise anders damit umgehen werden. Der Diskurs reicht von der Vermenschlichung der Technologie, die oft zu Fehleinschätzungen führt, bis hin zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den Grenzen und Herausforderungen, die mit KI-gesteuerten Systemen in landwirtschaftlichen Betrieben einhergehen. Welche Risiken entstehen, wenn KI-Systeme auf der Basis fehlerhafter Daten arbeiten? Welche Verantwortung trägt der Mensch im Umgang mit diesen Technologien? Diese und weitere Fragen werden aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, um ein ganzheitliches Verständnis für die komplexen Zusammenhänge zu fördern. Magdalena Waldauer arbeitet im Projekt agrifoodTEF daran, die Entwicklung von KI- und Robotiktool mit realen Testumgebungen und zuverlässigen Daten aus der Praxis zu unterstützen. Als Teil eines paneuropäischen Netzwerks aus neun Ländern soll das Projekt insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) ermöglichen, ihre Technologien voranzubringen und deren Zuverlässigkeit zu verbessern.

Folge 88: Wirtschaftsdüngermanagement – vom Stall bis zur Ausbringung
Effizientes Wirtschaftsdüngermanagement: Maßnahmen zur Nährstofferhaltung und Emissionsreduktion Wirtschaftsdünger sind wertvolle Mehrnährstoffdünger, die in der nachhaltigen, tier- und flächengebundenen Landwirtschaft eine wichtige wirtschaftliche und ökologische Funktion erfüllen. Zudem versteht sich die Landwirtschaft seit jeher als Kreislaufwirtschaft, das heißt, dass die Nährstoffe und humusbildenden Anteile in den Wirtschaftsdüngern möglichst verlustarm wieder den Pflanzen zugeführt werden. Die in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Energiepreise haben den Druck hinsichtlich Effizienzsteigerung nicht nur im produktionstechnischen Sinn, sondern auch im Sinne der Verringerung von Nährstoffverlusten erhöht. Vor diesem Hintergrund gilt es, alle Verlustpfade, und hier insbesondere im Zusammenhang mit Stickstoff, zu minimieren. Das beginnt mit einer bedarfsgerechten Fütterung und reicht vom tiergerechten, klimafitten, emissionsarmen Stallbau über die Lagerung bis zur Behandlung und möglichst gleichmäßigen und verlustarmen Ausbringung der Wirtschaftsdünger. Dabei spielt die bodennahe Gülleausbringung eine zentrale Rolle. Weitere Maßnahmen zur Emissionsreduktion, wie die Weidenutzung, die Gülleverdünnung mit Wasser (Sommergülle) und die Berücksichtigung der Witterung (kühl und feucht), eignen sich gut, um die bisherigen Emissionsreduktionsmaßnahmen zu unterstützen. Was es beim „Wirtschaftsdüngermanagement der Zukunft“ vom Stall bis zur Ausbringung zu berücksichtigen gilt – Was neu ist! Was geht! Was nicht geht! - wird im Podcast Agrar-Umwelt-Science von Andreas Steinwidder und Alfred Pöllinger-Zierler diskutiert.

Folge 87: Biodiversität im Weingarten
Anlage und Pflege von artenreichen Dauerbegrünungen in Fahrgassen von Weinbergen Im Rahmen des EU-Projekts Life VineAdapt wurden seit 2021 am Landesweingut Silberberg und bei steirischen Partner-Weingütern die Fahrgassen mit einer artenreichen Dauerbegrünungsmischung im Mittelstreifen und einer Rasenmischung in den Fahrspuren begrünt und evaluiert. Das Saatgut ist G-Zert zertifiziert und stammt aus regionalen Sammlungen von Wildpflanzen. Sehr gute Ergebnisse erzielte die Anlagetechnik in zwei Arbeitsschritten: die Saatbeetvorbereitung zwischen den Traktorreifen mit Rotor-Umkehregge Einsaat einer artenreichen Mischung mit oberflächlicher Ablage mittels Güttler-Gerät zwischen den Fahrspuren und nachfolgendem Walzen mit einer Prismenwalze. In den Fahrspuren wurde mit dem geteilten Säkasten gleichzeitig eine Mischung aus Rasengräsern angesät. Die Begrünung kann bei optimaler Pflege bis zu 10 Jahre ausdauernd in den Mittelstreifen bestehen. Die Verwendung eines Biodiversitätsmulchers bzw. durch das Ausbauen der mittleren Mulcher-Messer können die gesäten Arten abblühen, als Nektarquelle für Insekten dienen und die Samen abreifen.

Folge 86: Modellregion KLAR! Zukunftsregion Ennstal
Das Ennstal ist als alpine Region stärker vom Klimawandel betroffen, als der europäische Durchschnitt. Auswirkungen sind bereits jetzt in der Region spürbar. Vor allem extreme Wetterereignisse verursachen Naturkatastrophen wie Vermurungen und Hochwasser. Auch die Forstwirtschaft gerät zunehmend in Bedrängnis. Es gilt, Bewusstsein bei Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen zu bilden, wie man sich bestmöglich selbst vorbereiten und anpassen kann. Die drei obersteirischen Gemeinden Öblarn, Sölk und Michaelerberg-Pruggern haben sich als Klimawandel-Anpassungs-Modell-Region (kurz KLAR!) zum Ziel gesetzt, Bewusstseinsbildungsmaßnahmen für die Bevölkerung sowie regional maßgeschneiderte Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen umzusetzen. Seit 2017 wurden bereits 25 Projekte in den Schwerpunkten: Katastrophenschutz & Infrastruktur Forstwirtschaft & Biodiversität sowie Bildung umgesetzt. Auch das Konzept für das einzigartige Naturgefahren-Demonstrationsmodell „Wassererlebnis Öblarn“, welches 2023 mit dem Neptun Staatspreis für WasserBILDUNG ausgezeichnet wurde, wurde in der KLAR! entwickelt. Nun sind die drei KLAR! Gemeinden auch für den CliA Staatspreis für Klimawandelanpassung des Klimaschutzministeriums mit dem Wildbachpflege-Projekt „Unser Dörfl lassen wir nicht überfluten!“ nominiert.

Folge 85: Phosphor - und Schwefeldüngung am Bio-Grünland
Für die meisten Bio-Grünlandbetriebe in Mitteleuropa sind die hofeigenen Wirtschaftsdünger die zentrale Nährstoffquelle. In jüngster Zeit werden aber auch den Einzelnährstoffen Phosphor und Schwefel verstärkt Beachtung geschenkt. Phosphor geriet im Bio-Grünland in den Fokus, da Bodenanalysen auf den allermeisten Flächen einen Mangel attestieren. Dem Schwefel wird ebenfalls in der Bio-Landwirtschaft mehr Beachtung geschenkt da dieser Nährstoff wesentlich für die biologische Stickstofffixierung ist und somit zur Förderung der Futterleguminosen wie Rotklee und Luzerne beitragen kann. Welche Düngernotwendigkeiten sich für den Bio-Grünlandbetrieb ergeben erfahren sind im Podcast - hören Sie einfach rein:

Folge 84: Biologische Vielfalt und Landwirtschaft - gemeinsame Lösungen
Es gibt ja schon viele biodiversitätsfördernde Maßnahmen, die in der Landwirtschaft umgesetzt werden. Aktuell ist die EU-Renaturierungsverordnung im Gespräch. Wo stehen wir in Österreich und was kommt auf uns zu? Unter Biologischer Vielfalt verstehen wir eine große Anzahl von Lebensräumen und Ökosystemen, der darin lebenden Arten und die genetische Vielfältigkeit innerhalb der Arten. Der Zustand der Biologischen Vielfalt ist laut Dr. Helmut Gaugitsch vom Umweltbundesamt auf diesen drei Ebenen global, EU-weit und auch in Österreich schlecht, die Vielfalt von Lebensräumen und Arten ist rückläufig und ein Großteil der Schutzgüter ist in einem ungünstigen Erhaltungszustand. Die Ursachen dafür sind vielfältig und reichen von: intensiver Land- und Gewässernutzung über nicht nachhaltige Rohstoffnutzung und Flächeninanspruchnahme Klimawandel Schadstoffeinträge bis zu den standortfremden invasiven Arten. Die Landbewirtschaftung kann, abhängig von den unterschiedlichen Bewirtschaftungspraktiken, die Biologische Vielfalt positiv, neutral oder negativ beeinflussen. Unsere Landwirtschaft benötigt im Sinne der Nachhaltigkeit eine intakte Biologische Vielfalt als wichtige Lebens- und Produktionsgrundlage. Was kann jede/r Landwirt:in und auch jede/r einzelne in der Gesellschaft tun, damit der Zustand der Biologischen Vielfalt erhalten oder verbessert werden kann? Auch in der Umsetzung der EU-Renaturierungs-Verordnung, unter anderem durch die Erstellung nationaler Wiederherstellungspläne, werden gemeinsam und im Dialog ausgehandelte Maßnahmen sinnvoll und notwendig sein. Biologische Vielfalt und Landwirtschaft soll kein Widerspruch sein, sondern ein gemeinsames Anliegen für die Sicherung nachhaltiger Lebensmittelsysteme in der Umwelt. Falls Sie mehr darüber erfahren möchten, wie biologische Vielfalt und Landwirtschaft zusammenhängen und was zu ihrem Erhalt beigetragen werden kann, sollten Sie in diesen Podcast reinhören:

Folge 83: Fleischqualität beim Rind bewerten
In Österreich und der EU werden Rinder-Schlachtkörper nach Muskelfülle und Fettansatz beurteilt und bezahlt. Auch wenn vielen bekannt ist, dass Fleischqualität mehr ist, besteht hier noch Aufklärungsbedarf. Was ist Fleischqualität und was beeinflusst sie? Zartheit, Saftigkeit, Fleisch-und Fettfarbe, Fettgehalt, Fettsäuremuster sind wichtige innere Fleischqualitäts-Merkmale. Es genügt dafür aber nicht, die Schlachtkörperhälften nur visuell zu beurteilen, sondern es braucht Geräte und Analysen. Fleischqualität wird von vielen Faktoren beeinflusst. Diese betreffen das Tier selbst (Rinderkategorie, Rasse, Schlachtalter, Schlachtgewicht), die Fütterung (Futtermittelart, Kraftfuttermenge, Endmast vor Schlachtung), aber auch Vorgänge rund um die Schlachtung sowie die Zubereitung in der Küche. Außerhalb Europas werden bestimmte Fleischqualitäts-Merkmale seit Jahren routinemäßig am Schlachthof erhoben. Woran wird derzeit in Bezug auf Fleischqualität geforscht? In Europa werden Fleischqualitäts-Untersuchungen im Rahmen von Forschungsprojekten durchgeführt – so auch an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein. Immer wieder wird anregt, auch in Europa innere Fleischqualitätsmerkmale zusätzlich zur 5-teiligen EUROP-Fleisch-Fettklassen-Klassifizierung in die Schlachtkörper-Beurteilung aufzunehmen. Für eine breite Erfassung von Fleischqualitäts-Merkmalen im Feld braucht es allerdings Schnellmethoden und Geräte. Zusätzlich zu all diesen nachvollziehbaren Methoden gibt es die „emotionale“ Qualität, die Konsumenten wichtig ist. Sie umfasst Schlagworte wie Tierwohl, Haltung, Schlachtung aber auch Nachhaltigkeits- und Betriebsaspekte. Wenn Sie mehr über Rindfleischproduktion - von geeigneten Rinderrassen über Kreuzungen, Fütterung und weitere zu berücksichtigende Faktoren wissen möchten, sollten Sie reinhören:

Folge 82: Ackerflächen in die Beweidung integrieren
Die Verordnung für die Biologische Landwirtschaft sieht vor, dass auch Ackerflächen als Weideflächen für Raufutterverzehrer gelten. Da Bio-Betriebe im Rahmen der Fruchtfolge auf Feldfutter bzw. Kleegras angewiesen sind, lässt sich dieses Fruchtfolgeglied auch gut in die Beweidung integrieren. Welche Möglichkeiten und Strategien es gibt, Weidemischungen am Acker sinnvoll anzubauen und zu nutzen, erfahren Sie in diesem Podcast. Dr. Andreas Steinwidder hat Dr. Walter Starz von unserem Bio-Institut zu Gast und spricht viele Themenbereiche rund um die Möglichkeiten der Weidenutzung des Ackerlandes an - Einsaaten, Untersaaten, Pflegemaßnahmen und viele praktische Tipps sind nur Ausschnitte dieses Podcasts. Hören Sie selbst hinein: In dieser Podcast-Episode unterhält sich Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Dr. Walter Starz über das Integrieren von Ackerflächen in die Beweidung.

Folge 81: Solide Kennzahlen für solide Entscheidungen
Wie dir Kennzahlen dabei helfen, deinen Betrieb erfolgreich zu entwickeln Bäuerinnen und Bauern sind gefordert, unternehmerisch zu denken, stets am Laufenden zu sein, richtige Entscheidungen zu treffen sowie sich selbst und ihre Betriebe erfolgreich weiter zu entwickeln. Dabei ist die Wahl und Umsetzung einer zur eigenen Persönlichkeit, zum Betrieb und zum Umfeld passenden Strategie entscheidend für den Betriebserfolg. Seit fast dreißig Jahren unterstützt die Arbeitskreisberatung der Landwirtschaftskammern bzw. Ländlichen Fortbildungsinstitute mit Fachverbänden und Bundesanstalten die Bäuerinnen und Bauern mit Betriebszweigauswertungen (Ermittlung der Produktionskosten), Analyse und Vergleich von Erfolgskennzahlen offenem Erfahrungsaustausch und maßgeschneiderten Weiterbildungsangeboten dabei, gute Entscheidungen zu treffen. Denn Erfolg ist das Ergebnis richtiger Entscheidungen. Die Arbeitskreisberatung ist ein bundesweiter Bildungsschwerpunkt, der vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (BML) wesentlich unterstützt und durch das Ländliche Entwicklungsprogramm im höchstmöglichen Ausmaß gefördert wird. Dies umfasst neben der Unterstützung der Arbeitskreisaktivitäten die Bereitstellung von benutzerfreundlichen EDV-Anwendungen für die Betriebszweigauswertungen und von Bundesberichten mit den Gesamtergebnissen zur vertiefenden Analyse von Kennzahlen und zum Auffinden von Verbesserungspotenzialen. Wenn Sie überlegen, Ihren Betrieb neu auszurichten oder größere Investitionen vorhaben, sollten Sie reinhören: In dieser Podcast-Episode unterhält sich Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Dr. Marco Horn daüber, wie man seinen landwirtschaftlichen Betrieb am besten durchleuchten und auch zielführend weiterentwickeln kann.

Folge 80: Rückkehrer Wolf – Herausforderungen und Lösungen
Der Wolf erobert frühere Gebiete zurück und stellt Nutztierhalter und andere Landbewirtschafter vor große Herausforderungen. Was bedeutet die Anwesenheit der Wölfe für unsere Kulturlandschaft, wie kann man Nutztierrisse vermeiden und bleibt uns die Almwirtschaft erhalten? Dr. Johann Gasteiner hat Univ.Prof. Dr. Klaus Hackländer, Vorstand der Deutschen Wildtier Stiftung und Leiter des Instituts für Wildbiologie und Jagdwirtschaft der BOKU Wien zu Gast und spricht viele Themenbereiche rund um die Rückkehr der Wölfe an: rechtlicher Rahmen günstiger Erhaltungszustand Entnahmemöglichkeiten Herdenschutz Auswirkungen auf andere Wildarten und die Jagd. Wenn Sie sich für die Auswirkungen der Rückkehr der Wölfe auf die Nutztierhaltung, Jagd und Gesellschaft interessieren, dann hören Sie einfach rein

Folge 79: Herde, Hund und Hirt:in auf der Alm
Extensive Beweidung im alpinen Raum ist von hoher ökologischer, gesellschaftlicher und ökonomischer Bedeutung. Almen prägen unsere Kulturlandschaft. Dennoch steht die Almwirtschaft vor vielen Herausforderungen. Gelenkte Weideführung bietet eine Möglichkeit, um auf diese zu reagieren. Sie ermöglicht verbesserte Tierüberwachung, vereinfachten Zugriff auf Einzeltiere und eine optimalere Nutzung der Almweide. Außerdem ist sie die Basis für Herdenschutz. Qualifizierte Hirt:innen spielen dabei eine zentrale Rolle. Wozu gelenkte Weideführung wichtig ist, wie sie aussehen kann und welche Aufgaben Hirt:innen dabei haben, erfahren Sie in dieser Podcast-Episode. Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder und DIin Maria Naynar nehmen Sie mit auf die Almweiden – dorthin, wo die Luft etwas dünner wird.

Folge 78: Verein Landschaftspflegefonds - Kleinstbauern am Grundlsee erhalten
Crowdfunding für eine flächendeckende Landwirtschaft am Grundlsee In dieser Podcast-Episode dreht sich alles um die Gemeinde Grundlsee, wo es trotz sinkender Zahlen an viehhaltenden Betrieben 23 engagierte Bäuerinnen und Bauern gibt. Wir sprechen über den Verein „Landschaftspflegefonds“, der sich für nachhaltige Landwirtschaft einsetzt, und erfahren, wie Crowdfunding und der Einsatz des Bürgermeisters dazu beitragen. Der heutige Podcast-Gast ist Franz Steinegger, Bürgermeister der Gemeinde Grundlsee, Bauer und Initiator der genannten Initiative. Im Gespräch mit Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein schauen wir auf das Erreichte in der Gemeinde zurück, beleuchten wir die Zukunftsperspektiven von BM Steinegger für eine flächendeckende Landwirtschaft und sprechen wir darüber für welche Gemeinden die Aktivitäten am Grundlsee ein Beispiel sein könnte.

Folge 77: Bio-Rinderzucht: Individuelle Ansätze anstatt Einheitsbrei
In dieser Episode von „Agrar Science – Wissen kompakt“ spricht Dr. Andreas Steinwidder mit DIin Edina Scherzer über verschiedene Aspekte der Rinderzucht. Frau Scherzer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein und widmet sich aktuell unter anderem dem Thema Bio-Rinderzucht. Bewährte Herangehensweisen, die sich für Bio-Milchviehbetriebe im züchterischen Kontext ergeben, werden besprochen und genau erläutert. Aktuell läuft unter der Leitung von Bio-Austria ein Bildungsprojekt mit dem Titel „Bio-Rinderzucht“. Die Webinarreihe dazu startet am 31.Juli 2024. Begleitend dazu stehen Podcasts zur Verfügung, in denen Edina Scherzer mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten ins Gespräch kommt. Außerdem werden Workshops auf landwirtschaftlichen Betrieben angeboten. Für alle teilnehmenden Personen besteht die Möglichkeit, direkt im Stall verschiedene Ideen zur Rinderzucht und eigene Herangehensweisen zu diskutieren und gezielte Anpaarungsvorschläge zu erarbeiten. Wenn Sie sich für Rinderzucht interessieren, hören bzw. schauen Sie in diesen Beitrag an:

Folge 76: Bildungskonzept - Ökobilanzierung landwirtschaftlicher Betriebe
Betriebsmanagement-Tool "FarmLife" für die Ökobilanzierung landwirtschaftlicher Betriebe Die Forschungsgruppe „Ökoeffizienz landwirtschaftlicher Betriebe“ an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein hat, in Zusammenarbeit mit Agroscope, ein umfassendes Betriebsmanagement-Tool namens FarmLife für die österreichische Landwirtschaft entwickelt. Dieses Tool bewertet umweltrelevante Vorgänge auf landwirtschaftlichen Betrieben und bietet neben der ökologischen auch eine ökonomische Analyse der betrieblichen Managementbereiche. Die FarmLife Lernplattform und weitere Informationen finden Sie auf www.farmlife.at sowie auf https://raumberg-gumpenstein.at/farmlife und können diese Unterlagen kostenfrei verwenden. Zu den bewerteten Faktoren zählen neben vielen anderen der CO2-Fußabdruck, die Ökotoxizität, der Flächenbedarf, die Autarkie, die Produktionseffizienz in der Milchproduktion oder auch die Versorgungsleistung (Menschen pro ha) des Betriebes FarmLife wird bereits seit Jahren erfolgreich in der Praxis angewendet und zeigt beispielsweise, dass unsere Milchviehbetriebe in der Nachhaltigkeit Europameister sind. Für die junge Generation wurde zudem ein umfangreiches Bildungskonzept auf der Basis dieses Betriebsmanagement-Tools für den Einsatz an landwirtschaftlichen Schulen entwickelt. Regelmäßige Fortbildungsangebote für Lehrkräfte, betreut von Mag.a Elisabeth Finotti von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein, sichern die Integration dieses Wissens in den Unterricht. In der heutigen Podcast-Episode von Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Mag.a Elisabeth Finotti wird dieses Tool vorgestellt. Sie können die FarmLife Lernplattform kostenlos auf www.farmlife.at sowie auf https://raumberg-gumpenstein.at/farmlife nützen.

Folge 75 Bioökonomie - Chance für die Landwirtschaft?
ioökonomie ist ein im Einklang mit den Naturgesetzen agierendes Wirtschaftssystem, das auf zirkular geführten, nachhaltig erzeugten nachwachsenden Rohstoffen (Biomasse) aufbaut. Dr. Martin Greimel, Leiter des Zentrum für Bioökonomie an der BOKU, bespricht mit Dr. Andreas Steinwidder, wie ein Wechsel unseres derzeitigen linearen Wirtschaftssystem zur Bioökonomie gelingen kann. Auch die Thematik, was die Bioökonomie zur Lösung der wichtigsten gesellschaftlichen Herausforderungen wie etwa Klimawandel, Ressourcenknappheit und Biodiversitätsverlust beitragen kann, wird angesprochen. Hören Sie hinein und lassen Sie sich von der Klarheit der Bioökonomie überraschen!

Folge 74: Lebensmittel sind wertvoll
Die Lebenserhaltungskosten steigen stark. Die Zahl der Menschen, die bei steirischen Lebensmittelausgaben um Essen bitten, ebenfalls. „Wir sehen immer mehr Menschen, die durch die Teuerung und steigende Miet- und Energiekosten so unter Druck geraten, dass für den Lebensmitteleinkauf nichts mehr bleibt.", so Caritasdirektorin Nora Tödtling-Musenbichler. Wie Lebensmittelrettung in der Steiermark funktioniert und wie Sie auch selbst unterstützen können, erfahren Sie in diesem Podcast. Die Caritas mit insgesamt mehr als 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Steiermark und vielen freiwilligen Helfern hat es sich zum Ziel gesetzt, in Not geratene Menschen bei uns zu unterstützen. Dazu hat man sich unter anderem folgende Schienen zur Lebensmittelrettung überlegt: Waren mit beinahe abgelaufener Mindesthaltbarkeit, die nicht mehr verkauft werden können, zu sammeln und in Lebensmittelausgaben an Bedürftige abzugeben Lebensmittelspenden, um in Not geratene Menschen längerfristig verlässlich zu vorsorgen - z.B. die Aktion Herz, bei der sich in der Steiermark über 60 Sparmärkte beteiligen oder - Lebensmittelspenden von landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Überschüsse, Produkte mit "optischen Fehlern", ...) und diverse Sachspenden. Damit das System funktionieren kann, ist die Caritas immer wieder gefordert: Man muss zuerst zu den zu rettenden Lebensmitteln kommen, um sie dann wieder an Bedürftige verteilen zu können. Wie die Caritas die logistischen Herausforderungen der Lebensmittelrettung zu meistern versucht - vom Auffinden und Sammeln der Produkte, von der Lagerung bis hin zur Weitergabe - erfahren Sie in diesem Podcast mit Frau Mag. Eva Bakalli, Leiterin der Abteilung Region und Engagement der Caritas Steiermark. Sie erfahren auch, wie Sie sich selbst einbringen und bedürftige Menschen mit Zeit-, Sach- und Geldspenden unterstützen können. Hören Sie hinein und machen Sie sich ein Bild, wie Lebensmittelrettung und Unterstützung für bedürftige Menschen derzeit in der Steiermark funktioniert.

Folge 73: Rotklee und Luzerne in der Rinderhaltung
Klee und Luzerne sind wertvolle Pflanzen – sowohl auf Acker- als auch auf Grünlandbetrieben. Sie passen optimal in die Fruchtfolge und liefern ein hochwertiges Futter für Wiederkäuer! Worauf es in der Fütterung von Klee- und Luzerne ankommt, das erfahren Sie in der Podcast-Episode mit DI Karl Wurm. Er arbeitet seit Jahren erfolgreich als Berater an der Landwirtschaftskammer Steiermark und ist vielgebuchter Vortragender, Seminarleiter, Arbeitskreis- und Fütterungsberater, hat zahlreiche Publikationen und auch Bücher geschrieben. Hören Sie hinein und optimieren Sie damit die Fütterung ihrer Rinder!

Folge 72: Eine Welt ohne Nutztierhaltung?
Die Nutztierhaltung ist seit Jahrhunderten ein zentraler Bestandteil der Landwirtschaft und unserer Lebensmittelversorgung. Angesichts globaler Herausforderungen wie Klimawandel, Umweltverschmutzung und ethischen Bedenken fragen sich viele, ob wir auf Nutztierhaltung verzichten können bzw. wie diese nachhaltig und ethisch vertretbar gestaltet werden kann. In dieser "Agrar Science–Wissen kompakt" Podcast Episode der HBLFA Raumberg-Gumpenstein spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Univ. Prof. Dr. Werner Zollitsch, dem Leiter des Zentrums für Globalen Wandel & Nachhaltigkeit und stellvertretender Leiter des Zentrums für Agrarwissenschaften sowie des Instituts für Nutztierwissenschaften der BOKU über diese gestellten Fragen.

Folge 71: Eine standortangepasste Almbewirtschaftung liefert wertvolle Ökosystemleistungen
Almen haben in den österreichischen Bergregionen eine große Bedeutung. Etwa 300.000 ha Almflächen werden bewirtschaftet, was über 10 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche entspricht. Gut bewirtschaftete Almen liefern wertvolle Ökosystemleistungen. Welche diese sind und worauf es in der standortangepassten Almnutzung ankommt, erfahren sie in dieser „Agrar Science-Wissen kompakt“ Podcast-Episode.Im Gespräch mit Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder nimmt uns Dr. Andreas Bohner mit auf unsere Almen und erklärt wichtige Zusammenhänge. Hören Sie hinein und machen Sie mit uns einen gedanklichen Ausflug in die Bergregionen!

Folge 70: „Vision 2028+“ Zukunftsbild für Österreichs Landwirtschaft und ländlichen Raum
In dieser Podcast-Episode sprechen wir über die aktuellen Herausforderungen der österreichischen Landwirtschaft und des ländlichen Raums: volatile Märkte, sozioökonomische Veränderungen und der Klimawandel. Wir werfen mit DI Josef Plank, ein anerkannter Experte in der Land-, Forst- und Energiewirtschaft, einen Blick auf die Denkwerkstatt "Vision 2028+", die von Bundesminister Norbert Totschnig vor etwa acht Monaten ins Leben gerufen wurde. In einem umfassenden Strategieprozess wurde ein Zukunftsbild für die österreichische Landwirtschaft entwickelt, an dem alle gesellschaftlichen Gruppen beteiligt waren. Gemeinsam mit DI Johannes Fankhauser leitete DI Josef Plank über mehr als 8 Monate den sehr breit und offen aufgestellten Strategieprozess. Erfahren Sie im Gespräch von Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit DI Josef Plank mehr über den Ablauf dieses Prozesses und die erzielten Ergebnisse. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke und interessante Diskussionen!

Folge 69: Aktuelle Agrarpolitik - Ein Blick hinter die Kulissen
Nahezu wöchentlich werden auf nationaler und internationaler Ebene neue Gesetze, Verordnungen und Richtlinien herausgegeben, welche die Bäuerinnen und Bauern in ihrer täglichen Arbeit betreffen.In der Podcast-Episode erfahren sie welche Abläufe und Mechanismen es dabei zu beachten gibt und wie agrarpolitische Entscheidungen auf nationaler und internationaler Ebene zustande kommen. Dr. Andreas Steinwidder begrüßt dazu einen Gast – in zentraler politischer Funktion – DI Georg Strasser im Podcast-Studio an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein. DI Georg Strasser ist Obmann des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft im Parlament, Bauernbundpräsident, er führt einen Bauernhof und ist ausgebildeter Diplom-Ingenieur der Lebensmittel- und Biotechnologie. DI Strasser war auch Bürgermeister und in der Regionalentwicklung im Institut für Nachhaltigkeit Yspertal tätig.Gemeinsam wagen sie einen Blick hinter die Kulissen – ganz ohne Parteipolitik. Hören sie hinein!

Folge 68: Reisanbau in Österreich - geht das?
Wenn wir an den Reisanbau denken, dann haben wir die Bilder von gefluteten Feldern im Kopf und wir denken wohl auch an Regionen in Asien. Bei uns erfahren Sie heute, wie Reisanbau in Österreich möglich ist. Worauf beim Anbau zu achten ist und welche Tipps die Wissenschaft und Praxis dazu geben. Dr. Andreas Steinwidder spricht mit seinem Kollegen DI Daniel Lehner aus dem Bio-Institut der HBLFA Raumberg-Gumpenstein über die Ansprüche von Reis an den Boden, die Temperatur, die Fruchtfolge und die Bio-Düngung. Es werden die Unterschiede zwischen Trockenreisanbau und Nassreisanbau beleuchtet, wo man Saatgut bekommt, wie das Beikraut reguliert wird, worauf bei der Ernte und Verarbeitung Wert gelegt werden muss und wie die Vermarktung in Österreich läuft. Lassen sie sich überraschen!

Folge 67: Durch optimale Tierhaltung die Tiergesundheit fördern
Tiergerechten Haltungsbedingungen kommt eine Schlüsselrolle für Tiergesundheit, Tierwohl und Leistungsfähigkeit zu. Mit guter Tierbeobachtung und einer Optimierung des Haltungssystems und des Managements können wichtige Schritte in der Gesundheitsförderung gesetzt werden. Bei den Haupterkrankungen in der Milchviehhaltung – Mastitiden, Fruchtbarkeitsstörungen, Lahmheiten und Stoffwechselerkrankungen – handelt es sich um sogenannte „Faktorenerkrankungen“. Neben den jeweiligen Krankheitserregern nehmen Stallbau, Tierbetreuung und Management entscheidenden Einfluss auf das Krankheitsgeschehen. Dabei müssen sich die Funktionsbereiche im Stallsystem an den natürlichen Verhaltensweisen der Tiere orientieren. Die Liegebox stellt das zentrale Element im Liegeboxenlaufstall dar. Um ihre Funktion richtig erfüllen zu können, muss sie einigen grundlegenden Anforderungen genügen. Neben einer komfortablen Boxenlänge und –breite ist bei der Gestaltung von Liegeboxen die Lage der Steuerelemente aber auch die Wahl des richtigen Liegeboxenbodens von großer Bedeutung. Rinder benötigen Tränken mit einer ausreichend großen, freien Wasseroberfläche und ausreichend schnellem Wassernachlauf. Weidehaltung wirkt sich bei optimaler Weideführung positiv auf die Tiergesundheit aus und stärkt die Widerstandskräfte der Tiere. Richtige Stallgestaltung und umsichtige Tierbetreuung haben ein enormes Potential für Tierwohl und Tiergesundheit. Um dieses Potenzial voll ausschöpfen zu können, muss man die wesentlichen Stellschrauben kennen und Maßnahmen gezielt setzen. Zur Ermittlung des Tierwohl-Potenzials wurden an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein ein Online-Tool entwickelt – der FarmLife-Welfare-Index. Unter www.farmlife.at kann jede Bäuerin und jeder Bauer ihr/sein Rinderhaltungssystem beurteilen und Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten erkennen.

Folge 66: Im Bio-Ackerbau dem Klimawandel aktiv entgegengehen
Die Herausforderungen im Bio-Ackerbau haben sich verändert. Forschung, beispielsweise zum Humusaufbau, die auch dem Bio-Ackerbau hilft, wird mehr. Mechanische Beikrautregulierung findet ein breiteres Anwendungsspektrum, womit die Geräteentwicklung enorm an Dynamik gewinnt. Am Anfang stand schon der gesunde Boden im Zentrum des Bio-Landbaus und spezielle des Bio-Ackerbaus. Veränderungen bei den Wachstumsfaktoren bedingt durch den Klimawandel, aber vor allem Schwankungen im Witterungsverlauf zwischen den Jahren und auch innerhalb eines Jahres machen geplantes Handeln zunehmend unmöglich. Trockenheit ist beispielsweise jährlich ein Thema geworden – der Zeitpunkt ist aber nicht vorhersehbar.Dennoch braucht es bezüglich Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit eine klare Strategie, viele betriebsspezifische Überlegungen und auch Input, der zum Teil zu Lasten von kurzfristigen Erträgen geht. Eine einzelne Maßnahme kann ein Teil der Lösung auf einem Betrieb sein. Allein die Bodenbearbeitung zu reduzieren oder gänzlich darauf zu verzichten ist nicht falsch. Aber Bodenfruchtbarkeit wird durch Bodenbiologie, Bodenchemie und Bodenphysik beeinflusst. Die Vielfalt in den Maßnahmen, die Zusammenschau von Bodenfruchtbarkeit und Wirtschaftlichkeit, kurz der Blick aufs Ganze hilft uns, den Herausforderungen des Klimawandels aktiv zu begegnen.

Folge 65: Pferdeheu - was ist zu beachten?
Die etwa 130.000 österreichischen Pferde benötigen jährlich etwa 200.000 t Heu. Das sind rund 20 % der gesamten Heuproduktion Österreichs. Aufgrund der besonderen Empfindlichkeit des Verdauungs- und Atmungstraktes des Pferdes hat der Hygienestatus von Heu als wichtigste Grundfutterkomponente große Bedeutung. Deshalb organisierten die HBLFA Raumberg-Gumpenstein und das Futtermittellabor Rosenau das 2. Österreichische Pferdeheuprojekt, um insgesamt 718 Futteruntersuchungen von Pferdeheu seit 2019 auszuwerten. Gegenüber vor 10 Jahren zeigten die aktuellen Daten einen positiven Trend hin zur besseren Heuqualität auf. Dennoch verpilzten immer noch etwa ein Drittel der Pferdeheupartien mit verderbanzeigenden Schimmelpilzen, speziell die zu fest verdichteten Heuballen am Lager. Außerdem wurden etwa 80 % der untersuchten Partien zu spät geerntet. Hier lagen die Rohfasergehalte über 340 g/kg TM vor, der Nährwert dieses Pferdeheus ist nur mehr sehr gering.

Folge 64: Erfahrungen zum emissionsarmen Tierwohlstall für Schweine
Seit 1995 bildet die Direktvermarktung den Schwerpunkt der Arbeiten am Betrieb von Josef und Christina Neuhold in St. Veit in der Südsteiermark. Im Jahr 2022 wurde ein neuer und mit dem steirischen Tierschutzpreis ausgezeichneter Schweinemaststall eröffnet. In einem Podcast-Gespräch zwischen Dr. Andreas Steinwidder und Josef Neuhold wird die Entstehungsgeschichte dieses innovativen Stallbauprojektes beleuchtet. Dabei werden verschiedene Tierwohl-Stallbaubereiche wie Ruhe-, Fress-, Auslauf- und Ausscheidebereiche sowie das innovative Lüftungs-, Fütterungs-, Einstreu- und Düngersystem diskutiert. Forschungsergebnisse belegen, dass durch diese Maßnahmen die Emissionen reduziert und das Tierwohl gesteigert werden konnten. Die Wirtschaftlichkeit des Tierwohlstalls erfordert jedoch eine Abgeltung der höheren Baukosten und des zusätzlichen Arbeitszeitbedarfs pro Mastschwein durch höhere Produkterlöse. In der Direktvermarktung werden die Vorteile für Tier und Umwelt kommuniziert, während kontinuierlich an Innovationen gearbeitet wird, um den Qualitätsunterschied auch geschmacklich - am Gaumen - zu verdeutlichen. Durch den Einsatz alternativer Rassen für mehr Geschmack und bessere Fleischqualität, Kräuterpellets in der Fütterung und den Vertrieb über verschiedene Kanäle wie Verkaufsläden, Bauernmärkte, regionale Regale, Hauszusteller und die Spitzengastronomie, erzielt der Betrieb Erfolge in der Direktvermarktung und bei Tierwohl-Handelsmarken. In diesem Podcast erfahren Sie die praxisrelevanten Ergebnisse in Kurzform - Hören oder schauen Sie einfach rein:

Folge 63: Die Rolle der Landwirtschaft in der Energiewende
Energiefitte Bauernhöfe kennen ihren Energieverbrauch und setzen aktiv Maßnahmen, um trotz steigender Energiekosten wettbewerbsfähig zu bleiben. Die heimischen Bäuerinnen und Bauern sind direkt vom Klimawandel betroffen und damit ein wichtiger Faktor für die anstehenden Veränderungen. Der Land- und Forstwirtschaft ist es als einzigem produzierenden Sektor gelungen, durch umfassende Reduktionsmaßnahmen die Emissionen gegenüber 1990 um rund 15 Prozent zu senken. Darüber hinaus ist unser Sektor in der Lage, große Mengen an Kohlenstoff in Böden und in der Biomasse zu speichern. Die nachhaltige Kreislaufwirtschaft trägt dazu bei, die weitere Anreicherung von schädlichem fossilen CO2 in der Atmosphäre einzudämmen. Der Einsatz innovativer Energietechnologien stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und schafft moderne land- und forstwirtschaftliche Betriebe für nachkommende Generationen. Die steirischen Bäuerinnen und Bauern bewirtschaften ihre Betriebe energieeffizient, möglichst unabhängig von fossilen Energieträgern und erhalten dadurch eine lebenswerte Umwelt. Durch seine langjährigen Kontakte mit der land- und forstwirtschaftlichen Praxis beobachtet Dr. Christian Metschina den Weg zum energieeffizienten Betrieb und kennt die Hürden und Chancen. Im Gespräch mit Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder spricht er über seine Erfahrungen mit der erneuerbaren Energie. Auch über die unterschiedlichen Möglichkeiten der jeweiligen Betriebe, den sinnvollen Einstieg in die nachhaltige Nutzung bis hin zur betriebswirtschaftlichen Betrachtung gehen die beiden in diesem Podcast ein. Hören Sie rein:

Folge 62: Energierückgewinnung durch Tauschwäscher im Stall
In Kooperation mit der Universität Bonn war die HBLFA Raumberg-Gumpenstein Teil des Forschungsprojektes „Nutzung der regenerativen Energiequelle Abluftreinigungsanlage für das Kühlen und Heizen von Tierställen“ (EnergARA). In drei Fallstudien wurden unterschiedliche Technologien zur Wärmerückgewinnung in Kombination mit einer Abluftreinigungsanlage untersucht. Ziel des Projektes war es, durch Langzeitmessungen in der Praxis die Leistungspotentiale von drei unterschiedlichen Systemen objektiv und wissenschaftlich zu erfassen und zu evaluieren, wobei hier vor allem die ökologische und ökonomische Bewertung im Vordergrund standen. In Raumberg-Gumpenstein wurde für die Fallstudie die in den Mastschweineforschungsstall integrierte Abluftreinigungsanlage der Firma Schönhammer Wärmetauscher und Lüftungstechnik GmbH zu einem Tauschwäscher umgebaut. In dieser Podcast-Episode unterhält sich Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Ing. Irene Mösenbacher-Molterer und dem Geschäftsführer von Schönhammer Wärmetauscher Lüftungstechnik, Herrn Martin Schönhammer über die Verbesserung des Stallklimas mit Tauschwäschern und die weiteren Vorteile (Luftvorwärmung / -kühlung, Energieeffizienz) dieses Systems - hören Sie rein:

Folge 1 Klimawandel - Was kommt auf unsere Landwirtschaft zu
Das Weltklima ändert sich markant. Besonders die bäuerlichen Betriebe sind durch die zunehmenden Wetterkapriolen massiv belastet. Ursache dafür sind im Wesentlichen die steigenden Treibhausgasemissionen, welche die globale Mitteltemperatur in die Höhe treiben. Dies führt einerseits zu immer öfter auftretenden Hitze- und Dürreperioden, extremen Stürmen und Starkniederschlägen und andererseits zu einer allmählichen Veränderung ganzer Ökosysteme. Was konkret auf die Österreichische Landwirtschaft zukommt haben wir Dr. Andreas Schaumberger gefragt. Andreas Schaumberger beschäftigt sich an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein mit der Klimafolgenforschung und hat auch an bedeutenden Klimamodellen mitgearbeitet. Er betreibt als Leiter der Abteilung für Grünland auch Langzeit-Forschungsprojekte und nutzt dabei viele neue Technologien.