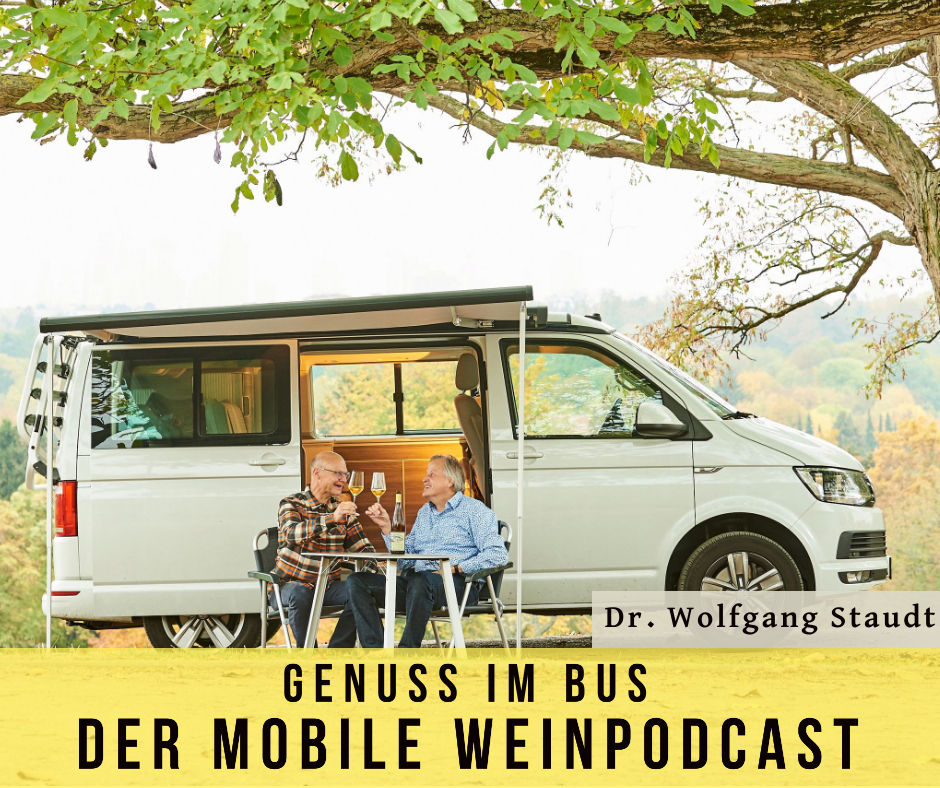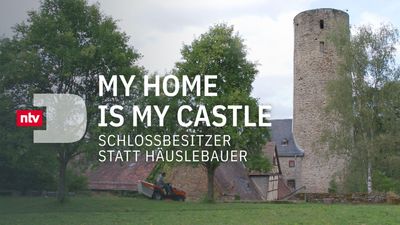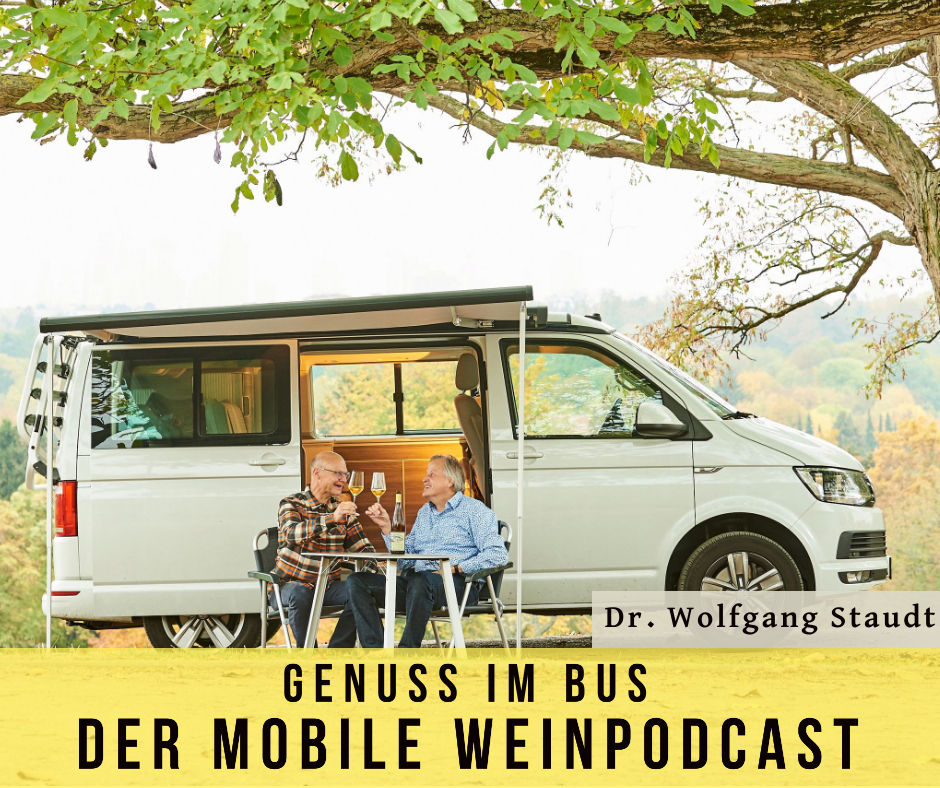
"Genuss im Bus ist der mobile Weinpodcast von Wolfgang Staudt. Wolfgang trifft sich mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie er selbst. In seinen Gesprächen versucht er herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben.
Alle Folgen
Trinkt Porphyr. Finn Steitz über Riesling vom Vulkanboden und kühle Präzision
Finn Steitz ist 21, studiert in Geisenheim – und arbeitet gleichzeitig längst im Maschinenraum des Familienweinguts in Stein-Bockenheim (Rheinhessische Schweiz): Weinberg, Keller, Marketing. Sein Antrieb: Perfektion – das Terroir so pur wie möglich in die Flasche zu bringen, ohne Schönungen, ohne „Make-up“. Wir sprechen über eine Region, die historisch oft als „zu kühl“ galt – und im Klimawandel genau daraus eine Stärke macht. Und wir gehen tief in die Geologie: Porphyr und Melaphyr, dazu das Zusammenspiel aus Mineralität und Säure-Länge, das Finn als Kern seiner Stilistik beschreibt. Dann wird’s konkret: regenerative Bewirtschaftung mit durchgehend begrünten Zeilen, Walzen statt Mulchen – und die Frage, wie sich Bodenarbeit in Vitalität, Wasserhaushalt und Traubenqualität übersetzt. Im Keller: Handlese, Sortierung, Korbpresse, Spontangärung mit Trub, lange Vollhefe, minimaler Schwefel und bei einzelnen Weinen sogar unfiltrierte Füllung. Und: Warum „Low Intervention“ in Wahrheit oft kontrolliertes Nichtstun ist.

Fahrgast-Fragen No. 01: Aroma ist die Überschrift, Textur der Inhalt
Das ist die erste Episode von Genuss im Bus im neuen Jahr – und zugleich die Premiere eines neuen Formats: Fahrgast-Fragen. In diesen Solo-Folgen greife ich Fragen auf, die mir immer wieder begegnen, und beantworte sie so, dass du sie direkt im Glas nachvollziehen kannst – ohne Buzzwords, mit Sensorik. In dieser Folge geht’s um fünf Themen, die gerade extrem prägend sind: Warum Frische nicht nur Säure ist (Energie aus Säure, feiner Phenolik und „salziger“ Kontur). Warum Textur wichtiger wird als Aroma – und wie Säure die Textur „strafft“, damit sie nicht pampig wirkt. Warum Holz wieder da ist, aber anders: weniger Aromaholz, mehr Strukturholz – das Fass als feine „Lunge“ des Weins. Reduktion: Stilmittel oder Problem? Mit Luft-Test, Gaumen-Test – und einem optionalen Sommelier-Hack mit Kupfer. Luxus im Wein 2026: Trinkfluss. Und warum moderatere Alkoholgrade oft (nicht immer) der schnellste Regal-Kompass sind. Und zum Schluss die wichtigste Frage für deinen Alltag: Nicht „Wie viele Punkte hat der?“, sondern „Wie fühlt sich meine Zunge nach dem zweiten Schluck an?“ Wenn du Lust hast: Schick mir Feedback und deine Fragen für die nächste Runde Fahrgast-Fragen.

„Wann’s Licht brennt, isch uff“ – Wie die Kochs die Südpfalz zum Burgunder-Terrain formen
Die Südpfalz hat sich in den vergangenen Jahren leise, aber grundlegend verändert. Wo früher vor allem Menge und faire Preise dominierten, entstehen heute einige der präzisesten Burgunder Deutschlands. Das Weingut Bernhard Koch in Hainfeld gehört zu den Betrieben, die diesen Wandel geprägt haben. Rund 50 Hektar Rebfläche, ein klarer Fokus auf Pinot Noir, Chardonnay und hochwertigen Winzersekt – und zugleich eine Haltung, die sich in einem einfachen Satz verdichtet: „Wann’s Licht brennt, isch uff.“ In dieser Episode von Genuss im Bus spreche ich mit Alexander Koch, Kellermeister und verantwortlich für die stilistische Handschrift der Weine, sowie mit Konstantin Koch, zuständig für Marke, Vertrieb und Positionierung. Bernhard Koch kann krankheitsbedingt leider nicht selbst dabei sein, ist im Gespräch aber in Geschichte und Haltung präsent. Wir sprechen über die Südpfalz als Burgunder-Herkunft, über Kalkböden, Klimawandel und Lesetiming, über Chardonnay als Schlüsselwein, über Pinot Noir zwischen Struktur und Eleganz – und über die Frage, wie man bei dieser Betriebsgröße präzise, handwerklich und klar im Stil bleibt. Verkostet werden drei Weine des Hauses: Brut Reserve, Chardonnay Grande Réserve 2021 und Pinot Noir Réserve 2021. Ein Gespräch über Herkunft, Stilfindung, Teamarbeit – und über eine Familienhandschrift, die sich weiter schärft, ohne ihre Wurzeln zu verlieren.

Kalk und Klarheit: Wie die Keßlers den Münzberg zur Burgunder-Ikone formen
In dieser Episode von Genuss im Bus spreche ich mit Gunter und Friedrich Keßler vom Weingut Münzberg. Wir werfen einen Blick zurück auf die Entwicklung eines Familienbetriebs, der sich in den letzten Jahrzehnten zu einer festen Größe der pfälzischen Burgunderszene entwickelt hat – geprägt von Mut, Klarheit und konsequenter Qualitätsarbeit. Gunter erzählt von der Transformation der 80er, 90er und 2000er Jahre: vom Abschied alter Arbeitsweisen, den prägenden Jahren der „Fünf Winzer – Fünf Freunde“ und der Suche nach einer eigenen, kalkgeprägten Stilistik. Friedrich gibt Einblicke in die aktuelle Handschrift des Weinguts: frühere Lese, präziseres Holz, weniger Eingriffe, mehr Terroir im Glas. Gemeinsam sprechen wir über die Herausforderungen des heutigen Marktes, über Haltung und Handwerk – und darüber, wie sich ein Weingut über Generationen hinweg treu bleibt und sich zugleich neu erfindet. Im Tasting probieren wir zwei Schlüsselweine des Hauses: den Chardonnay aus dem Godramsteiner Stahlbühl und das Weißburgunder GG Schlangenpfiff aus dem Münzberg – zwei Weine, die eindrucksvoll zeigen, was „Kalk und Klarheit“ in der Pfalz bedeuten.

Zwischen Feuer und Zeit“ – Johannes Freiherr von Gleichenstein über Wein vom Kaiserstuhl
Seit fast vierhundert Jahren lebt die Familie Freiherr von Gleichenstein Wein am Kaiserstuhl – einer Landschaft, die vom Feuer des Vulkanbodens und der Geduld der Zeit geprägt ist. Johannes führt das Weingut heute in elfter Generation. Ruhig, reflektiert und mit klarer Burgunder-Stilistik erzählt er, wie man Verantwortung weiterträgt, ohne sich im Gewicht der Geschichte zu verlieren. Im Gespräch geht es um Herkunft und Wandel, um Familie, Vertrauen und die Kunst, Wein reifen zu lassen – im Keller wie im Leben. Gemeinsam verkosten wir drei Weine, die all das ins Glas bringen: – Weißburgunder Winklerberg 2019 – Grauburgunder Henkenberg 2019 – Spätburgunder Baron Philipp 2018 vom Eichberg. Ein leises, intensives Gespräch über Wein, der aus Feuer kommt – und aus Zeit entsteht.

„Es geht nicht ums Ego“ – wie zwei Generationen im Weingut Walter Spitzenwein machen
Bürgstadt am Main – ein kleiner Ort mit großen Weinen. Im Weingut Walter arbeiten Vater Christoph und Sohn Felix Seite an Seite: zwischen Erfahrung und Aufbruch, zwischen Buntsandstein und Zukunft. Ein Gespräch über Bio, Freiräume und den Weg in die „Champions League“ des Spätburgunders.

Heimat im Wandel – Martin Schmidt über den Mut, Wein neu zu denken
Martin Schmidt steht für einen neuen, geerdeten Winzertyp: fest verwurzelt am Kaiserstuhl und zugleich offen für Wandel. Seit er 2008 das traditionsreiche Weingut Kiefer übernommen hat, führt er es gemeinsam mit seiner Frau Helen Schritt für Schritt in die Zukunft – ohne die Wurzeln zu verlieren. Gleichzeitig bewirtschaftet er das elterliche Weingut Schmidt, eines der frühen Bio-Weingüter der Region. Im Gespräch erzählt er von seiner Heimat, von 170 Vertragswinzern, die mit ihm gemeinsam Verantwortung tragen, und von PIWI-Reben, die für ihn weit mehr sind als Technik: ein Symbol für Nachhaltigkeit und Gemeinschaft. Ein ruhiges, tiefes Gespräch über Herkunft, Aufbruch und die Kunst, Wein neu zu denken.

Sebastian Schmidt – Handwerk, Heimat und die Leichtigkeit des Weinmachens
Am Bayerischen Bodensee, dort, wo Alpenlicht und Seeluft sich begegnen, hat Sebastian Schmidt ein Weingut geschaffen, das in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich ist: Ein Holzbau auf einer alten Gletschermoräne, mit Blick über den See und einer Philosophie, die gleichermaßen von Tradition, Präzision und Gelassenheit lebt. In dieser Folge erzählt Sebastian, wie er nach Stationen in Wien, Wachau und Burgund zurück in die Heimat fand – und dort begann, Wein neu zu denken. Wir sprechen über handwerkliche Präzision, über das Vertrauen in natürliche Prozesse, über die Verwandlung des Müller-Thurgau zu einem eigenständigen Charakterwein – und über die Kraft, die entsteht, wenn man seiner Intuition mehr Raum gibt als den Laborwerten. Ein Gespräch über Herkunft, Haltung und das Glück, angekommen zu sein.

Saar 2025 – Ein Weinjahr voller Zuversicht und Überraschungen
Mitten in der Lese nimmt sich Anna Reimann vom Weingut Cantzheim ein paar Minuten Zeit, um im Gespräch mit Wolfgang Staudt einen ersten Eindruck vom Jahrgang 2025 an der Saar zu geben. Nach dem Frostjahr 2024 startete die Saison mit Zuversicht und üppigem Fruchtansatz, begleitet von einer vitalen, grünen Vegetation. Doch kurz vor der Ernte kam der Regen – und damit der Druck, schnell und präzise zu lesen. Anna erzählt, wie sie und ihr Team reagiert haben, warum sie den Jahrgang trotz aller Herausforderungen als „saftig, klar und typisch Saar“ beschreibt – und wieso 2025 für sie ein richtig guter Jahrgang mit großer Bandbreite wird: vom Cremant-Grundwein bis zur Auslese. Ein spontanes, ehrliches Erntegespräch über Entscheidungen unter Zeitdruck, Fingerspitzengefühl im Weinberg und das Glück, endlich wieder volle Keller zu haben.

Exzellenter Wein-Jahrgang in Aussicht: Erste Eindrücke von der Lese 2025 mit Michel Andres
In dieser kurzen Sonderausgabe von Genuss im Bus bekommst du aktuelle Stimmen direkt aus den Weinbergen. Ich spreche mit dem Pfälzer Winzer Michel Andres aus Ruppertsberg, der seine Lese bereits fast abgeschlossen hat. Sein erstes Fazit: Der Jahrgang 2025 verspricht exzellente Qualitäten, auch wenn die Mengen unterdurchschnittlich ausfallen werden. Da die nächste geplante Episode leider wegen Hagelschäden beim Winzer entfällt und ich anschließend auf Reisen bin, hörst du die nächste reguläre Folge von Genuss im Bus erst wieder am 10. Oktober. Bitte gerne vormerken!

Simon Hornstein: Herkunft entdecken, Terroir prägen – Pinot und Chardonnay vom bayerischen Bodensee
In dieser Episode von Genuss im Bus spreche ich mit Simon Hornstein vom Seehaldenhof in Nonnenhorn. Wir blicken auf seinen Werdegang – vom Staatsweingut Meersburg über Geisenheim und die Steiermark bis zum Praktikum bei Fürst – und sprechen über seine heutige Arbeit mit Chardonnay und Pinot Noir. Ein zentrales Thema ist die geschützte Ursprungsbezeichnung (g.U.) für den bayerischen Bodensee, die Simon gemeinsam mit seinen Kolleg:innen vorantreibt. Es geht um Gemeinschaft, Visionen und die Suche nach einer regionalen Identität, die erst am Anfang steht. Außerdem verkosten wir aktuelle Weine – darunter den Nonnenhorner Ortswein Spätburgunder 2022 und einen Chardonnay, die beide zeigen, welches Potenzial die Region hat.

Claudius Haug – Bio, PIWI und Bodensee-Charme
Der Bayerische Bodensee ist ein Gebiet der Superlative: Hier liegen die südlichsten, höchstgelegenen und regenreichsten Weinberge Deutschlands. Claudius Haug bewirtschaftet in dieser einzigartigen Landschaft einen Familienbetrieb, der Wein- und Obstanbau vereint, seit vielen Jahren ökologisch arbeitet und einen hohen Anteil pilzwiderstandsfähiger Rebsorten pflegt. Wir sprechen über die besonderen klimatischen Bedingungen zwischen See und Alpen, die Chancen und Herausforderungen des Bio-Anbaus in einer Region mit hohen Niederschlägen, die Dynamik einer engagierten Winzergemeinschaft – und verkosten zwei Weine, die den Charakter des Bodensees ins Glas bringen.

Bio reicht nicht – was Gerald Baldauf wirklich antreibt
Gerald Baldauf führt einen der größten Biobetriebe Frankens – und will trotzdem mehr. Mehr Präzision. Mehr Tiefe. Mehr Profil. In dieser Folge geht es um Bio als Haltung – und um das, was darüber hinaus zählt: Cool-Climate-Lagen im Seitental der Saale, geringe Erträge, starke Familienstrukturen und ein Qualitätsanspruch, der nicht beim EU-Blatt aufhört. Gerald spricht offen über die Gratwanderung, wenn nicht jeder Wein biozertifiziert ist, über maschinelle Lese und Moral, über Frostängste, PIWIs, Skaleneffekte, die Linie CLEES und die Frage, wie man als großer Betrieb glaubwürdig bleibt. Ein Gespräch über Herkunft, Haltung und die tägliche Herausforderung, aus Überzeugung Winzer zu sein – in einer Zeit, in der das alles andere als selbstverständlich ist. ➤ Mehr über meine aktuellen Webinare und Masterclasses: www.wolfgangstaudt.com www.dr-staudt-weinerlebnisse.de

Robert Haller – Ein Leben für den Wein
Robert Haller über Wandel, Verantwortung und die leise Kraft des Loslassens. Er hat den Silvaner mitgeprägt, das Bürgerspital Würzburg weiterentwickelt und drei Jahrzehnte lang Verantwortung getragen – für Menschen, Weinberge, Entscheidungen. Nun steht Robert Haller kurz vor dem Ruhestand. In diesem Gespräch blickt er zurück – auf einen ungewöhnlichen Lebensweg, der bei IBM begann und über Geisenheim, die Toskana und Fürst Löwenstein schließlich ins Herz des fränkischen Weinbaus führte. Wir sprechen über Herkunft und Haltung, über Teamführung, Stilistik, VDP-Klassifikation, Klimawandel – und über die Frage, was bleibt, wenn man loslässt. Ein stilles, tiefes Gespräch mit einem Menschen, der nicht laut führen musste, um viel zu bewegen.

Philipp Wedekind: Haltung, Hoffnung, PIWI – ein Weingut am Wendepunkt
In dieser Episode treffe ich Philipp Wedekind, Biowinzer aus Nierstein – einen, der nicht mit der Mode geht, sondern seinen eigenen Weg verfolgt: kompromisslos ökologisch, mit PIWI-Rebsorten, Pflanzenkohle im Boden und viel Gespür für das Zusammenspiel von Mensch, Rebe und Natur. Wir sprechen über seine Lieblingsweine – Cabernet Blanc, Muscaris und Cabernet Jura – über seine Philosophie im Weinberg und im Keller, über Netzwerke wie Ecovin oder die Zukunftswinzer, aber auch über die Schattenseite dieses Berufs: die wirtschaftliche Enge, den Druck durch Banken und die Frage, wie man in schwierigen Zeiten Haltung bewahren kann. Ein Gespräch über Hoffnung, Verantwortung und darüber, wie viel Persönlichkeit im Glas stecken kann – gerade wenn der Weg steinig wird.

Mit sechs Fässern und einer alten Korbpresse – Cris & Pia von KarSey Winemaking
Cris & Pia von KarSey Winemaking haben sich ihren Traum erfüllt: ein eigenes Weingut, ganz ohne geerbte Flächen – aber mit viel Mut, Hingabe und einem tiefen Verständnis für die Natur. Mitten im Steigerwald, in einem alten Bauernhof, der zum Weingut wurde, entstehen heute handwerkliche Naturweine mit Ecken, Kanten – und Haltung. Im Gespräch erzählen die beiden von ihrem Weg: – vom Geisenheim-Studium zur Hofrenovierung – von Biodiversität, regenerativer Bodenarbeit und Low Intervention im Keller – von Zeit als Stilmittel und dem Vertrauen in den natürlichen Verlauf Wir sprechen über Familiengründung und Betriebsgründung zugleich, über Feedback als Motor, über die GbR-Zeit als Lernprozess – und über die Vision, Wein wieder als echtes Naturprodukt zu begreifen. Eine Folge über Neuanfänge, Partnerschaft, Erdverbundenheit – und über zwei Menschen, die etwas wagen.

Vom ältesten Weingut der Welt in die Zukunft des Weinbaus – Jan Matthias Klein und der Staffelter Hof
Der Staffelter Hof in Kröv ist das älteste Weingut der Welt – gegründet im Jahr 862. Doch wer glaubt, hier sei die Zeit stehen geblieben, irrt gewaltig. Denn Jan Matthias Klein, der heutige Kopf des Betriebs, denkt Weinbau radikal neu: Biodynamie, PiWis, Permakultur, internationale Gastwinzer:innen, kreative Etiketten, CO₂-Neutralität – und mittendrin ein lebendiger Ort der Gemeinschaft, der sich ständig weiterentwickelt. In dieser Episode spreche ich mit Jan über seine Vision vom Wein der Zukunft, seine Mentoren, seine Haltung zur Naturweinszene – und über Fehler, Glücksmomente und die Magie von Musik im Weinberg. Eine Episode für alle, die Weinbau als Kultur und Bewegung verstehen – und sich für neue Wege begeistern.

Philipp Emmich – Ein junger Winzer auf dem Weg zur eigenen Handschrift
Philipp Emmich ist 27 Jahre alt, hat bei Wagner-Stempel gelernt und in Geisenheim studiert. Heute bringt er als junger Winzer frischen Wind ins traditionsreiche Familienweingut Neef-Emmich in Rheinhessen. In dieser Episode geht es um das Spannungsfeld zwischen Vater und Sohn, um Chardonnay-Pläne, neue Etiketten, Spontangärung – und um Rieslinge aus dem Höllenbrand und Hundskopf, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Philipp spricht offen über Verantwortung, Veränderung und darüber, wie man seinen eigenen Stil findet, ohne die Wurzeln zu verlieren.

Pionier mit 24 – Benedikt Schnürr über PiWis, Vertrauen und Verantwortung
Benedikt Schnürr ist 24 Jahre alt – und längst eine tragende Säule im Weingut Wohlgemuth-Schnürr in Rheinhessen. Er hat in Geisenheim Weinbau und Önologie studiert, bei Wagner-Stempel und Paul Fürst gelernt, Auslandserfahrung gesammelt – und prägt heute den Familienbetrieb entscheidend mit: 60 % der Rebfläche sind mit PiWis bepflanzt, seine eigene Weinlinie ist spontanvergoren und länger ausgebaut, und 90 % der Weine gehen direkt an Endverbraucher – oft sogar persönlich ausgeliefert. Benedikt denkt mutig voraus, nutzt seine Freiräume, ohne die Bodenhaftung zu verlieren. Im Gespräch geht es um die Zukunftsfähigkeit von Rebsorten wie Calardis Blanc, Souvignier Gris oder Sauvignac, um Vertrauen innerhalb der Familie – und um eine Eventkultur, die das Weingut zu einem echten Begegnungsort macht. 👉 Diese Folge ist Teil der Serie „Zukunftswinzer“, in der junge Winzer:innen zu Wort kommen, die heute schon gestalten, was morgen wichtig ist.

Ein kurzer Zwischenruf – und ein Blick hinter die Kulissen
Heute gibt’s ausnahmsweise kein Interview – der geplante Termin mit einem Winzer musste krankheitsbedingt verschoben werden. Stattdessen nutze ich die Gelegenheit für ein kurzes Update aus dem Maschinenraum von Genuss im Bus – und um einfach mal Danke zu sagen: Für die vielen ermutigenden Rückmeldungen zu den letzten Episoden und für eure Treue über all die Jahre. Ich erzähle, was aktuell ansteht: von den nächsten Podcast-Folgen über neue Live-Webinare bis hin zur nächsten Runde der Weinkenner Masterclass. Und ich lade dich ein, bei Interesse einfach mal auf meiner Website vorbeizuschauen – oder dir direkt ein unverbindliches Infogespräch zu buchen. Nächste Woche geht’s wie gewohnt weiter – dann mit Benedikt Schnürr vom Weingut Wohlgemuth-Schnürr in Rheinhessen, dem Betrieb mit dem höchsten PiWi-Anteil in Deutschland. Ein Gespräch darüber, wie mutige Entscheidungen den Weg in eine nachhaltigere Zukunft ebnen können.

Zukunft mit Substanz – Wie Tobias Hemberger Nachhaltigkeit lebt
Tobias Hemberger gehört zu einer neuen Generation von Winzern, die Nachhaltigkeit nicht nur als Etikett verstehen, sondern als Haltung leben. In Episode 202 unserer Serie „Zukunftswinzer“ spricht er über neue Rebsorten, Energieautarkie, Regenwassernutzung – und darüber, wie sich ein junges Weingut zwischen Markt, Klimawandel und Generationendruck behaupten kann. Tobias ist Teil der fränkischen Winzergruppe ETHOS, die Nachhaltigkeit ganzheitlich denkt – vom Weinberg bis zur Photovoltaikanlage. Und er gehört zu denen, die sagen: „Zukunft braucht nicht nur Vision, sondern konkrete Schritte.“ Wir sprechen über: - die Chancen und Grenzen von Zukunftsreben - seine Erfahrungen mit PV-Anlage, Zisterne & Kompostwirtschaft - die Frage, wie man als junger Winzer seinen eigenen Weg findet - und über die Kraft, die in gemeinschaftlichen Initiativen steckt 💡 Live dabei sein? Am 3. Juni findet das kostenlose Webinar mit Eva Vollmer statt: „Zukunftsweine zwischen Hoffnung und Realität – Was neue Rebsorten heute schon leisten“ 👉 Jetzt anmelden – Link in den Shownotes 🎙 Wenn dir diese Episode gefallen hat, abonniere Genuss im Bus, teile die Folge – und bleib dran!

Eva Vollmer – Warum Zukunftsweine mehr als eine Vision sind
In dieser Episode fällt der Startschuss für unsere neue Serie: Zukunftswinzer – eine Reise zu den Menschen, die den Weinbau von morgen gestalten. Den Anfang macht Eva Vollmer – Winzerin, Pionierin und Botschafterin einer Bewegung, die zeigt: Neue Rebsorten sind keine Nische mehr, sondern ein konkreter Weg in Richtung Zukunft. Wir sprechen über Zukunftsreben, über Vision und Realität, über Hoffnung, Skepsis und Erfahrung – und darüber, warum der Wandel im Weinbau nicht mehr auf sich warten lässt. Eva erzählt von ihren eigenen Erfahrungen, von sensorischen Aha-Momenten, von Marktreaktionen – und von der Verantwortung, nicht nur an den Ertrag von heute, sondern an die Umwelt von morgen zu denken.
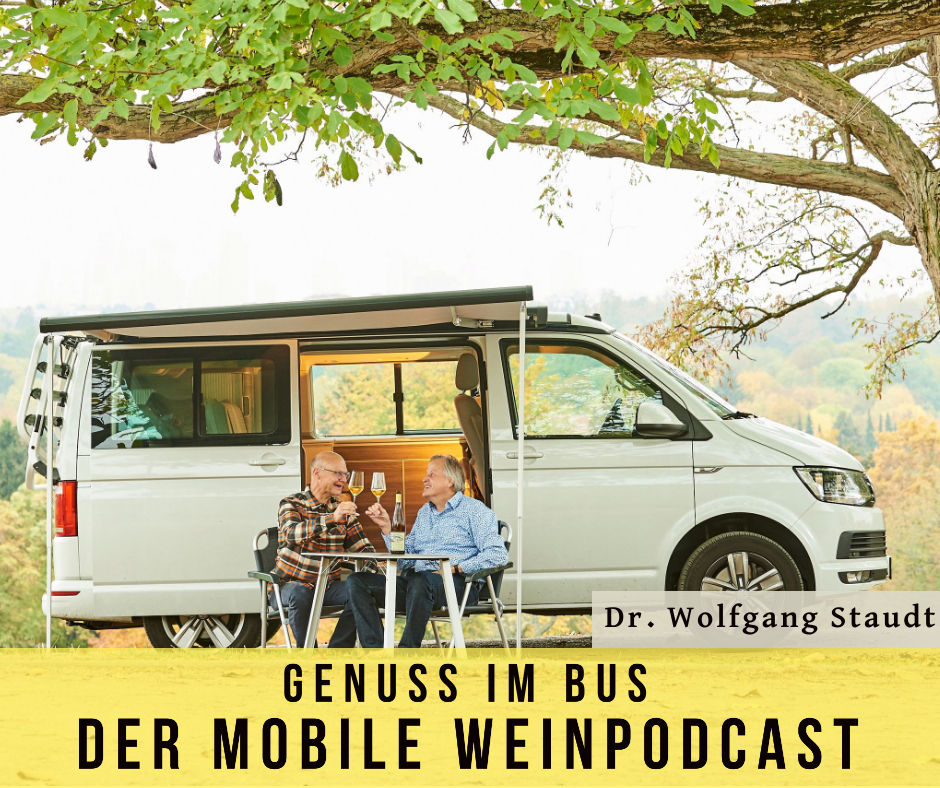
Weinbau & Klimawandel – Prof. Dr. Hans Reiner Schultz im Gespräch
Der Klimawandel verändert den Weinbau radikal – mit massiven Folgen für Winzer, Regionen und Rebsorten. Prof. Dr. Hans Reiner Schultz, Präsident der Hochschule Geisenheim und einer der weltweit führenden Experten für Klimafolgen im Weinbau, gibt Einblicke in die Entwicklungen, Herausforderungen und notwendigen Anpassungen. Welche Regionen sind besonders betroffen? Wie können Winzer sich vorbereiten? Und welche politischen Rahmenbedingungen sind nötig? Ein tiefgehendes Gespräch über die Zukunft des Weins in einer sich verändernden Welt.

Dramatische Zeiten für Winzer – Prof. Simone Loose über die Zukunft des deutschen Weinbaus
Dramatische Zeiten für Winzer – Prof. Simone Loose über die Zukunft des deutschen Weinbaus Steigende Kosten, sinkende Rentabilität, ein stagnierender Markt – viele Weinbaubetriebe stehen unter enormem wirtschaftlichem Druck. Doch was sind die Ursachen? Welche langfristigen Auswirkungen hat diese Entwicklung? Und wie können Winzer sich jetzt zukunftssicher aufstellen? In dieser Episode spreche ich mit Prof. Dr. Simone Loose, einer der führenden Expertinnen für die wirtschaftlichen Entwicklungen im Weinbau. Sie gibt Einblicke in: Warum immer mehr Betriebe unter Druck geraten Die dramatischen Veränderungen im deutschen Weinmarkt Welche wirtschaftlichen Stellschrauben jetzt wichtig sind Welche Strategien Winzer für eine nachhaltige Zukunft nutzen können 🎧 Jetzt reinhören und mehr erfahren!

Weinbau unkonventionell: Yvette Wohlfahrt über Freiheit und Leidenschaft
Für eine weitere Episode von Genuss im Bus treffe ich in Geisenheim Dr. Yvette Wohlfahrt, eine Wissenschaftlerin, die mit ihrem Partner Florian Franke gemeinsam das Weingut Wohlfahrt-Franke führt. Dieses kleine, ökozertifizierte Weingut bewirtschaftet etwa 1 Hektar Rebfläche und legt großen Wert auf naturnahe Weinproduktion. Ihre Weine tragen kuriose Namen und werden unfiltriert und mit nur minimalem Schwefeleinsatz abgefüllt. Neben ihrer Tätigkeit im Weingut ist Yvette als Wissenschaftlerin und Dozentin an der Hochschule Geisenheim tätig, während Florian Franke als Kellermeister und Außenbetriebsleiter bei Schloss Vaux arbeitet. Diese berufliche Vielfalt ermöglicht es den beiden, im Nebenerwerb mit großer Leidenschaft und Hingabe ihr eigenes Ding zu machen. Was mich an Yvette und Florian besonders fasziniert, ist ihre bewusste Entscheidung, ihren ganz eigenen Weg zu gehen. Sie haben sich bewusst dafür entschieden, ihre Freiheit zu bewahren und ihre Leidenschaft für Wein mit ihren Berufen zu verbinden – ohne sich dem Druck des Vollerwerbs auszusetzen. Dadurch haben sie die Möglichkeit gewonnen, ihren ganz eigenen Weg zu gehen – voller Selbstbestimmung und Leidenschaft. Ich denke, die Vita der beiden zeigt, dass es im Weinbau nicht nur den einen richtigen Weg gibt. Bei all dem wundert es nicht, dass sie sich selbst gern als „durchgeknalltes Önologenpärchen“ bezeichnen. Sie sagen: „Wir scheuen uns nicht, mit Traditionen zu brechen, nicht zuletzt, weil wir neugierig aufs Leben sind.“ Dafür sprechen selbstredend die Namen ihrer Weine: „Orange Utan“ für einen maischevergorenen Riesling, „Gewürz-Tapir“ für einen maischevergorenen Gewürztraminer und „Lippen Bärti“ für einen lange im Fass ausgebauten Spätburgunder. Im Rahmen ihrer Forschungsaktivitäten an der Hochschule Geisenheim beschäftigt sich Yvette unter anderem mit der Kupferreduzierung im ökologischen Weinbau. Denn einerseits ist Kupfer bei den Ökos nach wie vor das einzige wirksame und zugelassene Mittel gegen den Falschen Mehltau. Doch bekannt ist auch: Kupfer belastet Boden und Wasser – und so sucht die Branche schon lange und dringend nach Alternativen. Genau hier setzt das Vitivit-Projekt an, ein interdisziplinäres Forschungsprojekt, an dem auch Yvette beteiligt ist. Da geht es zum einen darum, die Wirkung des Kupfers zu maximieren, um dadurch die ausgebrachte Menge reduzieren zu können. Auch alternative Methoden werden erforscht: gezielte Entblätterung, Bodenabdeckungen, UV-C-Strahlung und neue Wirkstoffe. Also kein Wunder, dass ich ungemein happy bin, heute mit Yvette eine inspirierende Persönlichkeit an Bord zu haben. Ihre Geschichte zeigt, wie Wissenschaft, Weinhandwerk und Freiheit zu einer leidenschaftlichen Lebensphilosophie verschmelzen können. Perfekte Zutaten für ein spannendes Gespräch – und vielleicht auch für neue Denkanstöße. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet.

Heiner & Valentin Sauer - tolle Mischung aus Bodenständigkeit und Bescheidenheit, Unternehmergeist und Abenteuerlust
Das Weingut Sauer ist eins der ältesten Bioweingüter in Deutschland. Seit der Gründung im Jahr 1987 arbeitet der Betrieb nach den Richtlinien des Bioland-Verbandes und integriert seit 2010 Elemente der biodynamischen Landwirtschaft. Ein zentraler Aspekt der Betriebsphilosophie ist die Förderung der Biodiversität in den Weinbergen. Durch eine vielfältige Begrünung entstehen lebendige Biotope, die zu gesunden Böden und einer hohen Traubenqualität beitragen. Im Keller setzt das Weingut auf einen minimalistischen Ansatz, einschließlich der Spontangärung ohne Zugabe von Reinzuchthefen, um den individuellen Charakter der Weine zu betonen. Obwohl das Weingut Heiner Sauer in der Weinwelt ein hohes Ansehen genießt, verfolgen Heiner und Valentin eine vergleichsweise moderate Preisstrategie. Das ist sicher auch ein Grund dafür, dass der Anteil, den sie direkt ab Hof vermarkten, relativ hoch ist. In ihrer im Jahr 2021 neu erbauten Betriebsstätte haben sie eine wunderschöne Vinothek eingerichtet, die Besucher geradezu dazu einlädt, einzutreten und in großzügiger und zugleich gemütlicher Atmosphäre die Gastfreundschaft der Familie Sauer zu genießen und sich ohne Eile durch das Sortiment zu verkosten. In der wärmeren Jahreszeit steht eine große Terrasse mit genialem Fernblick für unvergessliche Augenblicke bereit. Zwei Besonderheiten des Weinguts dürfen nicht unerwähnt bleiben: 1. Mit dem Grünfränkisch kultivieren sie erfolgreich eine historische Rebsorte, die bereits als ausgestorben galt. Und 2. die Expansion nach Spanien. Im Jahr 1998 gründete Heiner zusammen mit seiner Frau Moni die "Bodegas Palmera" in der Region Utiel-Requena. Dies bietet die Chance, mit einer weiteren Produktionslinie völlig andere Weinstile zu produzieren. Neben ihren facettenreichen Pfälzer Weinen entstehen im Hinterland von Valencia körperreiche, südländisch geprägte Rotweine aus den Sorten Tempranillo, Syrah und Bobal. Aber auch die Sorten Cabernet und Merlot kommen zum Einsatz. Kurz und bündig auf den Punkt gebracht: Die "DNA" des Weinguts Heiner Sauer besteht in der Kombination aus ökologischem Engagement, Förderung der Biodiversität, minimalistischer Kellertechnik und internationaler Ausrichtung. Und das alles verbunden mit einem gehörigen Schuss Unternehmergeist und Abenteuerlust.

Janine Weinreich - Spätburgunder fließt durch ihre Adern
Janine Weinreich führt das Weingut Brüssel in zweiter Generation. Sie hat es mit innovativen Ideen und viel Leidenschaft zu einem echten Geheimtipp gemacht. Nach ihrer Ausbildung bei renommierten Winzern und Winzerinnen im In- und Ausland, unter anderem bei Klaus-Peter Keller in Rheinhessen, Sabine Mosbacher in der Pfalz und Birgit Braunstein im Burgenland, hat sie peu à peu seit 2007 immer mehr Verantwortung für das Familienweingut ihrer Eltern übernommen. 2019 war dann die finale Übergabe. Für Aufsehen haben in den vergangenen Jahren vor allem ihre Spätburgunder gesorgt. Sie sind ein bisschen wie Janine. Bei der Begegnung entlocken sie ein Lächeln. Sie wirken generös, entgegenkommend, freundlich und offen. Das sind Spätburgunder, die einem entgegenzurufen scheinen: „Hab mich gern, ich möchte dir gefallen.“ Und das machen sie auf eine sehr charmante, authentische Art, ohne dabei aufdringlich zu sein oder gekünstelt zu wirken. Sie zeigen viel Frucht, sie haben eine schöne Balance und sie sind super trinkig. Janine legt großen Wert auf Handarbeit im Weinberg und setzt auf traditionelle Methoden wie Spontangärung und langes Hefelager. Aktuell befindet sie sich in der Umstellung zum Bioweingut. Wichtig ist ihr der direkte Kundenkontakt, weshalb sie das Gros ihrer Weine direkt ab Hof verkauft. Über all diese Dinge spreche ich im Podcast mit ihr.

Elisabeth Muth - wie eine Architektin das Weingut Rappenhof leitet
Eine weitere Episode meines Podcasts "Genuss im Bus" führt mich noch einmal in die sanfte Hügellandschaft Rheinhessens. In der kleinen Weinbaugemeinde Alsheim bin ich mit Elisabeth Muth verabredet, die dort seit 2018 das elterliche Weingut, den Rappenhof führt. Ursprünglich studiert Elisabeth Architektur an den Technischen Universitäten Darmstadt und Zürich und arbeitet anschließend als Architektin in München. Sie kehrt nicht zuletzt deshalb in den Familienbetrieb zurück, weil ihr Bruder nach einem tödlichen Verkehrsunfall das Erbe nicht mehr antreten kann. Logisch, dass ich im Interview von ihr wissen will, welche Erfahrungen und Einsichten sie aus ihrem Leben als Architektin in den Weingutsalltag hat mitnehmen können und an welch anderen Punkten die Uhren im Weinbusiness doch ganz anders ticken. Wie erfrischend erweist sich der Blick von außen, ungeschminkt und fernab aller internen Scheuklappen und wie schnell gelingt es, in der Familie, im Kollegenkreis und von Mitarbeitern und Angestellten als neue, fachfremde Chefin akzeptiert zu werden. Im Interview erfahrt Ihr nicht nur, was Elisabeth binnen weniger Jahre alles erlebt und in Bewegung gebracht hat, sondern auch, weshalb sie in ihrer neuen alten Welt auch ihr Glück gefunden hat.

Bastian Beny - vom Koch zum visionären Winzer
Bastian Beny beginnt seine Karriere als Koch und sammelt Erfahrungen in renommierten Restaurants. Sein wachsendes Interesse am Wein führt ihn schließlich zum Studium der Weinbau & Oenologie in Geisenheim. Praktische Erfahrungen sammelt er bei namhaften Weingütern wie Klaus Peter Keller und Wagner-Stempel. Er legt großen Wert auf Biodiversität und nachhaltiges Arbeiten. Seit 2023 sind die Weine biologisch und biodynamisch zertifiziert. Im Weinberg setzt er auf artenreiche Begrünung, Humusaufbau und den Einsatz bretonischer Zwergschafe, um lebendige Böden und vitale Reben zu fördern. Im Keller setzt er auch interventionsarme Weinbereitung. Die Weine werden ausschließlich per Hand gelesen, spontan in kleinen Gebinden vergoren und verweilen fast ein Jahr auf der Hefe. Dadurch kann auf Schönungsmittel und Filtration verzichtet werden. Schwefel kommt nur dezent zum Einsatz. Das Ergebnis sind lebendige, ungemein energetische und langlebige Weine - ein echter Geheimtipp in der bunten, vielgesichtigen Weinszene Rheinhessens. Im Podcast reden wir über all diese Dinge und vertiefen insbesondere die Frage, wie nachhaltige, regenerative und biodynamische Landwirtschaft funktioniert und worin ihre großen Stärken liegen.

Patrick Chelaifa - Chef der Bickensohler Weinvogtei eG
Die Winzergenossenschaften in Deutschland stehen ja aktuell vor wirklich erheblichen Herausforderungen: Preisverfall und Margendruck, Rückgang der Mitgliederzahlen, Klimawandel, Markt- und Konsumveränderungen und ein ungemein dynamisches Wettbewerbsumfeld setzen die Genossenschaften unter Druck. Andererseits sind Winzergenossenschaften in vielen Weinbaugebieten ein wichtiger Teil der regionalen Identität und Tradition. Sie tragen zur Erhaltung des Kulturlandschaftsbildes bei und fördern die regionale Verbundenheit der Winzer. Insbersondere kleinen Winzern bieten die Genossenschaften die Möglichkeit, ihre Kräfte zu bündeln, um so gemeinsam wirtschaftlich überlebensfähig zu bleiben. Durch den Zusammenschluss können sie Zugang zu moderner Technik, größeren Absatzmärkten und professionellem Marketing erlangen, was für einzelne Winzer oft nicht möglich wäre. Leider haben Genossenschaftsweine seit geraumer Zeit den Ruf, Massenware zu sein, was in einem Markt, der zunehmend auf Individualität und Qualität setzt, problematisch ist. Einige Winzergenossenschaften haben erfolgreich begonnen, sich durch eine stärkere Fokussierung auf Qualität und Marketing neu zu positionieren, andere fusionieren, um durch größere Strukturen wirtschaftlich überlebensfähig zu bleiben. Die Lage ist nicht rosig, aber es gibt auch Ansätze zur Anpassung und Verbesserung. Mit Patrick Chelaifa rede ich über all diese Dinge. Ich will von ihm wissen, wie er den aktuellen Zustand der Bickensohler Weinvogtei einschätzt, wie die Stimmung unter den Genossen ist und mit welchen konkreten Herausforderungen sie zu kämpfen haben. Mit welcher Strategie gedenkt er, seine Genossenschaft zukunftsfähig zu machen und wie will er die Genossen, also die einzelnen Winzer und Winzerinnen so einbinden, dass sie diesen Modernisierungsprozess bereitwillig und engagiert mitgestalten. Einem wie Patrick kann man diese Aufgabe getrost anvertrauen. Es ist einer, der vorangeht ohne abzuheben, ein GF mit gutem Kontakt zur Basis, der hingeht und stets ein offenes Ohr für die Anliegen und Sorgen der Genossen hat. Gleichzeit hat er ein Faible für Kommunikation und Präsentationen, er geht gerne raus und verkörpert auf den Bühnen der Weinwelt seine Bickensohler Weinvogtei.

Fritz Waßmer - Burgundische Eleganz aus dem Herzen Badens
Für eine weitere Episode meines Podcasts "Genuss im Bus" bin ich ein weiteres mal ganz im Süden der Republik unterwegs und besuche im Markgräflerland in der kleinen Ortschaft Schlatt das Weingut Fritz Waßmer. Noch bevor ich die Schwelle des Verkostungsraums überschreite, kommen mir Lisa und Fritz Waßmer entgegen und entführen mich zum Lunch in ein nahegelegenes Restaurant. Ein lebhaftes Gespräch entspinnt sich entlang der aktuellen Jahrgangsherausforderungen und weshalb die Toplagen des Betriebs - trotz allem - immer noch recht gut mit den Wetterkapriolen zurecht kommen. Spätestens als dann die Sprache aufs Burgund kommt, gerät Fritz ins Schwärmen. Es ist unverkennbar, wie sehr er diese französische Region, die Menschen dort und ihre Art des Weinmachens liebt. Ich spüre, welche Hochachtung er von der Wertschätzung seiner burgundischen Kollegen hat, nicht zuletzt, weil sie sich dem Terroir, also der Herkunft der Weine auf so besondere Weise verpflichtet fühlen. Und so entpuppt sich bereits der Restaurantbesuch en passant zu einer Lehrstunde rund um die Historie und die Ideale des Weinguts Fritz Waßmer. Fritz Waßmer beginnt seine Karriere als Weinmacher zwar erst 1998, aber von Anfang an hat er sehr genaue Vorstellungen, wie die Weine, die er einmal produzieren wird, schmecken sollen. Seine Liebe gilt vor allem den Gewächsen der Domaine de la Romenée-Conti. Dort hat er eine Weile gearbeitet und sich dabei sehr genau angeschaut, auf was am meisten Wert gelegt wird. Der Kontakt dorthin ist seither nicht wieder abgerissen und bildet auch heute noch die Blaupause für sein persönliches stilistisches Ideal beim Spätburgunder. Wonach er strebt sind geschmeidige und aromatische Weine mit großer Eleganz und einer fein austarrierten Balance zwischen Körper und Frucht, zwischen Zartheit und Langlebigkeit. „Mehr als im Falle jeder anderen Rebsorte, sagt er, braucht es beim Pinot Feingefühl, Geduld und Frustrationstoleranz. Der geht seinen eigenen Weg, den kannst du nicht zwingen. Das Ideal wäre, überhaupt nichts zu tun – aber das ist unmöglich.“ Im Podcast sind neben Fritz auch seine Tochter Lisa, eine studierte Betriebswirtin und ihr Mann, der Geisenheim-Absolvent und langjährige Kellermeister im Weingut, Armin Ritter dabei. Wir sprechen darüber, wie es ihnen peu a peu gelungen ist, nicht nur die Eigenheiten der Sorten zu lesen, sondern auch die Besonderheiten der einzelnen Terroirs. Denn erst das kongeniale Zusammenspiel, so formuliert es Armin, das kongeniale Zusammenspiel von Lage, Rebe und Weinbergsmanagement, ist das, was große Weine möglich macht. Bereits der Spätburgunder Gutswein des Hauses Fritz Waßmer kann sich sehen lassen. Eine bessere Visitenkarte ist kaum denkbar. Charmant und unkompliziert im Antrunk, zeigt er doch schon eine bemerkenswerte Fruchttiefe, geschmeidige Textur und ordendlich viel Druck im Finale. Die Krönung sind die Lagenabfüllungen, allen voran die charmante Bombacher Sommerhalde, der feurige Kenziger Roter Berg und der stattliche und finessenreiche Herbolzheimer Kaiserberg. Am besten, man macht sich selbst vor Ort ein Bild. Die wunderschöne Vinothek lädt geradezu dazu ein. Kurzentschlossene haben bereits einen Tag nach Erscheinen dieser Podcast-Episode, also am ersten Novemberwochenende die Gelegenheit, die Präsentation des neuen Jahrgangs mitzuerleben. Also, nichts wie hin!

Junge Tuniberger Avantgarde - Sabeth & Severin vom Weingut Gebrüder Mathis
Für die heutige Episode mache ich mich auf den Weg in die ganz im Süden der Republik gelegene Weinregion Baden. Denn wer wie ich nach edlen Alternativen zu den berühmten weißen und roten Burgundern sucht, wird nicht zuletzt in diesem Teil Deutschlands fündig. Die feinsten Burgunder unter ihnen können zwar auch schon mal die 100 Euro-Marke knacken, aber es gibt auch hervorragende Weine, die weniger als die Hälfte, manche nicht mal ein Viertel dessen kosten, was unsere französischen Nachbarn dafür aufrufen. Sie verdienen unsere Aufmerksamkeit. Zum Beispiel das Weingut der Gebrüder Mathis in Merdingen am Tuniberg, westlich von Freiburg. Hier regieren heute Sabeth und Severin. Sie ist in der Pfalz groß geworden, er in Basel. In Geisenheim hat die Liebe sie zusammengebracht. Heute leiten sie eins der interessantesten Weingüter am Tuniberg. Die Weine der beiden aus den Sorten Weiß- und Grauburgunder, Chardonnay und Spätburgunder, strahlen eine berührende innere Ruhe und Harmonie aus. Sie sind zart und fein texturiert und gleichzeitig voller Energie. Es sind Weine, die ihr Herz auf der Zunge tragen und uns schon beim ersten Schluck in ihren Bann ziehen. Mich erstaunt insbesondere ihr Auxerrois und schon bei der ersten Begegnung frage ich mich, ob ein Auxerrois vom Tuniberg so betörend sein: in der Nase kühl, klar, frisch und lebhaft wie ein ins Tal hopsender Bergbach, am Gaumen präzise, elegant, energetisch und einem langen, fröhlichen Ausklang, der mir unweigerlich ein Lächeln entlockt. Aber auch die Chardonnays und Grauburgunder überzeugen auf ganzer Linie. An der Spitze der Pinots stehen die Crus Hohrain und Rosenloch, deren 2021er gerade verfügbar sind, aufgrund der geringen Stückzahlen bei Erscheinen des Podcasts aber auch schon vergriffen sein können. Eine mehr als interessante Alternative ist dann der Spätburgunder Alte Rebe. Dieser dichte, unfiltrierte Pinot stammt von über 30 Jahre alten Reben und reift 18 Monate in kleinen Fässern. Mir gefällt er wegen seines ungemein saftigen und raffinierten Gaumenauftritts, seiner superfeinen Tannine und konzentrierten Kirschfrucht und weil er im Finale noch mal richtig Gas gibt und so auch als Speisenbegleiter eine gute Figur macht. Von Sabeth und Severin will ich wissen, wie sie all das in so kurzer Zeit auf die Flasche bekommen, wie sie herangehen an die Pflege ihrer Weinberge und den Prozess der Weinbereitung. Ich will wissen, wie die beiden ticken, mit welchen Idealen und Werthaltungen sie durchs Leben gehen und was sich für die nächsten Jahre so alles vornehmen.

Geisenheimer Startup "Woii" - die Gründung eines "Mitmach-Weinguts"
Vor ein paar Wochen übernimmt ein junges Trio einen etablierten Rheingauer Weinbaubetrieb, um daraus mehr als nur ein ganz normales Weingut zu machen. Das ist für mich Anlass genug, den Dingen auf den Grund zu gehen. Ich verabrede mich in Geisenheim mit zwei der drei Gründer und führe ein ausführliches Gespräch. Vor allem will ich dem Hinweis nachgehen, dass die drei im Rahmen ihres Startups ein gänzlich neues und einzigartiges Angebot planen: sogenannte Weinmach-Stationen, die Studenten und Auszubildenden, aber auch Privatleuten die Möglichkeit bieten sollen, ihre eigenen Weine zu machen. Das Erstgespräch ist vielversprechend und so verabreden wir zeitnah die Produktion einer Podcastfolge für Genuss im Bus. So ist es gekommen, dass ich heute mit Manu Straub, einem ehemaligen Uhrmacher aus der Schweiz und seinem Geschäftspartner Max Tafel, einem promovierten Geisenheimer, die Hintergründe dieses interessanten Projekts beleuchten darf. Es hört auf den Namen „Woii“, das ist der Name, den die Protagonisten dem Unternehmen gegeben haben. Ich will wissen, wie es zu all dem gekommen ist, was genau sie in den nächsten Jahren vorhaben und wie weit die Dinge bereits vorangekommen sind.

Florian Lauer - der Terroir-Enthusiast der Saar
Für eine weitere Ausgabe meines Podcasts „Genuss im Bus“ - der mobile Weinpodcast habe ich den Terroir-Enthusiasten Florian Lauer in Ayl an der Saar besucht. Ich steige in seinen Geländewagen und schon geht es los. Zunächst zum Ayler Scheidterberg, dann zum Rauberg und schließlich auf die andere Seite von Ayl zur Lage Schonfels. Überall hat er ausschließlich Riesling-Reben stehen. „Das ist unsere einzige Rebsorte“, erklärt er mir und ergänzt: „Diese Landschaft hier will ich in die Flasche bringen, mit nur einer Rebsorte kann ich in diesen unterschiedlichen Terroirs eine hohe geschmackliche Diversität erzielen.“ Florian ist in seinem Element, wenn er über die große Vielfalt der Terroirs der Saar spricht. Durchdrungen, detailverliebt und voller Enthusiasmus. Einer, der den Dingen auf den Grund geht, Fragen stellt, wo so manch anderer zu denken aufhört. Eine unverkennbar wissenschaftliche Ader fließt durch ihn hindurch und gleichzeitig spürt man schon bei der ersten Begegnung: Florian ist keineswegs nur Analytiker, sondern ein Schaffer und Macher, ein Umsetzer, der Ergebnisse sehen will. Die berühmte Ayler Kupp zeigt er mir aus der Ferne, ebenso die Feils, direkt am Eingang des Altarms der Saar gelegen. Allmählich bekomme ich ein Gefühl für das ungemein komplexe Terroir der Saar und ahne, weshalb die Weine von Ayl so ganz anders performen als diejenigen von Kanzem, Wiltingen und Ockfen. Fortdauernd wechseln die Gegebenheiten, die Höhenlage, die Steilheit der Weinberge, ihre Ausrichtung zur Sonne, die Nähe bzw. Distanz zum Fluss und auch die Situation, ob die Lage windoffen oder windgeschützt ist, beeinflusst die mikroklimatischen Konstellationen in den Weinbergen. Logisch, dass wir über all diese Dinge im Podcast sprechen, ausführlich sogar, wie könnte das mit einem so kenntnisreichen und detailverliebten Gesprächspartner auch anders sein.

Katharina & Jan Raumland - die Zukunft des deutschen Winzersekts
Wer sich heutzutage fragt, ob deutscher Winzersekt eine gute Alternative zum Champagner sein kann, befindet sich auf einer heißen Fährte. Wer diese Fährte erst noch aufnehmen will, dem sei sowohl die heutige Podcast-Episode als auch das 5. Internationale Sparkling Festival ans Herz gelegt, das am 3. November diesen Jahres in Mainz stattfindet. In Main kann man sich ein Bild vom hohen Qualitätsniveau vieler deutscher Winzersekte machen und prüfen, ob sie dem König der Schaumweine, dem Champagner und anderen internationalen Spitzen-Cuvées das Wasser reichen können. Aber noch immer ist es so, dass deutscher Winzersekt international kein Thema ist. Man trinkt Champagner, Cava und Crémant, auch italienische Schaumweine und Sparkling aus England und Südafrika. Ja selbst hierzulande entfallen auf den Winzersekt gerade mal 3% des Schaumweinmarktes. Es handelt sich also definitiv um eine Nische. Wird es auch in Zukunft dabei bleiben? Kann die neu gewonnene Wertschätzung, die die besten deutschen Winzersekte aktuell genießen, so viel Ausstrahlung entfachen, dass aus diesem zarten Pflänzchen in absehbarer Zeit eine blühende Landschaft wird? Und natürlich gehört hierher auch die Frage, welche Faktoren im Entstehungsprozess eines erstklassischen Schaumwein denn schlussendlich qualitätsentscheidend sind, also die Frage nach Rebsorte, Terroir und Jahrgang, nach den Auswirkungen der Weinbergspflege und des Lesezeitpunktes. Und logisch, auch all die vielen Handgriffe im Keller spielen eine Rolle, angefangen vom Pressen über die Bereitung der Grundweine, die Assemblage bis hin zur Hefelagerung nach der 2. Gärung in der Flasche. Fragen über Fragen. Die will ich heute mit zwei Experten erörtern. Ans Mikrofon geholt habe ich Katharina und Jan Raumland, also die junge Generation im Hause Raumland, wo Volker und Heide-Rose als Pioniere in den vergangenen 30 40 Jahren Herausragendes für den deutschen Sekt, speziell den hochwertigen, flaschenvergorenen Winzersekt geleistet haben.

Anna Reimann - Botschafterin des Saar-Rieslings und vielseitige Weingutsmanagerin
Fast in Rufweite zum Weingut von Günther Jauch, der in der 181. Episode von Genuss im Bus mein Gast am Mikrofon war, ist ein weiteres Spitzenweingut der Saar beheimatet. Cantzheim ist sein Name. Ganz anders als von Othegraven blickt es nicht auf eine Jahrhunderte lange Tradition zurück. Im Gegenteil. Es handelt sich um ein echtes Startup, eine Weingutsgründung, die Anna und Stephan Reimann im Jahr 2016 auf den Weg gebracht haben. Seither ist nicht viel Zeit vergangen und doch sind die Weine der beiden bereits in der Spitze der Region Saar angekommen. Es sind zeitlose Dokumente einer der aufregendsten Weinlandschaften Deutschlands, ohne jeden vordergründigen Charme, puristische, reine Weine ohne Lametta und schmückendes Beiwerk. Dafür brillieren sie mit Tiefe und Eleganz, mit zugleich tänzelnder Leichtigkeit und Komplexität, mit salziger Länge und einer so seidigen Textur, dass man sie streicheln möchte. Nur Zeit sollte man ihnen geben, denn ihren ganzen Reichtum zeigen sie nicht schon kurz nach der Flaschenfüllung. Immer mal wieder bin ich Ihnen begegnet, im Restaurant, beim Darmstädter Vinocentral oder bei einem Besuch des Saar-Riesling-Sommers. Dieser steht übrigens gerade wieder vor der Tür: am 24. und 25. August öffnen die Saar-Weingüter ihre Keller und Vinotheken und laden alle Interessierten ein, ihre Weine zu verkosten und mit den Machern ins Gespräch zu kommen. Eine wirklich tolle Gelegenheit - auch um diese wundervoll wilde Region mit all ihren Facetten einmal persönlich in Augenschein zu nehmen. Anna und Stephan Reimann vom Weingut Cantzheim sind natürlich auch mit von der Partie. In ihrer architektonisch ungemein ästhetisch gestalteten Orangerie schenken sie und die Gastwinzer Alexander Loersch von der Mosel und Simone Adams aus Ingelheim ihre Weine aus und geben Gelegenheit zum persönlichen Gespräch. All jenen, die am 25./26. August keine Zeit haben, lege ich das Wochenende 7./8. September ans Herz, denn dann präsentiert das Cantzheimer Winzerpaar Anna und Stephan den neuen Jahrgang. Weitere Infos finden sich auf der Website des Weinguts, die ich in den Shownotes zu dieser Episode gerne noch einmal verlinke.

Anne Kauer - leidenschaftliche Repräsentantin des Mittelrheinweins
Für eine weitere Episode von Genuss im Bus habe ich Kai und Kristina in Korb adieu gesagt, bin dann nur kurz mit der Fähre übergesetzt und habe auf der anderen Rheinseite in Bacharach Anne Kauer vom Weingut Dr. Kauer getroffen. Die Geschichte dieses Weinguts ist zwar keine, die sich über Generationen oder gar Jahrhunderte zurückverfolgen lässt, aber doch eine gänzlich andere als diejenige von Kai und Kristina. Von Randolf Kauer und seiner Frau Martin 1982 als ökologisches Weingut gegründet, ist nun deren Tochter Anne gerade dabei, die Zügel in ihre Hände zu nehmen. Im Podcast-Interview will ich von ihr wissen, mit welchen Ideen vom Weinmachen sie zu Werke geht und wie sie es schaffen will, das Weingut von einem Nebenerwerbs- zu einem Vollerwerbsbetrieb umzustellen. Fast zwangsläufig vertiefen wir in unserem Gespräch die Situation der Mittelrheinwinzer, ihre Leiden genauso wie die Potenziale und Chancen für eine bessere Zukunft.

Kristina & Kai - vom Forschungslabor in die Steillagen des Mittelrheins
Für eine weitere Episoden von Genuss im Bus bin ich noch einmal im Weinbaugebiet Mittelrhein unterwegs, also in einer Region, die ein irres weinbauliches Potenzial bereithält, aber nicht zuletzt aufgrund der ungemein arbeitsintensiven Bewirtschaftung der im Gebiet vorherrschenden Steil- und Steilstlagen zunehmend weniger wettbewerbsfähig geworden ist. Wer hier seriöse Weine im Preissegment unter 8 - 10 Euro auf die Flasche ziehen will, kann das nur auf der Basis - ich sag’s mal salopp - auf der Basis von Selbstausbeutung tun. Fakt ist aber: Trotz hoher Arbeitsintensität, in der Regel bis zum fünffachen dessen, was in der Ebene zu veranschlagen ist, belaufen sich die durchschnittlichen Flaschenpreise der Weine vom Mittelrhein unter denen anderer deutscher Anbaugebiete. Verkehrte Welt könnte man meinen! Die Protagonisten der heutigen Episode von Genuss im Bus begeben sich in exakt diesen Kontext. Sie haben - wie ich meine - einen riesengroßen Schritt gewagt: die Gründung eines Weinguts in Kaub mit tatsächlich ausschließlich Steil- und Steilstlagen. Sie starten, während immer mehr Betriebe aufgeben. Ihre Weinberge liegen in spektakulären Lagen inmitten des UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal. Da ist und wie könnte es anders sein, viel Leidenschaft und Enthusiasmus im Spiel. Herzblut für den Wein, das Winzerhandwerk und auch für die Kulturlandschaft, die das Tal des Rheins zwischen Bingen und Koblenz seit Jahrhunderten prägt. Die beiden, um die es hier geht, sind Kai und Kristina. Kai arbeitet aktuell an seiner Promotion zu einem in der Weinbranche brandaktuellen Thema: Er erforscht den von vielen Winzern gefürchteten „Sonnenbrand“. Kristina arbeitet in einem Luxemburger Forschungslabor, inhaltlich u.a. mit Fragen, wie den Herausforderungen des Klimawandels begegnet werden kann. Die beiden haben sich vor ein paar Jahren im Weinbau Studium in Geisenheim kennen- und lieben gelernt. Nach einigen Praktika hat es sie beide gereizt, einen eigenen Wein zu machen und so haben sie KMH Weine gegründet. Gestartet sind sie mit einem einzigen Fass Rotwein. Jetzt wollen sie ernst machen. In Kaub am Mittelrhein haben sie zugeschlagen, haben die Chance genutzt, das Bio-Weingut von Wolfgang Hillesheimer zu übernehmen und sich damit einen lang gehegten, gemeinsamen Traum zu verwirklichen. Die große Party zur Eröffnung des Weinguts findet am 18. August 2024 in Kaub statt. Fühlt Euch eingeladen und rockt mit den beiden auf ihr geniales Projekt. Gut möglich, dass ihr mich dort auch irgendwo erspäht. Würde mich freuen!

Daniel Sigmund - junger Himmelstürmer des Südtiroler Steillagenweinbaus
Für eine weitere Episode meines Podcasts "Genuss im Bus" bin ich einen jungen Südtiroler Winzer ans Mikrofon geholt, der 2021 im Eisacktal in der Nähe von Brixen - auf der Basis von Vorarbeiten seiner Mutter - sein eigenes Weingut gegründet hat. Die Rede ist von Daniel Sigmund, der demnächst seinen 27. Geburtstag feiert. Als Daniel 2017 nach Veitshöchheim geht, um dort die Technikerschule für Weinbau zu besuchen, ist er überzeugt, dass die besten Weine aus Südtirol kommen und dass die Kellermeister der berühmten Genossenschaften seiner Heimat den Schlüssel für große Weine in Händen halten. Er hat dann nicht schlecht gestaunt, als es immer wieder seine aus Südtirol mitgebrachten Weine sind, die bei den Tastings mit seinen Mitschülern halbvoll übrig bleiben, während viele andere Flaschen ausgetrunken werden. Ein Umdenkungsprozess beginnt. Daniel erkennt, wie viel mehr möglich ist und so konkretisiert sich mit der Zeit ein gänzlich anderes Ideal an Weinstilistik. Nicht ganz unschuldig an diesem Lernprozess sind die Diskussionen mit seinen damaligen Mitstreitern in Veitshöchheim: u.a. Carsten Saalwächter Konrad Buddrus und Jonas Brand - alle miteinander heute Protagonisten des handwerklichen, naturbelassenen Weins. Und auch seinen Plan, einmal Kellermeister einer der großen südtiroler Kellereigenossenschaften zu werden, beerdigt er. Stattdessen reift in ihm die Idee, sein eigenes Weingut zu gründen. Wie es dann tatsächlich zur Gründung kommt, wie es ihm gelingt, seine Ideen vom handwerklichen, naturbelassenen Wein in die Praxis umzusetzen und dann auch schon ganz bald einen begeisternden Markt für seine Silvaner, Spätburgunder, Portugieser und Rieslinge zu finden, das alles ist Gegenstand unseres Podcast-Gesprächs.

Thomas Patek - vom Entwicklungsingenieur zum Naturweinwinzer
Für die heutige Episode bin ich noch einmal in Franken unterwegs und habe mit Thomas Patek einen jungen Mann ans Mikrofon geholt, der zunächst als Entwicklungsingenieur mit beiden Beinen im Berufsleben stand, dann aber in eine persönliche Krise geriet und schließlich im Weinbau sein neues Glück gefunden hat. Ich sage an dieser Stelle „Herzlichen Dank, lieber Thomas, Danke für deine schonungslose Offenheit, mit der du die Dinge ansprichst und Chapeau, mit wie viel Verve und Engagement du dich ins Leben als Winzer hineingeworfen und dabei einen Weg gefunden hast, deine Talente zum Zuge kommen zu lassen ohne deine Schwächen zu ignorieren. Über all das reden wir im Podcast und logisch, natürlich reden wir auch über seine Weine, seine Art der Weinbergspflege und wie er den Prozess der Weinbereitung im Keller begleitet. Immer wieder zum Vorschein kommt dabei seine große Liebe zum Silvaner, dieser landauf landab noch immer unterschätzten Rebsorte. Thomas mag ihre robuste Performance im Weinberg ebenso wie ihre leise, vielleicht sogar introvertierte Art im Glas. Sie ist ihm wesensverwandt.

Günther Jauch - vom Glück eines späten Weingutsbesitzers
Für eine weitere Episode meines Podcasts "Genuss im Bus" bin ich nach nun tatsächlich längerer Zeit mal wieder an die Saar gefahren und habe - inmitten einer dramatischen und zugleich malerischen Steillagenlandschaft - einen Weingutsbesitzer ans Mikrofon geholt, den wohl die meisten Menschen aus anderen Kontexten kennen. Die Rede ist von Günther Jauch, der 2010 zusammen mit seiner Frau Thea das Weingut von Othegraven in Kanzem von Dr. Heidi Kegel, einer entfernten Verwandten übernommen und damit zurück in Familienbesitz geführt hat. Wie es dazu kam und was Günther Jauch seinerzeit motivierte, das Projekt „Weingut“ in sein Leben zu holen, ist Teil unseres Podcast-Gesprächs. Wir sprechen darüber hinaus sehr intensiv über den Zustand des Saar-Rieslings, seine goldenen Jahrzehnte Ende des 19. Jahrhunderts, den Niedergang in den 30er Jahren des 20 Jahrhunderts und dann die fulminante Renaissance seit nun etwa 15 Jahren. Logisch, dass wir sein aktuelles Lagen- und Produktportfolio genauer unter die Lupe nehmen und auch den ein oder anderen Wein gemeinsam verkosten. Bei all dem wird nicht nur deutlich, wie sehr Günther Jauch sein Herz an den Wein und sein Weingut verloren hat, sondern auch wie pudelwohl er sich in dieser Welt fühlt. Er genießt die Nähe und den Austausch mit den anderen Winzern in der Region und ist begeistert, von der sensationellen Hilfsbereitschaft, wie sie in der Szene herrscht. Vieles ist in dieser Welt so ganz anders wie in der Welt der Medien und des Fernsehens. Er ist, so zumindest mein Eindruck, ziemlich happy, diesen Schritt vor nunmehr 14 Jahren gegangen zu sein. Das hat, so sagt er selbst, sein Leben und seinen Erfahrungshorizont um ein vielfaches bereichert. Und ihm neue Freundschaften beschert.

Schloss Vollrads - mit Volldampf in die Zukunft
Für eine weitere Episode meines Podcasts "Genuss im Bus" bin ich in den Rheingau gefahren und habe - inmitten einer malerischen Landschaft - Schloss Vollrads einen Besuch abgestattet. Bereits von Winkel aus wird der Blick frei auf das Schloss, umgeben von sanften Hügeln und Weinbergen. Eine idyllische Szenerie offenbart sich dem Blick des Besuchers. Besonders markant wirkt der runde Wohnturm aus dem 14. Jahrhundert, der als Wahrzeichen von Schloss Vollrads gilt. Dieser Turm verleiht dem Schloss einen wirklich einzigartigen romantischen Charme. Verabredet bin ich mit dem GF Ralf Bengel und dem Kellermeister Jochen Bug. Von den beiden will ich wissen, wie es einem so alten und traditionsreichen Weingut gelingt, Innovationskraft und Veränderungsbereitschaft an den Tag zu legen, ohne die Vergangenheit zu vergessen oder sie gar zu leugnen. So kommt es, dass wir darüber sprechen, worin der Kern der Identität von Schloss Vollrads eigentlich besteht, aus welchen Bausteinen diese Identität aufgebaut ist. Gibt es so etwas wie einen Wertekanon, der den Umgang mit der Natur, das soziale Miteinander und auch die Leitplanken im Prozess der Weinbereitung orientiert, einen Wertekanon, der Halt gibt und den Handelnden eine klare Richtung weist. Natürlich reden wir auch über die Besitzverhältnisse, die Dynastie der Grafen Matuschka-Greiffenclau ebenso wie die Nassauische Sparkasse. Wir reden über das besondere Terroir von Schloss Vollrads, die Stilistik der Weine und das aktuelle Portfolio. Logisch, dass wir auch die beiden aktuellen Großprojekte thematisieren: die gerade abgeschlossene Umstellung der Weinbergsflächen auf ökologische Bewirtschaftung und den Bau des neuen, hochmodernen Kellergebäudes, das derzeit in Hanglage direkt oberhalb des Schlosses errichtet wird. Der Neubau dient zum einen der Weinproduktion, aber auch der Energieversorgung des gesamten Schlosses. Mithilfe von Photovoltaik, Batteriespeichern und Blockheizkraftwerk soll das Gebäude den Wärme- und Energiebedarf der gesamten Schlossanlage – inklusive Weingut, Gutsrestaurant und Veranstaltungsbereich – zu 80% aus erneuerbaren Energien decken. Die Trauben sollen in der neuen Weinhalle nach dem Gravitationsprinzip verarbeitet werden, weil das schonender sei und zu besserer Weinqualität führt, so zumindest erläutern mir das Geschäftsführer und Kellermeister.

Christian Ottenbreit - mit viel Bauchgefühl und Kreativität in eine vielversprechende Zukunft
Christian Ottenbreit hat mit dem 2018er seinen ersten Jahrgang heimgeholt, insgesamt 2000 Flaschen waren das damals. Im Rückblick gesteht er, mit diesem Jahrgang so ziemlich alles falsch gemacht zu haben, was man falsch machen konnte. Vor allem viel zu spät gelesen und dann Weine auf Flaschen gefüllt, die viel zu viel Alkohol besaßen. Seither ist jede Menge passiert. Es hat einen deutlichen Flächenzuwachs gegeben und aus 2.000 Flaschen sind 50.000 Flaschen geworden. Die Qualitätssprünge von Jahr zu Jahr sind enorm. Hinter allem verbirgt sich eine glasklare Strategie, ein durchdachtes, stimmiges Konzept, auch wenn, wie Christian wiederholt betont, sein Bauchgefühl Takt und Rhythmus bestimmt. Christian geht es im Kern darum, ein zukunftstüchtiges Weingut auf der Basis ethisch klar definierter Prinzipien so aufzubauen, dass es den Herausforderungen des Klimawandels gewachsen ist. Dazu gehört u.a. die ökologische Bewirtschaftung der Weinberge, die Anpflanzung neuer, pilzwiderstandsfähiger Rebsorten und der schonende Ressourceneinsatz. Im Keller setzt er auf Spontangärung, langes Vollhefelager und so wenige Eingriffe, wie möglich. Er sagt: „Wenn die Traubenqualität stimmt, dann ist die Weinbereitung kein Hexenwerk. Dann ist es einfach nur ein Stück weit ein Begleiten des Weinwerdungsprozesses und kein Weinmachen. Wir betreiben im Weinberg viel Aufwand, da können wir im Keller die Zügel locker lassen.“ Schnell hat Christian dann auch sehr sehr viel Wertschätzung für seine Weine erfahren. Klar, da sind Zufälle, da ist etwas Glück im Spiel, aber seine Weine sind tatsächlich auf ganz unaufgeregte Weise charmant und generös, super balanciert und alle mit einer tollen Haptik, einem animierenden Gaumenauftritt, cremig, saftig und fordernd zugleich, exzellente Speisenbegleiter quer durch das Sortiment. Und auch ihr Gewand, in dem sie sich präsentieren, die Flaschenetiketten sind sehr sehr ansprechend, modern und doch auch bodenständig, vor allem aber super individuell, eben erfrischend anders. Und all das anscheinend ohne Masterplan, dafür umso mehr mit ganz ganz viel Bauchgefühl.

Martin Hirsch - wie ein Quereinsteiger sein Glück in Weinberg und Keller findet
Für eine weitere Episode meines Podcasts "Genuss im Bus" bin ich noch einmal in Franken unterwegs und habe in Kitzingen Martin Hirsch ans Mikrofon geholt. Sollte Martin je einen konkreten Plan von seinem Leben gehabt haben, so kommt ein Leben als Winzer darin sicher nicht vor. Eigentlich haben sich die Dinge für ihn immer irgendwie ergeben, so ganz ohne großen Masterplan. Zwar ist er groß geworden als Sohn eines Winzers, aber nach dem Abitur ist eins klar: Erst mal raus aus der dörflichen und familiären Enge, hinaus in die große Welt. Er will mehr von allem, was da draußen lauert, erleben und er ahnt, dass auch er selbst sich dabei noch mal ganz neu erleben, vielleicht neu erfinden, auf jeden Fall weiterentwickeln wird. Eigentlich will er Tourismus-und Event-Management studieren, überlegt sogar, das in Asien zu tun. Aber dann kommen die Dinge doch ganz anders. Mehr oder weniger zufällig landet er in einer 3D-Agentur in Frankfurt. Einige Jahre später macht er sich in der Medienbranche selbstständig und jobt nebenbei im Service des Gourmetrestaurants Emma Metzler. Dann kommt Corona und seine Aktivitäten in Frankfurt liegen auf Eis. Was folgt ist hochinteressant, mehr noch, es ist beeindruckend und erfrischend anders. In kürzester Zeit entstehen unter seiner Regie extrem spannende und bemerkenswert eigenständige Weine. Doch lassen wir dazu den Protagonisten der heutigen Podcast-Episode selbst zu Wort kommen.

Luisa & Elias - die beiden Protagonisten des Startup-Weinguts Hainbusch in Kaub am Mittelrhein
Für eine weitere Episode meines Podcasts "Genuss im Bus" habe ich spontan die Himmelsrichtung gewechselt und den Bulli gen Westen gesteuert, um die beiden Protagonisten eines jungen Startups kennenzulernen. Sie 27, er 21, Luisa und Elias. Die beiden haben einen großen Schritt gewagt: die Gründung eines Weinguts in Kaub am Mittelrhein mit aktuell ausschließlich Steil- und Steilstlagen. Sie starten, während immer mehr Betriebe aufgeben. Kaub hat zwar eine lange Weinbautradition, die bis ins Mittelalter zurückreicht und liegt im UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal, das für seine steilen Weinberge bekannt ist. Und auch die Weinberge bieten ideale Bedingungen für die Produktion exzellenter Rieslinge, aber immer weniger Winzer können von den Früchten ihrer harten Arbeit leben. Die Zahl der Arbeitsstunden, die hier pro Hektar veranschlagt werden müssen, übertrifft die vieler anderer Weinbaugegenden um das 4- bis 5-fache. Die Flaschenpreise liegen jedoch nicht selten weit unter denen anderer Regionen. In diesen Kontext begeben sich Luisa und Elias. Beide sind absolute Quereinsteiger, beide ohne weinbaulichen Hintergrund, sie aus Oberbayern, er aus Osthessen. Kennengelernt haben sie sich in der Berufsschule im Rahmen ihrer Ausbildung zum Winzer. Anfangs haben sich beide eher ignoriert, dann nach ein paar Wochen im Pausenhof doch mal mal miteinander gesprochen und gleich gemerkt, dass die Chemie stimmt, dass sie ganz ähnlich ticken und schon vier Wochen später war den beiden klar, dass sie gerne einen Weinberg gemeinsam bewirtschaften möchten. Luisa und Elias strahlen so viel Unbeschwertheit aus, so viel Enthusiasmus und Begeisterung für den Winzerberuf, dass es eine große Freude ist, ihnen zuzuhören. Ganz ohne romantische Überhöhungen wirkt ihre Art ansteckend und allen Hörerinnen und Hörern, die insgeheim mit dem Gedanken spielen, ins Weinbusiness einzusteigen, möchte ich zurufen: Nehmt Euch in acht, denn leicht könnte beim Hören dieser Podcast-Episode der Funke überspringen und ein Feuer in Gang gesetzt werden, dass sich so schnell nicht wieder löschen lässt. Als Interimslösung bietet sich die Teilnahme an der Crowdfunding-Kampagne der beiden an. Ihr könnt euch eine beliebige Menge des 24er Jahrgangs bereits heute sichern, bekommt die Weine dann, sobald sie für den Verkauf freigegeben werden. Ein genialer Win-Win-Deal: Luisa und Elias können die Kosten für aktuelle Aufwendungen decken, Ihr kommt in den Genuss des 24er Jahrgangs zu vermeintlich lukrativen Konditionen, schließlich ist damit zu rechnen, dass die Preise von Jahr zu Jahr steigen werden. Das jedenfalls, was ich ich an Fassproben im Glas hatte, ist schon heute exzellent und die Entwicklung der beiden wird, sofern die Natur da mitspielt, da bin ich mir ganz sicher, nur eine Richtung kennen. Den Link zu ihrer Crowdfunding-Plattform habe ich in die Shownotes zu dieser Episode gepackt

Florian Reus - vom Ultraläufer zum Garagenwinzer
Für eine weitere Episode von Genuss im Bus habe ich ein weiteres Winzertalent aus Franken ans Mikrofon geholt, einen, der gar nicht mehr ganz so jung ist, der schon 2002 seine Ausbildung zum Winzer startete und danach nur kurze Zeit in der Weinbranche gearbeitet hat, nicht weil ihm der Spaß daran verloren gegangen war, sondern weil er vorübergehend andere Prioritäten setzen wollte. Die Rede ist von Florian Reus, der seinerzeit auszog, die Welt der Ultraläufer so richtig aufzumischen. Mehrere nationale und einen Weltmeistertitel heimste er ein, bevor er dann den Weg zu seiner alten Leidenschaft, den Wein zurückfand. 2018 gründet Florian in Franken sein eigenes Weingut, pflegt seine Weinberge aber zunächst noch vom Taunus aus. Mittlerweile hat er sich zwar in seiner alten Heimat häuslich niedergelassen, seine Betriebsstätte und der Umfang seiner Rebanlagen entsprechen jedoch noch immer denen eines Garagenweinguts. Schnelles Wachstum strebt Florian auch gar nicht an, denn er hat keineswegs vor, seine zweite Leidenschaft, den Ultralaufsport gänzlich aufzugeben. An Wettkämpfen will er zwar nur noch sporadisch teilnehmen, aber die Tätigkeiten als Berater und Coach machen ihm ebenso viel Freude wie gelegentliche Impulsvorträge zu den Themen Motivation, Ausdauer und Grenzüberschreitungen. Er sagt: Mein großes Glück ist, dass ich beide Interessen, beide Leidenschaften total gut miteinander verbinden und mir dabei die Zeit so einteilen kann, wie sie gerade gebraucht wird. Das ist durchaus ein Modell auf Dauer.“ Ich habe Florian in Randersacker besucht und mit ihm gemeinsam sein Sortiment verkostet. Ich war und bin von seinen Weinen beeindruckt: athletisch gebaut, straff, vibrierend lebendig, Weine mit viel Energie, Struktur und Länge, Weine mit enorm viel Gripp und einem von der ersten bis zur letzten Sekunde beeindruckender Präsens am Gaumen.

Stefan Doktor - CEO und Teamplayer auf Schloss Johannisberg im Rheingau
Für eine weitere Episode meines Podcasts "Genuss im Bus" mache mich auf den Weg in den Rheingau. Der Grund dafür ist kein gewöhnlicher, schließlich geht es darum, einem wahren Monument der deutschen Weinkultur einen Besuch abzustatten. Schloss Johannisberg, das erste Riesling-Weingut der Welt. Auf Schloss Johannisberg wird nicht nur exzellenter Riesling erzeugt, es ist darüber hinaus ein beliebter Ort für Festivitäten ganz unterschiedlicher Art, für Konzerte und auch für Gala-Dinners. Von Anfang an war das Schloss Spielstätte des Rheingauer Musik-Festivals. Hochinteressant ist das zehn Meter tief in den Berg hinein gegrabene 900-jährige Kellergewölbe mit der Schatzkammer des Schlosses, der magischen Bibliotheca subterranea, wo derzeit rund 25.000 Flaschen aus allen großen Jahrgängen seit 1748 lagern. Getroffen habe ich vor Ort Stefan Doktor, den Geschäftsführer von Schloss Johannisberg. Unser Gespräch dreht sich im Kern um die Frage, wie es Schloss Johannisberg gelingt, sich modern und zukunftsfähig aufzustellen, ohne seine Wurzeln und die 1200-jährige Geschichte zu vergessen. Ich will von Stefan Doktor wissen, welche Kraft und Ausstrahlung in so einer langen Historie liegen und wie man sie für die aktuellen Herausforderungen nutzbar machen und was man davon lernen kann. Mich interessiert natürlich auch die andere Seite der Medaille, nämlich die Frage: Können Traditionen gelegentlich auch lähmen, können sie das Tempo für notwendige Modernisierungsmaßnahmen drosseln und Anpassungsprozesse auf die lange Bank schieben? Und noch eine Frage treibt mich um: Welche Vor- und welche Nachteile hat die unternehmerische Verfasstheit von Schloss Johannisberg - im Besitz der Familie Oetker und Teil der Henkell-Freixenet Holding. Fragen über Fragen! Und ein großes Vergnügen, mit dem charmanten und eloquenten Stefan Doktor all diese Dinge zu erörtern.

Nicolas Olinger - Charakterwinzer aus Iphofen, der in keine der gängigen Schubladen passt
Ein weiteres Mal bin ich bei meiner Suche nach interessanten, charakterstarken Jungwinzern in Franken fündig geworden, einer Region, die ja leider immer noch etwas unter dem Radar läuft und im Schatten der an Rhein und Mosel gelegenen Anbaugebiete steht. Mag sein, dass das Gros der Weine in den vergangenen Jahrzehnten tatsächlich nicht viel mehr Aufmerksamkeit verdiente, aber seit ein paar Jahren ist Bewegung in die Sache gekommen. Die Herangehensweise wird individueller, die Pflege der Weinberge wird intensiviert und im Keller wird zurückhaltender gearbeitet. Immer mehr vor allem junge Winzerinnen und Winzer haben erkannt, dass in einer globalisierten, scheinbar grenzenlos gewordenen Weinwelt das Originelle, das Authentische und Unverwechselbare auf besondere Art und Weise wertvoll geworden ist. Damit Weine mit echtem Ursprungscharakter möglich werden, widerstehen sie den Verlockungen der modernen Önologie, verzichten sie auf Reinzuchthefen und Gärenzyme, aufs Filtrieren und Schönen. Sie wagen Persönlichkeit mit Ecken und Kanten und sie sind bereit, auf diesem Weg Risiken in Kauf zu nehmen. Einer dieser Charakterwinzer ist Nicolas Olinger aus Iphofen. Nach Winzerausbildung und Auslandsaufenthalten hat er zunächst eine Sommelierausbildung absolviert, dann in Geisenheim internationale Weinwirtschaft studiert. Ich habe ihn in Iphofen besucht, er hat mir seine Weinberge gezeigt und ich hatte Gelegenheit, mich durch sein Sortiment zu verkosten. Dabei bin ich nicht nur exzellenten, ungemein harmonischen, balancierten und fein texturierten Weinen begegnet - animierenden, kräuterwürzigen Silvanern ebenso wie gnadenlos guten Burgundern, sondern mit Nico einem Winzer, der mit viel Herzblut und Leidenschaft, aber auch einer guten Portion Gelassenheit und Nachdenklichkeit zu Werke geht. In dem einen Moment sprüht er nur so vor Begeisterung für die kreativen Möglichkeiten seines Berufs, um dann wenige Augenblicke später voller Demut zu konzedieren, dass sich die Natur nicht beherrschen lässt, dass er als Landwirt ihr zu dienen habe. Keine Frage, Nico liebt seinen Beruf und doch begegnet er seinem Berufsstand mit einer gewissen kritischen Distanz. Er hat den Mut, seinen eigenen Weg zu gehen. Der Versuch, ihn in eine der gängigen Schubladen zu stecken, ist zum Scheitern verurteilt. Macht Euch selbst ein Bild.

Peter Leipold - Protagonist des neuen Franken
Zur Zeit bin ich ja mit meinem Podcast in den verschiedenen deutschen Weinbaugebieten unterwegs und halte Ausschau nach interessanten, vielversprechenden jungen Winzertalenten. Mit diesen jungen Menschen möchte ich über ihre Erfahrungen in den Lehr- und Studienjahren sprechen und wie ihnen dann anschließend der Einstieg in den Weingutsalltag gelungen ist. Mich interessiert, wie die Generation Z so tickt, was sie antreibt, was sie begeistert und ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht und was sie zu den wichtigen Themen der Weinbranche zu sagen haben. Logisch, dass ich auch neugierig bin, welche Weinstilistik sie besonders wertschätzen und wo in der Welt sie sich immer mal wieder Inspirationen holen. Noch einmal bin ich bei meinen Recherchen in Franken fündig geworden, eine Region, die leider noch immer etwas im Schatten der an Rhein und Mosel gelegenen Anbaugebiete steht. Zu allem Übel ist die Region gerade von zwei frostigen Nächten so stark heimgesucht worden, dass an manchen Orten die Erträge in diesem Jahr extrem gering ausfallen dürften. Von manchen Weinbergen wird gar ein Totalausfall gemeldet. Auch von anderen Weinregionen werden ähnlich traurige Nachrichten verbreitet. Genaueres wird sich sicher erst in den nächsten Tagen herausstellen. Auch mein heutiger Gast hier bei Genuss im Bus ist von den Frostereignissen betroffen. Es ist Peter Leipold aus Ober-Volkach. Hier seine Stellungnahme im O-Ton: „Es ist nicht so schlimm wie in 2020, aber nach der 2. Frostnacht rechnen wir aktuell nun mit ungefähr 60% Verlust in unserem Weingut. Das ist schwer zu verkraften. Gerade wo dieses Jahr alles so super draußen ausgeschaut hat... Aber das Wichtigste ist dennoch, dass wir alle gesund sind und es auch dem Nachwuchs gut geht!“ Peter Leipold ist ein leiser, bescheidener und ungemein besonnener junger Winzer. So manch anderer Zeitgenosse würde, angesichts der famosen Silvaner und Spätburgunder, die unter seiner Regie auf Flaschen gefüllt werden, eine größere Lippe riskieren. Nicht, dass es Peter an Selbstbewusstsein fehlen würde, ganz und ger nicht, aber er trägt es nicht lauthals zur Schau und er muss auch nicht immer und überall in der ersten Reihe stehen. Seine Vita kann sich sehen lassen: 2006 macht er sein erstes Praktikum bei Paul Fürst in Bürgstadt, es folgt die Lehre bei der LWG in Veitshöchheim. Anschließend arbeitet Peter vier Jahre bei Klaus Peter Keller im Rheinhessischen Flörsheim-Dalsheim, eine Zeit, die wie er sagt - ihn sehr geprägt hat. Zwischenrein schiebt er einen Aufenthalt bei Comte Liger-Belair in Vosne-Romanée, von denen er heute immer mal wieder Fässer für seinen Pinot bezieht. Und seit die Hip-Hop-Ikone Madlib begeisterer Fan seiner Weine ist, ist Peter international um einiges bekannter als hierzulande.

Benny May - Silvaner-Freak und Maschinenkonstrukteur vom fränkischen Weingut Rudolf May
Für eine weitere Episode meines Podcasts Genuss im Bus war ich erneut in Franken unterwegs und habe in Retzstadt den Benny May getroffen, den Juniorchef des Weinguts Rudolf May. Retzstadt liegt etwa auf halber Höhe zwischen Würzburg und Karlstadt, etwas abseits vom Main in dem kleinen Seitental Eberstal, umgeben von Weinbergen, Obstbäumen und viel ursprünglicher Natur. Erst 1998 startete die Familie May ihre Karriere als selbstständige Winzer. Die Generationen vorher betrieben Weinbau jedoch schon seit über 300 Jahren. Vor knapp 10 Jahren erfolgte die Umstellung auf ökologischen Weinbau und das aus der tiefen Überzeugung heraus, dass nur gesunde Böden gesunde Trauben hervorbringen. Junior Benny, der immer mehr die Regie im Betrieb übernimmt, formuliert das so: Nur auf der Basis gesunder, vitaler Böden können Weine entstehen, die authentisch ihre Herkunft transportieren und unser Weingut und unsere Region optimal vertreten. Wir haben uns bei meinem Besuch viel Zeit für einander genommen. Benny hat mir ausführlich seine Weinberge rund um Retzstadt und Thüngersheim gezeigt und die Lagenunterschiede erläutert. Die Böden sind hier vom Muschelkalk geprägt und fast unisono extrem karg, aber genau das schätzt Benny, denn sie bringen, wie er sagt, trockene und finessenreiche Weine hervor, die niemals fett wirken. Dann haben wir Keller und Maschinenhalle in Augenschein genommen und schließlich alle wichtigen Weine verkostet und ausgiebig besprochen. Wunderbare Stunden mit einem jungen Winzer, der eine große Zukunft vor sich hat. Die Podcast-Episode haben wir dann ein paar Tage später ganz entspannt remote aufgenommen.

Weingut am Stein - die junge Generation mischt kräftig mit
Für eine weitere Episode habe ich Antonia Knoll und Marius Rau vom Würzburger Weingut am Stein ans Mikrofon geholt und setze mit den beiden meine Podcast-Reihe mit jungen Winzerinnen und Winzern fort. Wie bereits in den Episoden mit Elena Andres und Philipp Jaillet spreche ich auch mit Antonia und Marius über ihre Erfahrungen in den Lehr- und Studienjahren und wie der Einstieg in den Weingutsalltag im Anschluss verlaufen ist. Wir reden über Ihre Motivation für den Beruf, über Werte und Ideale genauso wie über ihre Praxis in Weinberg, Keller und dem Verkauf. Mich interessiert, wie die Generation Z so tickt, was sie antreibt, was sie begeistert und ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht und was sie zu den wichtigen Themen der Weinbranche zu sagen haben. Antonia und ihr Pfälzer Freund Marius sind gerade in den Betrieb einstiegen, den Ludwig und Sandra Knoll aufgebaut und zu einem der qualitativ führenden in Franken ausgebaut haben. Insbesondere mit ihren Abfüllungen vom Stettener Stein bereichern sie Jahr für Jahr die Weinwelt mit außergewöhnlichen Köstlichkeiten. Nicht vordergründige Fruchtigkeit, sondern karge Würze und Kräutrigkeit prägen ihre Performance. Und sie strahlen eine Energie aus, die ihresgleichen sucht. Über diese Dinge habe ich mich hier im Podcast in der 99. Episode mit Ludwig ausführlich unterhalten. In den Shownotes zur aktuellen Ausgabe verlinke ich das für Euch.

Elena Andres - vielversprechender Start ins biodynamisch geführte Weingut von Vater Michel Andres
Für eine weitere Episode von Genuss im Bus habe ich mich mit Elena Andres aus Ruppertsberg in der Pfalz verabredet, um mit Ihr über ihre Erfahrungen als Jungwinzerin zu sprechen. Damit setze ich fort, womit ich in den vergangenen Wochen begonnen habe: eine Podcast-Reihe mit jungen Winzerinnen und Winzern, mit denen ich über Ihre Motivation für den Beruf spreche, über ihre Werte und Ideale genauso wie über ihren Alltag in Weinberg, Keller und dem Verkauf. Mich interessiert, wie die Generation Z so tickt, was sie antreibt, was sie begeistert und ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht und was sie zu den wichtigen Themen der Weinbranche zu sagen haben. Elena Andres ist gerade in den Betrieb einstiegen, den ihr Papa, der Michel Andres in den 90er Jahren als Startup - quasi von der Peake auf - aufgebaut hat. Seit ein paar Jahren entstehen unter seiner Regie einige der aufregendsten und ausdrucksstärksten Weine der Mittelhaardt, nicht zuletzt weil Michel seine Weinberge mit extrem viel Feingefühl, Intuition und Liebe zur Natur hegt und pflegt. Auch er war einmal hier bei Genuss im Bus zu Gast. Es war die Episode 106. In den Shownotes zur aktuellen Folge werde ich das noch einmal für Euch verlinken.

Alois Clemens Lageder - Weinbau der Zukunft und Summa 2024
Für eine weitere Episode meines Podcasts "Genuss im Bus" habe ich Alois Clemens Lageder aus Südtirol ans Mikrofon geholt. Er führt das traditionsreiche Familienunternehmen aktuell zusammen mit seinen Schwestern Helena und Anna. Zwei Dinge will ich mit ihm besprechen: Erstens will ich von ihm wissen, wie er die Dinge in und um das Weingut so organisiert, dass es zukunftsfähig ist. Es geht also um die Themen Boden- und Pflanzengesundheit, Biodiversität und Nachhaltigkeit, Kooperation und Motivation. Und da die Weinmesse der Lageders, die Summa 2024 in genau 2 Wochen an den Start geht, möchte ich von Clemens wissen, mit welchen Erwartungen er heuer die Pforten zu diesem wirklich ganz besonderen Event öffnet.

Philipp Jaillet - radikal ganzheitlich in Wort und Tat
Für eine weitere Episode von Genuss im Bus habe ich den Bulli noch einmal in die Pfalz gesteuert, diesmal nach Ruppertsberg, wo ich den jungen Winzer Philipp Jaillet getroffen habe. Im Namen verbirgt sich zweifelsfrei etwas unverkennbar Französisches, aber der Ursprung ist, wie die Ahnenforschung ergeben hat, nicht mehr so einfach rekonstruierbar. Alles deutet aber aufs Burgund hin, doch auch das Jura ist als Herkunftsregion seiner Vorfahren nicht ganz ausgeschlossen. Wer mit Philipp spricht, ahnt davon jedoch nichts, so unüberhörbar ist sein Pfälzer Dialekt. Hat man dann erst mal einen seiner Weine im Glas, macht der Namen Jaillet dann doch wieder Sinn und man spürt, dass ein französischer Geist in ihnen pulsiert. Philipp hat den Kopf voller Ideen, Visionen und ist bis in die Zehenspitzen motiviert. Aber wichtiger noch ist vielleicht etwas anderes: Philipp traut sich Fragen zu stellen, Fragen zu stellen, wo andere längst zu fragen aufgehört haben, wo viel zu viel unreflektiert und unkritisch hingenommen wird, gemacht und getan wird, nicht weil es schon immer so gemacht wurde, sondern weil es heute fast alle so machen und die Stimmen aus Technik und Chemie das immer nur zu weiter befeuern. Philipp ist einer, der die Dinge hinterfragt und dabei manchmal auf Lösungsansätze stößt, die an die Praxis früherer Generationen erinnern, Konzepte, die heute vielen in der Branche als Anachronismus anmuten.

Werner und Johannes Jülg - frankophile Winzerkunst in der Südpfalz
Für eine weitere Episode meines Podcasts Genuss im Bus bin ich in die Südpfalz gefahren, genauer gesagt nach Schweigen, um direkt an der deutsch-französischen Grenze im Weingut Jülg Vater und Sohn Jülg zu treffen. Seit Junior Johannes nach Lehrjahren bei einigen enorm renommierten Betrieben im In- und Ausland 2011 zurück ins elterliche Weingut kam, um dort fortan eine zentrale Rolle zu spielen, hat der Betrieb große Fortschritte gemacht. Die Bioumstellung wurde realisiert, Umbaumaßnahmen kamen in Gang, der Rebsortenspiegel wurde verschlankt und die Stilistik der Weine erfuhr Präzisierungen in mehreren Etappen. Von Jahrgang zu Jahrgang ein bisschen eleganter, feiner, subtiler - ohne jedoch die die Region so typische energetische Ausstrahlung zu verlieren. Dass sich diese Entwicklungen auch in den Kritiken der Fachpresse niederschlugen, war dann quasi die zwangsläufige Folge. »Aufsteiger des Jahres« im Vinum Weinguide 2020 und »Kollektion des Jahres 2021« bei Meiningers Rotweinpreis sind nur zwei Beispiele der vielen Auszeichnungen, die Johannes und Werner Jülg in den vergangenen Jahren einsammeln durften. Völlig logisch, aber für die beiden Protagonisten dennoch absolut überraschend folgte im Frühjahr 2021 dann die Aufnahme des Weinguts in den VDP.

Die WEINerliche Führungskraft - Leadership mit allen Sinnen
Für diese Episode habe ich mal keinen Vertreter aus der Wein- und Winzerszene ans Mikrofon geholt, sondern mit Thomas Gawron einen waschechten Führungskräftetrainer. Wieso denn das, werdet Ihr Euch sicher fragen. Der Grund dafür ist, dass ich mit Thomas ein sehr ungewöhnliches Trainingsangebot entwickelt und nun schon seit ein paar Jahren in der Praxis erfolgreich erprobt habe - ein Trainingsangebot für Führungskräfte. Wir nennen es „Die Weinerliche Führungskraft - Leadership mit allen Sinnen“. In den Trainings und Workshops generieren wir gleichermaßen Führungs- und Weinkompetenz, wir spielen mit den Parallelen beider Welten und verankern Führungswissen gerade deshalb so nachhaltig, weil wir es mit sinnlichen Eindrücken übers Weinverkosten verstärken und auf diesem Weg leichter erinnerbar machen. Wir finden, es ist eine einmalige Cuvée, kreiert von zwei Experten aus ganz unterschiedlichen Genres, der eine aus der Führungs-, der andere aus der Weinwelt.
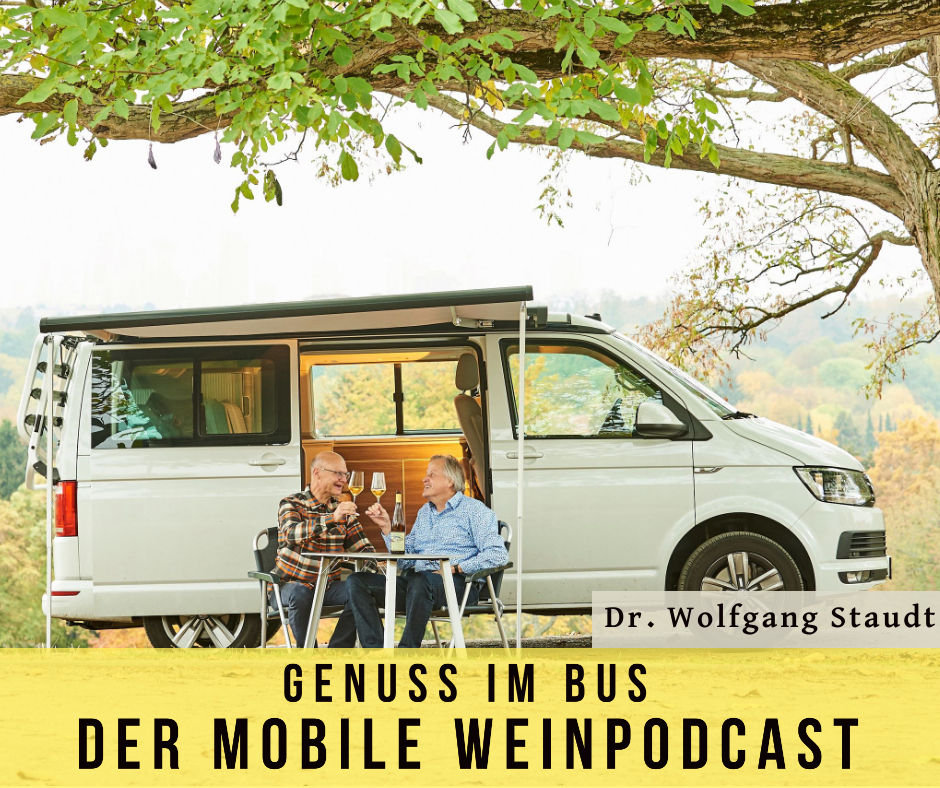
Corinna & Christian Eppelmann - junge rheinhessische Avantgarde
Für eine weitere Episode von Genuss im Bus bin ich nach Rheinhessen gefahren, um in Stadecken-Elsheim die jungen Winzer Corinna und Christian Eppelmann zu treffen. Nachdem ich mehr als einmal von anderen, von mir sehr geschätzten rheinhessischen Winzern den Tipp bekam, dieses Weingut im Auge zu behalten, war klar, dass ich da demnächst unbedingt hin muss. Was mir anfangs nicht klar war, war dass die noch sehr junge Generation der Winzerfamilie Eppelmann, die Geschwister Corinna und Christian mich empfangen und mit mir die Podcast-Episode bestreiten würden. Ihre Eltern, Timo und Simone, tragen zwar noch die volle Verantwortung für den Betrieb, haben aber einem Modell eine Chance gegeben, ihre Kinder, die beide bis über die Ohren für Wein und den Winzerberuf brennen, frühzeitig in das operative Geschehen und die wichtigen Entscheidungsprozesse einzubinden. Der Dynamik im Weingut hat das tatsächlich einen rießen Schub beschert. Die beiden Jungen geben Gas: in Weinberg und Keller ebenso wie auf den verschiedenen Feldern des Vermarktungsprozesses. Im Gespräch mit Corinna und Christian wird schnell klar, wo die beiden hin wollen, ganz nach oben nämlich, zur Spitze zählen wollen sie, zunächst im Selztal, dann in Rheinhessen und dann mal sehen, was noch geht. Wer ihnen zuhört, bemerkt schon bald, dass sie einen Masterplan haben und dass sie langfristig denken. Sie sind weder naiv, noch ungeduldig. Aber mutig und zuversichtlich. Sie kennen die Risiken, die überall lauern, trauen sich jedoch zu, ihre Chancen in der Nische zu nutzen - nicht zuletzt weil sich die beiden untereinander so extrem gut verstehen und genial ergänzen und weil sie wissen, dass sie mit ihren Eltern, mit Timo und Simone liebevolle und kooperationsfähige Partner im Boot haben, die das ganze zu einem Dreamteam auf Augenhöhe machen. Freut Euch auf eine spannende Podcast-Episode, freut Euch auf Corinna und Christian Eppelmann, die Shootingstars aus dem rheinhessischen Selztal.

Der Weinjahrgang 2023 - der Winzer Bernhard Fiedler aus dem Burgenland berichtet
In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Winzerinnen und Winzern aus den verschiedenen deutschen und deutschsprachigen Anbaugebieten über ihre Erfahrungen hinsichtlich Witterungsverlauf, Reifeentwicklung und die Gefahren, denen die Reben im Jahresverlauf 2023 ausgesetzt waren. Fast unisono berichten die Winzer und Winzerinnen von einem ungemein herausfordernden Jahrgang, nicht nur hierzulande, sondern auch in unseren Nachbarländern. In den meisten deutschen Anbaugebieten folgten auf einen entspannten und überwiegend vielversprechenden Start Hochdruckwetterlagen, die dem Oidium, also dem Mehltau-Befall günstige Bedingungen boten. Das waren trockene und meist sonnige Tage, denen Nächte mit niedrigen Temperaturen folgten. Die relative Luftfeuchtigkeit stieg. War diese Gefahr gebannt, folgte an nicht wenigen Orten in den folgenden Wochen die nächste Herausforderung. Warme, z.T. heiße Temperaturen mit so gut wie keinem Niederschlag verursachte Trockenstress. Als dann die ersehnten Niederschläge endlich in der 2. Julihälfte kamen, war die Freude groß und die Situation in den Weinbergen entspannte sich. Aus diesem Segen wurde jedoch mit zunehmendem Dauerregen ein Fluch. Das verfügbare Wasser lud die Beeren einerseits ein, schnell zu wachsen, andererseits blieb die Reifeentwicklung wegen fehlender Wärme und Sonneneinstrahlung in dieser Phase zurück. Beeren, die schnell sehr groß werden, neigen dazu sich gegenseitig abzudrücken und aufzuplatzen. Der Infektionsdruck nimmt zu. Fliegen werden angelockt. In manchen Lagen und bei manchen Rebsorten musste die Lese früh beginnen, weil weiteres Zuwarten zu noch mehr Fäulnis geführt hätte. Nicht überall waren die Trauben optimal reif. Andererseits drohten Säureverluste aufgrund der warmen Herbsttage. Es war nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spätreifende Sorten waren diesmal im Vorteil. Im Vorteil waren auch all jene, die ihre Weinberge im Schuss hatten, über gesunde und ältere Anlagen und ausreichend Humus verfügten und beim Pflanzenschutz ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Aber auch sie hatten während der Lese alle Hände voll zu tun, mussten die Zahl der Helfer erhöhen und so penibel selektieren, dass sich der Leseaufwand in machen Lagen und für manche Rebsorten exorbitant erhöhte. Die Erträge gingen gegenüber den Vorjahren zurück, obwohl die Verbände noch wenige Wochen zuvor das Gegenteil prognostiziert hatten. Dort, wo der Zustand der Trauben ein weiteres Zuwarten mit der Lese erlaubte, konnte man vom weitgehend stabilen und warmen Herbstwetter profitieren. Auf jeden Fall war es eine ungemein zügige Lese, für viele Betriebe die schnellste Lese, die sie je erlebt haben. Nicht zuletzt, weil sowohl Guts- und Lagenweine als auch die vielen unterschiedlichen Rebsorten praktisch gleichzeitig reif waren. Das zusammen mit dem hohen Selektionsaufwand machte die Weinlese 2023 zu einem echten Kraftakt, zu einer riesen Herausforderung.

Der Weinjahrgang 2023 - der Winzer Herbert Zillinger aus dem Weinviertel berichtet
In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Winzerinnen und Winzern aus den verschiedenen deutschen und deutschsprachigen Anbaugebieten über ihre Erfahrungen hinsichtlich Witterungsverlauf, Reifeentwicklung und die Gefahren, denen die Reben im Jahresverlauf 2023 ausgesetzt waren. Fast unisono berichten die Winzer und Winzerinnen von einem ungemein herausfordernden Jahrgang, nicht nur hierzulande, sondern auch in unseren Nachbarländern. In den meisten deutschen Anbaugebieten folgten auf einen entspannten und überwiegend vielversprechenden Start Hochdruckwetterlagen, die dem Oidium, also dem Mehltau-Befall günstige Bedingungen boten. Das waren trockene und meist sonnige Tage, denen Nächte mit niedrigen Temperaturen folgten. Die relative Luftfeuchtigkeit stieg. War diese Gefahr gebannt, folgte an nicht wenigen Orten in den folgenden Wochen die nächste Herausforderung. Warme, z.T. heiße Temperaturen mit so gut wie keinem Niederschlag verursachte Trockenstress. Als dann die ersehnten Niederschläge endlich in der 2. Julihälfte kamen, war die Freude groß und die Situation in den Weinbergen entspannte sich. Aus diesem Segen wurde jedoch mit zunehmendem Dauerregen ein Fluch. Das verfügbare Wasser lud die Beeren einerseits ein, schnell zu wachsen, andererseits blieb die Reifeentwicklung wegen fehlender Wärme und Sonneneinstrahlung in dieser Phase zurück. Beeren, die schnell sehr groß werden, neigen dazu sich gegenseitig abzudrücken und aufzuplatzen. Der Infektionsdruck nimmt zu. Fliegen werden angelockt. In manchen Lagen und bei manchen Rebsorten musste die Lese früh beginnen, weil weiteres Zuwarten zu noch mehr Fäulnis geführt hätte. Nicht überall waren die Trauben optimal reif. Andererseits drohten Säureverluste aufgrund der warmen Herbsttage. Es war nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spätreifende Sorten waren diesmal im Vorteil. Im Vorteil waren auch all jene, die ihre Weinberge im Schuss hatten, über gesunde und ältere Anlagen und ausreichend Humus verfügten und beim Pflanzenschutz ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Aber auch sie hatten während der Lese alle Hände voll zu tun, mussten die Zahl der Helfer erhöhen und so penibel selektieren, dass sich der Leseaufwand in machen Lagen und für manche Rebsorten exorbitant erhöhte. Die Erträge gingen gegenüber den Vorjahren zurück, obwohl die Verbände noch wenige Wochen zuvor das Gegenteil prognostiziert hatten. Dort, wo der Zustand der Trauben ein weiteres Zuwarten mit der Lese erlaubte, konnte man vom weitgehend stabilen und warmen Herbstwetter profitieren. Auf jeden Fall war es eine ungemein zügige Lese, für viele Betriebe die schnellste Lese, die sie je erlebt haben. Nicht zuletzt, weil sowohl Guts- und Lagenweine als auch die vielen unterschiedlichen Rebsorten praktisch gleichzeitig reif waren. Das zusammen mit dem hohen Selektionsaufwand machte die Weinlese 2023 zu einem echten Kraftakt, zu einer riesen Herausforderung.

Der Weinjahrgang 2023 - der Winzer Martin Gojer aus Bozen berichtet
In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Winzerinnen und Winzern aus den verschiedenen deutschen Anbaugebieten über ihre Erfahrungen hinsichtlich Witterungsverlauf, Reifeentwicklung und die Gefahren, denen die Reben im Jahresverlauf 2023 ausgesetzt waren. Fast unisono berichten die Winzer und Winzerinnen von einem ungemein herausfordernden Jahrgang, nicht nur hierzulande, sondern auch in unseren Nachbarländern. In den meisten deutschen Anbaugebieten folgten auf einen entspannten und überwiegend vielversprechenden Start Hochdruckwetterlagen, die dem Oidium, also dem Mehltau-Befall günstige Bedingungen boten. Das waren trockene und meist sonnige Tage, denen Nächte mit niedrigen Temperaturen folgten. Die relative Luftfeuchtigkeit stieg. War diese Gefahr gebannt, folgte an nicht wenigen Orten in den folgenden Wochen die nächste Herausforderung. Warme, z.T. heiße Temperaturen mit so gut wie keinem Niederschlag verursachte Trockenstress. Als dann die ersehnten Niederschläge endlich in der 2. Julihälfte kamen, war die Freude groß und die Situation in den Weinbergen entspannte sich. Aus diesem Segen wurde jedoch mit zunehmendem Dauerregen ein Fluch. Das verfügbare Wasser lud die Beeren einerseits ein, schnell zu wachsen, andererseits blieb die Reifeentwicklung wegen fehlender Wärme und Sonneneinstrahlung in dieser Phase zurück. Beeren, die schnell sehr groß werden, neigen dazu sich gegenseitig abzudrücken und aufzuplatzen. Der Infektionsdruck nimmt zu. Fliegen werden angelockt. In manchen Lagen und bei manchen Rebsorten musste die Lese früh beginnen, weil weiteres Zuwarten zu noch mehr Fäulnis geführt hätte. Nicht überall waren die Trauben optimal reif. Andererseits drohten Säureverluste aufgrund der warmen Herbsttage. Es war nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spätreifende Sorten waren diesmal im Vorteil. Im Vorteil waren auch all jene, die ihre Weinberge im Schuss hatten, über gesunde und ältere Anlagen und ausreichend Humus verfügten und beim Pflanzenschutz ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Aber auch sie hatten während der Lese alle Hände voll zu tun, mussten die Zahl der Helfer erhöhen und so penibel selektieren, dass sich der Leseaufwand in machen Lagen und für manche Rebsorten exorbitant erhöhte. Die Erträge gingen gegenüber den Vorjahren zurück, obwohl die Verbände noch wenige Wochen zuvor das Gegenteil prognostiziert hatten. Dort, wo der Zustand der Trauben ein weiteres Zuwarten mit der Lese erlaubte, konnte man vom weitgehend stabilen und warmen Herbstwetter profitieren. Auf jeden Fall war es eine ungemein zügige Lese, für viele Betriebe die schnellste Lese, die sie je erlebt haben. Nicht zuletzt, weil sowohl Guts- und Lagenweine als auch die vielen unterschiedlichen Rebsorten praktisch gleichzeitig reif waren. Das zusammen mit dem hohen Selektionsaufwand machte die Weinlese 2023 zu einem echten Kraftakt, zu einer riesen Herausforderung.

Der Weinjahrgang 2023 - der Winzer Florian Wecker aus Kinheim an der Mittelmosel berichtet
In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Winzerinnen und Winzern aus den verschiedenen deutschen Anbaugebieten über ihre Erfahrungen hinsichtlich Witterungsverlauf, Reifeentwicklung und die Gefahren, denen die Reben im Jahresverlauf 2023 ausgesetzt waren. Fast unisono berichten die Winzer und Winzerinnen von einem ungemein herausfordernden Jahrgang, nicht nur hierzulande, sondern auch in unseren Nachbarländern. In den meisten deutschen Anbaugebieten folgten auf einen entspannten und überwiegend vielversprechenden Start Hochdruckwetterlagen, die dem Oidium, also dem Mehltau-Befall günstige Bedingungen boten. Das waren trockene und meist sonnige Tage, denen Nächte mit niedrigen Temperaturen folgten. Die relative Luftfeuchtigkeit stieg. War diese Gefahr gebannt, folgte an nicht wenigen Orten in den folgenden Wochen die nächste Herausforderung. Warme, z.T. heiße Temperaturen mit so gut wie keinem Niederschlag verursachte Trockenstress. Als dann die ersehnten Niederschläge endlich in der 2. Julihälfte kamen, war die Freude groß und die Situation in den Weinbergen entspannte sich. Aus diesem Segen wurde jedoch mit zunehmendem Dauerregen ein Fluch. Das verfügbare Wasser lud die Beeren einerseits ein, schnell zu wachsen, andererseits blieb die Reifeentwicklung wegen fehlender Wärme und Sonneneinstrahlung in dieser Phase zurück. Beeren, die schnell sehr groß werden, neigen dazu sich gegenseitig abzudrücken und aufzuplatzen. Der Infektionsdruck nimmt zu. Fliegen werden angelockt. In manchen Lagen und bei manchen Rebsorten musste die Lese früh beginnen, weil weiteres Zuwarten zu noch mehr Fäulnis geführt hätte. Nicht überall waren die Trauben optimal reif. Andererseits drohten Säureverluste aufgrund der warmen Herbsttage. Es war nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spätreifende Sorten waren diesmal im Vorteil. Im Vorteil waren auch all jene, die ihre Weinberge im Schuss hatten, über gesunde und ältere Anlagen und ausreichend Humus verfügten und beim Pflanzenschutz ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Aber auch sie hatten während der Lese alle Hände voll zu tun, mussten die Zahl der Helfer erhöhen und so penibel selektieren, dass sich der Leseaufwand in machen Lagen und für manche Rebsorten exorbitant erhöhte. Die Erträge gingen gegenüber den Vorjahren zurück, obwohl die Verbände noch wenige Wochen zuvor das Gegenteil prognostiziert hatten. Dort, wo der Zustand der Trauben ein weiteres Zuwarten mit der Lese erlaubte, konnte man vom weitgehend stabilen und warmen Herbstwetter profitieren. Auf jeden Fall war es eine ungemein zügige Lese, für viele Betriebe die schnellste Lese, die sie je erlebt haben. Nicht zuletzt, weil sowohl Guts- und Lagenweine als auch die vielen unterschiedlichen Rebsorten praktisch gleichzeitig reif waren. Das zusammen mit dem hohen Selektionsaufwand machte die Weinlese 2023 zu einem echten Kraftakt, zu einer riesen Herausforderung.

Der Weinjahrgang 2023 - der Winzer Jonas Dostert aus Nittel an der Obermosel berichtet
In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Winzerinnen und Winzern aus den verschiedenen deutschen Anbaugebieten über ihre Erfahrungen hinsichtlich Witterungsverlauf, Reifeentwicklung und die Gefahren, denen die Reben im Jahresverlauf 2023 ausgesetzt waren. Fast unisono berichten die Winzer und Winzerinnen von einem ungemein herausfordernden Jahrgang, nicht nur hierzulande, sondern auch in unseren Nachbarländern. In den meisten deutschen Anbaugebieten folgten auf einen entspannten und überwiegend vielversprechenden Start Hochdruckwetterlagen, die dem Oidium, also dem Mehltau-Befall günstige Bedingungen boten. Das waren trockene und meist sonnige Tage, denen Nächte mit niedrigen Temperaturen folgten. Die relative Luftfeuchtigkeit stieg. War diese Gefahr gebannt, folgte an nicht wenigen Orten in den folgenden Wochen die nächste Herausforderung. Warme, z.T. heiße Temperaturen mit so gut wie keinem Niederschlag verursachte Trockenstress. Als dann die ersehnten Niederschläge endlich in der 2. Julihälfte kamen, war die Freude groß und die Situation in den Weinbergen entspannte sich. Aus diesem Segen wurde jedoch mit zunehmendem Dauerregen ein Fluch. Das verfügbare Wasser lud die Beeren einerseits ein, schnell zu wachsen, andererseits blieb die Reifeentwicklung wegen fehlender Wärme und Sonneneinstrahlung in dieser Phase zurück. Beeren, die schnell sehr groß werden, neigen dazu sich gegenseitig abzudrücken und aufzuplatzen. Der Infektionsdruck nimmt zu. Fliegen werden angelockt. In manchen Lagen und bei manchen Rebsorten musste die Lese früh beginnen, weil weiteres Zuwarten zu noch mehr Fäulnis geführt hätte. Nicht überall waren die Trauben optimal reif. Andererseits drohten Säureverluste aufgrund der warmen Herbsttage. Es war nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spätreifende Sorten waren diesmal im Vorteil. Im Vorteil waren auch all jene, die ihre Weinberge im Schuss hatten, über gesunde und ältere Anlagen und ausreichend Humus verfügten und beim Pflanzenschutz ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Aber auch sie hatten während der Lese alle Hände voll zu tun, mussten die Zahl der Helfer erhöhen und so penibel selektieren, dass sich der Leseaufwand in machen Lagen und für manche Rebsorten exorbitant erhöhte. Die Erträge gingen gegenüber den Vorjahren zurück, obwohl die Verbände noch wenige Wochen zuvor das Gegenteil prognostiziert hatten. Dort, wo der Zustand der Trauben ein weiteres Zuwarten mit der Lese erlaubte, konnte man vom weitgehend stabilen und warmen Herbstwetter profitieren. Auf jeden Fall war es eine ungemein zügige Lese, für viele Betriebe die schnellste Lese, die sie je erlebt haben. Nicht zuletzt, weil sowohl Guts- und Lagenweine als auch die vielen unterschiedlichen Rebsorten praktisch gleichzeitig reif waren. Das zusammen mit dem hohen Selektionsaufwand machte die Weinlese 2023 zu einem echten Kraftakt, zu einer riesen Herausforderung.

Der Weinjahrgang 2023 - der Winzer Hanspeter Ziereisen aus Efringen-Kirchen im Markgräflerland berichtet
In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Winzerinnen und Winzern aus den verschiedenen deutschen Anbaugebieten über ihre Erfahrungen hinsichtlich Witterungsverlauf, Reifeentwicklung und die Gefahren, denen die Reben im Jahresverlauf 2023 ausgesetzt waren. Fast unisono berichten die Winzer und Winzerinnen von einem ungemein herausfordernden Jahrgang, nicht nur hierzulande, sondern auch in unseren Nachbarländern. In den meisten deutschen Anbaugebieten folgten auf einen entspannten und überwiegend vielversprechenden Start Hochdruckwetterlagen, die dem Oidium, also dem Mehltau-Befall günstige Bedingungen boten. Das waren trockene und meist sonnige Tage, denen Nächte mit niedrigen Temperaturen folgten. Die relative Luftfeuchtigkeit stieg. War diese Gefahr gebannt, folgte an nicht wenigen Orten in den folgenden Wochen die nächste Herausforderung. Warme, z.T. heiße Temperaturen mit so gut wie keinem Niederschlag verursachte Trockenstress. Als dann die ersehnten Niederschläge endlich in der 2. Julihälfte kamen, war die Freude groß und die Situation in den Weinbergen entspannte sich. Aus diesem Segen wurde jedoch mit zunehmendem Dauerregen ein Fluch. Das verfügbare Wasser lud die Beeren einerseits ein, schnell zu wachsen, andererseits blieb die Reifeentwicklung wegen fehlender Wärme und Sonneneinstrahlung in dieser Phase zurück. Beeren, die schnell sehr groß werden, neigen dazu sich gegenseitig abzudrücken und aufzuplatzen. Der Infektionsdruck nimmt zu. Fliegen werden angelockt. In manchen Lagen und bei manchen Rebsorten musste die Lese früh beginnen, weil weiteres Zuwarten zu noch mehr Fäulnis geführt hätte. Nicht überall waren die Trauben optimal reif. Andererseits drohten Säureverluste aufgrund der warmen Herbsttage. Es war nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spätreifende Sorten waren diesmal im Vorteil. Im Vorteil waren auch all jene, die ihre Weinberge im Schuss hatten, über gesunde und ältere Anlagen und ausreichend Humus verfügten und beim Pflanzenschutz ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Aber auch sie hatten während der Lese alle Hände voll zu tun, mussten die Zahl der Helfer erhöhen und so penibel selektieren, dass sich der Leseaufwand in machen Lagen und für manche Rebsorten exorbitant erhöhte. Die Erträge gingen gegenüber den Vorjahren zurück, obwohl die Verbände noch wenige Wochen zuvor das Gegenteil prognostiziert hatten. Dort, wo der Zustand der Trauben ein weiteres Zuwarten mit der Lese erlaubte, konnte man vom weitgehend stabilen und warmen Herbstwetter profitieren. Auf jeden Fall war es eine ungemein zügige Lese, für viele Betriebe die schnellste Lese, die sie je erlebt haben. Nicht zuletzt, weil sowohl Guts- und Lagenweine als auch die vielen unterschiedlichen Rebsorten praktisch gleichzeitig reif waren. Das zusammen mit dem hohen Selektionsaufwand machte die Weinlese 2023 zu einem echten Kraftakt, zu einer riesen Herausforderung.

Der Weinjahrgang 2023 - der Winzer Matthias Wörner aus Durbach in der Ortenau berichtet
In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Winzerinnen und Winzern aus den verschiedenen deutschen Anbaugebieten über ihre Erfahrungen hinsichtlich Witterungsverlauf, Reifeentwicklung und die Gefahren, denen die Reben im Jahresverlauf 2023 ausgesetzt waren. Fast unisono berichten die Winzer und Winzerinnen von einem ungemein herausfordernden Jahrgang, nicht nur hierzulande, sondern auch in unseren Nachbarländern. In den meisten deutschen Anbaugebieten folgten auf einen entspannten und überwiegend vielversprechenden Start Hochdruckwetterlagen, die dem Oidium, also dem Mehltau-Befall günstige Bedingungen boten. Das waren trockene und meist sonnige Tage, denen Nächte mit niedrigen Temperaturen folgten. Die relative Luftfeuchtigkeit stieg. War diese Gefahr gebannt, folgte an nicht wenigen Orten in den folgenden Wochen die nächste Herausforderung. Warme, z.T. heiße Temperaturen mit so gut wie keinem Niederschlag verursachte Trockenstress. Als dann die ersehnten Niederschläge endlich in der 2. Julihälfte kamen, war die Freude groß und die Situation in den Weinbergen entspannte sich. Aus diesem Segen wurde jedoch mit zunehmendem Dauerregen ein Fluch. Das verfügbare Wasser lud die Beeren einerseits ein, schnell zu wachsen, andererseits blieb die Reifeentwicklung wegen fehlender Wärme und Sonneneinstrahlung in dieser Phase zurück. Beeren, die schnell sehr groß werden, neigen dazu sich gegenseitig abzudrücken und aufzuplatzen. Der Infektionsdruck nimmt zu. Fliegen werden angelockt. In manchen Lagen und bei manchen Rebsorten musste die Lese früh beginnen, weil weiteres Zuwarten zu noch mehr Fäulnis geführt hätte. Nicht überall waren die Trauben optimal reif. Andererseits drohten Säureverluste aufgrund der warmen Herbsttage. Es war nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spätreifende Sorten waren diesmal im Vorteil. Im Vorteil waren auch all jene, die ihre Weinberge im Schuss hatten, über gesunde und ältere Anlagen und ausreichend Humus verfügten und beim Pflanzenschutz ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Aber auch sie hatten während der Lese alle Hände voll zu tun, mussten die Zahl der Helfer erhöhen und so penibel selektieren, dass sich der Leseaufwand in machen Lagen und für manche Rebsorten exorbitant erhöhte. Die Erträge gingen gegenüber den Vorjahren zurück, obwohl die Verbände noch wenige Wochen zuvor das Gegenteil prognostiziert hatten. Dort, wo der Zustand der Trauben ein weiteres Zuwarten mit der Lese erlaubte, konnte man vom weitgehend stabilen und warmen Herbstwetter profitieren. Auf jeden Fall war es eine ungemein zügige Lese, für viele Betriebe die schnellste Lese, die sie je erlebt haben. Nicht zuletzt, weil sowohl Guts- und Lagenweine als auch die vielen unterschiedlichen Rebsorten praktisch gleichzeitig reif waren. Das zusammen mit dem hohen Selektionsaufwand machte die Weinlese 2023 zu einem echten Kraftakt, zu einer riesen Herausforderung.

Der Weinjahrgang 2023 - der Winzer Jochen Beurer aus dem Remstal berichtet
In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Winzerinnen und Winzern aus den verschiedenen deutschen Anbaugebieten über ihre Erfahrungen hinsichtlich Witterungsverlauf, Reifeentwicklung und die Gefahren, denen die Reben im Jahresverlauf 2023 ausgesetzt waren. Fast unisono berichten die Winzer und Winzerinnen von einem ungemein herausfordernden Jahrgang, nicht nur hierzulande, sondern auch in unseren Nachbarländern. In den meisten deutschen Anbaugebieten folgten auf einen entspannten und überwiegend vielversprechenden Start Hochdruckwetterlagen, die dem Oidium, also dem Mehltau-Befall günstige Bedingungen boten. Das waren trockene und meist sonnige Tage, denen Nächte mit niedrigen Temperaturen folgten. Die relative Luftfeuchtigkeit stieg. War diese Gefahr gebannt, folgte an nicht wenigen Orten in den folgenden Wochen die nächste Herausforderung. Warme, z.T. heiße Temperaturen mit so gut wie keinem Niederschlag verursachte Trockenstress. Als dann die ersehnten Niederschläge endlich in der 2. Julihälfte kamen, war die Freude groß und die Situation in den Weinbergen entspannte sich. Aus diesem Segen wurde jedoch mit zunehmendem Dauerregen ein Fluch. Das verfügbare Wasser lud die Beeren einerseits ein, schnell zu wachsen, andererseits blieb die Reifeentwicklung wegen fehlender Wärme und Sonneneinstrahlung in dieser Phase zurück. Beeren, die schnell sehr groß werden, neigen dazu sich gegenseitig abzudrücken und aufzuplatzen. Der Infektionsdruck nimmt zu. Fliegen werden angelockt. In manchen Lagen und bei manchen Rebsorten musste die Lese früh beginnen, weil weiteres Zuwarten zu noch mehr Fäulnis geführt hätte. Nicht überall waren die Trauben optimal reif. Andererseits drohten Säureverluste aufgrund der warmen Herbsttage. Es war nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spätreifende Sorten waren diesmal im Vorteil. Im Vorteil waren auch all jene, die ihre Weinberge im Schuss hatten, über gesunde und ältere Anlagen und ausreichend Humus verfügten und beim Pflanzenschutz ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Aber auch sie hatten während der Lese alle Hände voll zu tun, mussten die Zahl der Helfer erhöhen und so penibel selektieren, dass sich der Leseaufwand in machen Lagen und für manche Rebsorten exorbitant erhöhte. Die Erträge gingen gegenüber den Vorjahren zurück, obwohl die Verbände noch wenige Wochen zuvor das Gegenteil prognostiziert hatten. Dort, wo der Zustand der Trauben ein weiteres Zuwarten mit der Lese erlaubte, konnte man vom weitgehend stabilen und warmen Herbstwetter profitieren. Auf jeden Fall war es eine ungemein zügige Lese, für viele Betriebe die schnellste Lese, die sie je erlebt haben. Nicht zuletzt, weil sowohl Guts- und Lagenweine als auch die vielen unterschiedlichen Rebsorten praktisch gleichzeitig reif waren. Das zusammen mit dem hohen Selektionsaufwand machte die Weinlese 2023 zu einem echten Kraftakt, zu einer riesen Herausforderung.

Der Weinjahrgang 2023 - die Winzerin Laura Seufert aus Iphofen berichtet
In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Winzerinnen und Winzern aus den verschiedenen deutschen Anbaugebieten über ihre Erfahrungen hinsichtlich Witterungsverlauf, Reifeentwicklung und die Gefahren, denen die Reben im Jahresverlauf 2023 ausgesetzt waren. Fast unisono berichten die Winzer und Winzerinnen von einem ungemein herausfordernden Jahrgang, nicht nur hierzulande, sondern auch in unseren Nachbarländern. In den meisten deutschen Anbaugebieten folgten auf einen entspannten und überwiegend vielversprechenden Start Hochdruckwetterlagen, die dem Oidium, also dem Mehltau-Befall günstige Bedingungen boten. Das waren trockene und meist sonnige Tage, denen Nächte mit niedrigen Temperaturen folgten. Die relative Luftfeuchtigkeit stieg. War diese Gefahr gebannt, folgte an nicht wenigen Orten in den folgenden Wochen die nächste Herausforderung. Warme, z.T. heiße Temperaturen mit so gut wie keinem Niederschlag verursachte Trockenstress. Als dann die ersehnten Niederschläge endlich in der 2. Julihälfte kamen, war die Freude groß und die Situation in den Weinbergen entspannte sich. Aus diesem Segen wurde jedoch mit zunehmendem Dauerregen ein Fluch. Das verfügbare Wasser lud die Beeren einerseits ein, schnell zu wachsen, andererseits blieb die Reifeentwicklung wegen fehlender Wärme und Sonneneinstrahlung in dieser Phase zurück. Beeren, die schnell sehr groß werden, neigen dazu sich gegenseitig abzudrücken und aufzuplatzen. Der Infektionsdruck nimmt zu. Fliegen werden angelockt. In manchen Lagen und bei manchen Rebsorten musste die Lese früh beginnen, weil weiteres Zuwarten zu noch mehr Fäulnis geführt hätte. Nicht überall waren die Trauben optimal reif. Andererseits drohten Säureverluste aufgrund der warmen Herbsttage. Es war nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spätreifende Sorten waren diesmal im Vorteil. Im Vorteil waren auch all jene, die ihre Weinberge im Schuss hatten, über gesunde und ältere Anlagen und ausreichend Humus verfügten und beim Pflanzenschutz ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Aber auch sie hatten während der Lese alle Hände voll zu tun, mussten die Zahl der Helfer erhöhen und so penibel selektieren, dass sich der Leseaufwand in machen Lagen und für manche Rebsorten exorbitant erhöhte. Die Erträge gingen gegenüber den Vorjahren zurück, obwohl die Verbände noch wenige Wochen zuvor das Gegenteil prognostiziert hatten. Dort, wo der Zustand der Trauben ein weiteres Zuwarten mit der Lese erlaubte, konnte man vom weitgehend stabilen und warmen Herbstwetter profitieren. Auf jeden Fall war es eine ungemein zügige Lese, für viele Betriebe die schnellste Lese, die sie je erlebt haben. Nicht zuletzt, weil sowohl Guts- und Lagenweine als auch die vielen unterschiedlichen Rebsorten praktisch gleichzeitig reif waren. Das zusammen mit dem hohen Selektionsaufwand machte die Weinlese 2023 zu einem echten Kraftakt, zu einer riesen Herausforderung.

Der Weinjahrgang 2023 - Robert Haller vom Bürgerspital in Würzburg berichtet
In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Winzerinnen und Winzern aus den verschiedenen deutschen Anbaugebieten über ihre Erfahrungen hinsichtlich Witterungsverlauf, Reifeentwicklung und die Gefahren, denen die Reben im Jahresverlauf 2023 ausgesetzt waren. Fast unisono berichten die Winzer und Winzerinnen von einem ungemein herausfordernden Jahrgang, nicht nur hierzulande, sondern auch in unseren Nachbarländern. In den meisten deutschen Anbaugebieten folgten auf einen entspannten und überwiegend vielversprechenden Start Hochdruckwetterlagen, die dem Oidium, also dem Mehltau-Befall günstige Bedingungen boten. Das waren trockene und meist sonnige Tage, denen Nächte mit niedrigen Temperaturen folgten. Die relative Luftfeuchtigkeit stieg. War diese Gefahr gebannt, folgte an nicht wenigen Orten in den folgenden Wochen die nächste Herausforderung. Warme, z.T. heiße Temperaturen mit so gut wie keinem Niederschlag verursachte Trockenstress. Als dann die ersehnten Niederschläge endlich in der 2. Julihälfte kamen, war die Freude groß und die Situation in den Weinbergen entspannte sich. Aus diesem Segen wurde jedoch mit zunehmendem Dauerregen ein Fluch. Das verfügbare Wasser lud die Beeren einerseits ein, schnell zu wachsen, andererseits blieb die Reifeentwicklung wegen fehlender Wärme und Sonneneinstrahlung in dieser Phase zurück. Beeren, die schnell sehr groß werden, neigen dazu sich gegenseitig abzudrücken und aufzuplatzen. Der Infektionsdruck nimmt zu. Fliegen werden angelockt. In manchen Lagen und bei manchen Rebsorten musste die Lese früh beginnen, weil weiteres Zuwarten zu noch mehr Fäulnis geführt hätte. Nicht überall waren die Trauben optimal reif. Andererseits drohten Säureverluste aufgrund der warmen Herbsttage. Es war nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spätreifende Sorten waren diesmal im Vorteil. Im Vorteil waren auch all jene, die ihre Weinberge im Schuss hatten, über gesunde und ältere Anlagen und ausreichend Humus verfügten und beim Pflanzenschutz ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Aber auch sie hatten während der Lese alle Hände voll zu tun, mussten die Zahl der Helfer erhöhen und so penibel selektieren, dass sich der Leseaufwand in machen Lagen und für manche Rebsorten exorbitant erhöhte. Die Erträge gingen gegenüber den Vorjahren zurück, obwohl die Verbände noch wenige Wochen zuvor das Gegenteil prognostiziert hatten. Dort, wo der Zustand der Trauben ein weiteres Zuwarten mit der Lese erlaubte, konnte man vom weitgehend stabilen und warmen Herbstwetter profitieren. Auf jeden Fall war es eine ungemein zügige Lese, für viele Betriebe die schnellste Lese, die sie je erlebt haben. Nicht zuletzt, weil sowohl Guts- und Lagenweine als auch die vielen unterschiedlichen Rebsorten praktisch gleichzeitig reif waren. Das zusammen mit dem hohen Selektionsaufwand machte die Weinlese 2023 zu einem echten Kraftakt, zu einer riesen Herausforderung.

Der Weinjahrgang 2023 - Gerd Bernhart berichtet über die Bedingungen in der Südpfalz
In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Winzerinnen und Winzern aus den verschiedenen deutschen Anbaugebieten über ihre Erfahrungen hinsichtlich Witterungsverlauf, Reifeentwicklung und die Gefahren, denen die Reben im Jahresverlauf 2023 ausgesetzt waren. Fast unisono berichten die Winzer und Winzerinnen von einem ungemein herausfordernden Jahrgang, nicht nur hierzulande, sondern auch in unseren Nachbarländern. In den meisten deutschen Anbaugebieten folgten auf einen entspannten und überwiegend vielversprechenden Start Hochdruckwetterlagen, die dem Oidium, also dem Mehltau-Befall günstige Bedingungen boten. Das waren trockene und meist sonnige Tage, denen Nächte mit niedrigen Temperaturen folgten. Die relative Luftfeuchtigkeit stieg. War diese Gefahr gebannt, folgte an nicht wenigen Orten in den folgenden Wochen die nächste Herausforderung. Warme, z.T. heiße Temperaturen mit so gut wie keinem Niederschlag verursachte Trockenstress. Als dann die ersehnten Niederschläge endlich in der 2. Julihälfte kamen, war die Freude groß und die Situation in den Weinbergen entspannte sich. Aus diesem Segen wurde jedoch mit zunehmendem Dauerregen ein Fluch. Das verfügbare Wasser lud die Beeren einerseits ein, schnell zu wachsen, andererseits blieb die Reifeentwicklung wegen fehlender Wärme und Sonneneinstrahlung in dieser Phase zurück. Beeren, die schnell sehr groß werden, neigen dazu sich gegenseitig abzudrücken und aufzuplatzen. Der Infektionsdruck nimmt zu. Fliegen werden angelockt. In manchen Lagen und bei manchen Rebsorten musste die Lese früh beginnen, weil weiteres Zuwarten zu noch mehr Fäulnis geführt hätte. Nicht überall waren die Trauben optimal reif. Andererseits drohten Säureverluste aufgrund der warmen Herbsttage. Es war nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spätreifende Sorten waren diesmal im Vorteil. Im Vorteil waren auch all jene, die ihre Weinberge im Schuss hatten, über gesunde und ältere Anlagen und ausreichend Humus verfügten und beim Pflanzenschutz ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Aber auch sie hatten während der Lese alle Hände voll zu tun, mussten die Zahl der Helfer erhöhen und so penibel selektieren, dass sich der Leseaufwand in machen Lagen und für manche Rebsorten exorbitant erhöhte. Die Erträge gingen gegenüber den Vorjahren zurück, obwohl die Verbände noch wenige Wochen zuvor das Gegenteil prognostiziert hatten. Dort, wo der Zustand der Trauben ein weiteres Zuwarten mit der Lese erlaubte, konnte man vom weitgehend stabilen und warmen Herbstwetter profitieren. Auf jeden Fall war es eine ungemein zügige Lese, für viele Betriebe die schnellste Lese, die sie je erlebt haben. Nicht zuletzt, weil sowohl Guts- und Lagenweine als auch die vielen unterschiedlichen Rebsorten praktisch gleichzeitig reif waren. Das zusammen mit dem hohen Selektionsaufwand machte die Weinlese 2023 zu einem echten Kraftakt, zu einer riesen Herausforderung.

Der Weinjahrgang 2023 - Michael Andres berichtet über die Bedingungen an der Mittelhaardt, Pfalz
In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Winzerinnen und Winzern aus den verschiedenen deutschen Anbaugebieten über ihre Erfahrungen hinsichtlich Witterungsverlauf, Reifeentwicklung und die Gefahren, denen die Reben im Jahresverlauf 2023 ausgesetzt waren. Fast unisono berichten die Winzer und Winzerinnen von einem ungemein herausfordernden Jahrgang, nicht nur hierzulande, sondern auch in unseren Nachbarländern. In den meisten deutschen Anbaugebieten folgten auf einen entspannten und überwiegend vielversprechenden Start Hochdruckwetterlagen, die dem Oidium, also dem Mehltau-Befall günstige Bedingungen boten. Das waren trockene und meist sonnige Tage, denen Nächte mit niedrigen Temperaturen folgten. Die relative Luftfeuchtigkeit stieg. War diese Gefahr gebannt, folgte an nicht wenigen Orten in den folgenden Wochen die nächste Herausforderung. Warme, z.T. heiße Temperaturen mit so gut wie keinem Niederschlag verursachte Trockenstress. Als dann die ersehnten Niederschläge endlich in der 2. Julihälfte kamen, war die Freude groß und die Situation in den Weinbergen entspannte sich. Aus diesem Segen wurde jedoch mit zunehmendem Dauerregen ein Fluch. Das verfügbare Wasser lud die Beeren einerseits ein, schnell zu wachsen, andererseits blieb die Reifeentwicklung wegen fehlender Wärme und Sonneneinstrahlung in dieser Phase zurück. Beeren, die schnell sehr groß werden, neigen dazu sich gegenseitig abzudrücken und aufzuplatzen. Der Infektionsdruck nimmt zu. Fliegen werden angelockt. In manchen Lagen und bei manchen Rebsorten musste die Lese früh beginnen, weil weiteres Zuwarten zu noch mehr Fäulnis geführt hätte. Nicht überall waren die Trauben optimal reif. Andererseits drohten Säureverluste aufgrund der warmen Herbsttage. Es war nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spätreifende Sorten waren diesmal im Vorteil. Im Vorteil waren auch all jene, die ihre Weinberge im Schuss hatten, über gesunde und ältere Anlagen und ausreichend Humus verfügten und beim Pflanzenschutz ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Aber auch sie hatten während der Lese alle Hände voll zu tun, mussten die Zahl der Helfer erhöhen und so penibel selektieren, dass sich der Leseaufwand in machen Lagen und für manche Rebsorten exorbitant erhöhte. Die Erträge gingen gegenüber den Vorjahren zurück, obwohl die Verbände noch wenige Wochen zuvor das Gegenteil prognostiziert hatten. Dort, wo der Zustand der Trauben ein weiteres Zuwarten mit der Lese erlaubte, konnte man vom weitgehend stabilen und warmen Herbstwetter profitieren. Auf jeden Fall war es eine ungemein zügige Lese, für viele Betriebe die schnellste Lese, die sie je erlebt haben. Nicht zuletzt, weil sowohl Guts- und Lagenweine als auch die vielen unterschiedlichen Rebsorten praktisch gleichzeitig reif waren. Das zusammen mit dem hohen Selektionsaufwand machte die Weinlese 2023 zu einem echten Kraftakt, zu einer riesen Herausforderung.

Der Weinjahrgang 2023 - Lisa Bunn berichtet über die Bedingungen an der Rheinfront
In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Winzerinnen und Winzern aus den verschiedenen deutschen Anbaugebieten über ihre Erfahrungen hinsichtlich Witterungsverlauf, Reifeentwicklung und die Gefahren, denen die Reben im Jahresverlauf 2023 ausgesetzt waren. Fast unisono berichten die Winzer und Winzerinnen von einem ungemein herausfordernden Jahrgang, nicht nur hierzulande, sondern auch in unseren Nachbarländern. In den meisten deutschen Anbaugebieten folgten auf einen entspannten und überwiegend vielversprechenden Start Hochdruckwetterlagen, die dem Oidium, also dem Mehltau-Befall günstige Bedingungen boten. Das waren trockene und meist sonnige Tage, denen Nächte mit niedrigen Temperaturen folgten. Die relative Luftfeuchtigkeit stieg. War diese Gefahr gebannt, folgte an nicht wenigen Orten in den folgenden Wochen die nächste Herausforderung. Warme, z.T. heiße Temperaturen mit so gut wie keinem Niederschlag verursachte Trockenstress. Als dann die ersehnten Niederschläge endlich in der 2. Julihälfte kamen, war die Freude groß und die Situation in den Weinbergen entspannte sich. Aus diesem Segen wurde jedoch mit zunehmendem Dauerregen ein Fluch. Das verfügbare Wasser lud die Beeren einerseits ein, schnell zu wachsen, andererseits blieb die Reifeentwicklung wegen fehlender Wärme und Sonneneinstrahlung in dieser Phase zurück. Beeren, die schnell sehr groß werden, neigen dazu sich gegenseitig abzudrücken und aufzuplatzen. Der Infektionsdruck nimmt zu. Fliegen werden angelockt. In manchen Lagen und bei manchen Rebsorten musste die Lese früh beginnen, weil weiteres Zuwarten zu noch mehr Fäulnis geführt hätte. Nicht überall waren die Trauben optimal reif. Andererseits drohten Säureverluste aufgrund der warmen Herbsttage. Es war nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spätreifende Sorten waren diesmal im Vorteil. Im Vorteil waren auch all jene, die ihre Weinberge im Schuss hatten, über gesunde und ältere Anlagen und ausreichend Humus verfügten und beim Pflanzenschutz ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Aber auch sie hatten während der Lese alle Hände voll zu tun, mussten die Zahl der Helfer erhöhen und so penibel selektieren, dass sich der Leseaufwand in machen Lagen und für manche Rebsorten exorbitant erhöhte. Die Erträge gingen gegenüber den Vorjahren zurück, obwohl die Verbände noch wenige Wochen zuvor das Gegenteil prognostiziert hatten. Dort, wo der Zustand der Trauben ein weiteres Zuwarten mit der Lese erlaubte, konnte man vom weitgehend stabilen und warmen Herbstwetter profitieren. Auf jeden Fall war es eine ungemein zügige Lese, für viele Betriebe die schnellste Lese, die sie je erlebt haben. Nicht zuletzt, weil sowohl Guts- und Lagenweine als auch die vielen unterschiedlichen Rebsorten praktisch gleichzeitig reif waren. Das zusammen mit dem hohen Selektionsaufwand machte die Weinlese 2023 zu einem echten Kraftakt, zu einer riesen Herausforderung.

Der Weinjahrgang 2023 - Stefan Sander berichtet über die Bedingungen im südlichen Rheinhessen am Rande des Wonnegaus
In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Winzerinnen und Winzern aus den verschiedenen deutschen Anbaugebieten über ihre Erfahrungen hinsichtlich Witterungsverlauf, Reifeentwicklung und die Gefahren, denen die Reben im Jahresverlauf 2023 ausgesetzt waren. Fast unisono berichten die Winzer und Winzerinnen von einem ungemein herausfordernden Jahrgang, nicht nur hierzulande, sondern auch in unseren Nachbarländern. In den meisten deutschen Anbaugebieten folgten auf einen entspannten und überwiegend vielversprechenden Start Hochdruckwetterlagen, die dem Oidium, also dem Mehltau-Befall günstige Bedingungen boten. Das waren trockene und meist sonnige Tage, denen Nächte mit niedrigen Temperaturen folgten. Die relative Luftfeuchtigkeit stieg. War diese Gefahr gebannt, folgte an nicht wenigen Orten in den folgenden Wochen die nächste Herausforderung. Warme, z.T. heiße Temperaturen mit so gut wie keinem Niederschlag verursachte Trockenstress. Als dann die ersehnten Niederschläge endlich in der 2. Julihälfte kamen, war die Freude groß und die Situation in den Weinbergen entspannte sich. Aus diesem Segen wurde jedoch mit zunehmendem Dauerregen ein Fluch. Das verfügbare Wasser lud die Beeren einerseits ein, schnell zu wachsen, andererseits blieb die Reifeentwicklung wegen fehlender Wärme und Sonneneinstrahlung in dieser Phase zurück. Beeren, die schnell sehr groß werden, neigen dazu sich gegenseitig abzudrücken und aufzuplatzen. Der Infektionsdruck nimmt zu. Fliegen werden angelockt. In manchen Lagen und bei manchen Rebsorten musste die Lese früh beginnen, weil weiteres Zuwarten zu noch mehr Fäulnis geführt hätte. Nicht überall waren die Trauben optimal reif. Andererseits drohten Säureverluste aufgrund der warmen Herbsttage. Es war nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spätreifende Sorten waren diesmal im Vorteil. Im Vorteil waren auch all jene, die ihre Weinberge im Schuss hatten, über gesunde und ältere Anlagen und ausreichend Humus verfügten und beim Pflanzenschutz ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Aber auch sie hatten während der Lese alle Hände voll zu tun, mussten die Zahl der Helfer erhöhen und so penibel selektieren, dass sich der Leseaufwand in machen Lagen und für manche Rebsorten exorbitant erhöhte. Die Erträge gingen gegenüber den Vorjahren zurück, obwohl die Verbände noch wenige Wochen zuvor das Gegenteil prognostiziert hatten. Dort, wo der Zustand der Trauben ein weiteres Zuwarten mit der Lese erlaubte, konnte man vom weitgehend stabilen und warmen Herbstwetter profitieren. Auf jeden Fall war es eine ungemein zügige Lese, für viele Betriebe die schnellste Lese, die sie je erlebt haben. Nicht zuletzt, weil sowohl Guts- und Lagenweine als auch die vielen unterschiedlichen Rebsorten praktisch gleichzeitig reif waren. Das zusammen mit dem hohen Selektionsaufwand machte die Weinlese 2023 zu einem echten Kraftakt, zu einer riesen Herausforderung.

Der Weinjahrgang 2023 - Matthias Runkel berichtet über die Bedingungen im nördlichen Rheinhessen
In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Winzerinnen und Winzern aus den verschiedenen deutschen Anbaugebieten über ihre Erfahrungen hinsichtlich Witterungsverlauf, Reifeentwicklung und die Gefahren, denen die Reben im Jahresverlauf 2023 ausgesetzt waren. Fast unisono berichten die Winzer und Winzerinnen von einem ungemein herausfordernden Jahrgang, nicht nur hierzulande, sondern auch in unseren Nachbarländern. In den meisten deutschen Anbaugebieten folgten auf einen entspannten und überwiegend vielversprechenden Start Hochdruckwetterlagen, die dem Oidium, also dem Mehltau-Befall günstige Bedingungen boten. Das waren trockene und meist sonnige Tage, denen Nächte mit niedrigen Temperaturen folgten. Die relative Luftfeuchtigkeit stieg. War diese Gefahr gebannt, folgte an nicht wenigen Orten in den folgenden Wochen die nächste Herausforderung. Warme, z.T. heiße Temperaturen mit so gut wie keinem Niederschlag verursachte Trockenstress. Als dann die ersehnten Niederschläge endlich in der 2. Julihälfte kamen, war die Freude groß und die Situation in den Weinbergen entspannte sich. Aus diesem Segen wurde jedoch mit zunehmendem Dauerregen ein Fluch. Das verfügbare Wasser lud die Beeren einerseits ein, schnell zu wachsen, andererseits blieb die Reifeentwicklung wegen fehlender Wärme und Sonneneinstrahlung in dieser Phase zurück. Beeren, die schnell sehr groß werden, neigen dazu sich gegenseitig abzudrücken und aufzuplatzen. Der Infektionsdruck nimmt zu. Fliegen werden angelockt. In manchen Lagen und bei manchen Rebsorten musste die Lese früh beginnen, weil weiteres Zuwarten zu noch mehr Fäulnis geführt hätte. Nicht überall waren die Trauben optimal reif. Andererseits drohten Säureverluste aufgrund der warmen Herbsttage. Es war nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spätreifende Sorten waren diesmal im Vorteil. Im Vorteil waren auch all jene, die ihre Weinberge im Schuss hatten, über gesunde und ältere Anlagen und ausreichend Humus verfügten und beim Pflanzenschutz ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Aber auch sie hatten während der Lese alle Hände voll zu tun, mussten die Zahl der Helfer erhöhen und so penibel selektieren, dass sich der Leseaufwand in machen Lagen und für manche Rebsorten exorbitant erhöhte. Die Erträge gingen gegenüber den Vorjahren zurück, obwohl die Verbände noch wenige Wochen zuvor das Gegenteil prognostiziert hatten. Dort, wo der Zustand der Trauben ein weiteres Zuwarten mit der Lese erlaubte, konnte man vom weitgehend stabilen und warmen Herbstwetter profitieren. Auf jeden Fall war es eine ungemein zügige Lese, für viele Betriebe die schnellste Lese, die sie je erlebt haben. Nicht zuletzt, weil sowohl Guts- und Lagenweine als auch die vielen unterschiedlichen Rebsorten praktisch gleichzeitig reif waren. Das zusammen mit dem hohen Selektionsaufwand machte die Weinlese 2023 zu einem echten Kraftakt, zu einer riesen Herausforderung.

Der Weinjahrgang 2023 - Martin Korrell berichtet über die Bedingungen an der Nahe
In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Winzerinnen und Winzern aus den verschiedenen deutschen Anbaugebieten über ihre Erfahrungen hinsichtlich Witterungsverlauf, Reifeentwicklung und die Gefahren, denen die Reben im Jahresverlauf 2023 ausgesetzt waren. Fast unisono berichten die Winzer und Winzerinnen von einem ungemein herausfordernden Jahrgang, nicht nur hierzulande, sondern auch in unseren Nachbarländern. In den meisten deutschen Anbaugebieten folgten auf einen entspannten und überwiegend vielversprechenden Start Hochdruckwetterlagen, die dem Oidium, also dem Mehltau-Befall günstige Bedingungen boten. Das waren trockene und meist sonnige Tage, denen Nächte mit niedrigen Temperaturen folgten. Die relative Luftfeuchtigkeit stieg. War diese Gefahr gebannt, folgte an nicht wenigen Orten in den folgenden Wochen die nächste Herausforderung. Warme, z.T. heiße Temperaturen mit so gut wie keinem Niederschlag verursachte Trockenstress. Als dann die ersehnten Niederschläge endlich in der 2. Julihälfte kamen, war die Freude groß und die Situation in den Weinbergen entspannte sich. Aus diesem Segen wurde jedoch mit zunehmendem Dauerregen ein Fluch. Das verfügbare Wasser lud die Beeren einerseits ein, schnell zu wachsen, andererseits blieb die Reifeentwicklung wegen fehlender Wärme und Sonneneinstrahlung in dieser Phase zurück. Beeren, die schnell sehr groß werden, neigen dazu sich gegenseitig abzudrücken und aufzuplatzen. Der Infektionsdruck nimmt zu. Fliegen werden angelockt. In manchen Lagen und bei manchen Rebsorten musste die Lese früh beginnen, weil weiteres Zuwarten zu noch mehr Fäulnis geführt hätte. Nicht überall waren die Trauben optimal reif. Andererseits drohten Säureverluste aufgrund der warmen Herbsttage. Es war nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spätreifende Sorten waren diesmal im Vorteil. Im Vorteil waren auch all jene, die ihre Weinberge im Schuss hatten, über gesunde und ältere Anlagen und ausreichend Humus verfügten und beim Pflanzenschutz ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Aber auch sie hatten während der Lese alle Hände voll zu tun, mussten die Zahl der Helfer erhöhen und so penibel selektieren, dass sich der Leseaufwand in machen Lagen und für manche Rebsorten exorbitant erhöhte. Die Erträge gingen gegenüber den Vorjahren zurück, obwohl die Verbände noch wenige Wochen zuvor das Gegenteil prognostiziert hatten. Dort, wo der Zustand der Trauben ein weiteres Zuwarten mit der Lese erlaubte, konnte man vom weitgehend stabilen und warmen Herbstwetter profitieren. Auf jeden Fall war es eine ungemein zügige Lese, für viele Betriebe die schnellste Lese, die sie je erlebt haben. Nicht zuletzt, weil sowohl Guts- und Lagenweine als auch die vielen unterschiedlichen Rebsorten praktisch gleichzeitig reif waren. Das zusammen mit dem hohen Selektionsaufwand machte die Weinlese 2023 zu einem echten Kraftakt, zu einer riesen Herausforderung.

Der Weinjahrgang 2023 - Randolf Kauer berichtet über die Bedingungen am Mittelrhein
In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Winzerinnen und Winzern aus den verschiedenen deutschen Anbaugebieten über ihre Erfahrungen hinsichtlich Witterungsverlauf, Reifeentwicklung und der Gefahren, denen die Reben im Jahresverlauf 2023 ausgesetzt waren. Fast unisono berichten die Winzer und Winzerinnen von einem ungemein herausfordernden Jahrgang, nicht nur hierzulande, sondern auch in unseren Nachbarländern. In den meisten deutschen Anbaugebieten folgten auf einen entspannten und überwiegend vielversprechenden Start Hochdruckwetterlagen, die dem Oidium, also dem Mehltau-Befall günstige Bedingungen boten. Das waren trockene und meist sonnige Tage, denen Nächte mit niedrigen Temperaturen folgten. Die relative Luftfeuchtigkeit stieg. War diese Gefahr gebannt, folgte an nicht wenigen Orten in den folgenden Wochen die nächste Herausforderung. Warme, z.T. heiße Temperaturen mit so gut wie keinem Niederschlag verursachte Trockenstress. Als dann die ersehnten Niederschläge endlich in der 2. Julihälfte kamen, war die Freude groß und die Situation in den Weinbergen entspannte sich. Aus diesem Segen wurde jedoch mit zunehmendem Dauerregen ein Fluch. Das verfügbare Wasser lud die Beeren einerseits ein, schnell zu wachsen, andererseits blieb die Reifeentwicklung wegen fehlender Wärme und Sonneneinstrahlung in dieser Phase zurück. Beeren, die schnell sehr groß werden, neigen dazu sich gegenseitig abzudrücken und aufzuplatzen. Der Infektionsdruck nimmt zu. Fliegen werden angelockt. In manchen Lagen und bei manchen Rebsorten musste die Lese früh beginnen, weil weiteres Zuwarten zu noch mehr Fäulnis geführt hätte. Nicht überall waren die Trauben optimal reif. Andererseits drohten Säureverluste aufgrund der warmen Herbsttage. Es war nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spätreifende Sorten waren diesmal im Vorteil. Im Vorteil waren auch all jene, die ihre Weinberge im Schuss hatten, über gesunde und ältere Anlagen und ausreichend Humus verfügten und beim Pflanzenschutz ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Aber auch sie hatten während der Lese alle Hände voll zu tun, mussten die Zahl der Helfer erhöhen und so penibel selektieren, dass sich der Leseaufwand in machen Lagen und für manche Rebsorten exorbitant erhöhte. Die Erträge gingen gegenüber den Vorjahren zurück, obwohl die Verbände noch wenige Wochen zuvor das Gegenteil prognostiziert hatten. Dort, wo der Zustand der Trauben ein weiteres Zuwarten mit der Lese erlaubte, konnte man vom weitgehend stabilen und warmen Herbstwetter profitieren. Auf jeden Fall war es eine ungemein zügige Lese, für viele Betriebe die schnellste Lese, die sie je erlebt haben. Nicht zuletzt, weil sowohl Guts- und Lagenweine als auch die vielen unterschiedlichen Rebsorten praktisch gleichzeitig reif waren. Das zusammen mit dem hohen Selektionsaufwand machte die Weinlese 2023 zu einem echten Kraftakt, zu einer riesen Herausforderung.

Flo Busch - ein Moselaner in Südfrankreich auf Erfolgskurs
Mein Interviewgast ist diesmal Flo Busch von der Domaine Flo Busch in Südfrankreich. Flo lebt und arbeitet gemeinsam mit seiner Frau Paola in der kleinen Gemeinde Jonquières knapp 40 Kilometer westlich von Montpellier im Languedoc. Weinbaulich bekannter ist die Nachbargemeinde Montpeyroux und natürlich vor allem die Appellation Terrasses du Larzac, eines der aktuell dynamischsten und spannendsten Ursprungsgebiete im ganzen Languedoc, wenn nicht sogar Frankreich weit. Flo stammt aus einer nicht ganz unbekannten Winzerfamilie in Pünderich an der Mosel. Seine Eltern Rita und Clemens Busch haben dort im Laufe der vergangenen 30 Jahre ökologischen Steillagenweinbau vom feinsten praktiziert und auf der Basis biodynamischer Prinzipien ein Weingut mit Weltruf aufgebaut. Wie es nun kam, dass Flo nicht an der Mosel, sondern im französischen Süden Weine auf Flaschen füllt, wer und was ihn auf diesem Weg geprägt und beeinflusst hat und mit welchen Grundüberzeugungen er gemeinsam mit seiner Frau das Winzerhandwerk betreibt, darüber spreche ich mit ihm in dieser Episode von Genuss im Bus. En passent ist es eine exzellente Lehrstunde zum Weinbau im Herault und zur Frage, wie verantwortungsbewusster und ökologischer Weinbau unter den Klimabedingungen warmer und vor allem extrem trockener Landstriche gelingt. Wer die Weine von Flo zum ersten mal im Glas hat, dürfte überrascht sein, wie frisch, leichtfüßig und energiegeladen sie einem entgegentreten - gerade so als wollten sie mit einem Augenzwinkern darauf verweisen, dass ein Stück Mosel in ihnen steckt.

Laura Paccot - eine Hommage an den Chasselas
Für eine weitere Episode von Genuss im Bus habe die junge Winzerin Laura Paccot vom Weingut La Colombe ans Mikrofon geholt. Laura lebt und arbeitet in Fechy am Genfer See im Weinbaugebiet Waadt. Sie hat zwar gerade erst den elterlichen Betrieb übernommen, doch bereits mit ihren ersten Jahrgängen zeigt sie Flagge. Die Kollektion präsentiert sich noch einmal präziser, fokussierter und puristischer. Chichi und Brimborium waren auch die Sache ihres Vaters Raymond nicht. Nun aber hat Laura ihre Weine von den letzten Resten, die sie noch an Überflüssigem mit sich trugen, befreit. Auf diese Weise abgespeckt und reduziert haben sie eine Strahlkraft gewonnen, die sie über alles stellen, das ich je aus dieser Gegend im Glas hatte. Die Terroirs ihrer Heimat und die hier seit Jahrhunderten heimische Rebsorte Chasselas liegen ihr sehr am Herzen. Unter anderem geht es ihr um die Rettung der großen Klonenvielfalt beim Chasselas und die Beantwortung der Frage, welche Klone an die Bedingungen der Weinbergslagen rund um Féchy am besten angepasst sind und zugleich gute Eigenschaften mitbringen, die Herausforderungen des Klimawandels zu parieren. Darüber und über viele weitere Themen spreche ich mit Laura in dieser Podcast-Episode.

Edgar Brutler - Weinmachen mit der Sensibilität eines Musikers
Mein Interviewgast ist diesmal Edgar Brutler, der erste rumänische Winzer, den ich für Genuss im Bus ans Mikrofon hole. Edgar gehört zur bislang noch recht kleinen Winzerschar, die das vergessene Potenzial des rumänischen Weinbaus reanimieren und der Welt die verborgenen Schätze ihrer Heimat zeigen möchten Sein 2018 gegründetes Weingut liegt in Bildegg im Nordwesten Transsylvaniens in der Weinregion Crisana. Die 4 ha Weingärten, die er seit 2018 ökologisch bewirtschaftet, sind, wie für die Region üblich, überwiegend nach dem Prinzip des gemischten Satzes und in der traditionellen Einzelpfahlerziehung bepflanzt - ein wilder Mix aus fast zwei Dutzend Sorten, darunter etliche, deren Identität bis heute nicht eindeutig ermittelt werden konnte. Das Durchschnittsalter seiner Reben ist immens, in der Spitze älter als 90 Jahre. Bereits für seine ersten Abfüllungen hat er von der internationalen Sommelierszene viel Lob und Zustimmung erhalten, vor allem weil er einen kompromisslos eigenständigen Weg verfolgt und dabei auf die originelle Strahlkraft der lokalen Rebsorten setzt. Er selbst beschreibt seinen Zugang zum Weinmachen heute als „Old School Avantgarde“. Old School Avantgarde mit viel Bauchgefühl wäre präziser. Der sensible Musiker vertraut nämlich ganz und gar seinen Sinnen. Riechen, schmecken und ertasten gehen ihm über alle technischen Analysen. „Diesen Firlefans hinter mir zu lassen, war wie eine große Befreiung. Endlich allein meiner Wahrnehmung und Intuition vertrauen zu dürfen, war ein riesiges Geschenk“, so Edgar im O-Ton.

Zoltán Heimann - der "Kadarka Man"
Mein Interviewgast ist diesmal mit Zoltan Heimnann erstmals ein ungarischer Winzer. Oder vielleicht sollte ich ihn treffender als „Kadarka Man“ anmoderieren. Wieso dieser Titel? Na ja ganz einfach, weil Zoltan für diese alte ungarische Rebsorte durchs Feuer geht. Er will sie rehabilitieren, etablieren, will beweisen, dass sie zu unrecht belächelt und ins Abseits gestellt wurde. Zoltan, der „Kadarka Man“. Im Interview reden wir darüber, weshalb er bei der Verfolgung dieses Ziels zunächst sehr viel Lehrgeld hat bezahlen müssen, dass er sich dafür mit seinen ungemein erfolgreichen Eltern hat in den Klinch begeben müssen und lernen müssen, den Ungeduldigen in sich zu zähmen und langfristig zu denken. Aber er ist zutiefst überzeugt, dass seine Heimat, dass Szekszárd eins der potentesten und vielversprechendsten Weinterroirs Ungarns ist und dass er es zu seiner Lebensaufgabe machen möchte, ja machen muss, der Welt ein schönes und authentischen Bild des kulturellen Erbes seiner Heimat, der lokalen Terroirs und Rebsorten zu liefern. Er sagt: „Dieses kulturelle Erbe verpflichtet gerade uns junge Winzer, die wir mit so viel besseren Voraussetzungen gesegnet sind, als unsere Eltern das vor 30 Jahren waren.“

Valentina Phillips vom CMB
Mein Interviewgast ist diesmal Valentina Phillips, die Presse und Öffentlichkeitsverantwortliche des Concours Mondial de Bruxelles. Sie ist eine echte Globetrotterin. Geboren ist sie in Bulgarien. Mit 18 kam sie nach Deutschland, um hier zu studieren. 2008 hat sie den Masterabschluss im Studiengang Medien und Kommunikation an der Uni Augsburg gemacht. Im Anschluss hat sie für eine PR-Abentur in Stuttgart gearbeitet, bevor sie in 2015 nach Brüssel weiterpilgerte, um dort für den Concours die Presse und Öffentlichkeitsarbeit zu übernehmen. Seit letzten Sommer wohnt Valentina in Denver, ist von dort aber weiterhin für den CMB tätig. Wer sie kennenlernt, spürt sofort ihre Leidenschaft, mit der sie unterwegs ist. Sie liebt das Organisieren, vor allem den Kontakt zu Menschen, am liebsten in einem internationalen, polyglotten Kontext. Dass sie neben dem Deutschen noch Englisch, Französisch, Spanisch, Bulgarisch und Russisch spricht, kommt ihr da sehr entgegen. Während ich im Interview mit ihr über die Hintergründe des Concours Mondial spreche, findet gerade in Agerola, unweit von Neapel, der nächste Wettbewerb statt. Diesmal sind über 50 Fachjuroren an die Amalfiküste gereist, um knapp 1000 Schaumweine zu bewerten. Die Einreichungen kommen aus allen wichtigen Erzeugerregionen, ganz vorne die Champagne mit 160 Anmeldungen.

Frank John - Flying Winemaker und Pfälzer Winzer
Mein Interviewgast in der 143. Ausgabe von Genuss im Bus ist Frank John vom Hirschhorner Hof in Neustadt-Königsbach. Bevor er dort seßhaft wurde, arbeitete Frank John viele Jahre als angestellter Betriebsleiter - zunächst bei Heyl zu Herrnsheim in Nierstein und anschließend beim Deidesheimer Weingut Reichsrat von Buhl. Heute ist er mit rund 150 Beratungstagen europaweit für mehr als 10.000 Hektar Weingärten zuständig. Als flying winemaker berät er vor allem solche Betriebe önologisch, ökologisch und ökonomisch, die ihre Weinberge gesunden, kellertechnische Interventionen minimieren und die betrieblichen Abläufe nachhaltiger gestalten wollen. 2002 erfüllten er und seine Frau Gerlinde sich einen gemeinsamen Traum. Sie kauften in Neustadt-Königsbach den Hirschhorner Hof, ein 400 Jahre altes Renaissance-Anwesen mit beeindruckendem Kreuzgewölbekeller. Mittlerweile von ihren Kindern tatkräftig unterstützt, keltern sie dort auf der Basis biologisch-dynamischer Prinzipien große Weine alter Schule.

Protagonistin klassisch flaschenvergorener Sekte - Barbara Roth vom Wilhelmshof
Für eine weitere Episode von Genuss im Bus war ich in der Südpfalz unterwegs und habe in Siebeldingen die Winzerin Barbara Roth besucht. Gemeinsam mit ihrem Mann Thorsten Ochocki betreibt sie das Sekt- und Weingut Wilhelmshof. Wie so viele deutsche Winzerpaare haben auch Barbara und Thorsten sich während ihres Studiums in Geisenheim kennen und lieben gelernt. 2005 haben sie - nachdem sie zuvor in verschiedenen Weltgegenden ihre Erfahrungen diversifiziert und erweitert haben - gemeinsam den Betrieb von Barbaras Eltern in Siebeldingen übernommen. Seither haben sie ihn kontinuierlich weiterentwickelt - die Rebflächen erweitert, Gebäude saniert und modernisiert, die Umstellung auf ökologischen und nachhaltigen Weinbau eingeleitet und das Produktportfolio so aufgebaut, dass es auf zwei starken Säulen basiert, etwa zur Hälfte auf klassisch flaschenvergorenem Sekt und zur anderen Hälfte auf Stillweinen in den Farben weiß, rot und rosé. Im Interview besprechen wir zwei zentrale Themen: zunächst über die Zukunftsrebsorten und ihre Bedeutung für den nachhaltigen und verantwortungsvollen Weinbau und dann im zweiten Teil des Interviews über die Methoden und Strategien des Wilhelmshofs bei der Bereitung klassisch flaschenvergorener Sekte nach dem Vorbild der Champagne und weshalb gerade die Zweigleisigkeit zwischen Sekt- und Stillweinproduktion unter den Bedingungen immer heterogener und unberechenbar werdender Jahrgangsverläufe zur Minimierung betriebswirtschaftlicher Risiken beiträgt.

Hélène Berthet-Bondet - junge Repräsentantin einer gehypten französischen Weinbauregion
Für eine weitere Episode von Genuss im Bus war ich in Frankreich unterwegs und habe im Jura die junge Winzerin Hélène Berthet-Bondet besucht. Zu Hause ist sie in der wohl berühmtesten Appellation des Jura, in Chateau-Chalon. Ich spreche mit ihr darüber, weshalb das Jura lange unter dem Radar blieb, ja als rückständig galt, heute aber in den Augen vieler Wein-Experten geradezu mythische Verehrung genießt. Kaum ein junger ambitionierter Winzer, der nicht dorthin pilgert, um den Produzenten vor Ort ihre Geheimnisse der Weinbereitung zu entlocken. Die Winzer des Jura stehen weltweit an der Spitze einer Gegenbewegung zu all den glattgebügelten, charakterlosen Abfüllungen, die landauf landab die Regale füllen. Die Weine aus dem Jura haben diesen besonderen individuellen Charme, den immer mehr Menschen bei vielen anderen Angeboten so sehr vermissen. Doch was ist eigentlich das Besondere am Jura-Wein? Sind es die Kalk- und Mergelböden, das lokale Klima oder die einheimischen Rebsorten? Welchen Anteil an der zunehmenden Wertschätzung hat die Tradition der Weinbereitung sous voile, also die Reifung der Weine unter dieser besonderen Hefeschicht? Oder ist alles ganz anders und die genialen Crémants des Gebiets sind verantwortlich für die Renaissance? Fragen über Fragen. Hélène beantwortet sie im Interview.

Hajo Becker - das Rheinhauer Urgestein im Podcast Genuss im Bus
Für eine weitere Episode meines Podcasts Genuss im Bus bin ich noch einmal im Rheingau unterwegs und habe in Walluf das Weingut Jean Baptist Becker besucht und dort den heutigen Inhaber Hans-Josef Becker, genannt Hajo, ans Mikrofon geholt. Er gilt landauf landab als das Schnauzbart-Urgestein des klassischen Rheingaus. Es ist fast ein bisschen ein Paradox: Die einen stufen Hajo Becker als altmodischen Winzer ein, während gerade junge Sommeliers, Geisenheim-Absolventen und Wein-Nerds seine Weine förmlich anbeten. In seinem direkt am Rhein gelegenen Weingarten haben wir uns getroffen und weil die Zeit, die zur Verfügung stand, knapp bemessen war, habe ich das Interview anders angelegt als sonst hier im Podcast üblich. Ich habe mir ein paar zentrale Aspekte herausgepickt und sie Hajo so zugespielt, dass er kurz und prägnant dazu Stellung beziehen kann. Mit dem Ergebnis, dass uns der Altmeister des trockenen Rieslings und ganz wunderbarer Spätburgunder tiefe Einblicke in sein Denken, Handeln und sein Wertesystem gibt.

Wein & Yoga - Synergien für eine nachhaltige Entwicklung
Für eine weitere Episode von Genuss im Bus bin ich in den Rheingau gefahren und habe in Östrich-Winkel das junge Winzerpaar Cosima Lindenau und Niklas Eisenacher getroffen. Beide haben im Herbst 2019 ihr Weinbaustudium in Geisenheim begonnen und sich kurz später in einander verliebt. Dabei mitgeholfen haben sicher auch ihrer beider Leidenschaften, die Leidenschaft für Wein und die Leidenschaft für Yoga. Eine Partnerschaft fürs Leben entstand und mit ihr ein bemerkenswertes Wein-Start-up. Groß denken und immer mit beiden Beiden auf dem Boden bleiben, das scheint das Erfolgsgeheimnis der beiden zu sein. Da war irgendwie zu erwarten, dass es nicht lange dauern kann, bis sie sich ihren Traum von einem eigenen Weingut erfüllen. In Winkel konnten sie zuschlagen und den Eiserhof übernehmen. Und gleich legen sie richtig los. Vieles soll anders werden, draußen in den Weinbergen genauso wie im Weinkeller und dem Wohngebäude. Die ehemalige Gutsschenke haben sie mittlerweile in ein Yogastudio verwandelt. Gemeinsam mit einem Team aus fünf Yogalehrern finden hier regelmäßig Yogakurse und Meditationsstunden statt. Logisch, dass sich das auch im Namen des Weinguts niederschlagen würde. „Prana“ haben sie es genannt, der Hindu-Ausdruck für Lebensenergie. Und genau darüber sprechen wir auch im Podcast: über Energie, das neue Leben der beiden und wie es gelingt, sich heute so aufzustellen, dass das gemeinsame Projekt zukunftsfähig wird, eben nachhaltig und lebenswert.

Grabenwerkstatt - frischer Wind in der Wachau
Für die heutige Episode habe ich die beiden Protagonisten eines ungemein erfolgreichen österreichischen Startups ans Mikrofon geholt - Michael Linke und Franz Hofbauer. Michael ist ein waschechter Pfälzer, der auch nach Jahren im Ausland dem Sound seiner Muttersprache treu bleibt. Franz ist in der Wachau aufgewachsen, genauer gesagt in dem kleinen Trandorf, also dort, wo der Spitzer Graben ins Waldviertel übergeht. Beide stammen nicht aus Weinbaubetrieben. Sie sind aus Interesse und einer starken Motivation heraus zum Wein gekommen. Ihre Sporen haben sie sich im In- und Ausland verdient, darunter bei so bekannten Weingütern wie der Domäne Wachau, Bürklin-Wolf und Felton Road in Neuseeland. Ganz besonders nachhaltig waren ihre gemeinsames Erlebnisse bei Pyramid Valley Vineyards im neuseeländischen Canterbury. Über all das spreche ich mit den beiden, vor allem aber interessiert mich, wie es ihnen gelungen, fast aus dem Nichts im vergessenen, weinbaulich zum Teil verwahrlosten Spitzer Graben ein kleines Juwel zu zimmern und aus den Rieden Brandstatt, Bruck, Kalkofen und Trenning Weine auf die Flasche zu ziehen, die keinen Vergleich mit den Abfüllungen der berühmten Wachauer Starwinzern unten im Tal zu scheuen brauchen.

Eva Vollmer - Zukunftsweine im Visier
Für die heutige Episode habe ich die Mainzer Winzerin Eva Vollmer eingeladen, am Mikrofon Platz zu nehmen, nicht zuletzt, weil sie in den vergangenen Monaten - gemeinsam mit einer Handvoll Mitstreiterinnen - mit viel Engagement dafür geworben, sich dafür stark gemacht hat, die Thematik der pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, der sogenannten Piwis öffentlichkeitswirksam auf die Agenda zu katapultieren. Weil Eva fest an die Zukunft von Piwis glaubt, hat sie ihnen einen neuen Namen gegeben: sie nennt sie Zukunftsreben. Ihre Vorteile bilanziert sie wie folgt: Geringerer Spritzmitteleinsatz, weniger Hilfsstoffe, niedrigere Maschinenkosten, weniger Überfahrten und deshalb geringere Bodenverdichtungen, weniger Risiken und eine schlussendlich deutliche Verringerung des CO2-Fußabdrucks. Das stellt sich im Falle vieler Vinifera-Reben in der Regel ganz anders dar. Der Pflanzenschutz gestaltet sich bei manchen sogar so aufwendig, dass in Sachen Umweltbelastung kein grosser Unterschied mehr zwischen bio und konventionell besteht. Im Podcast-Interview, das ich mit Eva geführt wird deutlich, dass sie zutiefst davon überzeugt ist, dass insbesondere all jene, die in und mit der Natur arbeiten und ihren Lebensunterhalt verdienen, große Verantwortung für eine intakte Umwelt, die Bewahrung der biologischen Vielfalt und möglichst geringen Ressourcenverbrauch auf ihren Schultern tragen. In dieser Hinsicht will sie persönlich Verantwortung übernehmen und vorangehen.

Michael Bode-Böckenhauer - Weinhändler des Jahres in der Kategorie „Nachaltiger Weinhandel“
Ich spreche mit Michael Bode-Böckenhauer, dem Geschäftsführer des Vinocentral in Darmstadt, einem spannenden Weinhandel, der ganz aktuell vom Meininger Verlag die Auszeichnung „Weinhändler des Jahres in der Kategorie „Nachaltiger Weinhandel“ zugesprochen bekommen hat. Im Interview mit Michi will ich wissen, was das ist so ein Nachaltiger Weinhandel und wie es sich darin lebt und arbeitet. Wir reden natürlich auch über das Sortiment des Vinocentral und weshalb sich die Kunden am Darmstädter Standort so wohl fühlen. Also freut Euch auf ein super interessantes Interview mit Michael Bode-Böckenhauer, dem Geschäftsführer des mit dem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichneten Vinocentral in Darmstadt.

Paula Bosch - die Grande Dame der deutschen Wein- und Gastroszene
Paula Bosch ist unbestreitbar eine der anerkanntesten Wein-Persönlichkeiten im deutschsprachigen Raum. Nach Ihrer Ausbildung zur Restaurant-Fachfrau baute sie sich in der Weinstube Leimeister in Königstein im Taunus den Ruf der ersten weiblichen Sommelière Deutschlands auf. Trotz einiger Vorbehalte in dieser klassischen Männer-Domäne wurde sie anschließend im Hotel Inter-Conti in Köln als Chef-Sommelière engagiert. 1991 wurde sie von dem damals mit drei Sternen ausgezeichneten Tantris verpflichtet, wo sie Herrin über einen Weinkeller mit bis zu 60.000 Flaschen war. Seit nunmehr rund 10 Jahren ist Paula Bosch als Konsulentin für Gastronomie, Hotellerie und Handel unterwegs. Sie begleitet zudem Weinreisen und organisiert Weinverkostungen. Auch das Schreiben beherrscht sie. Mit Ihren Kolumnen und Büchern ist sie eine der ganz großen Influencerinnen in Deutschland Weinwelt. Ihr neuestes Werk "Eingeschenkt - Deutschlands erste Sommelière über Winzer, Weine und die Zukunft der Branche" ist gerade im Zabert & Sandmann Verlag erschienen. In dem Buch führt sie Gespräche mit zwölf Wegbegleitern, Freunden, Winzern und Stammgästen. In diesen unterhaltsamen, persönlich gehaltenen Gesprächen wird ganz oft zurückgeblickt in die Vergangen, es werden wichtige Entwicklungslinien in der Wein- und Gastrobranche identifiziert. Auch Schwachstellen und Problemzonen werden nicht ausgelassen. Mit dabei ist Hans Haas, ehemaliger Küchenchef des Tantris, Sterrnekoch Tohru Nakamura und der Gastronom Axel Bach. Ebenso der Garibaldi-Inhaber Eberhard Spangenberg und der Sommelier Daniel Kurosh von der Szene-Pizzeria NineOFive. Dabei sind auch drei bekannte deutsche Winzer: Joachim Heger, Bernhard Ott und Stephan Attmann. Paula Bosch ist Gast im Podcast Genuss im Bus.

Martin Korrell - Schritt für Schritt an die Spitze des Weinbaugebiets Nahe
Gast in der heutigen Episode ist der Bad Kreuznacher Winzer Martin Korrell. Nachdem Martin das Weingut im Jahr 2003 viel früher als gedacht von seinen Eltern übernehmen musste, hat er es peu à peu zu einer festen Größe im Weinbaugebiet Nahe entwickelt. Ohne Hektik und dennoch mit viel Tempo hat er eine Innovation nach der anderen eingeleitet und dabei nicht nur die Qualität seiner Weine enorm verbessert, sondern schon sehr früh großen Wert auf nachhaltiges Wirtschaften gelegt. Nun steht auch die Bio-Zertifizierung unmittelbar bevor. Und noch ein Wort zu Martin’s Weinen. Tja, die muss man einfach mögen. Sie sind ungemein fein, elegant und immer von einer wohltuenden Frische geprägt - vinophile Allzweckwaffen, die Beginner und Freaks gleichermaßen abholen. Im Podcast reden wir darüber, mit welcher Strategie er den elterlichen Betrieb weiterentwickelt hat, wir reden über die wichtigsten Etappen und Meilensteine und mit welchem Portfolio er sich heute am Markt positioniert hat. Und er verrät mir, welche Rolle seine Frau im Weingut spielt.

Michael Moosbrugger - der Chef des Weinguts Schloss Gobelsburg und Obmann der Österreichischen Traditionsweingüter (ÖTW)
Mein Gast in der heutigen Episode ist mit Michael Moosbrugger einer echter Influencer in der österreichische Weinszene. Mir will niemand einfallen, der größeren Einfluss auf die aktuellen Entwicklungen nimmt, als dieser Michael Moosbrugger. Seit 2007 hat er als Obmann der ÖTW, der Österreichischen Traditionsweingüter die rasante Expansion dieser prestigeträchtigsten Winzerorganisation seines Landes entscheidend geprägt und dabei ein Projekt besonders dynamisch voangetrieben: nämlich die Klassifizierung der Weinbergslagen. Wenn es nach Michael Moosbrugger geht, soll es hierzu schon bald eine bundesweit einheitliche Regelung geben. Noch wird dieses Thema jedoch kontrovers diskutiert. Vor allem aber ist Michael Moosbrugger der Chef des traditionsreichen Weinguts Schloss Gobelsburg. Er war 29 Jahre, als er dort die Poolposition übernahm und was er seither aus diesem ehemaligen Flaggschiff des österreichischen Weins gemacht hat, ist beeindruckend. Er hat es aus den Untiefen der Bedeutungslosigkeit herausgeholt und an die Spitze in der Region Kamptal, ja mehr noch an die Spitze in ganz Österreich geführt. Logisch, dass ich im Interview von ihm wissen will, wo er die Kraft für diese Riesenaufgabe hergenommen hat und mit welchem Mindset und welcher Strategie er vorgegangen ist. Es entspann sich ein intensives und ungemein spannendes Gespräch. Eins darf ich vorwegnehmen: Ich bin selten im Rahmen meines Podcasts auf jemanden getroffen, der so tiefgründig und umfassend über Wein und seine Einbettung in kultur-historische und gesellschaftspolitische Kontexte zu sprechen vermag. Ein intellektueller Hochgenuss!

Randolf Kauer - sympathischer Ökowein-Professor und charakterstarker Mittelrhein-Biowinzer
Für eine weitere Epsiode von "Genuss im Bus" habe ich mich erstmals mit einem Wissenschaftler getroffen, dem Geisenheimer Professor Dr. Randolf Kauer, Inhaber des Lehrstuhls für „ökologischen Weinbau“. Seine Forschungsschwerpunkte kreisen also um den Ökoweinbau“ und zielen auf die Weiterentwicklung dieses Anbausystems - insbesondere auf die Bereiche Bodenfruchtbarkeit und Biodiversität sowie die Pflanzenschutzproblematik. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in vergleichenden Untersuchungen zum integrierten, bioorganischen und biodynamischen Weinbau. Hier betreut er seit 2006 einen Langzeitversuch, in dem alle Anbauparameter inklusive der Most- und Weinqualität überprüft werden. Federführend beteiligt ist Randolf Kauer auch bei Vitifit, dem 2019 gestarteten, grössten Praxisforschungsprojekt im Ökoweinbau. Themen sind dabei unter anderem die Möglichkeiten der Kupferreduzierung und die Akzeptanzproblematik bei PIWIS. Neben seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit in Geisenheim leitet er - mittlerweile zusammen mit seiner Tochter Anne - ein 4 ha kleines Weingut in Bacharach. Und das schon seit Anfang der 80er Jahre und - wie könnte es anders sein - von Anfang an ökologisch. Jahr für Jahr kommen von hier exzellente Rieslinge aus extrem steilen Lagen am Mittelrhein und seinen Seitentälern. Neben großartigen trockenen Spätlesen, sind es vor allem die Kabinett-Weine, die begeistern und Schluck für Schluck ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Im Podcast adressiere ich meine Fragen vor allem an den Wissenschaftler und Hochschullehrer Randolf Kauer. Ich will wissen, wie er die Chancen und Risiken des Ökoweinbaus im Zeitalter des Klimawandels einschätzt und welche Rolle die pilztoleranten Sorten, die sogenannten Piwis spielen können. Wir reden über handwerkliche Weinproduktion und nachhaltige Betriebsführung und wie es gelingt, Betriebsübergaben friedlich zu gestalten, also die Wünsche und Bedürfnisse aller Beteiligten zu berücksichtigen.

Weingut Esterházy - mit Frank Schindler kommt frischer Wind und eine brillante Strategie
Die heutige Epsiode setzt mit Frank Schindler die mehrteilige Podcast-Serie rund um den österreichischen Wein fort. Frank Schindler hat 2019 das Regiment beim traditionsreichen Weingut Esterhazy im Burgenland übernommen. Er selbst bezeichnet sich als „viel gereister Europäer“. Aufgewachsen ist er in Halle an der Saale, dann kurz vor der Wende nach Hannover gegangen, um wenig später in Köln Sportmedizin zu studieren. Über viele Jahre war er Mitglied der deutschen Nationalmannschaft im Schwimmen und Rettungsschwimmen, bevor er das Genre gewechselt und sein Leben dem Wein gewidmet hat. Er hat sich zunächst zum Weinakademiker ausbilden lassen und dann den Master auf dem Feld des internationalen Weinmarketings gemacht. In 2005 ist er nach Südtirol gegangen, um etwas oberhalb von Bozen den Weinhandel Vinum verantwortlich zu führen. Dort hat er fast 16 Jahre verbracht und sich die Sporen für sein heutiges Projekt verdient: die Leitung des Weinguts Esterhazy. Er sagt: „Für mich ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich habe immer gesagt, der nächste Schritt nach dem Handel kann nur Produktion heißen.“ Binnen kürzester Zeit hat er bei Esterhazy für so viel frischen Wind gesorgt, dass landauf landab von einer wundervollen Auferstehung, von einer unerwarteten Renaissance dieses traditionsreichen Weinguts gesprochen wird. Man sagt, Frank habe dem Weingut seine Seele zurückgegeben. Im Interview spreche ich mit ihm darüber, wie er die Dinge anpackt und welche Werte und Grundüberzeugungen seinem Denken und Handeln zugrunde liegen. Freut Euch auf eine spannende Podcast-Episode. Freut Euch auf Frank Schindler.
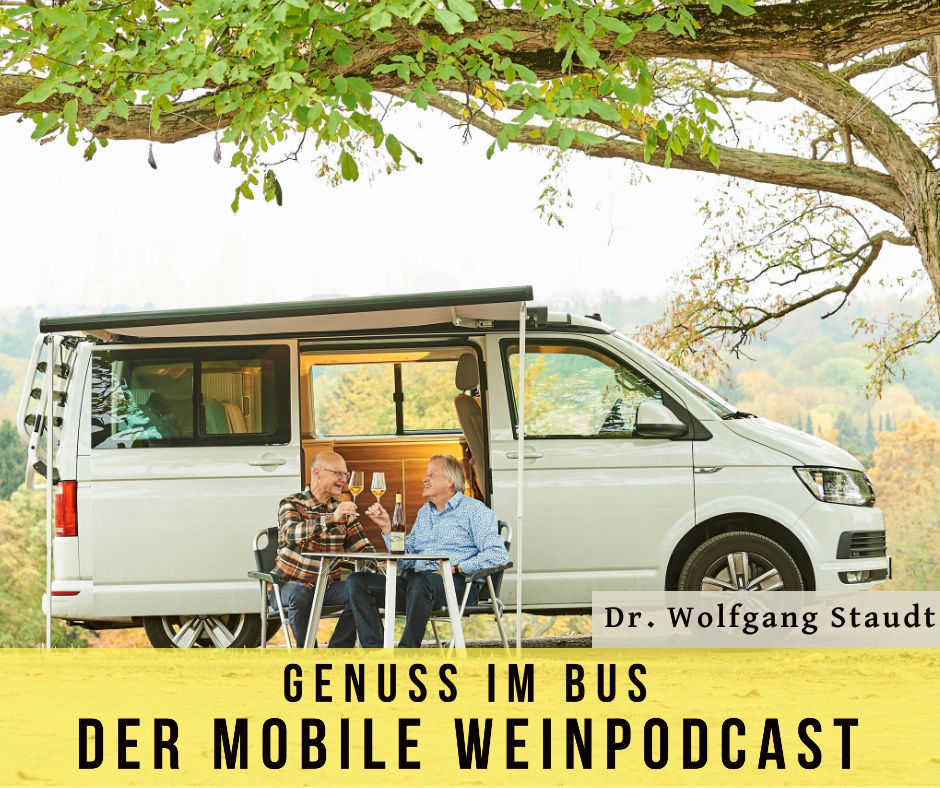
Bernhard Fiedler - Dozent, Blogger und Weinbauer mit Leib und Seele
Bernhard Fiedler führt das Weingut Grenzhof-Fiedler. Es liegt in der Neusiedlersee-Gemeinde Mörbisch inmitten der burgenländischen DAC Leithaberg. Bis heute ist Bernhard einer der aktivsten österreichischen Winzer-Blogger und nach seiner Ausbildung zum Weinakademiker hat er sich auch an der Weinakademie in Rust einen Namen als Referent und Vortragender gemacht. Er ist ein ungemein bodenständiger Winzer oder - wie er selbst es formulieren würde - ein Weinbauer mit Leib und Seele. Er und seine Familie sind tief in der Region verwurzelt und so ist es nur folgerichtig, dass seine Weine keine oberflächlichen Blender sind, sondern charakterstarke, von ihrer Herkunft geprägte Gewächse mit Tiefgang und Eleganz.

Herbert Zillinger - ein leiser Winzer mit viel Herzblut und Tiefe
Wie wohl kein anderer verkörpert Herbert Zillinger den Aufbruch in dem vor allem für einfache Massen- und Sektgrundweine bekannten Weinviertel. Zusammen mit seiner Frau Carmen geht er in Ebenthal ungewöhnliche Wege und weist mit seiner kompromisslos individuellen Herangehensweise dem Gebiet den Weg in eine vielversprechende Zukunft.

Fred Loimer - auf leise, subtile und wahrhaftige Art große Spuren hinterlassen
Fred Loimer entwickelt sein Weingut von einem bäuerlichen Kleinbetrieb, der jahraus jahrein die örtliche Gastronomie mit sogenannten Dopplern, also preiswerten Zwei-Liter-Flaschen mit einfachen, gefälligen Weinen beliefert, hin zu einem High-Tech-Weingut, bevor er dann den Weg zu einem biodynamischen Weingut einschlägt und die Weinbereitung sukzessive und im Einzelfall pragmatisch nach interventionsarmen, low-tech Prinzipien organisiert - mit sehr viel Gespür für Mensch und Natur, Ästhetik und Architektur.

Domäne Wachau
Mit Roman Horvath und Heinz Frischengruber habe ich die beiden zentralen Repräsentanten der Domäne Wachau ans Mikrofon geholt. Roman Horvath ist Geschäftsführer und Heinz obliegt die operative Verantwortung für die Pflege der Weingärten und die Prozesse Weinbereitung. Ein Dreamteam, wie manche sagen. Roman hat sich die Sporen zunächst im Weinhandel verdient und später dann auch die Master of Wine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Heinz ist ein waschechter Wachauer, der die Terroirs der Region wie kein Zweiter kennt. Gemeinsam haben sie die Domäne strategisch neu ausgerichtet und die Qualitätsschraube kräftig angezogen.

Der Weinjahrgang 2022 - wie verliefen die ersten 6 Monate des Jahres?
Wie war das Wetter beim Austrieb, wie in der Zeit der Blüte? Gab es Spätfröste zu beklagen? Hat es wieder mal zu wenig geregnet oder vielleicht sogar zu viel? Bereiten die gefährlichen Pilzkrankheiten Peronospora und Oidium auch in 2022 viel Kopfzerbrechen? In welchem Zustand befinden sich aktuell Reben und Weinbergsböden und wann ist mit dem Beginn der Ernte zu rechnen? Und selbstverständlich erkundige ich mich, was überwiegt: Zuversicht oder Skepsis?

Toni Askitis - Wein ist unkompliziert
Für die heutige Epsiode habe ich mich online mit dem frisch gebackenen Buchautor Toni Askitis getroffen. „Wein ist unkompliziert“ - das ist sein Slogan, mit dem er vor allem jüngeren Menschen den Wein näher bringen möchte. Und es ist der Titel seines Buchs, das er gerade veröffentlicht hat. Im Interview spreche ich mit Toni darüber, wie es ihm gelingt, junge Menschen für den Wein zu begeistern. Wie es gelingt, die Komplexität von Wein so einzudampfen, dass unerfahrene, noch wenig mit Wein vertraute Menschen neugierig werden.

Brennerei Ziegler - Relaunch einer in Vergessenheit geratenen Marke im Einklang mit der Natur
Nach drei Jahrzehnten als Teil der Hawesko-Gruppe, wuppen Andreas Rock und sein Team gerade einen umfassen Relaunch des Unternehmens und der Marke Ziegler. Die neue Marken-Maxime bringt den Enthusiasmus, mit dem die junge Truppe zu Werke geht, auf den Punkt: „Wir brennen!“ – „Wir brennen für Gastgeber und Freigeister, für Kultur und Weltoffenheit, für Qualität und Nachhaltigkeit und die kostbarsten Lebensmomente, in denen die Zeit für einen Augenblick stillsteht.“ Alles wirkt jünger, moderner und frischer, vor allem aber entschiedener und fokussierter. Denn statt eines kaum zu überblickenden Portfolios, ist ein neuer Fokus eingezogen. Die Produktpalette wird jedoch nicht nur verschlankt, sie wird mit spannenden Produkten attraktiv ergänzt.

Fabian Zähringer - mit leisen Tönen und unkonventionellem Businessplan an die Markgräfler Spitze
Fabian Zähringer ist Chef des ungemein traditionsreichen, bereits seit 1987 biologisch und seit 2010 Demeter zertifizierten Weinguts Zähringer in Heitersheim im Markgräflerland. Im Podcast-Interview sprechen wir unter anderem über Rudolph Steiner, die Weinbauregion Markgräflerland, die Sorte Gutedel, die Historie des Weinguts Zähringer, die Erfahrungen, die Fabian im Prozess der Betriebsübergabe gemacht hat und die Chancen und Risiken in der heutigen Zeit ein erfülltes Leben als Winzer zu bestreiten.

Nullnummer - Portrait "Genuss im Bus"
Der mobile Wein-Podcast "Genuss im Bus" stellt sich vor und erläutert, wohin die Reise geht.