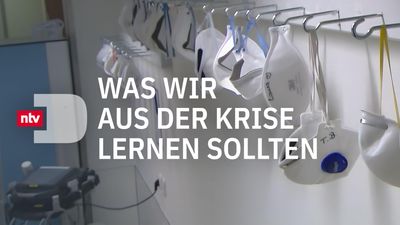Der Sustainable-Finance-Podcast der Börsen-Zeitung Wer definiert, was nachhaltig ist? Wo beginnt Greenwashing? Und wie müssen sich Investoren, Finanziers, Unternehmen und Dienstleister positionieren, um zukunftsfähig aufgestellt zu sein? Diese Fragen beleuchtet „Nachhaltiges Investieren“, der Podcast der Börsen-Zeitung rund um Sustainable Finance, ESG-Investments, Nachhaltigkeitstransformation & Co. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten, die etwas zu sagen haben. Unsere Gäste sind Professionals aus Fondsgesellschaften, Banken und Unternehmen, andere bringen ihre Perspektive als Wissenschaftler, Regulierer oder Dienstleister ein. In jeder Episode nehmen wir im Interview ein aktuelles Thema oder eine besondere Herausforderung in den Blick und sprechen über professionelle und persönliche Einschätzungen. Zum Abschluss liefert unser Newsblock einen Überblick über die wichtigsten Meldungen aus der Sustainable-Finance-Community. Nachhaltiges Investieren erscheint jeden zweiten Donnerstag, Redaktion: Sabine Reifenberger. Feedback und Fragen sind willkommen: podcast[at]boersen-zeitung[dot]de Sie interessieren sich für ein Sponsoring des Podcasts oder für die weiteren ESG-Produkte der Börsen-Zeitung? Dann tretet gern in den Austausch mit unserem Sales-Team. Eva Kammler: E.Kammler[at]boersen-zeitung[dot]de
Alle Folgen
Wald als Assetklasse: Wo liegen die Risiken? | Episode 108
Bereits seit 2009 beschäftigt sich die Münchener Meag mit Waldinvestments. Damit zählt sie zu den ersten Assetmanagern, die sich das Thema näher angeschaut haben, sagt Jasper Renk, Senior Investment Manager Illiquid Assets Natural Capital bei Meag, im Podcast „Nachhaltiges Investieren“ der Börsen-Zeitung. In der Meag konzentriert sich die Vermögensverwaltung von Munich Re und Ergo. Die Zugehörigkeit zur Versicherungsgruppe hat auch für die Risikobewertung Vorteile, sagt Renk: „Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir mit den Climate Experts von Munich Re ein Team haben, was uns regelmäßig zur Verfügung steht, für die Abschätzung und vor allen Dingen auch die Bezifferung der Auswirkungen des Klimawandels in verschiedenen Szenarien.“ Der erste Schritt bei der projektbezogenen Due Diligence ist bei Meag die geographische Auswahl. Dabei fokussiert sich der Assetmanager auf entwickelte Länder. Diese punkten mit einer stabilen Infrastruktur, mit Rechtssicherheit beim Erwerb von Flächen sowie mit politischer und ökonomischer Stabilität. Risikofaktoren werden bei der Prüfung bestmöglich beziffert und einkalkuliert. Schäden durch Stürme, Feuer oder Borkenkäfer, die medial besonders präsent sind, sind aus Investorensicht dabei eher zweitrangig. „Bei einem global diversifizierten Waldportfolio einer gewissen Größe spielen solche Naturrisiken eigentlich eine eher untergeordnete Rolle“, sagt Renk. Bei kaum einer anderen Assetklasse gebe es „eine so große Diskrepanz zwischen empfundenen Risiken und echten Risiken“. Mittlerweile hat Meag rund 2 Mrd. Euro in Waldinvestments gesteckt. Die Konkurrenz um attraktive Flächen nimmt allerdings zu. Vor 20 Jahren habe man „fast immer das gleiche Bieterkonsortium“ gesehen, erinnert er sich. Doch mittlerweile entdecken immer mehr Neulinge die Assetklasse Wald für sich.

Wie sich die Rolle von ESG-Ratings verändert | Episode 107
Ab Mitte 2026 gelten neue Regeln im Markt für ESG-Ratings. Erstmals übernimmt mit der ESMA eine Behörde die Aufsicht und Kontrolle über Nachhaltigkeitsratingagenturen im europäischen Raum. Die Regulierung soll für mehr Transparenz und Vergleichbarkeit der Ratings sorgen, etwa durch Offenlegung der Methoden, Datenquellen und Bewertungslogik. Vergleichbarkeit ist gewünscht – Vereinheitlichung hingegen nicht, betont Till Jung, Managing Director und Head of Sustainability Business bei dem Datendienstleister ISS Stoxx, im Podcast „Nachhaltiges Investieren“ der Börsen-Zeitung. „Es gab ja auch Bestrebungen, durch diese Regulierung die Methodik zu vereinheitlichen. Weil es immer Kritik gibt, dass Ratings im Nachhaltigkeitsbereich stark auseinandergehen, je nach Anbieter – wohingegen das doch so schön ist im Kreditrating-Bereich, da sind sich alle einig“, sagt Jung. „Aus meiner Sicht ist das eine etwas verkürzte Sichtweise, weil natürlich im Bereich Nachhaltigkeit auch viel mehr verschiedene Themen zu bewerten sind.“ Investoren müssten sich die unterschiedlichen Methoden anschauen und dann entscheiden, welche Gewichtung zu ihnen passt. Manchen sei beispielsweise die Bewertung kurzfristiger finanzieller Risiken wichtig, anderen die Auswirkungen der Unternehmenstätigkeit auf Gesellschaft und Umwelt. „Es ist ganz wichtig, dass man einfach anerkennt, dass es unterschiedliche Anforderungen und Nachfragen im Markt gibt“, sagt Jung. In seiner Wahrnehmung hat sich die Rolle der Nachhaltigkeitsratings verändert. „Früher hatten viele Fondsmanager und Vermögensverwalter gar keine Expertenabteilungen zu dem Thema nachhaltiges Investment“, erinnert er sich. Ratings sollten in diesen Fällen die benötigten Daten liefern und Orientierung bieten. Mittlerweile ist bei vielen Fondsmanagern allerdings eigenes Expertenwissen vorhanden. Manche Vermögensverwalter haben eigene Abteilungen mit Dutzenden Analysten aufgebaut. Diese Kunden seien nicht an Basisinformationen interessiert, sondern benötigten detaillierte Daten und Branchen-Einblicke, um diese mit dem eigenen Research in Bezug zu setzen, erklärt Jung. Die Datenlage wird nach Jungs Eindruck „von Jahr zu Jahr besser“. Nachholbedarf sieht er beispielsweise noch bei der Erhebung von ESG-Daten entlang der Lieferkette. Doch er ist optimistisch, dass die Anzahl der berichteten Datenpunkte trotz Omnibus-Initiative zunehmen wird. „Es ist nicht so, dass das alles perfekt ist“, sagt Jung. „Aber es ist auch nicht so, dass man den Kopf in den Sand stecken muss.“

Das Problem mangelnder Planungssicherheit für ESG-Investments | Episode 106
Die nachhaltige Transformation der Wirtschaft wird gegenwärtig durch einen Mangel an Planungssicherheit behindert – und dafür ist die Politik mitverantwortlich. Diese Einschätzung äußert Katharina Beck, die finanzpolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag: „Wir brauchen wieder eine gewisse Verlässlichkeit in der Politik – nichts ist schlimmer als dieses ständige Hin und Her“, betont Beck. Natürlich müsse es immer die Möglichkeit geben, Anpassungen vorzunehmen. Aber generell brauche es „eine gewisse Planungssicherheit“. Aktuell herrsche Verwirrung, niemand wisse so recht, welche Vorgaben er einhalten müsse. Konkret verweist Beck zum Beispiel auf die Tatsache, dass die EU-Richtlinie über Nachhaltigkeits-Berichtspflichten, die CSRD, in Deutschland noch immer nicht in nationales Recht umgesetzt worden und daher seit anderthalb Jahren überfällig sei. Mit Blick auf den Gesetzesentwurf, der nun in erster Lesung im Bundestag verhandelt werde, äußert Beck zwar einige Vorbehalte, weil er bürokratisch aufwändig sei. „Ich bin aus der Motivation heraus, dass es funktioniert, dafür, dass es besonders praxisnah ausgestaltet wird“. Die Finanzexpertin macht aber zugleich deutlich, es sei wichtig, dass nun zügig entschieden werde. Denn Planungssicherheit für Unternehmen sei in den aktuell geopolitisch angespannten Zeiten noch wichtiger. In der öffentlichen Debatte habe das Thema Sicherheit die Debatte über Nachhaltigkeit etwas verdrängt. Beck unterstreicht in diesem Kontext, dass beides durchaus eng verknüpft sei. Europa müsse realisieren, dass es in der EU wenig fossile Vorkommen gebe – und dabei die geopolitische Situation berücksichtigen. Dann werde offensichtlich: „ClimateTech ist ja am Ende auch ResilienceTech oder wie immer man das nennen will.“ Was die Investitionen in ClimateTech und GreenTech angeht, erinnert die Bundestagsabgeordnete daran, dass Deutschland vor zwei Jahren im Bereich der Klima- und Umwelttechnologien noch Vize-Weltmeister war. „Und ich hätte richtig Bock, dass wir da wieder Weltmeister werden.“ Dabei sei es nicht richtig, Industrie und Nachhaltigkeit – wie es oft in der politischen Debatte geschehe – argumentativ als einen Gegensatz darzustellen. „In meinem Wahlkreis wird gerade ein neues Plastik hergestellt, das man sofort auf den Kompost werfen kann, das ist ja auch Industrie.“

Das ESG-Datendilemma der Banken | Episode 105
Ist Nachhaltigkeit für Mittelständler in Deutschland kein Thema mehr? Der Eindruck könnte fast entstehen – schließlich werden sie im Zuge der Omnibus-Initiative von Reportingpflichten entlastet. „In der Breite hat sich einfach manifestiert: ESG ist tot“, beobachtet Michael Sindram, Gründer und Geschäftsführer von OpenESG, einer Plattform zur Erfassung und Analyse von Nachhaltigkeitsdaten. Dabei sei das Gegenteil der Fall – gerade in der Bankenwelt würden ESG-Risiken immer relevanter. Da mittelständische Firmenkunden die Nachhaltigkeitsdaten nicht im Rahmen einer Berichtspflicht erfassen, müssen Banken nachfragen. „Dann kommen Sie natürlich in eine sehr unangenehme Diskussion. Sie sind sofort in der Rechtfertigungspflicht“, sagt Sindram. Für eine Studie hat OpenESG mit Partnern gerade 165 Teilnehmer aus deutschen Finanzinstituten zur Relevanz von ESG-Daten befragt. Dabei wurde deutlich, dass es den Banken zunehmend schwerfällt, die erforderlichen Angaben zu erheben – gerade bei mittelständischen Firmenkunden. In der Kreditvergabe an Mittelständler nutzen zwei Drittel der Banken hauptsächlich Branchen- oder Durchschnittswerte. Mit Blick auf das Risikomanagement sei dies schwierig – es drohe eine Negativauslese, mahnt Sindram. „Wenn ich ein Unternehmen bin mit einem sehr schlechten ESG-Footprint, dann bin ich natürlich froh, wenn ich den Durchschnittswert bekomme“, erklärt er. Wer hingegen über dem Branchendurchschnitt liege, werde benachteiligt. „Das ist aus Risikomanagementgesichtspunkten definitiv nicht die optimale Lösung.“ Im Gespräch berichtet Sindram, wie die Banken versuchen, dieses Datendilemma zu lösen, und welche Perspektive auf Nachhaltigkeit er aus seiner eigenen Zeit im Unternehmensmanagement mitgenommen hat.

Nachhaltigkeit bei Schwellenländer-Anleihen | Episode 104
Auf Wunsch eines institutionellen Investors, der nachhaltig in ein Staatsanleihen-Portfolio für Industrieländer investieren wollte, hat der Assetmanager Degroof Petercam Asset Management (DPAM) 2007 begonnen, ein ESG-Bewertungstool zu entwickeln. Mittlerweile nutzt DPAM dieses auch für Analysen von Schwellenländer-Anleihen. „Für uns ist das ein Risikothema“, erklärt Deutschland-Chef Thomas Meyer im Podcast „Nachhaltiges Investieren“ der Börsen-Zeitung. Demokratische Werte stehen für den Assetmanager mit 4 Mrd. Euro Assets under Management an erster Stelle. Staaten, die von der Nichtregierungsorganisation Freedom House als autoritär eingestuft werden, seien beispielsweise aus Nachhaltigkeitsperspektive nicht investierbar. „Das hat uns schon in der Vergangenheit vor so manchem Risiko bewahrt“, sagt Meyer. Insgesamt fließen mehr als 50 Datenpunkte in unterschiedlicher Gewichtung in die Analyse ein. Die Datenqualität hat sich in der Breite in den vergangenen Jahren „deutlich verbessert“, beobachtet der DPAM-Deutschland-Chef. Wichtig sei allerdings, auf vertrauenswürdige Quellen zu achten. Daten kommen beispielsweise vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder von Indexanbietern. Lücken machen sich in der Einstufung negativ bemerkbar: „Wenn wir gar keine Informationen haben oder veraltete, dann führt das eben dazu, dass der Datenpunkt nicht bewertet wird“, erklärt Meyer. Das Land falle dadurch im Ranking zurück. Abstiege im Ranking haben Folgen für den Anteil der Mittel, die ein Portfoliomanager allokieren darf. So fließen 40% der Mittel in die Länder, die im obersten Quartil einsortiert sind. Der Schwellenländerbegriff ist allerdings weit gefasst. In der Liste findet sich beispielsweise Singapur, das von der Wertschöpfung her höher liege als so manches Industrieland, wie Meyer einräumt. Andere Länder hätten hingegen keine große finanzielle Basis, aber investierten dennoch in ihr Nachhaltigkeitsprofil. Die unterschiedliche Ausgangsbasis will der Assetmanager über einen Trendindikator ausgleichen. „Dieser Trendindikator bewertet die Entwicklung eines Landes in rollierenden Dreijahreszeitraum“, erklärt Meyer. Wenn sich ein schwaches Land in der Nachhaltigkeitsbewertung steigere, dann gebe es einen Bonus obendrauf. Wer hingegen über finanzielle Mittel verfüge, sich aber schlechter entwickle, werde mit Punktabzügen bestraft. Länder, die im Nachhaltigkeitsranking gute Werte erreichen, sind Meyers Beobachtung zufolge in vielen Bereichen ein stabileres Investment. Sie seien widerstandsfähiger bei Umweltkatastrophen, „aber auch was deren demokratisches Setup, die Institutionen angeht“.

Die Klima-Vorbilder im Dax | Episode 103
Das Climate-Tech-Unternehmen Right° schaut sich in seinem „What if“-Report an, wie stark die Dax-Konzerne zur Erderwärmung beitragen – und zumindest eine Handvoll Vorbilder ist bereits auf gutem Weg, die Vorgaben der Pariser Klimaziele einzuhalten. In den am Donnerstag veröffentlichten Ergebnissen der jüngsten Ausgabe stechen von 34 untersuchten Unternehmen fünf besonders positiv hervor. Sie haben ein Klimaziel definiert, das im Einklang mit den Pariser Klimazielen von „deutlich unter 2 Grad Celsius“ liegt. Und die Datenentwicklung der vergangenen Jahre zeigt, dass sie auf Kurs liegen, dieses Ziel auch zu erreichen. Einige weitere Unternehmen erfüllen zumindest einen der beiden Faktoren. Die Modelle von Right° zeigen, wie stark sich die Erde bis zum Jahr 2100 erwärmen würde, wenn die Welt dieselbe Klimaperformance hätte wie das betrachtete Unternehmen. „Insgesamt nennen wir 21 Unternehmen im „What if“-Report, die in irgendeiner Form greifbaren Fortschritt machen in Richtung Pariser Klimaziele. Und das finde ich schon ganz gut“, sagt Hannah Helmke, CEO von Right°, bei der Einordnung der Ergebnisse im Podcast „Nachhaltiges Investieren“ der Börsen-Zeitung. Die Branchenzugehörigkeit lässt sie als Ausrede für schwächere Klimawerte nicht gelten. Das Modell basiere auf branchenspezifischen Benchmarks: „Die Emissionsreduktionsanforderungen an ein Unternehmen im Energiebereich sind anders als bei einem Unternehmen in der Chemie-Branche.“ Auch die fünf Vorbilder stammen aus unterschiedlichen Bereichen. Helmke war von einem Energieunternehmen positiv überrascht: „Die RWE ist unter den fünf Unternehmen, die sowohl ein Paris-konformes Ziel hat, als auch ihre Wertschöpfung von den Emissionen in Paris-konformem Tempo entkoppelt“, berichtet sie. Auch der Autobauer Porsche erfüllt beide Voraussetzungen, ebenso Siemens Healthineers, Adidas und die Deutsche Börse. Ein Ergebnis bereitet Helmke allerdings Sorgen: Die mittlere Klimawirkung über alle Unternehmen hinweg liegt nun bei 4,3 Grad Celsius, nach 3,7 Grad Celsius im Vorjahr. „Die Lücke zu 1,5 Grad hat sich leider wieder geweitet vom Jahr 2023 auf das Jahr 2024 – da haben wir noch nicht mal den Trump-Effekt drin.“

Vom Umgang mit Rüstung, Rohstoffen & Co. | Episode 102
Das Thema Rüstung ist derzeit allgegenwärtig, auch bei Investoren. Die Renditen sind attraktiv. Aber bei nachhaltigen Investments ergibt sich ein Spannungsfeld, sagt Daniel Sailer, Head of Sustainable Investment Office bei Metzler Asset Management, im Podcast „Nachhaltiges Investieren” der Börsen-Zeitung. Er beobachtet, dass Kunden sich intensiv mit der Branche befassen – und mitunter neu darüber nachdenken, welche Auswirkungen ein Ausschluss von Rüstungswerten auf ihr Anlageuniversum hat. „Es gibt Versicherungsunternehmen, die immer Rüstung ausgeschlossen hatten, und sich jetzt im Kontext dieser politischen Veränderungen die Frage gestellt haben: Ist es noch zeitgemäß?“, berichtet Sailer. Hinzu komme der Rendite-Aspekt: „Ist es für mich als Anleger vielleicht sogar meine treuhänderische Pflicht, Rüstung aufzunehmen?“ Wichtig sei es, die quantitativen Effekte in der Kapitalanlage zu ermitteln. „Das hat dann doch der eine oder andere schon stark unterschätzt“, beobachtet Sailer. Metzler Asset Management hat sich vor kurzem einem Moratorium im Bereich Tiefseebergbau angeschlossen. Die Technologie zur Rohstoffförderung in der Tiefsee wird von Umweltschützern scharf kritisiert. Erste Tests für Tiefseebergbau habe es bereits vor über 30 Jahren gegeben, die damals genutzten Gebiete hätten sich aber seither nicht erholt, erklärt Sailer. Wird es Kunden nicht irgendwann zu viel, wenn man von ihnen verlangt, sich nun auch noch mit Tiefseebergbau zu befassen? „Ja, die Reaktion ist verständlich. Die habe ich auch schon bekommen“, räumt Sailer ein. Das Thema ist aus seiner Sicht aber besonders wichtig, gerade weil es noch nicht so bekannt ist. Es sei „von dramatischer Bedeutung“.

Der Faktor Mensch im ESG-Monitoring | Episode 101
Mit einem verwalteten Vermögen von rund 10 Mrd. Euro hat sich die Investmentboutique Palladio Partners auf Private Markets spezialisiert. Barbara Treusch verantwortet als Director die Nachhaltigkeitsthemen und muss die Herausforderungen bei verschiedenen Investitionswegen von Dachfondsstrukturen bis zu Direktinvestments im Blick behalten. „Wir haben permanent mit Unsicherheiten und mit unvollständigen Informationen zu kämpfen. Das wird auch eine Regulierung, egal in welche Richtung sie geht, nicht ändern“, sagt Treusch im Podcast „Nachhaltiges Investieren“ der Börsen-Zeitung. Durch eine Fortbildung zur Nachhaltigkeitsmentorin hat Treusch gelernt, wie wichtig Kommunikation für die Umsetzung einer ESG-Strategie ist. „Ein Datenpunkt kommt nicht einfach so. Sondern da stecken Menschen, die treffen Entscheidungen, es gibt Aktivitäten – und das ist ja die Basis, um überhaupt Informationen und Daten einsammeln zu können.“ Eine Herausforderung sieht sie darin, aus diesen Erkenntnissen dann konkrete Handlungsweisen abzuleiten: „Wie kann ich denn – oder Menschen, die ich begleite –, in dieses Tun kommen.“ In schwierigen Situationen hilft ihr die Weiterbildung zur ESG-Mentorin: „Unsicherheiten bei Investoren, bei unseren Teammitgliedern, die sind nun mal da“, sagt Treusch. Eine wichtige Veränderung hat die Regulierung aus ihrer Sicht aber angestoßen: „Sie hat uns eine gewisse Macht gegeben“, findet Treusch. Diskussionen mit dem Management könne man dadurch anders führen. Mittlerweile gehe es weniger darum, formale Kriterien von Artikel-8- oder Artikel-9-Fonds zu erfüllen. „Wir gehen jetzt viel stärker in die fachliche Diskussion.“

Warum Sustainable Finance am Storytelling arbeiten muss | Episode 100
Als der Podcast „Nachhaltiges Investieren“ im Oktober 2021 startete, war die Corona-Pandemie noch ein prägendes Thema. „Ich glaube, da kam Deutschland gerade kollektiv aus der Joggingrose raus“, erinnert sich Henrik Pontzen, Chief Sustainability Officer bei Union Investment, im Gespräch zur 100. Podcast-Episode. Ist er nun zufrieden mit der Entwicklung von Sustainable Finance seither? Wenn man bedenke, wie dramatisch sich die Weltenlage seither insgesamt seitdem verändert habe, könne man durchaus zufrieden sein, findet Pontzen. Allerdings müssen ESG-Themen seiner Wahrnehmung nach am Image feilen: „Wir hängen in der nachhaltigen Kapitalanlage viel zu häufig noch zu sehr in diesem Ausschlussdiskurs.“ Die Fokussierung auf Ausschlüsse und Einschränkungen schreckt nach seiner Wahrnehmung viele Kapitalmarktteilnehmer ab. Dass es beim Storytelling hapert, erklärt Pontzen sich mit dem starken Fokus des Kapitalmarkts auf kurzfristige Entwicklungen. „Gerade deswegen ist es so wichtig, diese Professionalität zu haben, immer wieder auch die lange Frist mit in den Entscheidungshorizont zu nehmen.“ Die aktuelle ESG-Müdigkeit führt er ein Stückweit auch auf eine Überfrachtung mit Nachhaltigkeitsanforderungen zurück: „Backlash kommt notwendigerweise nach Overload. Das ist eine Korrekturbewegung, die ganz wichtig ist, um auch wieder Spreu vom Weizen zu trennen.“ Es gelte nun, durch Anpassungen in der Regulierung und ein neues Narrativ einen guten Mittelweg zu finden. Dann könne Europa durchaus langfristig Wettbewerbsvorteile durch seine ambitionierte Herangehensweise erzielen.

Impact Investing in Emerging Markets | Episode 99
Seit fast 20 Jahren ist Edda Schröder mit Invest in Visions im Impact Investing unterwegs – und fokussiert sich dabei auf Regionen, die für viele außerhalb des Fokus liegen. „Ich habe immer das Gefühl, wenn der institutionelle Kunde über seinen Tellerrand hinausblickt, sind wir in Europa, eventuell noch Amerika. Aber Emerging Markets ist ganz weit weg“, berichtet Schröder im Podcast „Nachhaltiges Investieren“ der Börsen-Zeitung. Zudem gebe es in einigen Häusern selbst auferlegte Einschränkungen. „Richtlinien geben vor, dass man das teilweise nicht darf“, sagt sie. Sie würde sich wünschen, dass der Horizont weiter aufgeht. „Wir müssen einfach globaler denken.“ Bei Investitionen in Afrika käme oft die Reaktion – „Oh Gott, Korruption!“, berichtet sie. „Dieses Vorurteil sollten wir versuchen, einfach abzulegen. Das sind super-professionelle Unternehmen, die in afrikanischen Ländern unterwegs sind.“ Bei Invest in Visions wird Schröder sich perspektivisch aus der operativen Führung zurückziehen, den Großteil ihrer Anteile verkaufte sie 2022. Noch denke sie „noch nicht so viel darüber nach“, räumt sie ein. „Aber, vielleicht so im nächsten Jahr, sollte man intensiver drüber nachdenken.“

Wie Nachhaltigkeit das Geschäftsmodell von Versicherungen beeinflusst | Episode 98
Bei ESG-Themen gibt es gerade zwei gegenläufige Tendenzen: Einerseits mehren sich Schlagzeilen über verheerende Waldbrände und Überschwemmungen, andererseits sind viele Menschen des Themas müde geworden. Für Philipp Bäcker, Leiter Nachhaltigkeit bei der R+V Versicherung, ist das der Punkt, der ihn zurzeit „am meisten umtreibt“, berichtet er im Podcast „Nachhaltiges Investieren“ der Börsen-Zeitung. Denn Nachhaltigkeit berührt für Versicherungen zentrale Fragen, bis hin zum Geschäftsmodell: „Ich glaube, dass die die Stärke von Versicherern in Zukunft nicht mehr das sein wird, was unsere Stärke in der Vergangenheit war“, sagt er. Die Branche müsse sich stärker fragen, wie man Risiken versicherbar und bezahlbar halten könne – etwa durch Prävention und Beratung der Versicherungsnehmer. Bäcker engagiert sich auch im Vorstand des Vereins für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten (VfU). In dem Mitte der 90er Jahre gegründeten Netzwerk sind Sustainable Finance Professionals aus mehr als 60 Finanzunternehmen aktiv, von Versicherungen über Asset Manager bis hin zu Banken. Eine Beobachtung teilten die Nachhaltigkeitsmanager über die Gewerke hinweg: „Wir merken, dass beim Thema Nachhaltigkeit eine gewisse Erschöpfung eingetreten ist“, beobachtet Bäcker. Ein Grund dafür ist seiner Einschätzung nach die hohe Belastung durch regulatorische Neuerungen wie die CSRD. Doch auch „ein fehlendes Backing von oben“ sei problematisch. Viele Menschen seien aus ihren angestammten beruflichen Positionen in Nachhaltigkeitsrollen gewechselt, „ganz pathetisch gesprochen mit dem Anspruch, die Welt einen Ticken besser zu machen.“ Nun sei es wichtig, die Stimmung wieder zu heben und in die Umsetzung zu kommen. „Sind wir mal ganz ehrlich, die großen Herausforderungen kommen ja eigentlich noch“, meint Bäcker. „Da brauchen wir motivierte und kompetente Menschen.“

Early-Stage-Investments im Energiesektor: Wer hat Potenzial? | Episode 97
Die Dekarbonisierung ist für Felix Krause nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Investmentmöglichkeit. Seit Oktober 2020 investiert er als Gründungsmitglied mit dem Venture-Capital-Investor Vireo Ventures in Unternehmen, die neue Wege zur Energieerzeugung und -nutzung erarbeiten. Die wichtigsten Ansätze für den Investor sind Elektrifizierung und Digitalisierung. „Wir investieren in die Hypothese der elektrifizierten Welt, angetrieben von erneuerbaren Energien. Und wir suchen die Startups, die diese elektrifizierte Welt orchestrieren“, erklärt er im Podcast „Nachhaltiges Investieren“ der Börsen-Zeitung. Im Fokus stehen junge Unternehmen, die oft erst ein Jahr alt sind – Zahlenreihen zu Umsatz und Ergebnis sucht man bei denen vergebens. Ein wichtiger Faktor für die Investitionsentscheidung ist daher das Team. Das Management sollte „eine sehr starke Tech-Komponente“ mitbringen, sagt Krause. Man brauchen ein Team, das „das Hustler-Gen hat, wirklich bereit ist, jeden Stein umzudrehen und wirklich für den Erfolg kämpft“. Natürlich sei auch das Produkt wichtig – „jedoch in der Phase, in der wir investieren, werden die meisten Teams nicht mit der Lösung, die sie ursprünglich vorgestellt haben, durchs Ziel gehen“, erklärt Krause. Krause bringt Erfahrung aus beiden Seiten mit: Mehrere Jahre arbeitete er für Innogy Ventures, den damaligen Venture-Arm des Energieunternehmens, der 2020 von Future Energy Ventures übernommen wurde. Die Sorgen und Nöte der Gründer kann Krause nachvollziehen. Als 2009 der Boom im Bereich Photovoltaik kam, hat er mit einem Geschäftspartner selbst ein Unternehmen gegründet. „Ich glaube, das Gründen an sich wird sehr häufig glorifiziert“, sagt er rückblickend. Was er aus den Erfahrungen mitnimmt und auf welche Technologie er setzt, erklärt Felix Krause im Podcast.

Was bleibt vom Sustainable-Finance-Beirat? | Episode 96
Als Expertengremium mit 34 Mitgliedern stand der Sustainable-Finance-Beirat der vergangenen Bundesregierung beratend zur Seite. Der Bruch der Ampel-Koalition im Herbst brachte dann ein vorzeitiges Ende. „Mir war ganz klar im November: Okay, wenn jetzt Ampel-Aus ist, dann machen wir noch bis zum Ende der Legislaturperiode. Das war ganz klar“, erinnert sich die damalige Beiratsvorsitzende Silke Stremlau im Podcast „Nachhaltiges Investieren“ der Börsen-Zeitung. Stremlau war bereits in der vorherigen Legislaturperiode Mitglied des 2019 neu gegründeten Beirats, 2022 übernahm sie in der 20. Legislaturperiode den Vorsitz. Zum Start hat sie sich damals gewünscht, dass der Beirat von der Bundesregierung zu konkreten Problemen angefragt wird und man messbare Erfolge in den Portfolios und bei der Regulierung sieht. Hat es geklappt? „Teils, teils“, resümiert Stremlau. Die Einbindung des Gremiums habe bei der Offenlegungsverordnung (SFDR) gut geklappt, beim Thema Aktienrente hingegen nicht. „Aber ehrlich gesagt, ich glaube, von dem, was ich mir damals gewünscht hätte, da haben wir vielleicht die Hälfte erreicht oder 40% erreicht.“ Was sie an den Strukturen und Abläufen verbessern würde, welche persönlichen Erfahrungen sie aus der Arbeit mitnimmt und warum sie dem Gremium noch einige weitere Jahre wünschen würde, berichtet Stremlau im Podcast.

Was die BaFin von der SFDR-Reform erwartet | Episode 95
Mit Angaben wie „Artikel 8“ oder „Artikel 9“ sollte die EU-Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) den Anlegern mehr Orientierung beim nachhaltigen Investieren bieten. Doch in der Praxis werden die Angaben oft als Label für vermeintlich besonders nachhaltige Produkte fehlinterpretiert. „Dabei ist ‚Artikel 8‘ acht oder ‚Artikel 9‘ keine Definition von Ambitionsniveaus an Nachhaltigkeit“, betont Theresa Nabel, Co-Head des Zentrums Sustainable Finance bei der Finanzaufsicht BaFin, im Podcast „Nachhaltiges Investieren“ der Börsen-Zeitung. Vielmehr gehe es um unterschiedliche Transparenzstufen. Mindestkriterien für Nachhaltigkeit seien damit nicht verbunden. Eine Reform der SFDR soll künftig für mehr Klarheit sorgen. Nabel sieht bei Anlegern durchaus ein Bedürfnis nach einem Label, das nachhaltige Produkte klar von anderen abgrenzt. „Das bedeutet, dass wir wirklich stark dafür plädieren, dass ein Kategoriesystem eingeführt wird.“ Die Produktkategorien sollten dann mit klaren Kriterien unterlegt sein. Im Gespräch sind derzeit eine Nachhaltigkeitskategorie und eine Transformationskategorie. „Die unterstützen wir auch“, sagt Nabel. Kritisch sieht sie eine dritte Kategorie, die unter dem Titel „ESG-Kollektion“ diskutiert wird. „Die hätte ein deutlich niedrigeres Ambitionsniveau.“ In diese Kategorie könnten die aktuellen Artikel-8-Produkte überführt werden. Der Finanzmarktteilnehmer könnte in der ESG-Kollektion selbst festlegt, welche Mindestschwellen oder Mindestkriterien er „Das sehen wir eben als kritisch an, weil es ja genau das ist, was aktuell nicht funktioniert“, sagt Nabel. Neben klaren Kriterien wünscht Nabel sich auch eine stärkere Einbindung der Anlegerinnen und Anleger. Im aktuellen System seien viele Informationen schwer verständlich aufbereitet oder für Investoren nicht aussagekräftig. Die BaFin plädiert für ein Consumer Testing der möglichen neuen Produktkategorien vor ihrer Einführung – „damit das System im Vorhinein einmal geprüft wird und ausprobiert wird, damit es dann im Nachhinein funktioniert – und wir nicht bald wieder die Notwendigkeit für einen Review sehen“.

Von der Unternehmensberatung zum Impact Investing | Episode 94
Es gibt Stationen in Saskia Bruystens Lebenslauf, die viele in der Finanzbranche vorweisen können: einige Zeit in der Unternehmensberatung bei der Boston Consulting Group, ein Studium an der London School of Economics. Was hingegen die wenigsten im CV stehen haben, ist ein gemeinsames Business mit einem Friedensnobelpreisträger. Bruysten gründete mit Muhammad Yunus das Unternehmen Yunus Social Business. Das gelang, wie sie rückblickend sagt, aufgrund einer gewissen „Dreistigkeit“ auf ihrer Seite: „Yunus sprach an der LSE, wo ich damals studiert habe, und sprach über Microfinance“, berichtet sie im Podcast „Nachhaltiges Investieren“ der Börsen-Zeitung. Nach dem Vortrag rannte sie auf die Bühne, drängelte sich durch die Menge und sprach Yunus an. Der lud sie ein, nach Bangladesch zu kommen. „Normalerweise ist das sozusagen seine Art und Weise, Leute abzuwimmeln“, erklärt Bruysten. Doch sie nahm die Einladung an. „Ich war halt hartnäckig oder dreist oder wie man es noch nennen will, und bin dann tatsächlich gekommen.“ Ihren Investitionsfokus hat Bruysten mittlerweile vom globalen Süden auf den Norden verlagert. Dort wird der Großteil an CO2-Emissionen verursacht. Die Plattform Carbon Equity, bei der sie als Co-Founder International an Bord ist, konzentriert sich auf Klimatechnologien und will Lösungen schaffen, die CO2-Ausstöße verringern. Für sie ist privates Kapital ein unterschätztes Instrument im Kampf gegen den Klimawandel. „Wir denken alle über unseren persönlichen Fußabdruck nach und denken: Ach, wir sollten weniger Fleisch essen, wir sollten weniger fliegen.“ Der größte Hebel liege aber bei vielen Menschen im Kapital. Man müsse sich stärker bewusstmachen, „dass Kapital Power bedeutet“, sagt Bruysten. Welchen Hebel sie in privatem Kapital sieht, was sie sich vom neuen Eltif-Regime verspricht und warum Klimatechnologien für sie das wichtigste Thema derzeit sind, erklärt sie im Podcast "Nachhaltiges Investieren".

Worauf es bei Systemic Investing ankommt | Episode 93
Geld investieren und damit eine bestimmte Entwicklung befördern – diese Idee kennen die meisten von Impact Investments. Auch Systemic Investing zielt auf Ergebnisse ab, allerdings unterscheiden sich die Ansätze. „Der große Unterschied liegt daran, dass man beim Impact Investing letztlich in einzelne Punktlösungen investiert“, erklärt Falko Paetzold, Gründer und Leiter des Center for Sustainable Finance and Private Wealth im Fachbereich Finanzen der Universität Zürich, im Podcast „Nachhaltiges Investieren“ der Börsen-Zeitung. So könne Impact Investing etwa darauf abzielen, in einem Fahrzeug eine andere Antriebstechnologie zu verwenden. Das systemische Investieren könnte stattdessen betrachten, wie die Mobilität in Deutschland für Einzelpersonen aufgestellt ist: „Wer sind die unterschiedlichen Akteure, und dann – ganz wichtig – was sind die wichtigsten Hebelpunkte, um tatsächlich großen Wandel in diesem ganzen System zu erreichen?“ Viele Hochvermögende seien an Nachhaltigkeit sehr interessiert– doch die Kundenberater bildeten mitunter eine Barriere, beobachtet Paetzold. Er hat mit seinem Team auch einen Investor Guide entwickelt, der die Herangehensweise des Systemic Investing zusammenfasst. Entscheidend ist aus seiner Sicht, dass sich die Investoren selbst überlegen, was sie mit ihren finanziellen Mitteln erreichen wollen, wie ihre Renditeerwartungen sind und wie stark sie das Investment mit philanthropischer Arbeit verbinden wollen. Vermögensverwalter oder Berater führten diese Diskussion mit den Kunden zu wenig, kritisiert Paetzold. Am Ende könne auch das Ergebnis stehen, für unterschiedliche Kapitaltöpfe verschiedene Ziele auszurufen. „Das können Impact-Ziele sein, das können finanzielle Ziele sein.“ Paetzold ist überzeugt, dass auch traditionelle Investoren von dem Ansatz des Systemic Investing noch lernen können. Das Prinzip findet er so einleuchtend, dass man den Ansatz aus seiner Sicht, wenn man ihn einmal verinnerlicht hat, „nicht wieder vergessen kann“.

Das ESG-Datenproblem der Immobilienbranche | Episode 92
Die Immobilienbranche spielt bei der nachhaltigen Transformation eine große Rolle, doch am Überblick über ESG-Daten mangelt es vielerorts. Es gebe einige „wirklich tolle Vorreiter“, sagt Johanna Fuchs-Boenisch im Podcast „Nachhaltiges Investieren“ der Börsen-Zeitung. In vielen Unternehmen fehle es aber an Transparenz. „Und zwar gar nicht, weil die Unwillens sind, sondern weil das eine schwierige Nuss ist, die man hier zu knacken hat.“ Wie schwer Veränderungen zu erzielen sind, hat sie in den zurückliegenden Monaten selbst erlebt. Fuchs-Boenisch wurde 2023 CEO bei Susteco, einer Plattform, über die Akteure der Immobilienbranche ihre ESG-Daten erfassen und analysieren konnten. Die Idee hinter dem Ansatz: stärker kollaborativ arbeiten. 2023 wurde Susteco als Bosch-Tochter in Berlin gegründet. Doch Mitte April hat Bosch entschieden, das Corporate Start-up einzustellen. „Gestiegene Zinsen, der makroökonomische Outlook. Das sind alles Themen, wo eine Datenplattform vielleicht noch als ‚nice to have‘ betrachtet wird und nicht als ein ‚must have‘“, erklärt Fuchs-Boenisch. Fuchs-Boenisch sieht das freilich anders, für sie gehören ESG-Daten weit oben auf die Agenda. „Die Immobilienbranche trägt zum Beispiel bis zu 40% aller CO2-Emissionen bei. Das ist ein Riesenthema“, betont sie. Kleine Fortschritte könnten aus ihrer Sicht spürbare Verbesserungen bringen: „Wir haben da natürlich auch eine Riesenchance, weil: Einsparung ist Einsparung. Egal, ob ich da ESG draufschreibe oder was anderes.“ Sie ist überzeugt, dass ESG-Transparenz auch bei Finanzierungen zunehmend eine Rolle spielen wird. „Banken verlangen immer mehr Transparenz, auch was ihr Reporting angeht. Und meine persönliche Meinung ist, dass es einen Riesenunterschied macht, ob ich mit sieben oder acht Banken sprechen kann und deren Erfordernisse erfülle oder ob es nur mehr zwei sind.“ Was sie aus ihrer Erfahrung als Investmentmanagerin über den Umgang mit ESG-Transparenz mitgenommen hat, wie sie das Aus von Susteco erlebt hat und welche Ansätze sie für die Branche sieht, erklärt Johanna Fuchs-Boenisch im Podcast.

Argos Wityu zielt mit Mittelstandsfonds auf Dekarbonisierung | Episode 91
Bei Transaktionen ist das Timing oft entscheidend. Der Private-Equity-Investor Argos Wityu hatte den Faktor auf seiner Seite, als er im Januar das Final Closing seines Climate Action Fonds verkündete – noch vor dem stärker werdenden ESG-Backlash. Mit 337 Mill. Euro hat Argos das Zielvolumen um 12% übertroffen. Über das Timing war er „absolut erleichtert“, sagt Partner Fabian Söffge im Podcast „Nachhaltiges Investieren“ der Börsen-Zeitung. Argos Wityu versteht den Climate Action Fonds nicht als Impact-Fonds, sondern als Buyout-Fonds mit einem Fokus auf Dekarbonisierung und Mittelstand. „Ungefähr zwei Drittel der Emissionen in Europa werden durch mittelständische Unternehmen verursacht“, sagt Söffge. Etwa zehn bis zwölf Investments soll der Fonds tätigen, der „Sweet Spot“ liegt bei 30 bis 40 Mill. Euro Equity und Unternehmenswerten um die 100 Mill. Euro. Die Unternehmen sollen einerseits eine attraktive finanzielle Entwicklung erwarten lassen, zudem soll über Dekarbonisierung zusätzlicher Wert generiert werden. „Wir reden oft über energieintensive Industrien, wo jede Kilowattstunde Gas, die ich einsparen kann, schlichtweg Geld spart, aber natürlich auch Emissionen“, sagt Söffge. Welche Emissionsziele der Investor den Portfoliounternehmen vorgibt und wie diese an die Übergewinnansprüche der Investmentmanager gekoppelt sind, erklärt er in der aktuellen Episode von „Nachhaltiges Investieren“.

Wasserfußabdruck als Indikator für Nachhaltigkeit | Episode 90
Wenn es um ESG-Kennzahlen geht, ist der CO2-Fußabdruck häufig dabei. Der Wert wird von Unternehmen selbst, aber auch von externen Anbietern erhoben. „Das ist im Vergleich relativ leicht zu schätzen“, erklärt Walter Hatak, Head of Responsible Investments bei Erste Asset Management, im Podcast „Nachhaltiges Investieren“ der Börsen-Zeitung. Der Wasserfußabdruck hingegen sei komplexer. „Er sagt uns einerseits, wie effizient Unternehmen im Bereich Wassernutzung sind, und andererseits, in welchen Regionen die Wasserentnahme stattfindet.“ Aus Hataks Sicht könnte der Wasserfußabdruck eine ähnliche Funktion einnehmen wie der CO2-Fußabdruck. Beide Kennziffern dienen als Indikatoren: „CO2 ist ein Vorlaufindikator, wie die Erderwärmung weitergehen wird“, erklärt Hatak. Im Bereich der Biodiversität messe man zurzeit primär den Artenverlust. „Ein Vorlaufindikator, der sich in Zukunft anbieten könnte, wäre durchaus Wasser.“ Auch aus wirtschaftlicher Sicht sollten Unternehmen sich seiner Meinung nach mit Wasser auseinandersetzen. Hersteller von Mikrochips etwa seien auf sauberes Wasser angewiesen. Die Ressource habe daher auch eine finanzielle Komponente. Welche Fortschritte die Unternehmen bei der Datenerhebung zum Thema Wasser machen und wo häufige Fehlerquellen liegen, erklärt er im Podcast.

Patente als Indikator für ESG-Innovationen | Episode 89
Wie lassen sich die ESG-Bemühungen eines Unternehmens von außen einschätzen? Andreas Schubert, ESG Officer und Portfoliomanager bei Ariad Asset Management, setzt dafür auf Patente. Er will Unternehmen ausfindig machen, die an spannenden Entwicklungen arbeiten – und ihre Branche damit ein wenig grüner machen. Ariad verwaltet ein Vermögen von rund 300 Mill. Euro Assets under Management und hat sich auf weltweite Small- und Microcap-Unternehmen spezialisiert. „In der zweiten Reihe ist auch die Technologie noch wichtiger“, sagt Schubert im Podcast „Nachhaltiges Investieren“ der Börsen-Zeitung. Der Portfoliomanager ist überzeugt: „Wer es ernst meint mit ESG, der forscht und entwickelt in dem Bereich. Und das sehe ich über Patente.“ Wie er an die Daten kommt und für welches Moonshot-Projekt er sich zurzeit besonders begeistern kann, erklärt er im Podcast „Nachhaltiges Investieren“.

Wie Kommunen grüne Finanzierungen nutzen | Episode 88
Von Infrastrukturprojekten bis zum sozialen Wohnungsbau – Kommunen bringen viele Voraussetzungen für grüne Finanzierungen mit. Dennoch ist ihr Anteil an den Finanzierungen im kommunalen Umfeld überschaubar. Axel Wilhelm, Geschäftsführer bei Ethifinance Deutschland, geht von etwa 10% aus. Er setzt auf die Vorbildfunktion erster Pionier-Emittenten wie München, Köln, Hannover und Münster. „Es werden tendenziell mehr“, sagt er im Podcast „Nachhaltiges Investieren“ der Börsen-Zeitung. Die Kommunen sind aus seiner Sicht „eigentlich ideale Emittenten für nachhaltige Anleihen“. Ein Grund ist ihr Projektportfolio „Da passt vieles per se schon in die Klammer nachhaltiger, das heißt grüner, sozialer Anlagen“, sagt Wilhelm. Herausfordernder sei es häufig, die Prozesse für eine Emission aufzusetzen. Welche Voraussetzungen die Kommunen schaffen müssen und wie sie sich von Emittenten im Unternehmensumfeld unterscheiden, berichtet Wilhelm im Podcast.

Grüner Zwilling: Warum Source For Alpha einen Fonds gedoppelt hat | Episode 87
Vor gut einem Jahr hat die Frankfurter Vermögensverwaltung Source For Alpha (S4A) einen ihrer Fonds geklont – auf Wunsch eines großen institutionellen Investors. Dieser wollte eine Investitionsmöglichkeit, die nach Offenlegungsverordnung als „hellgrüner“ Artikel-8-Fonds klassifiziert sein sollte, erklärt S4A-Mitgründer und Vorstand Christian Funke im Podcast „Nachhaltiges Investieren“ der Börsen-Zeitung. Um nicht den bestehenden Fonds komplett umgestalten zu müssen, hat S4A entschieden, ihn zu doppeln. „Aufgabe bei der Entwicklung des Investmentprozesses war: Wir wollen die originäre Anlagestrategie – die US Value Aktienstrategie – anpassen, dass sie alle Anforderungen für Artikel 8 erfüllt, und idealerweise natürlich keinen Malus auf der Renditeseite hat“, erklärt er. Dadurch entstand der grüne Zwillingsfonds. Die Zwillinge sind zu etwa 80% deckungsgleich, erklärt Funke. Etwa ein Fünftel der Titel des Originalfonds habe man für die Artikel-8-Variante aufgrund von Ausschlusskriterien aussortieren müssen. Die Entwicklung der beiden Fonds sei zuletzt „erstaunlich parallel“ verlaufen, berichtet er. In den zurückliegenden 15 Monaten habe die ESG-Variante sogar eine leicht höhere Rendite erwirtschaftet – dies sei aber eher Zufall, sagt Funke. Den Unterschied mache die Entwicklung der 20% Anteile, die nicht gedoppelt wurden. Dass die ESG-Variante des Fonds zu 80% mit dem Original übereinstimmt, macht die Risikosteuerung einfacher als etwa bei einem Impact-Fonds nach Artikel 9, der das Investmentportfolio stärker einschränken würde. Dennoch fände Funke es gut, wenn sich Produkte mit nachhaltiger Ausrichtung stärker differenzieren ließen. Teile der Branche hätten die Offenlegungsverordnung „als Marketinginstrument“ eingesetzt und nutzten Attribute wie „Artikel 8“ wie ein ESG-Siegel. Funke würde mehr Trennschärfe an dieser Stelle begrüßen. Wie er die Motivation der Kunden für nachhaltige Investments erlebt und welchen Beitrag der Schwarmintelligenz-Ansatz beim Aufbau eines grünen Portfolios leisten kann, berichtet er im Podcast.

Zwischen ESG-Backlash und Langfristzielen | Episode 86
Austritte aus Klimainitiativen, das Ende für Diversity-Programme – im ESG-Bereich häufen sich derzeit die Negativschlagzeilen. Doch man müsse differenzieren, mahnt Henrik Pontzen, Chief Sustainability Officer der Union Investment, im Podcast „Nachhaltiges Investieren“ der Börsen-Zeitung. Aus Amerika komme viel „Noise“, doch es gelte weiterhin: „Der Klimawandel ist real, und er ist da.“ Die übergroße Mehrheit der professionellen Investoren am Kapitalmarkt werde sich an diesem Fakt orientieren, ist Pontzen überzeugt. Dabei gehe es auch darum, Risiken zu vermeiden: „Wer langfristig Geld anlegt, kann auf der einen Seite ein besseres Risikomanagement bekommen, indem gerade langfristig wirkende Risiken – Nachhaltigkeitsrisiken – systematisch analysiert werden.“ Auf der anderen Seite könne man auch Renditequellen erschließen, wenn man früh auf langfristige Investmenttrends setzt. Aus seiner Sicht ist derzeit „die Stimmung schlechter als die Sachlage“. Welche Fortschritte er speziell den Dax-Konzernen bei der Klimafitness attestiert und wo er Erfolge im Engagement-Ansatz sieht, berichtet er im Podcast.

Wollen Investoren überhaupt noch Impact? | Episode 85
Der Investment Manager Susi Partners wirbt mit dem Slogan von „Impactful Returns“, Susi steht für Sustainable Investment. Doch mit Impact und dem Schwerpunkt auf nachhaltiger Energieinfrastruktur rennt man derzeit nicht überall offene Türen ein, sagt Raphaela Schmid, Head of ESG and Sustainability. „Es ist schon richtig, dass das ganze Thema Nachhaltigkeit in den letzten zwei Jahren natürlich auch im ganzen geopolitischen Umfeld, in dem wir alle leben, ein bisschen eingebüßt hat“, sagt sie im Podcast „Nachhaltiges Investieren“ der Börsen-Zeitung. Das liege auch daran, dass es bei Themen wie Nachhaltigkeit oder Impact „schwieriger ist, nachzuvollziehen, wer was tut“. Die Inhalte seien erklärungsbedürftig, das benötige mitunter Zeit. Entmutigen lassen will sie sich von dem Gegenwind allerdings nicht. „Ich sehe es tatsächlich gar nicht so negativ“, sagt Schmid. Das Thema habe in den zurückliegenden Jahren einen Boom erfahren, „der vielleicht auch nicht immer gesund war“. Nun versuche man, über eine stärkere Regulierung wieder mehr Einheitlichkeit zu erreichen. Wie unterschiedlich Investoren auf das Thema Impact reagieren, wieso Susi Partners auch in Südostasien in die Energiewende investiert und warum ihr intern ihre Erfahrung im Investment Management hilft, erklärt Raphaela Schmid im Podcast.

Transformationsfinanzierung in Deutschland und Frankreich | Episode 84
Bei Gesprächen über nachhaltige Investments fallen in Deutschland meist Begriffe wie Artikel-8-Fonds oder Artikel-9-Fonds. „In Deutschland, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, dann ist es nur grün, tiefgrün, ultragrün – also man erwartet quasi, dass ein Unternehmen oder dass eine Person dieses Nachhaltigkeitsthema schon bis zum Endpunkt, bis zum Extrem durchgesetzt hat“, beobachtet John Korter, Head of European Sales bei dem französischen Vermögensverwalter La Financière de l'Echiquier (LFDE). Der Ansatz im Nachbarland sei ein anderer, erklärt er im Podcast „Nachhaltiges Investieren“: „In Frankreich sagt man: ‚Okay, wie kommen wir dahin?‘“ Durch den stärkeren Fokus auf die Transformation sei das Investitionsuniversum breiter, der Fokus liege in Frankreich eher auf dem Weg und nicht allein auf dem Ziel. Dem Ansatz kann Korter einiges abgewinnen – und auch den Ansatz, Privatanleger etwa durch steuerliche Anreize zu Anlagen in Aktiensparplänen zu motivieren, begrüßt er. In Deutschland dagegen sieht er bei ESG-Investments eine wachsende Zurückhaltung. „Bis auf wirklich spezialisierte Investoren oder auch institutionelle Investoren, die das als Vorgabekriterium haben, will inzwischen keiner mehr über das Thema reden.“ Wann sich das aus seiner Sicht wieder ändern dürfte und welche finanziellen Anreize die Fondsmanager im Nachhaltigkeitsbereich haben, berichtet Korter im aktuellen Podcast.

Wie sich der CO2-Fußabdruck im Portfolio senken lässt | Episode 83
Seit fast 16 Jahren ist Christian Jasperneite Chief Investment Officer der Privatbank M.M. Warburg & Co., vor fünf Jahren ist er zudem unter die Unternehmer gegangen. Gemeinsam mit einem Partner hat er Cap2 gegründet, ein Unternehmen, das sich mit der Stilllegung von CO2-Emissionsrechten befasst. Er habe sich darüber geärgert, dass der Standardansatz zur CO2-Reduzierung in Portfolios zumeist in Umschichtung bestehe, berichtet er im Podcast „Nachhaltiges Investieren“ der Börsen-Zeitung. Damit ist aus seiner Sicht wenig gewonnen: „Wir reden alle über Impact Investing, aber wenn man ehrlich ist: Durch das Umschichten von Portfolios habe ich gerade keinen Impact – also vielleicht ganz indirekt, aber direkt ganz sicher nicht.“ Interessenkonflikte gebe es durch die Doppelrolle nicht, versichert er. Cap2 erwirbt überschüssige Emissionsrechte und legt diese dann still. Mit Blick auf die Rendite ist das allerdings nicht förderlich – im Gegenteil. „Am Ende werden ja Rechte gekauft und quasi vernichtet. Und das kostet Geld“, erklärt Jasperneite. Die Zahl der Nutzer sei daher begrenzt, oft entschieden sich Family Offices dafür. Zu glauben, dass Impact immer umsonst sei, sei „ein Wunschgedanke, der im echten Leben nicht wirklich funktioniert“, sagt Jasperneite. Welche Effekte er durch die Stilllegung der Zertifikate sieht und wie er auf das 1,5°-Klimaziel blickt, erklärt er im Podcast.

Enpal geht neue Finanzierungswege | Episode 82
Als Verkäufer für Solaranlagen ist Enpal 2017 an den Markt gegangen, inzwischen werden die Anlagen auch vermietet oder zum Ratenkauf angeboten. Diese Finanzierungslösungen für die eigenen Kunden muss Enpal wiederum selbst refinanzieren. Im November hat Enpal eine erste Verbriefung von Kundenkrediten umgesetzt und eine damit besicherte Anleihe emittiert. „Wir gehen davon aus, dass wir ungefähr einmal im Jahr diesen Public-Teil der Verbriefung machen werden“, sagt Felix Eisel, Mitgründer der Finanzierungseinheit Enpal Financial Services, im Podcast „Nachhaltiges Investieren“. Eine Regelmäßigkeit sei wichtig für die Struktur der Finanzierungen. „Es ist eine Maschinerie, es ist ein standardisierter Prozess. Dem will man dann auch immer wieder was geben.“ Für Enpal, deren Wachstum stark schuldenfinanziert ist, eröffnet die Einheit neue Finanzierungswege. Während Verbriefungen von Solaranlagenkrediten in den USA schon seit einigen Jahren etabliert sind, ist die Assetklasse in Deutschland noch relativ unbekannt, Verbriefungen kennt man eher von Autokrediten. Dass einige Tranchen der Enpal-Transaktion im November dennoch mehrfach überzeichnet waren, schreibt Eisel dem engen Zuschnitt zu: „So ein Solarkredit oder ein Wärmepumpenkredit, der geht nur an deutsche Hausbesitzer“, erklärt er. Dieser Bereich sei bei internationalen Investoren gefragt, aber bislang kaum zugänglich gewesen – und er zahle auf ESG-Anforderungen ein. „Es gibt sozusagen nichts Grüneres als einen Kredit für eine Solaranlage auf einem Haus.“ Was Enpal sich von den Transaktionen im US-Markt abschauen kann, welche regulatorischen Herausforderungen es bei der Gründung gab und wie er den Wechsel vom Fondsboutique-Inhaber auf die Unternehmensseite erlebt hat, berichtet Eisel im Podcast.

Wie Viessmann sich ein grünes Portfolio aufbaut | Episode 81
Am M&A-Markt meldet sich Viessmann derzeit regelmäßig zu Wort. „Wir sind gerade dabei, das neue Kapitel des Familienunternehmens Viessmann zu schreiben“, sagt COO Boris Scukanec Hopinski im Podcast „Nachhaltiges Investieren“. Den unternehmerischen Kern bilden 30 Beteiligungen mit insgesamt etwa 1 Mrd. Euro Umsatz, fast zehn Transaktionen sind im laufenden Jahr bereits hinzugekommen. Mit dabei sind Investitionen in Infrastruktur, im Gesundheitsbereich und im Energiesektor. Bei Transaktionen tritt Viessmann sowohl als Mehrheitseigner als auch als Co-Investor auf. Dabei gibt es aber eine Bedingung: „Auch, wenn wir in die Minderheit gehen, reden wir von einer sogenannten qualifizierten Minderheit“, betont der COO. In der Regel sieht Viessmann je Investment einen dreistellgien Millionenbetrag vor. Man wolle „natürlich auch mit den Unternehmen zusammenarbeiten“, sagt Scukanec Hopinski. „Das erfordert natürlich auch eine Fokussierung in der Stückzahl auf unserer Seite.“ Was ein Investment mitbringen muss, um interessant zu sein und an welchen Leitfragen sich Investitionsentscheidungen orientieren, erklärt er im Podcast.

Grüner Wasserstoff & Co.: Finanzierung für die Energiewende | Episode 80
Mit einem Volumen von 270 Mill. Euro soll der Power-to-X Entwicklungsfonds (PtX) der KfW Bankengruppe in den nächsten Jahren Wasserstoffprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern fördern. Das Mandat als Investment Manager des Fonds liegt bei dem Vermögensverwalter KGAL. Thomas Engelmann, der das Energy Transition Team bei KGAL verantwortet, ist nun in Personalunion auch Geschäftsführer des PtX-Entwicklungsfonds. Bei den PtX-Mitteln handelt es sich um Zuschüsse – die Perspektive als Investment Manager bei KGAL, wo im Bereich Sustainable Infrastructure rund 3,5 Mrd. Euro Assets under Management liegen, ist daher eine andere: „Ich vergleiche jetzt mit dem PtX-Fund: Dort versuchen wir, die Projekte zu stimulieren, indem wir Geld geben zum Financial Close. Im Fonds der KGAL ist es anders, dort können wir die gesamte Wertschöpfungsstufe bearbeiten“, erklärt Engelmann in der aktuellen Podcast-Episode von „Nachhaltiges Investieren“. Dass er sich mit seinen zwei Perspektiven am Markt selbst begegnet, ist ausgeschlossen: Der PtX-Development Fund sei auf sieben Länder fokussiert, in denen der KGAL-Fonds nicht aktiv ist, sagt Engelmann. Auch wenn bei den KfW-Zuschüssen keine Renditeerwartungen im Fokus stehen, sieht er Parallelen, etwa bei der Projektanalyse. Dort gehe das Team genauso vor wie ein Investment Management. Wie der mehrmonatige Auswahlprozess für das PtX-Mandat gelaufen ist, warum Erfahrung in Entwicklungsländern für die Rolle wichtig ist und wieso er politische Risiken als besonders relevant für einen Erfolg der Energiewende einstuft, erklärt Engelmann im aktuellen Podcast.

Wie ein Forstwissenschaftler auf Waldinvestments schaut | Episode 79
Für FS Impact Finance, eine Tochter der Frankfurt School, berät Thomas Richter Investoren bei der Restoration Seed Capital Facility zu nachhaltigen Waldinvestments im globalen Süden. Als Forstwissenschaftler hat er einen ungewöhnlichen beruflichen Hintergrund. Doch für Richter stand früh fest, dass er beruflich mit Natur und Wäldern zu tun haben möchte, berichtet er im Podcast „Nachhaltiges Investieren“. Nach dem Studium der Forstwissenschaft arbeitete er zunächst für eine auf die Holzindustrie spezialisierte Unternehmensberatung, von dort wechselte er in die Finanzindustrie. Die mit 25 Mill. Euro ausgestattete Facility beteiligt sich an den Investitionen im globalen Süden durch eine Co-Finanzierung der Projektentwicklungskosten. An diesem Punkt scheitern Richter zufolge viele Investments. Richter ist regelmäßig auch vor Ort, um die Partner für die lokale Umsetzung kennenzulernen. „Wenn Sie im Amazonas oder in Afrika unterwegs sind und wirklich mit ‚boots on the ground‘ die Projekte anschauen – das ist glaube ich auch eine der wichtigsten Komponenten der Due Diligence, dass man wirklich eine Vertrauensbasis zu den Partnern aufbaut“, sagt er. Welche Projekte ihn besonders beeindruckt haben, wie es bei den Investitionen um das Thema Rendite steht und wie der Blick des Forstwirtes ihm in der täglichen Arbeit hilft, das erklärt er im Podcast.

„Verwirrung“ durch EU-Vorgaben | Episode 78
Die EU-Vorgaben stellen Anleger, die sich in nachhaltigen Produkten engagieren wollen, noch immer vor schwierige Aufgaben, unterstreicht Roland Kölsch, Verantwortlicher Standards & Labels beim gemeinnützigen Wissenschaftsverein F.I.R.S.T. e.V. im Podcast „Nachhaltiges Investieren“ der Börsen-Zeitung. Denn das Zusammenspiel von Taxonomie, MiFiD und Offenlegungs-Verordnung ist verwirrend, beispielsweise wegen der unterschiedlichen Möglichkeiten der Definition des Begriffs einer nachhaltigen Investition. Die Märkte haben auf der Suche nach Differenzierungsmerkmalen die Kategorisierung von Fonds in Art. 6, Art. 8 oder Art. 9 dazu beigetragen, dass diese Kategorien als Qualitäts-Labels wahrgenommen worden. Die Tatsache, dass in den EU-Institutionen über Reformen des Regelwerks nachgedacht wird und Vorbereitungen für Anpassungen gestartet wurden, ist aus Sicht von Kölsch ein Hoffnungszeichen.

Wie Siemens Healthineers über Nachhaltigkeit berichtet | Episode 77
Über die Schwerpunkte der eigenen Nachhaltigkeitsstrategie berichtet Siemens Healthineers bereits, doch mit der EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung kommen künftig weitere Angaben hinzu. Neben eigenen Daten werden dann auch Angaben von Lieferanten und Kunden entlang der Wertschöpfungskette erhoben. In der Kommunikation werde es darum gehen, für Investoren und andere Stakeholder die wirklich wesentlichen Informationen in den Fokus zu rücken, sagt CFO Jochen Schmitz im Podcast „Nachhaltiges Investieren“ der Börsen-Zeitung. Wer Unternehmensinformationen lese, werde künftig in der Finanz- und in der Nachhaltigkeitsberichterstattung mit einer Flut an Informationen konfrontiert. „Diese Flut hat ja nur eine Richtung, sie wird mehr.“ Eine wesentliche Aufgabe der Investoren- und der Unternehmenskommunikation müsse darin liegen, die strategischen Schwerpunktthemen herauszuheben. Siemens Healthineers engagiert sich in der Debatte um regulatorische Anforderungen im Deutschen Rechnungslegungs-Standards-Committee. Insgesamt bewertet Schmitz die Entwicklung der zurückliegenden Jahre positiv: „Ich glaube, gerade im Bereich der Corporate Governance, der Finanzberichterstattung, ist die deutliche Mehrheit der Themen sinnvoll“, sagt er. „Ich muss jetzt gestehen, bei dem Sustainability-Thema bin ich mir noch nicht so sicher. Ich glaube, da sind wir sehr schnell vorangegangen. Da müssen wir jetzt mal gucken, was sich da wirklich etabliert, was wirklich sinnvoll ist.“ Wie Siemens Healthineers sich auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung nach der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vorbereitet, wo er Mehraufwand auf das Unternehmen zukommen sieht und welche strategischen Schwerpunkte der Dax-Konzern in seiner Nachhaltigkeitsstrategie setzt, erklärt Schmitz im Podcast.

Kleiner Investor, großer Konzern: Wie aussichtsreich ist aktive Beteiligung? | Episode 76
Weil er selbst mit den Angeboten für Geldanlage unzufrieden war, gründete Tillmann Lang mit einem Kommilitonen die Plattform Inyova, die sich auf Impact Investing spezialisiert hat. Mit 300 Mill. Franken Assets under Management ist das in Zürich gegründete Unternehmen ein vergleichswese kleiner Marktteilnehmer. „Wir sind nicht Blackrock“, sagt Lang. Ernstgenommen werde man aber trotzdem: „Wir vertreten Kleininvestoren aus dem Streubesitz. Das sind Aktionäre, die kennen die Unternehmen oft gar nicht genau, das ist für die interessant“, beobachtet er. Bei BMW, Netflix oder der Zurich Versicherung hat Inyova schon auf Veränderungen gedrungen, um die Unternehmen nachhaltiger auszurichten. BMW habe er als „relativ offen“ für ihr Anliegen empfunden, sagt Lang – im Gegensatz zu Netflix. Ihm ist wichtig, den Konzernen mit konstruktiven Vorschlägen zu begegnen. „Wir treten nicht die Tür ein und werfen Farbbeutel.“ Dass nachhaltige Investments zuletzt weniger Rendite erzielt haben, sei für die Anleger „eine starke Probe des Nachhaltigkeitswunsches“, räumt er ein. Nach welchen Kriterien Inyova die investierbaren Unternehmen auswählt, welche Rolle Crowd-Investments für die Finanzierung des Start-ups spielen und was ein Konzertflügel mit der Gründungsgeschichte zu tun hat, erklärt er im Podcast-Gespräch.

Was auf Fonds mit „grünen“ Namen zukommt | Episode 75
Eine neue ESMA-Leitlinie soll künftig die Namensgebung von Fonds mit Fakten unterlegen – wer Begriffe wie Umwelt, Sozial oder Impact verwendet, muss bestimmte Vorgaben erfüllen. „Aus meiner Sicht ist die Leitlinie ein Meilenstein“, sagt Daniel Sailer, Head of Sustainable Investment Office bei Metzler Asset Management, im Podcast Nachhaltiges Investieren. Die Zahl der betroffenen Fonds ist hoch: Über 60% des Fondsmarkts in Europa sind Sailer zufolge bereits als Artikel 8 oder Artikel 9 klassifiziert, davon tragen etwa 16% einen Nachhaltigkeitsnamenszusatz. „Das sind 16% von 6 Billionen Fonds.“ Anleger könnten die „grünen“ Fonds dank der Richtlinie künftig transparenter vergleichen und sicherstellen, dass ihre Anlagepräferenzen wirklich berücksichtigt sind. Doch auf die Anbieter kommt nun Arbeit zu. Die Übergangsfrist für die Anpassung auf die ESMA-Leitlinie endet im Mai 2025. Für Unternehmen mit Nachhaltigkeitsbezug im Namen greifen künftig bestimmte Benchmarks und klimaspezifische Grenzwerte. Sailer rechnet damit, dass es auch Fälle geben wird, in denen die Fonds den Umwelt-Bezug im Namen lieber streichen werden als sich daran anzupassen. Außerdem erwartet Sailer, dass es eine große Zahl an Transitionsfonds geben wird. Diese aufzunehmen, sei ein „absoluter Wunsch von vielen Marktteilnehmern“ gewesen, berichtet er. Mitunter müsse man dorthin gehen, „wo es dreckig ist, um sauber zu machen“. Dies ermögliche der Transitionsrahmen. Allerdings muss auch dieser Transitionspfad messbar gemacht werden. Wie das aussehen kann und wie Metzler Asset Management sich selbst in den nächsten Monaten auf die ESMA-Leitlinie vorbereitet, erklärt Sailer im Podcast.

Impact im Großen und im Kleinen | Episode 74
Für die Energiewende werden große Summen benötigt, und zumindest ein Teil davon soll über European Long-Term Investment Funds (Eltif) zusammenkommen. Tobias Huzarski hat als Head of Impact Investment der Commerz Real den Fonds Klimavest konzipiert. Seit Ende Oktober 2020 hat dieser 1,4 Mrd. Euro Kapital angezogen und gilt damit als einer von Deutschlands größten Eltif in dem Bereich. Huzarski sieht mit Blick auf den Kapitalbedarf „Platz für sehr, sehr viele Fonds“, die im ein- oder zweistelligen Milliardenbereich investieren können, erklärt er im Podcast Nachhaltiges Investieren. Sachwertefonds, die in konkrete Projekte investieren, sind für ihn ein wichtiger Baustein bei der Energiewende. Man brauche „einen vertikalen Kapitalfluss“, der in konkrete Projekte fließt. Neben dem großen Maßstab kümmert Huzarski sich in sogenannten Change Clubs auch um Veränderungsmöglichkeiten im Kleinen. Beide Perspektiven ergänzen sich für ihn. So könne man auf der einen Seite große Summen an Kapital bewegen, „aber auf der anderen Seite, im persönlichen Leben und Umfeld, fallen kleine Veränderungen oft sehr, sehr schwer“, beobachtet er. Welche kleinen Schritte im Alltag einen Impact haben können und wie er im großen Maßstab die Auswahl von Projekten für den Eltif trifft, berichtet Huzarski im Podcast.

Greenwashing & Co.: Wann sind Klimaklagen erfolgreich? | Episode 73
ESG-Themen werden immer stärker reguliert. Damit steigt die Gefahr, gegen eine Vorgabe zu verstoßen, sagt Thomas Nebel, Partner bei der Kanzlei Dentons. Klima-bezogene Prozesse hätten in den vergangenen zwei Jahren „massiv zugenommen“, berichtet er im Podcast „Nachhaltiges Investieren“. Doch was ist eigentlich erlaubt und was nicht? Eine klare Linie in der Rechtsprechung hat sich Nebel zufolge noch nicht herausgebildet, was die Orientierung für Unternehmen erschwere. Doch es gibt erste Ansätze. Vor wenigen Wochen hat sich der Bundesgerichtshof zu Wort gemeldet und zumindest das Thema Greenwashing dadurch „sehr allumfassend mitentschieden“, findet Nebel. Es gilt nun: „Wenn ich mehrdeutige Begriffe nehme, muss ich sie erklären, und ich muss sie an Ort und Stelle erklären. Alles andere geht nicht.“ Wer also Attribute wie „umweltschonend“ auf eine Verpackung schreibt, müsse „höllisch aufpassen“, warnt Nebel. Die geforderten Erklärungen lassen sich auf kleinen Verpackungen kaum platzieren. Wie Unternehmen sich behelfen können, welche weiteren regulatorischen Entwicklungen noch bevorstehen und warum hinter Klimaklagen nicht immer nur finanzielle Motive stehen, erklärt der Jurist im Podcast.

Private-Market-Investments zwischen Nachhaltigkeit und Rendite | Episode 72
Als Fund-of-Fund-Manager investiert Nordic Investment Opportunities mit Hauptsitz in Dänemark im Bereich Private Markets, etwa in Private Equity, Private Debt oder Real Assets. Der Großteil der Anleger sind Family Offices und kleinere institutionelle Investoren, erklärt Marc Dellmann, der die DACH-Region verantwortet. Ihm ist es wichtig, vor einer Investitionsentscheidung die Beweggründe eines Fonds zu verstehen: „Wir schauen pro Jahr ein Universum von etwa 500 Managern an, in verschiedenen Bereichen, von denen wir dann vielleicht vier oder fünf auswählen. Die Selektionskriterien sind da schon sehr hoch“, sagt Dellmann im Podcast „Nachhaltiges Investieren“. Impact ist für ihn ein wichtiges Element jeder Due Diligence. Ein Private-Equity-Manager müsse die Absicht mitbringen, in Unternehmen zu investieren, die eine positive Auswirkung auf die Gesellschaft oder das Klima haben – und er müsse in der Lage sein, diese Auswirkung auch zu messen, betont Dellmann. Dabei soll das Investment aber immer auch mit einer mindestens marktüblichen Rendite einhergehen: „Es geht nicht um Philanthropie.“ Nordic Investment Opportunities sieht sich als aktiver Manager: In regelmäßigen Follow-ups werde überprüft, dass die Manager bei ihren Nachhaltigkeitszeilen auf Kurs liegen, erklärt Dellmann. Gerade bei Family Offices, bei denen die jüngere Generation das Steuer übernimmt, sieht er eine steigende Nachfrage nach Sustainable Investing. Wie er zu Nachhaltigkeitskennziffern steht und welche Länder er bei nachhaltigen Investments zurzeit noch ein Stück weiter vorn sieht als Deutschland, verrät er im Podcast.

Woran Unternehmen in der Value Balancing Alliance arbeiten | Episode 71
Wer schon einmal eine Bilanz gelesen hat, findet sich auch in der Bilanz eines anderen Unternehmens rasch zurecht. Bei Nachhaltigkeitsberichten ist das anders. Die hohe Varianz und Vielfalt an Informationen seien ein „Grundproblem“ der Nachhaltigkeitsdebatte, sagt Christian Heller, Vorstandsvorsitzender der Value Balancing Alliance, im Podcast „Nachhaltiges Investieren“. In der Allianz engagieren sich Vertreter großer Unternehmen, aber auch die Big-Four-Wirtschaftsprüfer. Hellers beruflicher Hintergrund liegt beim Chemiekonzern BASF. Er meint: „Um die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen relevant zu machen, müssen wir auf eine ähnliche Vereinfachung kommen wie bei finanziellen Statements.“ In der Allianz tauschen sich Unternehmen darüber aus, wie sich die Nachhaltigkeitsperformance am besten messen lässt. Das Ziel: ökologische und soziale Auswirkungen in vergleichbare Finanzdaten zu übersetzen. Durch den starken Fokus auf regulatorische Themen sei jedoch zuletzt die Diskussion darüber, wie man die ESG-Daten für Entscheidungen und Analysen nutzen kann, in den Hintergrund gerückt. Am Ende gehe es darum, die Nachhaltigkeitsperformance auch zu bepreisen, erklärt Heller: Wenn ein Unternehmen besser sei als der Wettbewerb, solle es dafür auch belohnt werden. Während die Value Balancing Alliance primär die wirtschaftlichen Entscheidungsträger adressiert, gibt es eine Vielzahl an anderen Initiativen, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf ähnliche Themen schauen. Das sei „eine große Spaghetti-Schüssel“, räumt Heller ein. Wie groß seine Hoffnung auf mehr Einheitlichkeit ist und warum die VBA mit Metriken arbeitet, die Angaben in Euro auswerfen, erklärt er im Podcast-Gespräch.

Wie geht man mit Öl- und Gasinvestments um? | Episode 70
Der Umgang mit Investitionen in Öl und Gas ist für Investoren und Unternehmen ein kritisches Thema. Die Fondsgesellschaft Union Investment hat nun angekündigt, fossile Investitionen einzuschränken. So dürfen etwa ESG-Fonds von April 2025 an nicht mehr direkt in Wertpapiere von Unternehmen der Öl- oder Gasförderung investieren. Konventionelle Fonds sollen kein Geld mehr in Unternehmen stecken, die mehr als 5% des Umsatzes in der Förderung von Teersand erzielen. Allerdings werden Öl und Gas in der Wirtschaft nach wie vor gebraucht. „Wir verabschieden uns nicht vollkommen aus dem Öl- und Gasgeschäft“, betont deshalb Henrik Pontzen, seit April Chief Sustainability Officer bei Union Investment, im Podcast „Nachhaltiges Investieren“. Man wolle aber klare Vorgaben schaffen. Grundsätzlich gelte: „Was wir in Zukunft begleiten, das muss sich glaubwürdig transformieren.“ Pontzen setzt dafür auf den direkten Dialog. Daneben arbeitet er seit Juni im Sustainable Finance Beirat auch am Zukunftsbild eines nachhaltigen Finanzsystems mit. Wie er den Start dort erlebt hat und wo er als neuer CSO bei Union Investment Schwerpunkte setzen will, berichtet er im aktuellen Podcast.

Die ersten Erfahrungen der Wirtschaftsprüfer mit CSRD & Co. | Episode 69
Seit fünf Jahren befasst Yvonne Meyer sich als Wirtschaftsprüferin intensiv mit ESG-Themen – länger als die meisten in der Branche. Mit regulatorischen Vorstößen wie der CSRD werde Nachhaltigkeitsberichterstattung nun jedoch in der Breite ein Thema, betont Meyer im Podcast „Nachhaltiges Investieren“. Nachhaltigkeit sei für Investoren längst entscheidungsrelevant: „Ohne Nachhaltigkeit wird künftig eine holistische Betrachtung von Unternehmen gar nicht mehr möglich sein.“ Auch für die Prüfer bringt die Nachhaltigkeitsberichterstattung eine große Veränderung: Teilweise gibt es Prognosezeiträume von bis zu zehn Jahren – bislang beschränkte sich die zu prüfende Berichterstattung dagegen zumeist auf die kommenden zwölf Monate. „Die neue Berichterstattung ist wirklich ein Paradigmenwechsel“, findet Meyer. Warum sie die Entwicklung ihres Berufs „mega“ findet, wie sich die Prüfer vorbereiten und wie man Mandanten beim ersten Nachhaltigkeitsbericht die Angst vor dem weißen Blatt nehmen kann, erklärt sie im aktuellen Podcast.

Wie die Deutsche Telekom Nachhaltigkeit im Konzern verankert | Episode 68
Jura-Studium, Stationen in Finanzabteilung und Einkauf – mit ESG-Themen ist Melanie Kubin-Hardewig erst im Laufe ihrer Karriere in Berührung gekommen. Heute ist sie bei der Deutschen Telekom für den Bereich unternehmerische Verantwortung zuständig, arbeitet an der Nachhaltigkeitsstrategie und an ESG-Initiativen im Konzern. Die Quereinsteigerrolle sei für den noch jungen ESG-Bereich typisch, berichtet sie im Podcast „Nachhaltiges Investieren“. Mittlerweile nehme die Spezialisierung aber zu. Um das Thema im Unternehmen breit zu verankern, setzt die Telekom auf Nachhaltigkeitsteams in allen zentralen Segmenten der Organisation. Zentrale Ziele seien zudem in der finanziellen Vergütung für sehr viele Beschäftigte verankert. Damit erreiche man auch Menschen, die sich für ESG-Themen sonst weniger interessiert hätten, stellt Kubin-Hardewig fest. Die Fragen von Investoren zu ESG-Themen haben sich über die Jahre verändert: „Es kommt nicht mehr die Grundsatzfrage nach der Nachhaltigkeitsstrategie“, berichtet sie. Stattdessen gingen viele Fragen „ganz tief in die Details“. Ihr Nachschlagewerk zu häufig wiederkehrenden Fragen ist auf 140 Seiten angewachsen. Intern sieht sie große Herausforderungen an die Soft Skills von Führungskräften. Ein Langfristthema wie Nachhaltigkeit komme mit neuen Herausforderungen und Unsicherheiten – das erfordere ein Umdenken: „Viele unserer Informationen sind eben nicht klar und sind auch nicht 100% klar belegt, und trotzdem müssen wir eine Entscheidung treffen.“ Wie die Deutsche Telekom versucht, ihre Beschäftigten dabei mitzunehmen und welche Ansätze es gibt, um die Transparenz entlang der Lieferkette zu erhöhen, berichtet Kubin-Hardewig im Podcast.

ESG-Finanzierung durch Venture Capital und Debt | Episode 67
Mit Zusagen über gut 100 Mill. Euro vom Europäischen Investitionsfonds EIF sowie von Eon im Rücken hat Future Energy Ventures vor wenigen Monaten seinen zweiten Fonds gelauncht. Gut 20 Mill. Euro sind von weiteren Investoren hinzugekommen, bis zum Final Closing am Jahresende sollen es 250 Mill. Euro werden. Der neue Fonds ist ein geöffneter Artikel-9-Kapitalmarktfonds, während der erste Fonds 2016 noch ein reiner Corporate Fonds von Eon war. Die Öffnung erklärt Jan Lozek, Managing Partner von Future Energy Ventures, im Podcast „Nachhaltiges Investieren“ mit der rasanten Marktentwicklung in den zurückliegenden Jahren. Die Verhandlungsmacht hat sich verschoben: Während 2020/21 die Unternehmer oftmals am längeren Hebel saßen, war der Markt zuletzt „eher von Investoren getrieben“, beobachtet Lozek. Zuletzt wurden vermehrt auch Debt-Finanzierer aktiv. Sind sie aus Sicht eines Venture-Investors eher Konkurrenz oder Ergänzung? Grundsätzlich sei es für ein dynamisches Wachstum wünschenswert, wenn in der Branche verschiedene Arten von Finanzierung verfügbar seien, findet Lozek. Allerdings seien die Volumina für Fremdfinanzierungen oft noch grenzwertig klein. „Ich glaube, die Herausforderung für uns als Eigenkapitalinvestoren ist, noch stärker auf das Skalierungsgaspedal zu treten, um dann Fremdkapitalanbietern anzubieten, mit in diese Strukturen einzusteigen. Und gemeinsam können wir dann viel mehr erreichen“, sagt Lozek. Wie Future Energy Ventures bei der Auswahl von Beteiligungen von einer „Bierdeckel-Kalkulation“ zu einer Investitionsentscheidung kommt und ob der Name von Großinvestor Eon bei Start-ups eher Türen öffnet oder für Sorgenfalten sorgt, erklärt Lozek im aktuellen Podcast.

Cleantech: Wo sind die Hoffnungsträger? | Episode 66
Für seinem im März aufgelegten 10xDNA Clean-Technologies-Fonds will Promi-Investor Frank Thelen Hoffnungsträger im Cleantech-Bereich finden. Sich Umweltziele zu setzen findet Thelen wichtig – auch wenn er ESG-Siegel als Nachweis skeptisch sieht. „Diese ganzen Siegel – wir haben auch welche in unseren Fonds – aber, ich bin einfach ehrlich: Ich glaub da nicht dran“, sagt er im Podcast „Nachhaltiges Investieren“. Aufgelegt ist der neue Fonds als Artikel-8-Fonds, etwa 30 Titel soll das Portfolio einmal umfassen. Investoren in ältere Fonds von 10xDNA sitzen auf teils deutlichen Verlusten. Doch die Strategie, möglichst auf Nummer Sicher zu gehen bei der Portfoliozusammensetzung, kritisiert Frank Thelen: Es sei „wirklich erschreckend“, in wie vielen Cleantech-Fonds sich Titel wie Microsoft oder Nvidia fänden, sagt er. Mit einer solchen Auswahl verringerten Fondsmanager das Risiko, sich Ärger einzuhandeln. Auch Thelen setzt auf Tesla und BYD, will aber bei Clean Technologies auch in kleine Firmen investieren. Welche Technologien ihm Hoffnung machen und warum er nicht mehr über Renditeziele spricht, erklärt er im aktuellen Podcast.

Von ESG-Regulatorik zum Kundenfokus | Episode 65
Banken müssen einerseits die ESG-Themen in ihrer Organisation verankern, andererseits aber auch Kunden bei Fragen zur Nachhaltigkeit unterstützen. Für BNP Paribas in Deutschland soll dies Katharina Nickel umsetzen, die vor zwei Jahren „Head of Sustainable Business Investment & Protections Services & Institutional Clients“ angetreten ist. Sie verantwortet Nachhaltigkeit für alle investmentnahmen Bankbereiche – und will den Themenfokus künftig gern verlagern. „Die letzten zwei Jahre waren leider sehr regulatorisch getrieben“, berichtet sie im Podcast „Nachhaltiges Investieren“. Warum leider? „Weil die Regulatorik in einigen Aspekten doch vergessen hat, den Endkunden abzuholen.“ Künftig will sie „hin zu kundenfreundlicher Kommunikation“. Die regulatorischen Dokumente ließen Investoren zu häufig noch ratlos zurück. Das ist ihrer Meinung nach auch ein Grund dafür, dass in Umfragen erst 20 bis 25% der Endinvestoren Interesse an nachhaltigen Investments äußern. In Belgien sei die Zahl deutlich höher, berichtet Nickel – dort seien Schulungen von Kunden zu Nachhaltigkeitsthemen bereits viel stärker verbreitet. Was sie sich von ihren Kollegen im Ausland abschauen kann, welche zentralen Vorgaben von BNP Paribas in Paris kommen und welchen organisatorischen Kraftakt es bedeutet, verschiedene Abteilungen bei internen Vorhaben zu koordinieren, berichtet sie im aktuellen Podcast.

ESG in der Immobilienfinanzierung | Episode 64
Einen aktiven Beitrag zur Erreichung des Pariser Klimaabkommens zu leisten – das hat sich die Deutsche Pfandbriefbank pbb vorgenommen. Den größten Hebel bildet dabei nicht der bankeigene ökologische Fußabdruck, sondern das milliardenschwere Kreditportfolio, das die Bank finanziert, sagt Vorstandsmitglied Pamela Hoerr. „Wir haben uns eine grüne Quote von 30% gesetzt, bezogen auf unser Immobilienkreditportfolio – im Vergleich dazu stehen wir aktuell bei einer Quote von rund 22% unseres Immobilienportfolios“, berichtet Hoerr im Podcast „Nachhaltiges Investieren“. Bis 2026 habe man sich damit „ein ambitioniertes Ziel in der Weiterentwicklung“ gesetzt. Eine der größten Aufgaben sieht Hoerr darin, die Daten zu erheben. Dabei ist die Pfandbriefbank, die für diesen Zweck ein eigenes Scoring-Modell nutzt, auch auf Zulieferung der Kunden angewiesen. Die Anzahl der Datensätze, die eingesammelt werden müssen, sei „enorm“, sagt Hoerr. Das Verständnis der Kunden für den Aufwand ist ihrer Wahrnehmung nach jedoch gestiegen. Bei allen Anforderungen sieht Hoerr auch einen positiven Nebeneffekt in der ESG-Regulierung: Wettbewerber würden sich mit Blick auf die neuen Herausforderungen stärker austauschen und häufiger zusammenschließen, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Welche Aspekte dabei im Fokus stehen und ob sich Fonds ohne Artikel-8-Klassifizierung überhaupt noch vermarkten lassen, sind Themen im aktuellen Podcast.

Kann man Nachhaltigkeit objektiv bewerten? | Episode 63
Zur Nachhaltigkeitsbewertung eines Investments gibt es verschiedene Modelle – doch für Investoren sind diese oft schwer nachvollziehbar. Es herrsche große Unzufriedenheit, was Transparenz und Verständlichkeit der verschiedenen Konzepte angehe, sagt Andreas Gintschel, Geschäftsführer von Effectual Capital, einer 2022 gegründete Tochtergesellschaft des Investment Office Perpetual Investors. Viele Investoren stünden vor einem Dilemma: „Wir wollen diese Transformation begleiten, wir sollen das auch tun – entweder durch die Politik getrieben oder durch letztendlich die Eigentümer, die hinter uns stehen. Auf der anderen Seite finden wir das, was uns an Kriterien aufgezeigt wird, ein sehr großes Stückwerk, uneinheitlich, intransparent“, fasst er das Problem im Podcast „Nachhaltiges Investieren“ zusammen. Er setzt auf eine Analyse, die sich auf messbare Faktoren fokussiert und deren externe Effekte bewertet. 15 Kriterien aus den Bereichen Umwelt und Soziales fließen darin bereits ein, weitere sollen hinzukommen. Dass die EU die Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung ausweitet, sei mit Blick auf den datenbasierten Ansatz „fast ein Geschenk des Himmels“, sagt Gintschel. Für mehr Vergleichbarkeit engagiert Effectual sich auch in der Value Balancing Alliance, wo Gintschel den Austausch mit Unternehmen der Realwirtschaft schätzt. Wo es Gemeinsamkeiten gibt, wo Bewertungen an Grenzen stoßen und an welchen Stellen er die Finanzindustrie in der Pflicht sieht, erklärt er im aktuellen Podcast.

Klima-Aspekte im Fördergeschäft | Episode 62
Seit dem Jahreswechsel gilt bei der NRW.Bank eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie. Nicht nur das eigene Haus soll bis 2045 klimaneutral werden, auch in der Kapitalanlage und im Fördergeschäft sollen ESG-Kriterien stärker einfließen. Gerade im Fördergeschäft ist das eine Herausforderung, sagt Jan Gerdts, Leiter der Abteilung Nachhaltigkeit und Wirkungsmanagement, im Podcast „Nachhaltiges Investieren“. Die zentrale Frage aus seiner Sicht: „Wie können wir weiterhin relativ zugängliche und einfache Förderprogramme strukturieren, aber gleichzeitig auch das Thema Nachhaltigkeit stärker in den Fokus setzen?“ Ein Fokus soll künftig darauf liegen, Unternehmen zu fördern, die besonders transformativ unterwegs sind. Zudem gibt es Mindestanforderungen in den Förderkriterien. Die Datenlage, um die finanzierten Emissionen zu beurteilen, ist allerdings noch lückenhaft: Gerade im Geschäft mit kleineren Mittelständlern können nicht alle Kunden CO2-Bilanzen vorweisen, berichtet Gerdts. Wie sich die Bank in solchen Fällen behilft, welche Steuerungsgrößen die NRW.Bank im Kapitalmarktgeschäft anlegt und welche Hebel er noch sieht um im eigenen Haus auch ohne Kompensationen der Klimaneutralität näher zu kommen, erklärt er im aktuellen Podcast.

Asset-Bewertung in Grad Celsius | Episode 61
Das Klimaziel der UN ist ehrgeizig: Bis Ende des Jahrhunderts soll die menschengemachte globale Erwärmung möglichst auf 1,5 Grad Celsius begrenzt werden. Hannah Helmke, CEO des Tech-Unternehmens Right°, will Portfolien daraufhin prüfen, wie stark sie zur Erderwärmung beitragen. Am Ende der Analyse steht eine Kennzahl in Grad Celsius: „Das Schöne ist, dass es tatsächlich etwas macht mit den Leuten, weil sie die Klimawirkung plötzlich in Bezug setzen können zum Ziel“, berichtet sie im Podcast „Nachhaltiges Investieren“. Oft seien dies „große Aha-Momente“, mitunter werde es emotional. Dass das 1,5°-Ziel fallengelassen wird, hält sie für ein mögliches Szenario, doch Helmke meint: „Davon muss man aber unabhängig sehen, dass ich dennoch den Anspruch haben kann, mein eigenes Unternehmen auf 1,5° zu bringen und allen Menschen, die damit zu tun haben, eine Alternative zu geben, die – wenn die Welt sich selber so verhalten hätte – 1,5°-konform ist.“ Wie Unternehmen auf die Ergebnisse reagieren und welche Punkte bisher die größten Schwierigkeiten bereiten, berichtet Helmke im aktuellen Podcast.

Greenwashing wirft jede Menge Rechtsfragen auf | Episode 60
Was genau ist Greenwashing? Wer ist der Geschädigte? Und wie ist Greenwashing schadensrechtlich zu bewerten, wenn der Investor letztlich Gewinn gemacht hat? Diese und viele andere sehr praxisnahe Fragen treiben die Leibniz-Forschungsgruppe "Nachhaltiges Finanzrecht in Europa" am Frankfurter Forschungsinstitut SAFE um. Der Leiter der Forschungsgruppe, Nikolai Badenhoop, ist in dieser Woche zu Gast bei "Nachhaltiges Investieren", der Podcast der Börsen-Zeitung. Er berichtet über eine umfangreiche Studie, die zu ergründen versucht hat, warum Anfang vorigen Jahres sehr viele "dunkelgrüne" Art.-9-Fonds in "hellgrüne" Art.-8-Fonds umgewidmet worden sind. Und er gewährt einen Ausblick auf das langfristige Projekt eines Gesetzeskommentars über nachhaltiges Finanzrecht in Europa – von der Offenlegungsregeln über die Klimareferenzvorgaben und die Taxonomie-Verordnung bis hin zum europäischen Rechtsrahmen für Green Bonds.

Das Transparenzproblem am Markt für CO₂-Zertifikate | Episode 59
Auf dem Weg zur Klimaneutralität spielen CO₂-Kompensationen für viele Unternehmen eine Rolle. Doch die Projekte mit Blick auf Wirksamkeit und Risiko zu überblicken, ist alles andere als einfach. Neben dem Risiko seien auch der Preis und die künftige Verfügbarkeit wichtige Aspekte, sagt Magnus Drewelies, CEO und Gründer der Plattform für CO₂-Zertifikate Ceezer, im aktuellen Podcast „Nachhaltiges Investieren“. Man müsse die Kompensation auch in fünf oder zehn Jahren in der gewünschten Menge sichern können. Die Plattform umfasst nach eigenen Angaben weltweit über 8.000 Projekte unterschiedlicher Kategorien. Für Kunden sei es häufig nicht einfach, die unterschiedlichen Plattformen und ihre Angebote zu beurteilen, räumt Drewelies ein. Zumal die Branche gegen einen Vertrauensverlust ankämpfen muss: Immer wieder werden Zweifel an der Wirksamkeit einzelner Zertifikate laut. David Antonioli, Chef des Zertifizierungsdienstes Verra, trat 2023 zurück. „Der Markt hat das gemerkt, ganz klar“, sagt Drewelies. Er glaubt, dass eine stärkere Regulierung sinnvoll wäre, um die Transparenz zu steigern und eine Mindestqualität der Angebote zu sichern. Wie er die Entwicklung auf Anbieterseite wahrnimmt, ob er eine Konsolidierung kommen sieht und wie man die Kriterien für eine Risikoeinstufung von Projekten findet, berichtet er im Podcast.

Wie Klimarisiken die Investmentstrategie beeinflussen | Episode 58
Der Weltrisikobericht des World Economic Forum spricht eine deutliche Sprache: Auf Zehnjahressicht sind nach Einschätzung der 1.500 Befragten vier der fünf größten Risiken ökologisch begründet. Eine Investmentstrategie müsse diese Entwicklung einbeziehen, sagt Henrik Pontzen, Abteilungsleiter ESG im Portfoliomanagement bei Union Investment, im aktuellen Podcast „Nachhaltiges Investieren“: „Wir reden ja hier über langfristigen Vermögenserhalt, über langfristige Vermögensmehrung. Und das wird ohne eine ganz systematische Berücksichtigung des Themas Klimawandel nirgendwo funktionieren.“ Dabei sei es dann auch einerlei, ob das Produkt als nachhaltig gekennzeichnet sei oder ob es sich um ein konventionelles Finanzmarktprodukt handle. „Die Integration dieser Risiken in die Kapitalanlage – ohne die kann es nicht gehen.“ Auch wenn sich einige Umweltrisiken wie Extremwetterphänomene durch den Kapitalmarkt nicht unmittelbar beeinflussen lassen, so müsse man diese strategisch berücksichtigen. „Wir werden aus vielen Gründen in den nächsten Jahren die Lieferketten von Unternehmen sehr viel genauer, detaillierter verstehen müssen“, sagt Pontzen. Neben physischen Risiken gehe es dabei zunehmend auch um regulatorische Anforderungen. Pontzen sieht auch die Unternehmen gefordert, in ihrem Einflussbereich für Verbesserungen zu sorgen. Eine Erhebung unter den Dax-Mitgliedskonzernen zeige selbst bei Unternehmen mit ähnlichem Branchenhintergrund noch große Unterschiede. Welche Dax-Unternehmen besonders gut oder schwach abschneiden, wie Asset Manager mit den Nachzüglern umgehen und wieso er es für problematisch hält, wenn Umweltrisiken auf der Zeitachse zu sehr aus einer Langfristperspektive betrachtet werden, das erklärt Pontzen im aktuellen Podcast.

So schauen Banken auf ESG-Daten | Episode 57
Wenn das Pricing von Finanzierungen und Finanzmarktprodukten festgelegt wird, fließt neben weiteren Daten auch die ESG-Performance eines Unternehmens in die Analyse mit ein. Eddy Henning, der das Wholesale Banking im Vorstand der ING Deutschland verantwortet, will aber nicht allein auf ein „Greenium“ als finanziellen Anreiz für nachhaltige Unternehmen abstellen. Er wünscht sich stattdessen mehr Begeisterung für das Thema: „Zum jetzigen Zeitpunkt geht’s noch gar nicht so sehr um harte Daten, es geht wirklich darum: Wie wollen wir 2050 CO2-neutral sein?“. Henning geht davon aus, dass der Wettbewerb um die Finanzierung „grüner“ Adressen zunehmen wird. Seine Firmenkundenbetreuer setzen neben Informationen aus Nachhaltigkeitsreports und Ratings auf regelmäßige Gespräche, um die Entwicklung der Kunden einzuschätzen. In welchen Bereichen sich die Bank mittlerweile aus Finanzierungen zurückzieht, welche Herausforderungen er beim Sammeln von Nachhaltigkeitsdaten derzeit sieht und wie man es schaffen kann, auch in Zeiten von Polykrisen die Euphorie für ESG-Themen aufrechtzuerhalten, berichtet Henning im aktuellen Podcast.

Biodiversität rückt bei Investoren in den Fokus | Episode 56
Die Vielfalt von Arten und Ökosystemen rückt am Kapitalmarkt immer mehr in den Fokus. Biodiversität betrifft die gesamte Wertschöpfungskette, die Datenlage ist jedoch lückenhaft und wird teilweise von regionalen Gegebenheiten beeinflusst. Noch gebe es kein einheitliches Verständnis von Biodiversität, sagt Soňa Stadtelmeyer-Petru, Global Head of Sustainable Investing Client Solutions bei JP Morgan Asset Management, im aktuellen Podcast. Während im Bereich Klima Einigkeit darüber herrscht, mit welchen Methoden sich etwa der Treibhausgasausstoß messen lässt, ist bei Biodiversität vieles noch offen. Asset Manager setzen im Moment stark auf Engagement und den Austausch mit Unternehmen, berichtet Stadtelmeyer-Petru. Wichtig ist es aus ihrer Sicht, dass die Marktteilnehmer sich nicht von der Komplexität des Themas abschrecken lassen. Stattdessen könne man mit konkreten, abgegrenzten Aspekten wie Plastik- oder Wassermanagement starten. Wie sich das Interesse an Biodiversität auf die Nachfrage nach Investments in Wald- und Forstwirtschaft auswirkt und welche Initiativen sich für Rahmenbedingungen einsetzen, sind Themen im Podcast.

Artikel-9-Klassifizierung: Hilfe oder Hindernis? | Episode 55
Eine Klassifizierung nach Artikel 9 soll es Investoren erleichtern, nachhaltige Investitionsmöglichkeiten zu erkennen. Doch Fonds außerhalb der EU werden davon kaum erfasst. Sie haben oft ähnlich ambitionierte Nachhaltigkeitsstrategien wie Artikel-9-Fonds, tragen aber nicht diese Klassifizierung. „Es ist eine regulatorische Eingrenzung, ob ein Fonds sich den EU-Behörden unterwirft oder nicht“, sagt Andreas Nilsson, Head of Impact bei Golding Capital Partners, im aktuellen Podcast „Nachhaltiges Investieren“. Er hat einen Dachfonds aufgesetzt, der Zielfonds ohne eine solche Klassifizierung evaluiert und prüft, ob sie mit den Artikel 9-Kriterien konform sind. Durch diese „Schattenklassifizierung“ vergrößert sich das investierbare Fondsuniversum um etwa das Dreifache, sagt Nilsson. Dabei sollen die Zielfonds strengere Kriterien als für eine reine Artikel-9-Klassifizierung erfüllen. Ein „Impact Pathway“ legt für jeden Fonds bestimmte Nachhaltigkeitsziele fest. „Es geht um hohe finanzielle Rendite, aber nie ohne messbaren Impact“, sagt Nilsson. Von der Prüfung bis zur Investitionsentscheidung vergehen oft mehrere Monate. Nilsson findet es wichtig, sich Zeit zu nehmen. „Impact Investing als Thema ist nicht wirklich ausgearbeitet. Wir lernen immer wieder dazu.“ Wie aufwendig der Prozess der Schattenklassifizierung ist, was bei regulatorischen Änderungen passiert und wie das Feedback von Investoren und Wettbewerbern ist, verrät Nilsson im aktuellen Podcast.

Landwirtschaft und ESG – auf dem Weg zu Standards | Episode 54
Die Landwirtschaftliche Rentenbank ist mit der Aufgabe konfrontiert, Finanzierungen für Landwirte auf Basis unterschiedlicher Datensätze über den CO2-Fußabdrück der Kreditnehmer auszureichen. Denn die Daten, die die Hausbanken der Rentenbank liefern, unterscheiden sich in Intensität, Qualität und Umfang. Deshalb bemüht sie sich um Standardisierung: "Wir sind dabei, gemeinsam mit den Bankenverbänden und Vertretern der Branche zu überlegen, wie wir dieses Datenset vereinheitlichen können", berichtet Vorstandssprecherin Nikola Steinbock. Der Förderbank gehe es nicht darum, Kapital nur in bereits grüne Vorhaben zu lenken, sondern Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit zu finanzieren – also auch Aktivitäten, die "nicht per se grün sind". Wenn Verbraucher in Deutschland weiterhin Fleisch konsumieren wollten, müsse man sich damit befassen, Ställe umzubauen. Aber es bleibe ein Stall mit Tieren drin – und somit Treibhausgasemissionen.

Der Faktor G in ESG: Wird Governance zu wenig mitgedacht? | Episode 53
Wenn es um ESG-Aspekte geht, steht Governance oft eher in der zweiten Reihe. Das hat auch regulatorische Gründe, erklärt Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit & Corporate Governance bei Deka Investment und seit diesem Jahr Mitglied der Kommission des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK), in der neuen Podcast-Episode von „Nachhaltiges Investieren“. So gebe es bei Governance-Themen stark länderbezogene Regelungen, etwa über das Aktienrecht in Deutschland. Klare übergeordnete Vorgaben seien schwierig: „Es gibt ja auch jetzt nicht den Anspruch an den perfekten Aufsichtsrat, an den perfekten Vorstand, das perfekte Board über alle Ländergrenzen hinweg“, sagt Speich. Es sei dahingehend im ersten Schritt auch folgerichtig zu sagen, dass Governance ein etwas exotischeres Dasein in der Nachhaltigkeitsbetrachtung friste. „Wenngleich wir jetzt feststellen, dass eben die ökologisch-sozialen Aspekte eine Steuerung benötigen, und diese Steuerung kann eben nur über die Governance erfolgen. Und das führt dann doch die drei Säulen ESG wieder zusammen“, sagt Speich. Wie sich Governance in Anlagestrategien bereits niederschlägt, was er mit seinem Einsatz für die Kodexkommission erreichen möchte und welche Kritikpunkte er bei Unternehmen mit Blick auf Governance-Fragen immer wieder adressiert, erklärt Speich in der neuen Episode von „Nachhaltiges Investieren“.

ESG in der Arbeit der Investment Professionals | Episode 52
Bilanzierung nach IFRS, Auseinandersetzen mit neuen digitalen Geschäftsmodellen, und jetzt ein verstärkter Fokus auf ESG-Aspekte: Das Berufsbild der Investment Professionals hat sich in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach stark gewandelt, sagt Michael Schmidt, Vorstandsmitglied der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA), im aktuellen Podcast „Nachhaltiges Investieren“. Die Fragestellung, welche Nachhaltigkeitsaspekte auf das Unternehmen wirken, und wie umgekehrt auch das Unternehmen selbst auf Umwelt und Gesellschaft wirkt, seien ein spannendes neues Feld. Dieses komme nicht aus der klassischen Analystenarbeit, sagt Schmidt – „aber es muss voll integriert werden“. Der erweiterte Analyserahmen verändert auch die gesuchten Qualifikationen. Dabei gehe es für Analysten und Asset Manager auch um die Frage, wie sie in ihrem Beruf wettbewerbsfähig bleiben. Entsprechende Stellen für Nachhaltigkeitsexperten gebe es – und zum Teil sei es für Häuser schwer, sie zu besetzen, beobachtet Schmid. Welche Weiterbildungen sich als Standard herauskristallisieren und wie sich die Motivation junger Berufsanfänger verändert, das berichtet er im aktuellen Podcast.

Wie man die Taxonomie in einer Organisation verankert | Episode 51
Bei der EU-Taxonomie ist vieles noch im Fluss. Regulierte Branchen wie Banken sind dagegen daran gewöhnt, sich an festen Vorgaben zu orientieren. Bei der Taxonomie, für die es noch keine Referenzwerte gibt, tun sich daher noch viele Fragestellungen auf, berichtet Luis-Miguel Gutiérrez Demmel, Senior Referent und Spezialist für Nachhaltigkeit und Strategie bei der KfW Ipex-Bank, in der neuen Episode des Podcast „Nachhaltiges Investieren“. „Das große Thema bei der EU-Taxonomie ist: Wie gehe ich mit Unsicherheiten in der Regulatorik um? Und wie schaffe ich das, das in die Bank zu tragen und auch für Verständnis zu werben. Denn am Ende des Tages müssen natürlich die Kollegen mit der Regulatorik leben.“ Das Vorgehen bezeichnet er als „Lernprozess“, sowohl für die Kunden als auch für die Beschäftigten der Bank. Intern habe man versucht, sich an bestehenden Prozessen zu orientieren, um die Vorgaben möglichst effizient und schlank umzusetzen. Wo die Verantwortung für die Taxonomie zurzeit verankert ist, welche Herausforderungen sich speziell mit Blick auf Projektfinanzierungen auftun und wie der gemeinsame Austausch über Taxonomie-Fragen die Zusammenarbeit mit den Kunden verändert, berichtet Luis-Miguel Gutiérrez Demmel im Podcast.

Was ELTIF für die grüne Transformation leisten sollen | Episode 50
Bereits seit 2015 gibt es das Konstrukt des European long-term investment fund (ELTIF), doch die langfristigen Fonds werden bislang kaum genutzt. Dabei sollen sie eine wichtige Rolle dabei spielen, Kapital für Zukunftsbereiche einzuwerben, auch für die grüne Transformation. Über ELTIF sollen Investitionen in Infrastrukturanlagen, die bisher Großanlegern vorbehalten waren, auch für Privatanleger zugänglich werden. Doch die regulatorischen Vorgaben waren bislang eher hinderlich, sagt Christian Humlach, Leiter Client Advisory Österreich und Deutschland bei der Investmentgesellschaft Aquila Capital, im aktuellen Podcast „Nachhaltiges Investieren“. Doch nun hat die EU Erleichterungen auf den Weg gebracht. Für die Investitionen in Assets wie Windparks oder Solaranlagen müssen die Anbieter jedoch erst einmal Vertrauensarbeit leisten. Strengere Vorgaben zu Transparenz und Diversifikation sind für Humlach ein Schritt in die richtige Richtung. Die Zahl der Angebote nehme von niedrigem Niveau an zu, sagt Humlach. Zudem sieht er Bemühungen, die Konstrukte zugänglicher zu machen: „ELTIF haben in der Regel eine lange Laufzeit von acht bis zwölf Jahren. Aber da merke ich auch, dass viele Anbieter den Weg gehen, hier sukzessive liquidere Möglichkeiten anzubieten“, beobachtet er. Wie sich das aktuelle Zinsniveau auf die Nachfrage auswirkt und wie der Wissensstand bei Beratern zum Thema ELTIF ist, erklärt Humlach im Podcast.

So arbeitet das Green and Sustainable Finance Cluster Germany | Episode 49
Aus Sicht der Finanzindustrie aufzeigen, wie Finanzstrukturen nachhaltiger gestaltet werden können – diesem Ziel hat sich das Green and Sustainable Finance Cluster Germany verschrieben. Die rund 20 Mitglieder kommen aus Banken, Versicherungen oder Fintechs. „Diese Diversität ist ein hohes Gut, um verschiedene Perspektiven abbilden zu können“, sagt Geschäftsführerin Kristina Jeromin im aktuellen Podcast „Nachhaltiges Investieren“. Die Interessen seien aber nicht immer gleich gelagert. „Eine Versicherung hat andere Herausforderungen und sieht andere Chancen als eine Bank.“ Wichtig ist ihr der Austausch mit anderen Initiativen aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft oder Politik, wie dem Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung, um Wirkung zu generieren. Dabei gibt es immer auch mal frustrierender Erfahrungen, räumt sie ein. Ihre Einstellung dazu: „Wir haben jetzt die Möglichkeit, das Richtige zu tun, da muss man sich auch teilweise gegenseitig frustrieren, da muss man auch immer wieder miteinander ringen – aber vor allem muss man weitermachen.“

Wie gut kann man Impact messen? | Episode 48
Viele Family Offices, Stiftungen und vermögende Privatleute wollen mit ihren Investments Gutes bewirken. Gerade bei Vertretern der Erben-Generation sei dies zu beobachten, sagt Susanne Bregy, Head of Impact Investing bei Phineo. Die Generation sehe ihr Erbe als Verantwortung und wolle etwas zurückgeben – „aber eben nicht nur mit Philanthropie, sondern auch über Investments“. Dabei ist Transparenz ein wesentlicher Faktor, um die Wirksamkeit zu prüfen – und häufig sei man da abseits des breiten Kapitalmarkts unterwegs, sagt Bregy: „Ein Artikel-9-Aktienfonds, der vor allem im Sekundärmarkt tätig ist – also: ich schmeiße Coca-Cola aus dem Portfolio, weil ich die Firma nicht mag, jemand anders kauft aber diese Aktie – das wäre für uns nicht Impact Investing, trotz Artikel 9.“ Die Befürchtung, dass Impact automatisch mit weniger Rendite einhergehe, will Bregy zerstreuen: „Es gibt einfach auch ganz, ganz viele Investmentstrategien, die skalierbar sind, die durchaus Marktrenditen erwirtschaften können – und einen hohen Impact haben können.“ Was aus ihrer Sicht Warnzeichen für „Impact Washing“ sind und was sie aus ihrer Zeit bei Private-Equity-Investoren für ihre heutige Arbeit gelernt hat, das verrät Bregy im aktuellen Podcast.

Wie Natur zur Assetklasse werden soll | Episode 47
Nach rund 20 Jahren im Investmentbanking, unter anderem als Deutschland-Chef der Bank Mainfirst, ist Ebrahim Attarzadeh zum Gründer geworden: Die Plattform Callirius widmet sich dem Thema CO2-Kompensationen. Attarzadeh bezeichnet den Markt für CO2-Zertifikate als „undurchsichtig“ und will das ändern. Zurzeit ist die Preisspanne enorm – Zertifikate seien ab 3 Dollar zu haben und könnten bis zu 1.000 Dollar kosten, berichtet Attarzadeh in der aktuellen Episode des Podcast Nachhaltiges Investieren. „Maßgebend für den Preis ist die Qualität.“ Mitte Juli ging die Plattform an den Start, zunächst mit Fokus auf große Unternehmen und institutionelle Investoren. Perspektivisch will Attarzadeh mit seinem Team Natur als eine Assetklasse etablieren, in die jeder investieren kann, etwa über Fonds. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg: „Wenn wir Klimaschutz ernstnehmen wollen, und wenn wir tatsächlich auch was schaffen wollen, dann geht es nur, wenn dieser Markt professionalisiert wird“, sagt Attarzadeh. Welche Schritte er für notwendig hält, wie die Qualitätssicherung für Projekte auf der Plattform läuft und wie sein Netzwerk aus Bank-Zeiten ihm heute hilft, das berichtet Attarzadeh im aktuellen Podcast.

Wie man „grüne Perlen“ bei Small- und Midcaps findet | Episode 46
Wie findet man Unternehmen für einen Nachhaltigkeitsfonds, der nicht in Large Caps investiert, sondern kleinere Marktteilnehmer im Blick hat? „Das Wichtigste ist, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen“, sagt Marian Klemm, Geschäftsführer der Research- und Beratungsgesellschaft Green Growth Futura. „Also das heißt, tatsächlich zu schauen, wo hört man irgendwas Neues, wo hört man eine neue Technologie, und sich dann zu hinterfragen: Okay, welche Unternehmen sind in diesen Technologien unterwegs?“ Um spannende Unternehmen in der zweiten Reihe zu finden, setzt Klemm beispielsweise auf einen engen Draht zu Hochschulen. Unter 100 Unternehmen, die das Research- und Beratungshaus für den Mittelstandsfonds analysiert, schaffen es etwa zehn durch die Nachhaltigkeitsfilter. Diese werden von einem Nachhaltigkeitsbeirat final geprüft. Die Analysten gehen Klemm zufolge auch direkt mit den Unternehmen ins Gespräch. Das Fondsportfolio wird regelmäßig durchleuchtet. Kommt es zu Verstößen gegen ESG-Kriterien, droht der Ausschluss. „In diesem Jahr gab es so einen Fall“, sagt Klemm. Green Growth Futura berät auch Stiftungen und Family Offices dabei, nachhaltige Portfolien zusammenzustellen. Gerade die jüngere Generation in den Family Offices ist Klemms Beobachtung stark an nachhaltigen Investments interessiert: „Für sie ist es eine Grundanforderung“, sagt er. Welche Technologie er mit Blick nach vorn besonders spannend findet und wie der Midcap-Fonds mit stark wachsenden Unternehmen umgeht, verrät Klemm im aktuellen Podcast.

Klimastrategie konkret: Was Investoren durchsetzen können | Episode 45
Deutlich weniger Co2-Ausstoß bis 2030, Klimaneutralität bis 2050 – an Langfristzielen für eine grünere Wirtschaft mangelt es nicht. Doch vieles ist noch vage. Union Investment will von ihren Portfoliounternehmen bereits vor 2050 konkrete Zwischenziele sehen. In einem ersten Schritt geht es um die Vorlage vollständiger Klimaziele bis 2025, erklärt Henrik Pontzen, Abteilungsleiter ESG im Portfoliomanagement bei Union Investment, im aktuellen Podcast "Nachhaltiges Investieren". Bei der Frage, was die Portfoliounternehmen leisten sollen, ist Augenmaß gefragt: „Leere Forderungen machen keinen Sinn, aber Unmögliches zu fordern ebenso wenig. Es geht um diesen Mittelweg, und da werden wir – von Unternehmen zu Unternehmen, von Argument zu Argument – abwägen, um dann in 2025 eine Entscheidung zu treffen“, sagt Pontzen. Liefert ein Unternehmen nicht, drohen Konsequenzen: „Wer uns nicht überzeugen kann, dass er oder sie das maximal Mögliche unternommen hat, um hier zu guten Lösungen zu kommen, wer nicht belegen kann, warum das nicht gelungen ist – von dem werden wir uns verabschieden müssen. Und das eben nicht nur für die nachhaltigen Fonds, sondern diese Klimastrategie betrifft alle Fonds, auch und insbesondere die konventionellen.“ Wie die Portfoliounternehmen auf die Pläne reagieren, welche weiteren Zwischenziele der Investor in den folgenden Jahren fordert, und wie groß der Anteil an Unternehmen im Portfolio ist, die noch Schwierigkeiten bei der Zielformulierung haben, berichtet Pontzen in der aktuellen Episode von „Nachhaltiges Investieren“.

Die Rolle der Banken bei Transition Finance | Episode 44
Nachhaltigkeitsregulierung, Leitfäden zu Taxonomie und Klimastresstests: Im Bundesverband deutscher Banken (BdB), der sich als Stimme der privaten Finanzwirtschaft sieht, nimmt das Thema Nachhaltigkeit einen immer größeren Raum ein. Für Sustainable Finance gibt es mittlerweile ein eigenes Team, berichtet Torsten Jäger, Leiter Sustainable Finance beim BdB, im neuen Podcast „Nachhaltiges Investieren“. Von Unternehmen hört er regelmäßig die Sorge, es könnte schwieriger werden, als nicht Taxonomie-konformes Unternehmen noch an Kredite zu kommen. „Ich kann da so ein bisschen Entwarnung geben“, sagt Jäger. „Wir wollen die Unternehmen begleiten, sie auch mit finanziellen Mitteln unterstützen.“ Klar sei aber auch, dass auch die Unternehmen sich Gedanken machen müssten, was sie tun können. Er hält Transitionspläne für eine gute Möglichkeit, den Weg zu nachhaltigerem Wirtschaften aufzuzeigen. Allerdings brauch es einen übergeordneten Rahmen, was unter „Transition Finance“ zu verstehen sei, findet Jäger. „Es muss ein gewisses Ambitionsniveau haben.“ Welche Schritte er als nächstes von regulatorischer Seite erwartet und warum der Fokus auf dunkelgrüne Investments aus seiner Sicht zu kurz greift, berichtet er im aktuellen Podcast.

Wo findet man noch ESG-Experten? | Episode 43
Ob Banken, Fonds, Konzerne oder Mittelständler – sie alle müssen zunehmend über ESG-Themen berichten. Doch die richtigen Mitarbeiter dafür zu finden, ist nicht einfach. „Man braucht Personen, die über Seniorität verfügen“, sagt Stephan Lang, Partner bei der Personalberatung Indigo Headhunters, in der neuen Episode des Podcast „Nachhaltiges Investieren“. Denn die Anforderungen sind hoch: Von fachlichen Themen über regulatorische Vorgaben bis hin zu technischen Implikationen sollten ESG-Experten alles im Blick behalten – und idealerweise auch noch die Verankerung von Nachhaltigkeit in der Unternehmensstrategie vorantreiben. Solche Kandidaten sind Mangelware. Das zeigt sich auch, wenn es darum geht, Stellen zu besetzen. „Es ist ein Kandidatenmarkt, definitiv“, sagt Lang. Wer sich verändern wolle, könne in der Regel verschiedene Optionen gegeneinander abwägen. Im Podcast erklärt der Personalberater, wo speziell auch Mittelständler nach Experten suchen können, warum Unternehmen mitunter Budgets zu ESG-Themen umschichten, und wie lange es noch dauern wird, bis neue Aus- und Weiterbildungsangebote den Engpass abmildern könnten.

Wie man ESG-Kriterien für Alternative Assets auslegt | Episode 42
An ESG-Vorgaben, die es zu berücksichtigen gilt, herrscht kein Mangel. Doch viele sind auf liquide Investments oder Investitionen in Unternehmen ausgelegt. Für Janna Brokmann, Head of Sustainability bei dem auf alternative Assetklassen spezialisierten Assetmanager Prime Capital, der stark bei Infrastruktur- und Erneuerbare-Energie-Projekten engagiert ist, ist das eine Herausforderung: „Das lässt sich nicht immer eins zu eins übertragen“, erklärt sie im aktuellen Podcast „Nachhaltiges Investieren“. Sie müsse daher die regulatorischen Themen auslegen – und dabei versuchen, die Intention des Regulators bestmöglich zu treffen, erklärt sie. Als hilfreich empfindet Brokmann den Austausch mit anderen Assetmanagern, um ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Gerade bei Artikel-8- oder Artikel-9-Fonds müsse man dabei immer auch neue Auslegungshinweise berücksichtigen, die nur schrittweise kommen. Wie Nachhaltigkeitsaspekte bei Investments im Due-Diligence-Prozess berücksichtigt werden und welche Fragen die Investoren mit Blick auf grüne Investitionen stellen, darüber spricht Brokmann in der neuen Folge von „Nachhaltiges Investieren“.

Wie aussagekräftig sind ESG-Ratings? | Episode 41
ESG-Ratings sollen Investoren Orientierung bieten, doch nicht immer gelingt dies auch. Denn im Gegensatz zu Kreditratings gibt es bei den Nachhaltigkeitseinstufungen große Unterschiede. Das liegt nicht zuletzt an den drei Hauptbereichen Ökologie, Soziales und Governance, sagt Oliver Everling, Geschäftsführer des Unternehmens „Rating Evidence“, der zu Ratingfragen bei Investitions- und Finanzierungsentscheidungen sowie beim Aufbau von Ratingsystemen berät. Die Wertungen in diesen drei Teilbereichen könnten stark variieren. „Das zeigt sich dann mitunter in den Ergebnissen unterschiedlicher Ratingagenturen“, sagt er im Podcast „Nachhaltiges Investieren“. Letztlich sei ein Rating eine Meinungsäußerung, die Kriterien und Maßstäbe würden nicht zuletzt von kulturellen Faktoren beeinflusst. Anleger sollten sich daher intensiver mit Ratingagenturen befassen, um zu entscheiden, wem sie vertrauen, rät Everling. „Der Anleger delegiert einen Teil der Analysetätigkeit, indem er Ratingagenturen vertraut.“ Welche regulatorischen Anforderungen an ESG-Ratingagenturen er sinnvoll fände und wie Agenturen mit schwacher Datenlage umgehen, erklärt Everling im aktuellen Podcast.

ESG im Private-Equity-Portfolio | Episode 40
Finanzinvestoren bewegen große Summen, und auch bei Private Equity wächst der Druck, mehr Transparenz über ESG-Fortschritte zu erhalten. Denn auch die Limited Partners, die in die Fonds investieren, setzen auf das Thema: „Wir sehen immer mehr Interesse von unseren LPs, nicht nur im Fundraising, sondern auch unterjährig als Teil ihres Monitorings“, berichtet Kim Woehl, Head of Sustainability bei Montagu Private Equity, im Podcast „Nachhaltiges Investieren“. Dabei nehme auch der Detailgrad der Nachfragen zu. Montagu selbst ist regelmäßig mit seinen Portfoliounternehmen in Kontakt. Ein jährlicher Report sei ein guter Weg, um zu zeigen, wie man ESG im Investitionslebenszyklus integriere wo es Fortschritte gebe, sagt Woehl. Eine gute Entwicklung der Nachhaltigkeitsfaktoren hilft nicht zuletzt dabei, einen guten Preis beim Exit zu erzielen. Welche Rolle ESG bei der Due Diligence vor einer Investition spielt und welche Anstrengungen die Private-Equity-Community unternimmt, um die Vergleichbarkeit über verschiedene Fonds hinweg zu erhöhen, berichtet Woehl im aktuellen Podcast.

Sustainable-Finance-Aktionspläne für Kommunen | Episode 39
Die Budgets in vielen Kommunen sind knapp, die Verwaltung ist häufig mit Alltagsprobleme schon mehr als ausgelastet – findet man da mit einer Idee wie Sustainable Finance überhaupt Gehör? Markus Duscha, Mitglied im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung und Gründer des Fair Finance Institute, hat die Pilot-Städte Mannheim und München zu Sustainable-Finance-Aktionsplänen beraten. Die Idee dahinter: die Sustainable-Finance-Bemühungen der EU, die eher Top-down-getrieben sind, durch Ansätze von unten zu ergänzen. „Wir wollten möglichst viele Menschen mitnehmen“, berichtet Duscha in der aktuellen Podcast-Episode von „Nachhaltiges Investieren“. Neben der Verwaltung sollen auch NGOs, Unternehmen und regionale Banken in die Aktionspläne eingebunden werden. Eine Hürde liegt Duscha zufolge darin, für das Thema Zuständigkeiten zu definieren: Das Thema Sustainable Finance sei als Querschnittsthema für eine Stadt nicht so einfach zu behandeln, hat er festgestellt. „Es würde helfen, wenn politische Initiativen das auch strukturell unterstützen.“ Welche Vorschläge für die Sustainable-Finance-Aktionspläne der beiden Städte bereits auf dem Tisch liegen und wie es nun weitergeht, darüber spricht Markus Duscha im aktuellen Podcast.

Das lange Warten auf die Sozialtaxonomie | Episode 38
Während einige Banken erst in den vergangenen Jahren das Thema Nachhaltigkeit für sich entdeckt haben, zählt die Bank für Kirche und Caritas in Paderborn zu den Pionieren in diesem Bereich. Bereits seit rund 20 Jahren arbeitet sie daran, ihre Eigenanlagen und die Bankprodukte mit einer ethisch-nachhaltigen Anlagestrategie zu verknüpfen. Nachhaltigkeit sei „Kernbestandteil der Geschäftstätigkeit“, betont Tommy Piemonte, Leiter des Nachhaltigkeitsresearch bei der Bank für Kirche und Caritas (BKC). Die BKC gehört zum genossenschaftlichen Finanzverbund, ist aber ein Spezialinstitut, dessen Hauptklientel im katholisch-caritativen Sektor zu finden ist. Neben Umweltaspekten sind für die Bank soziale Themen ganz zentral. Eine Sozialtaxonomie befindet sich allerdings noch im Entwurfsstadium – und bis zu einer finalen Vorlage könnte noch einige Zeit vergehen: So gebe es am Markt bereits Stimmen, die davon ausgehen, dass es in dieser Legislaturperiode wahrscheinlich nicht mehr zu einer Verabschiedung der EU-Sozialtaxonomie kommen werde, berichtet Piemonte. Eine Verabschiedung in der neuen Legislaturperiode fände dann frühestens 2024 statt. „Ich hoffe allerdings, dass es dann recht zügig geht“, sagt Piemonte. Sonst droht im Zweifel ein Ungleichgewicht zwischen Umwelt und Sozialem: Geld könnte vorerst am sozialen Bereich etwas vorbeigelenkt werden und stärker in den Umweltbereich fließen, fürchtet Piemonte. Die Bank ist mit ihrer langjährigen Erfahrung im ESG-Bereich inzwischen auch als Ratgeber gefragt und international in verschiedene Netzwerke eingebunden. Auch mit Unternehmen steht die BKC regelmäßig in Kontakt. Engagement und der direkte Dialog über Nachhaltigkeitsaspekte seien ein essentieller Part der ethisch-nachhaltigen Anlagestrategie, sagt Piemonte. Wie er darüber von Paderborn aus schon Entscheidungen in Namibia und dem Vatikan mit beeinflusst hat und welche Zielkonflikte zwischen Nachhaltigkeitsleitlinien und Rendite man bei einer ethischen Investmentstrategie mitunter aushalten muss, das berichtet er in der aktuellen Podcast-Episode von „Nachhaltiges Investieren“.

Do investors care about impact? | Episode 37
Do investors care about impact? Dieser Frage sind Wissenschaftler der Universität St. Gallen (HSG) systematisch auf den Grund gegangen. Sie wollten herausfinden, ob Investoren bereit sind, für mehr Impact auch mehr zu bezahlen. Die Ergebnisse zeigen jedoch: Zwar bevorzugt die Mehrzahl bei ihrer Entscheidung ein nachhaltiges Produkt und nimmt dafür auch Preisaufschläge in Kauf. Wie stark der Nachhaltigkeitseffekt ist, macht jedoch für die Anleger dann keinen großen Unterschied mehr. „Den Leuten ist Impact wahnsinnig wichtig, aber auf einer emotionalen Basis“, sagt Julian Kölbel, Assistenzprofessor an der Universität St. Gallen, im aktuellen Podcast „Nachhaltiges Investieren“. Die Herangehensweise sei emotional, nicht kalkulativ. Dies sei nichts grundsätzlich Schlechtes, meint er. Aber es sei wichtig, dass diese Emotionen auch in sinnvolle Produkte übersetzt würden. Ein Risiko bestehe darin, dass Anbieter Produkte gezielt so gestalten könnten, dass sie den Investoren ein gutes Gefühl bescheren, auch wenn sie dabei kaum Impact erzeugen. Wer nicht in eine solche Falle tappen möchte, kommt um etwas Recherche nicht umhin, sagt Kölbel. So müsse man die gesamte Produktpalette in den Blick nehmen und sich die Abstufungen klarmachen. Wie die wissenschaftliche Beschäftigung mit nachhaltigen Geldanlagen seine eigene Sicht auf Investitionsentscheidungen verändert hat und was er sich an regulatorischen Rahmenbedingungen wünscht, das verrät Kölbel in der aktuellen Episode von „Nachhaltiges Investieren“.

Wie man Nachhaltigkeitsrisiken im Kreditportfolio aufspürt | Episode 36
Risikomanagement ist für Banken eine zentrale Aufgabe, und dabei rücken ESG-Risiken zunehmend in den Fokus – bis hin zu der Frage, mit welchen Kunden man im Kreditgeschäft überhaupt noch zusammenarbeitet. Ein wichtiger Treiber ist die Regulatorik: In der 6. MA-Risk-Novelle kam ESG nicht einmal vor. Im Konsultationspapier zur 7. Novelle, deren Veröffentlichung zeitnah erwartet wird, taucht der Begriff dagegen 47 Mal auf. „Das ist für die Banken ein ganz zentraler Treiber: Die Aufsicht möchte verbindlich, dass die themen ESG-Risiken und Nachhaltigkeit Anklang finden“, erklärt Patrick Jackes im aktuellen Podcast „Nachhaltiges Investieren“. Jackes ist Projektleiter für den ESG-Risiko-Score im Bereich Prozessmanagement bei dem IT-Dienstleister Parc IT und berät Banken zur Messbarkeit von Nachhaltigkeitsrisiken. Die ESG-Risiken zu identifizieren bedeutet allerdings viel Aufwand für Banken und Kunden. Denn viele Einschätzungen beruhen auf qualitativen Angaben, die manuell ausgewertet werden müssen. Es ist daher nicht gesagt, dass alle Banken zu einheitlichen Einschätzungen kommen. „Man setzt auf der grünen Wiese auf“, sagt Jackes. Die Banken müssen derzeit in einem Bottom-up-Ansatz erarbeiten, welche Faktoren die Nachhaltigkeitsrisiken im Kreditportfolio beeinflussen – und was dies wiederum für das Geschäftsmodell der Bank bedeutet. „Und das kann von Bankengruppe zu Bankengruppe unterschiedlich sein.“ Welche Faktoren in die Risiko-Scores einfließen und welche Perspektive es gibt, ein Nachhaltigkeitsrating mit den klassischen Kreditratings zusammenzuführen, erklärt Jackes im aktuellen Podcast „Nachhaltiges Investieren“.

Nachhaltige Finanzierung ist auch Mittelstandsthema | Episode 35
Bei hochvolumigen syndizierten Finanzierungen großer Unternehmen ist es mittlerweile üblich, ESG-Kriterien zu berücksichtigen. Bei kleineren Unternehmen sei dieses Bild zwar gemischter, aber auch hier nehmen die Einbindung von ESG-Komponenten zu: „Es gibt einige Mittelständler, die da sehr, sehr weit sind“, berichtet Katlen Blöcker, Partnerin Banking und Finance bei der Kanzlei Hogan Lovells im aktuellen Podcast „Nachhaltiges Investieren“. Die Juristin stellt im Podcast unterschiedliche nachhaltige Finanzierungsformate vor. Green Loans etwa eigneten sich bei Finanzierungen, bei denen eine Tranche vollständig für einen bestimmten Verwendungszweck bestimmt seien, beispielsweise die energieeffiziente Sanierung einer Werkshalle. Alternativ dazu würden auch Sustainability Linked Loans genutzt, sei es orientiert an ESG-Ratings oder an vereinbarten Schlüsselindikatoren (Key Performance Indicators), mit denen etwa der Schadstoffausstoß messbar reduziert werde.

Wie Lieferkettenfinanzierung grüner wird | Episode 34
Bei Krediten und Anleihen sind nachhaltige Komponenten in der Finanzierung schon fast an der Tagesordnung, und auch in der Lieferkettenfinanzierung gewinnen Umweltaspekte immer mehr an Bedeutung. Wie die Programme ausgestaltet sind und welche Kennzahlen im Fokus stehen, ist allerdings sehr unterschiedlich, erklärt Marion Reuter, Regional Head of Transaction Banking Sales Europe bei Standard Chartered. Denn sämtliche Zulieferer vom Ein-Personen-Betrieb bis zum großen Mittelständler in ein Programm zu pressen, ist schwierig. Regelmäßig werden Handelsfinanzierungen auch als normale Variante begonnen und eine Nachhaltigkeitskomponente dann später ergänzt, berichtet Reuter. „Oft ist es ein Zeitfaktor“, sagt sie. Wie regelmäßig die Kennzahlen für eine grüne Lieferkettenfinanzierung überprüft werden, welche Branchen sich mit Nachhaltigkeit entlang der Lieferkette bereits besonders intensiv befassen und welche Folgen das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz für die Beschäftigung mit dem Thema hat, das berichtet Reuter im aktuellen Podcast „Nachhaltiges Investieren“.

War 2022 ein „schwarzes Jahr“ für die Nachhaltigkeit? | Episode 33
Das Jahr 2022 haben manche schon als „schwarzes Jahr“ für Nachhaltigkeit abgehakt. Doch ist dieser Eindruck berechtigt? Wer auf die Rendite nachhaltiger Anleihen sowie die Ergebnisse politischer Großereignisse wie der Weltklimakonferenz COP27 schaut, könnte zu diesem Schluss kommen. „Auch ich war enttäuscht von den Ergebnissen der Klimakonferenz“, sagt Henrik Pontzen, Abteilungsleiter ESG im Portfoliomanagement bei Union Investment. Doch massive Investitionsprogramme in den USA und Europa machen ihm Hoffnung. Zwar hätten der Kriegsausbruch und im weiteren Jahresverlauf die Zinswende die Märkte unter Druck gesetzt, doch dadurch könne auch ein positiver Effekt entstehen: „Der Druck hat dazu geführt, dass Investitionen umfassender und schneller getätigt werden.“ Jedoch könne die Transformation zu einer klimafreundlichen Wirtschaft nicht allein durch Ausschlüsse gelingen – gerade Unternehmen, die noch ein Stück des Weges vor sich hätten, bräuchten Unterstützung, findet Pontzen. Welche Rolle die Finanzbranche aus seiner Sicht beim Wandel zu mehr Nachhaltigkeit einnimmt, was er von der wachsenden Zahl an ESG-Labels hält und warum „Je strenger, desto besser“ im Nachhaltigkeitskontext aus seiner Sicht nicht immer der richtige Ansatz ist, das verrät Pontzen im aktuellen Podcast „Nachhaltiges Investieren“.

ESG in der digitalen Vermögensverwaltung | Episode 32
Immer mehr Anbieter setzen auch in der digitalen Vermögensverwaltung auf Nachhaltigkeitsaspekte. Einer der jüngsten Neuzugänge ist das im Herbst 2022 lancierte Angebot „Willbe“ der Liechtensteinischen Landesbank. Mensch und Maschine arbeiten dabei zusammen: Zwar könne Technologie inzwischen sehr gut ein Portfolio zusammenstellen, für fundamentale Analysen sei aber nach wie vor ein Mensch gefragt, findet LLB-CEO Gabriel Brenna. Die rein digitale Vermarktung eines Produkts ist auch für die LLB ein Lerneffekt, räumt Brenna ein. Das Thema Nachhaltigkeit dagegen hat inzwischen in der Geldanlage seinen festen Platz, bei institutionellen Kunden sei es Bestandteil jedes Gesprächs. „Bei den Privatkunden ist es unterschiedlich“, beobachtet Brenna. Dort gehe der Wissenstand noch weiter auseinander. Die Liechtensteinische Landesbank will selbst bis 2040 klimaneutral werden, Energieverbrauch und Reiseverhalten sind bereits in den Fokus gerückt. Brenna sagt aber auch: „Eine Bank ist nicht die große CO2-Schleuder.“ Der deutlich größere Hebel liege auf der Kundenseite, wo nachhaltigere Produkte mehr Impact erzeugen könnten. Wie lange es gedauert hat, einen Algorithmus für die digitale Vermögensverwaltung so zu programmieren, dass er neben Risiko und Rendite auch Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen kann und wie gut die Datenlage dafür ist, das verrät Brenna im aktuellen Podcast „Nachhaltiges Investieren“.

Mit Crowdinvesting den Klimawandel bekämpfen | Episode 31
Ausgezogen, um mit Crowdinvesting den Klimawandel zu bekämpfen: Das Scale-up-Unternehmen ecoligo sammelt mit einem Schwarmfinanzierungsansatz Geld von Privatanlegern ein, finanziert damit Solarprojekte in Vietnam, Kenia oder Costa Rica und will so Rendite für die Anleger erzielen sowie den Planeten retten. Wie sieht dieses Modell im Einzelnen aus? Welche Anforderungen werden an die Gewerbeindustriekunden in Sachen Nachhaltigkeit gestellt? Was bedeutet das bankaufsichtlich? Und wie sehen die Konditionen für die Anleger aus? Diese und andere Fragen beantwortet ecoligo-Mitgründer und CFO Markus Schwaninger in der aktuellen Episode von „Nachhaltiges Investieren“. Dabei spricht er unter anderem über den Track Record von ecoligo, was Kreditausfälle angeht, erklärt welche Branchen als Kunden ausgeschlossen werden und warum – und er erläutert auch, wie das Unternehmen die eigenen Risiken minimiert.

Warum Mikrofinanz allein keine Lösung ist | Episode 30
In rund 40 Ländern ist Günther Kastner, geschäftsführender Gesellschafter und CIO bei Impact Asset Management, mit einem Mikrofinanzfonds aktiv. An diesem Markt bewegt er sich seit 2006. Bis zu einem Jahr dauert es, bis ein neues Institut in einem neuen Markt an Bord ist, berichtet Kastner. Ein Großteil seiner Arbeit entfalle auf Recherchen und Analysen, um mögliche Kooperationspartner zu identifizieren, erklärt er. Sein Fonds gibt Gelder an lokale Finanzinstitute, die dann ihrerseits Mikrokredite ausreichen. Aus einem Markt von Tausenden Mikrofinanzinstituten gelte es diejenigen herauszufiltern, die wirklich in unternehmerische Projekte investieren. „Man braucht Menschen, die bereits wirtschaftlich aktiv sind“, sagt Kastner. Diese könnten profitieren, wenn sie mit zusätzlichen Mitteln ihr Geschäft ausbauen können. Aber auch Politik und lokale Förderinstitute müssten dafür sorgen, dass sich das wirtschaftliche Umfeld verbessert. „Mikrofinanz allein ist keine Lösung“, stellt Kastner klar. Wie sich die Gewichtung von Impact und Rendite auf Investorenseite seit dem Start des Fonds verändert hat und auf welches Projekt er besonders stolz ist, berichtet Kastner in der aktuellen Episode des Podcast „Nachhaltiges Investieren“, die es ab heute auf allen gängigen Podcast-Plattformen gibt.

Das Rohstoffdilemma bei der Grünen Transformation | Episode 29
Der Abbau von Rohstoffen gilt nicht gerade als umweltfreundlich. Doch viele Bereiche der Wirtschaft brauchen Rohstoffe wie Lithium oder Graphit, um ihre Transformation zu bewältigen – von der Herstellung von Windparks und Solaranlagen bis hin zur Fertigung von Komponenten für Elektroautos. Rohstoffproduzenten sind daher ein wesentlicher Faktor auf dem Weg zur Klimaneutralität, sagt Tilmann Galler, Globaler Marktstratege bei J.P. Morgan Asset Management. Das zentrale Dilemma dabei: „Sie sind gleichzeitig ein Teil der Lösung, aber auch ein Teil des Problems.“ Er hält es für wichtig, die Bedingungen beim Rohstoffabbau zu verbessern. Dabei sieht er auch die Investmentbranche in der Pflicht. Für Geldgeber ist die Rohstoffbranche wegen der hohen Nachfrage attraktiv, auch wenn sie mit Blick auf ESG-Faktoren problematisch sein kann. Wie dieser Spagat zu schaffen ist, welchen Beitrag Asset Manager und Investoren Gallers Meinung nach jetzt schon zur Transformation leisten können und wie offen Minenbetreiber und Rohstoffkonzerne für ESG-Themen sind, verrät er in der aktuellen Episode von Nachhaltiges Investieren.

Wie viel Impact erzeugen kleine Fonds? | Episode 28
Seit Juli 2021 war Felix Eisel mit f3x Capital am Markt unterwegs, mit zuletzt 8 Mill. Euro Assets under Management war er ein kleiner Spieler. Nun wickelt er den Fonds ab – nicht zuletzt, weil die regulatorischen Anforderungen im ESG-Bereich mit hohen Kosten verbunden sind. Das Problem trifft viele Boutiquen. „Es gibt eine Konzentration in der Asset-Management-Industrie“, sagt Eisel. Vielfalt werde reduziert – wobei man sich auch fragen müsse, wie groß der Kundennutzen einer solchen Vielfalt sei. Als kleiner Fonds habe man ohnehin nur wenig Möglichkeit, Impact zu erzeugen, bedauert Eisel. Er sieht großes Potenzial in der Private-Equity-Industrie, die direkter auf Unternehmen einwirken könne. Wie er den Ansatz der Best Owner Group in der Automotive-Industrie bewertet und welche Erkenntnisse er aus der Lektüre von Offenlegungsverordnung und Taxonomie-Verordnung gezogen hat, das verrät Felix Eisel im aktuellen Podcast, zu hören donnerstags ab 7 Uhr auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

Als ESG-Themen noch exotisch waren | Episode 27
Kurz vor der Finanzkrise stieg Henning Padberg bei Nordea in Kopenhagen an und übernahm dort einen Umweltfonds – der zunächst ein sehr stilles Dasein fristete. „Es gab kein Interesse, nicht einmal intern“, erinnert sich der Portfoliomanager im Gespräch mit dem Podcast „Nachhaltiges Investieren“. Während der Finanzkrise mussten sie kämpfen, damit der Bereich nicht zum Streichkandidaten wurde. Die Ausdauer hat sich gelohnt: Mittlerweile ist der Fonds rund 10 Mrd. Euro schwer. Die Krise hat ihn viele wichtige Lektionen zum Thema Risikomanagement gelehrt, sagt Padberg rückblickend. Er will in Lösungen investieren. „Was wirtschaftlich Sinn macht, setzt sich durch“, ist er überzeugt. Auch privat beschäftigt Padberg sich mit Nachhaltigkeit: Gemeinsam mit seiner Frau baut er Obst Gemüse an und züchtet Blumen. Wann man ihn auf dem Feld findet und wie er auf die aktuelle Schwächephase am Markt blickt, verrät Henning Padberg im aktuellen Podcast, zu hören donnerstags ab 7 Uhr auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

Green Loans, Transition Loans, Social Loans & Co. | Episode 26
Wer einen Green Loan abschließt setzt neben der Finanzierung für ein Projekt meist auch auf den Marketingeffekt: „Die Kunden möchten darstellen, wie nachhaltig sie sind“, beobachtet Sabine Lehmann, Green Loan Advisor, KfW Ipex-Bank. Die Aufgabe der Geldgeber sei es dann, darauf zu achten, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Doch nicht immer können Projekte, die im Hinblick auf eine grüne Finanzierung aufgesetzt wurden, diesen Anspruch über die gesamte Laufzeit halten. Diese könne man zwar weiter begleiten – „aber dann eben nicht als Green Loan oder Transition Loan“, stellt Lehmann klar. Welche Reporting-Pflichten über die Laufzeiten zu erfüllen sind, welches klassische Anwendungsfelder für Green, Transition und Social Loan sind und an welchen Stellen die Regulatorik die Hürden für nachhaltige Finanzierungen senkt, berichtet Lehmann in der neuen Episode von „Nachhaltiges Investieren“, zu hören donnerstags ab 7 Uhr auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

Was der EZB-Klimastresstest verrät | Episode 25
Die EZB hat kürzlich die Ergebnisse ihres ersten Klimastresstests vorgelegt – doch wie aufschlussreich waren die Erkenntnisse? Die EZB hat selbst ein Hauptziel formuliert: Lernen für alle Beteiligten. Unter dieser Prämisse war der Klimastresstest ein Erfolg, findet Holger Spielberg, Partner im Bereich Financial Services bei KPMG. Der Test habe deutlich gemacht, wo noch Nachholbedarf bestehe, berichtet er im Podcast-Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Ein Knackpunkt sind aus seiner Sicht die Daten: „Hier wird auf komplett neue Sachverhalte geschaut“, berichtet er. Diese Daten lägen mitunter weder in den Banken vor, noch bei Aufsehern oder Unternehmen. Perspektivisch wünscht er sich, Klimawandel weniger isoliert zu betrachten, sondern Klimarisikoaspekte stärker in die regulären Stresstests zu integrieren. Welche Aufgaben er auf die Aufseher zukommen sieht und warum man die Ergebnisse des ersten Klimastresstests nicht unterschätzen sollte, berichtet Spielberg in der neuen Episode von „Nachhaltiges Investieren“, zu hören donnerstags ab 7 Uhr auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

Wie ESG-Reporting die Wirtschaftsprüfung verändert | Episode 24
Die Nachhaltigkeitsberichterstattung wird immer weiter ausgebaut. Schon jetzt ist absehbar, dass die Zahl der Unternehmen, die dazu verpflichtet sind, in den kommenden Jahren rasant steigen wird. Das verändert auch die Arbeit der Wirtschaftsprüfer: Neben einer Vielzahl an Daten gebe es künftig auch vermehrt qualitative Angaben, die zu prüfen seien, berichtet Melanie Sack, stellvertretende Vorstandssprecherin des Instituts der Wirtschaftsprüfer und außerdem Mitglied im Sustainable-Finance-Beirat der Bundesregierung. Nachhaltigkeitsberichte werden in den kommenden Jahren für immer mehr Unternehmen zum Thema: „Schätzungen sagen, dass derzeit etwa 500 Unternehmen berichtspflichtig sind“, sagt Sack. Schon 2026 könnten es 15.000 sein. Wie sie den Mehraufwand der zunehmenden ESG-Reportings für ihre eigene Zunft einschätzt, mit welchen Herausforderungen die Unternehmen kämpfen und warum die Beschäftigung mit Nachhaltigkeit den Beruf des Wirtschaftsprüfers auch attraktiver machen kann, berichtet sie in der neuen Episode von „Nachhaltiges Investieren“, zu hören donnerstags ab 7 Uhr auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

So läuft eine Nachhaltigkeitsanalyse ab | Episode 23
Eine enorme Auswahl potentieller Kandidaten und begrenzter Platz: Bei der Zusammenstellung von Fonds greifen verschiedene Filter – insbesondere, wenn die Unternehmen für Umwelt- oder Ethik-Fonds besondere ESG-Anforderungen erfüllen sollen. Florian Hauer, ESG-Verantwortlicher bei Kepler-Fonds im österreichischen Linz, setzt bei seiner Nachhaltigkeitsanalyse stark auf quantitative Ansätze: Bei sehr stark qualitativ ausgerichteten Ansätzen sei man eher gefährdet, „dass man sich vielleicht in eine Firma verliebt und dann manche Fakten nicht mehr sieht“, findet er. Welche Filter ein Unternehmen durchlaufen muss, um in seiner Auswahl zu landen, und wie vergleichbar die Ansätze unterschiedlicher Häuser sind, darüber spricht Hauer in der aktuellen Episode von „Nachhaltiges Investieren“.

Das bedeutet die ESG-Anlageberatung für den Vertrieb | Episode 22
Seit Anfang dieses Monats müssen Anleger vor Investitionsentscheidungen verpflichtend zu ihren Nachhaltigkeitspräferenzen befragt werden. Das ist komplizierter als es klingt: Unter Nachhaltigkeit versteht jeder etwas anderes, und Klassifizierungskonzepte wie die Taxonomie-Verordnung kann man bei Anlegern nicht voraussetzen. Aufklärung lautet daher das Gebot der Stunde, und die dauert: „In den ersten Gesprächen sprechen wir schon über eine halbe Stunde Extra-Zeit“, schätzt Gerhard Faust, Leiter Produktmanagement Kapitalmarktprodukte bei der Deutschen Bank. Ein Problem für die Berater: Viele der Daten, die sie für die ESG-Anlageberatung schon jetzt benötigen, müssen erst vom kommenden Jahr an verpflichtend ausgewiesen werden. Wie die Berater in der Praxis damit umgehen, welche regulatorischen Konzepte für ESG-konforme Beratung eine Rolle spielen und warum man Kunden, die in besonders hohem Maße Taxonomie-konform investieren wollen, oft enttäuschen muss, darüber spricht Gerhard Faust in der aktuellen Episode von „Nachhaltiges Investieren“.

So arbeitet der Sustainable-Finance-Beirat | Episode 21
Wie kommt ein Gremium aus 34 Mitgliedern und 19 ständigen Beobachtern zu Entscheidungen? Als Vorsitzende des Sustainable-Finance-Beirats der Bundesregierung muss Silke Stremlau genau dieses Kunststück bewerkstelligen. Bereits in der vorherigen Legislaturperiode hat die Vorständin der Hannoverschen Kassen in dem Gremium mitgearbeitet, nun steht sie ihm vor. Eitel Sonnenschein herrscht dabei nicht immer, berichtet sie. Doch ihre Erfahrung zeigt: „Man kann sich einigen, weil die Menschen, die dabei sind, sehr intrinsisch motiviert sind.“ Sie will den Beirat als kritischen Sparringspartner der Politik positionieren und zugleich eine Brücke bauen zwischen dem politischen Betrieb und den Finanzmarktakteuren: „Bei manchen Politikerinnen und Politikern müssen wir auch erstmal dafür werben, was der Finanzmarkt bewirken kann, da gibt es eine hohe Skepsis“, sagt Stremlau. Wie sie die Hemmnisse abbauen will, welche Erfahrungen sie mit Lobbyisten gemacht hat und warum der Sustainable-Finance-Beirat der alten Bundesregierung einiges an Beraterhonoraren eingespart hat, darüber spricht Silke Stremlau in der aktuellen Folge von „Nachhaltiges Investieren“.

Reform der ESG-Risiko-Bewertungen nötig | Episode 20
Für Investoren ist es wichtig, die bestehenden Nachhaltigkeitsrisiken in ihren Investments richtig einschätzen zu können. Die aktuellen Methoden zur Bewertung dieser Risiken aber reichen noch nicht aus, um vor Greenwashing zu schützen. Die Definitionen sind noch zu unscharf, es fehlt an der Quantifizierbarkeit der ESG-Risiken (Environmental, Social, Governance). Eine Arbeitsgruppe der CFA Society Germany, einem Berufsverband für Investmentmanager und professionelle Investoren, erforscht deshalb aktuell, wie sich die existierenden Bewertungsmethoden von Nachhaltigkeitsrisiken bei Aktien und Anleihen reformieren lassen. Bei Anleihen beispielsweise werde die die Modellierung eines Sustainability Spread diskutiert, sagt Andreas Rätzel, CFA, Mitglied des German Advocacy Committee der CFA Society Germany und Market Risk Specialist, im Gespräch mit Christiane Lang.

ESG-Chancen in der Krise | Episode 19
Der Ukraine-Krieg, die Energiekrise, Inflation und Rezessionsängste haben das Thema Nachhaltigkeit in der öffentlichen Diskussion in den Hintergrund gedrängt. „Schmutzige“ Aktien wie Öl- und Rüstungstitel haben an den Börsen einen Aufschwung erlebt. Trotz allem bleibt Nachhaltigkeit neben der Digitalisierung das wichtigste Thema der nächsten Dekaden, das auch nicht außer Kraft gesetzt wird, wenn Ereignisse katastrophischen Ausmaßes diesen Megatrend kurzfristig überlagern können, sagt Henrik Pontzen, Leiter ESG im Portfoliomanagement bei Union Investment, im Gespräch mit Christiane Lang. Zudem können Krisen die Entwicklung auch vorantreiben, erläutert Pontzen und verweist auf das in aller Eile vorgelegte Osterpaket der Bundesregierung zum Ausbau der erneuerbaren Energien.

Wie ein Portfolio CO2-negativ wird | Episode 18
Viele Investoren ergreifen Maßnahmen, um die CO2-Bilanz ihrer Portfolien zu verbessern. Dazu werden Unternehmen mit geringem CO2-Austoß übergewichtet, „schmutzigere“ Titel dagegen untergewichtet oder ausgeschlossen. Damit kann der CO2-Ausstoß gegenüber der Benchmark durchaus um 50% reduziert werden. Mit einer innovativen Strategie ist das aber noch steigerungsfähig. So hat die St. Galler Kantonalbank in Zusammenarbeit mit Finreon eine sogar CO2-negative Strategie entwickelt. Dazu wird ein CO2-Hedge kreiert, der den CO2-Fußabdruck eines Anlageportfolios nicht nur komplett neutralisiert, sondern sogar überkompensiert, erläutert Christoffer Müller, Leiter des Portfoliomanagements der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG, im Gespräch mit Christiane Lang.

ESG in Immobilienfonds nimmt an Fahrt auf | Episode 17
ESG ist inzwischen auch bei Immobilienfonds der größte Trend. Nachhaltige Immobilienfonds entwickeln sich sehr dynamisch und damit steigt der Bedarf an Standards und Transparenz für Anleger. Besonders bei Fonds, die in internationale Objekte investieren, haben es Investoren schwer, die Nachhaltigkeit einzuschätzen und Portfolien miteinander zu vergleichen. Denn auch innerhalb der EU sind Angaben beispielsweise zum Energieverbrauch von Gebäuden aufgrund unterschiedlicher Normen nicht vergleichbar. Noch schwieriger wird es bei der Beurteilung sozialer Kriterien, die auch bei Immobilien immer wichtiger werden. In Zukunft würden Investoren viele Projekte nur noch dann an den Markt bringen können, wenn zumindest ein Mindestkatalog an Anforderungen im Sozialbereich erfüllt werde, meint Fabian Tacke, Initiator und Vorstand der Klimagut Immobilien AG, im Gespräch mit Christiane Lang.

Potenzial für nachhaltige Alternatives | Episode 16
Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist nicht mehr nur aus klimapolitischen Gründen essentiell. Der Ukraine-Krieg unterstreicht, dass zusätzlich sicherheits- und wirtschaftspolitische Aspekte wesentliche Faktoren darstellen. Das zeigt: Allein in Infrastruktur gibt es enormes Potenzial für nachhaltige Investitionen. Das gilt auch für andere alternative Assetklassen. Im Bereich Private Equity spielt der nachhaltige Transformationsprozess von Unternehmen eine wichtige Rolle. Für die Begleitung dieses Prozesses seien gerade Private-Equity-Manager prädestiniert, meint Frank Dornseifer, Geschäftsführer beim Bundesverband Alternative Investments BAI, im Gespräch mit Christiane Lang. Schwieriger sei dagegen die Umsetzung von Nachhaltigkeit in Hedgefonds.

Wo die Reise der ESG-Siegel hingeht | Episode 15
Viele Fondsgesellschaften bemühen sich um Nachhaltigkeitssiegel für ihre Produkte, um sich von der Konkurrenz abzuheben und Vertrauen bei den Kunden zu schaffen. Das wird angesichts der rasant wachsenden Zahl an ESG-Fonds im Markt immer wichtiger. Und auch weil die aktuelle Regulierung und die Offenlegungsvorschriften keine inhaltlichen Anforderungen an nachhaltige Fonds beinhalten, seien externe Siegel zumindest kurz- bis mittelfristig nötig, um die Selbsteinstufungen der Fonds zu überprüfen, meint Roland Kölsch, Geschäftsführer der Qualitätssicherungsgesellschaft Nachhaltiger Geldanlagen (QNG), die das FNG-Siegel verantwortet, im Gespräch mit Christiane Lang. Längerfristig geht es Kölsch zufolge in Richtung einer Art Nachhaltigkeitsampel. Voraussetzung dafür aber seien ausreichende Daten.

Noch Luft nach oben beim Engagement | Episode 14
Engagement oder aktives Aktionärstum ist in Deutschland verglichen mit manchen anderen Ländern noch relativ unterentwickelt. Dabei ist dies ein wichtiger Faktor bei der Transformation der Wirtschaft von braun nach grün. Gerade großen Assetmanagern wird teils vorgeworfen, dass ihr Abstimmungsverhalten auf Hauptversammlungen zu oft hinter den eigenen kommunizierten ESG-Ansprüchen zurückbleibt. Das könne auch mit Interessenskonflikten zu tun haben, wenn Assetmanager über ihren eigenen Konzern mit den Unternehmen, in die sie investiert sind, weitere geschäftliche Verbindung pflegen, beispielsweise in den Bereichen Investmentbanking oder Beratung, meint Gesa Vögele, Mitglied der Geschäftsführung von Cric, dem Verein zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage, im Gespräch mit Christiane Lang. Um Engagement hierzulande voranzureiben, fordert sie klare Stewardship Codes und vor allem für kleinere und mittlere Investoren eine ESG-Engagement-Plattform, um die Kooperation zu erleichtern.

Die Mythen über Sustainable Finance | Episode 13
Sustainable Finance ist oft noch mit Vorbehalten und Unklarheiten behaftet. Das betrifft zum Beispiel die Rolle der öffentlichen Hand, die Ausgestaltung von Transformationspfaden, die Verfügbarkeit von Nachhaltigkeitsdaten, Reporting-Standards oder auch den Wert von Biodiversität. Der WWF will mit seinem neuen Arbeitspapier „7 Sustainable-Finance-Mythen im WWF-Faktencheck“ für Aufklärung sorgen. Sehr aktuell, ausgelöst durch den Ukraine-Krieg, seien die Missverständnisse über die Rolle des Staates, sagt Matthias Kopp, Leiter Sustainable Finance beim WWF Deutschland, im Gespräch mit Christiane Lang. Dessen Aufgabe sei es privates Kapital für die nachhaltige Transformation zu mobilisieren. Allerdings werde das Kapital noch nicht nach den richtigen Kriterien und auch noch viel zu langsam in grüne Investitionen gelenkt.

Die Schwierigkeiten mit der Sozial-Taxonomie | Episode 12
Mit der von der EU geplanten sozialen Taxonomie kocht das nächste brisante Thema in der Nachhaltigkeitsdebatte hoch. Die Definition sozialer Kriterien ist schwierig, Weltanschauungen und ethische Wertungen spielen eine große Rolle. Das zeigt schon die mit dem Ukraine-Krieg verschärfte Debatte über die Rüstungsindustrie. Mit dem neuen Stellenwert, die die Sicherheit in Europa bekommen hat, könnte sich das Blatt für die Waffenindustrie im Assetmanagement drehen, meint Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer des deutschen Fondsverbands BVI, im Gespräch mit Christiane Lang. Trotz aller Probleme sei eine soziale Taxonomie für die Fondsbranche wichtig, um Leitplanken für die von den Anlegern nachgefragte nachhaltige Kapitalanlage zu haben und Greenwashing-Vorwürfe zu vermeiden. Richter rechnet angesichts der Probleme, einen Konsens herzustellen, allerdings damit, dass es noch sehr lange dauern wird, bis eine soziale Taxonomie steht.

Nachhaltige Indizes – klein versus groß | Episode 11
Mit dem Boom des nachhaltigen Investierens haben sich sehr viele nachhaltige Indizes am Markt etabliert. Es gibt die sehr großen ESG-Indizes von den bekannten Anbietern wie Dow Jones, MSCI oder Morningstar, die mehrere hundert Titel umfassen können, oder auch ganz kleine Indizes wie den ÖkoDax mit nur acht oder neun Titeln. Die Börse Hannover ist mit ihrem 50 Titel umfassenden Global Challenges Index, kurz GCX, schon sehr lange am Markt und vor wenigen Monaten ist ein zweiter nachhaltiger Index dazugekommen. Wie setzen sich die kleineren nachhaltigen Indizes von den Marktführern ab? Birgt das eingeschränkte Anlageuniversum Risiken für die Anleger? Welches sind die nächsten Themen und Herausforderungen für ESG-Indizes? Unter anderem zu diesen Themen äußert sich Martin Braun, Leiter Vertrieb und Customer Relations bei den Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover, im Gespräch mit Christiane Lang.

Werbung, Vertrauen und Greenwashing | Episode 10
Nachhaltige Finanzprodukte fluten den Markt. Der Wettbewerb nimmt kräftig zu und für die Anbieter wird es immer wichtiger, ihre Produkte effizient zu bewerben. Will man jedoch nicht in der Masse gleichförmiger Botschaften und Bilder untergehen oder sich möglicherweise Greenwashing-Vorwürfen aussetzen, ist das keine einfache Aufgabe. Wo liegen die speziellen Schwierigkeiten bei der Werbung für nachhaltige Produkte? Wie begegnet man der Skepsis der Verbraucher, die der Finanzindustrie oft nicht trauen und bei Nachhaltigkeit Greenwashing vermuten? Wie können sich die Anbieter differenzieren, wenn sich die Produkte mehr oder weniger ähneln? Welches sind die größten Fehler in einer Kampagne? Das erläutert Nicole Hecht, Kreativdirektorin der 744 Werbeagentur, im Gespräch mit Christiane Lang.

Der sanfte Druck der Nachhaltigkeitsinitiative PRI | Episode 09
In den vergangenen Jahren wurden immer mehr Klimainitiativen im Finanzsektor ins Leben gerufen, zum Beispiel die Net Zero Asset Owner Alliance oder die Climate Action 100+. Bereits seit 2005 gibt es die Principles for Responsible Investment (PRI), eine Initiative der Vereinten Nationen, deren Unterzeichner weit mehr als die Hälfte des weltweiten Vermögens abbilden und die jährlich mit deutlich zweistelligen Zuwachsraten wächst. Woher das große Interesse an den freiwilligen Nachhaltigkeitsinitiativen kommt, wie PRI die Unterzeichner „motiviert“, sich in Sachen ESG zu verbessern, wie die künftige Strategie aussieht und ob es ihn stört, dass manche Assetmanager die PRI-Mitgliedschaft quasi als Gütesiegel im Marketing verwenden, erklärt Dustin Neuneyer, Leiter Deutschland und Österreich bei PRI, im Gespräch mit Christiane Lang.

ESG-Investments, Ratings und Greenwashing | Episode 01
Nachhaltigkeit ist eines der Megathemen unserer Zeit, und Green Finance dominiert die finanzwirtschaftliche Debatte. Aber was ist nachhaltig? Und wie agieren Finanzwirtschaft, Investoren, Regulatoren und die Politik? In der ersten Episode von „Nachhaltiges Investieren“ erläutert Jochen Thiel, Country Head of Germany and Austria bei Morningstar, im Gespräch mit Christiane Lang, was Ratings zu leisten vermögen, ob sie Greenwashing verhindern können und inwieweit eine Standardisierung der ESG-Bewertungen möglich, beziehungsweise ob sie überhaupt sinnvoll ist.