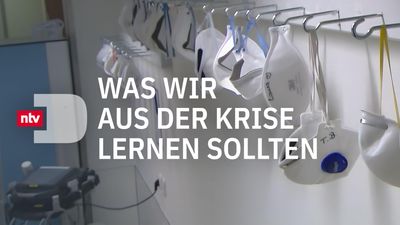Im ECONtribute Wirtschaftspodcast beleuchten wir monatlich die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung und geben Einblick in die Arbeit unseres Exzellenzclusters. ECONtribute ist der einzige wirtschaftswissenschaftliche Exzellenzcluster Deutschlands, getragen von den Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Der Cluster forscht zu Märkten im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Kontakt: podcast@econtribute.de Redaktion und Moderation: Carolin Jackermeier
Alle Folgen
#53: Wie gerecht ist das Rentenpaket?
Wie sinnvoll ist das Rentenpaket aus ökonomischer Sicht? Profitiert auch die junge Generation davon? Und welche Reformen sind von der Rentenkommission zu erwarten? Christian Bayer, Professor für Makroökonomie bei ECONtribute an der Uni Bonn, forscht unter anderem zu Fiskalpolitik und Ungleichheit. Wir sprechen darüber, wie das Rentenpaket der Bundesregierung ökonomisch zu bewerten ist, ob es Lasten ungleich verteilt und wie sich das Rentensystem jetzt überhaupt noch reformieren lässt. In dieser Folge geht es um Reden, Renten und Reformen.

#52: Wie verändert KI das Investieren am Aktienmarkt?
Kann KI bald zuverlässig Aktienrenditen vorhersagen? Ersetzt sie menschliche Analysti:innen und Berater:innen? Und was verändern KI-Modelle für Privatanleger:innen? Tom Zimmermann, Professor bei ECONtribute an der Universität zu Köln, forscht unter anderem zu Finanzmarktstabilität und Geldpolitik. Wir sprechen darüber, wie der KI-Boom das Anlagen am Finanzmarkt verändert hat, wie Finanzdienstleister schon heute auf Machine Learning-Modelle setzen und ob diese künftig bessere Anlageentscheidungen treffen als der Mensch und den Markt schlagen können. In dieser Folge geht es um (Aktien)Märkte, Menschen und Maschinen.

#51: Geldpolitik: Fördern hohe Zinsen Ungleichheit?
Welche Effekte hat die Geldpolitik von Zentralbanken auf lokale Arbeitsmärkte? Warum treffen Zinsänderungen nicht alle Bevölkerungsgruppen gleich stark? Und wer profitiert am meisten, wenn die Zinsen sinken? Benjamin Born, Professor an der Universität Bonn, forscht zu den Folgen von Geld- und Fiskalpolitik und berät unter anderem die Europäische Kommission sowie das Europäische Parlament. In einer Studie hat er untersucht, wie sich Zinssenkungen auf lokale Arbeitsmärkte auswirken. Wir sprechen darüber, welche Bevölkerungsgruppen Zinsänderungen besonders stark treffen, warum sich die Ziele der Geldpolitik teilweise widersprechen und ob sie Einkommensungleichheit verstärken kann. In dieser Folge geht es um geldpolitische Zusammenhänge, Zinsen und Zentralbanken.

#50: Bürokratieabbau: Was kann Deutschland von einer Bäckereikette lernen?
Gibt es gute und schlechte Bürokratie? Warum scheitert der Bürokratieabbau seit Jahren? Und was kann Deutschland von einer Bäckereikette lernen? Matthias Heinz, Professor bei ECONtribute an der Uni Köln, forscht zu Managementpraktiken und deren Auswirkungen auf die Leistung und das Verhalten von Mitarbeitenden. In einer Studie hat er den Bürokratieabbau in einer großen deutschen Bäckereikette untersucht. Wir sprechen darüber, ob sich der Nutzen von Bürokratie messen lässt, wie viel Kontrolle sinnvoll ist und was Bürokratie mit dem Fachkräftemangel zu tun hat. In dieser Folge geht es um Bürokratie, Betriebe und Brötchen.

#49: Wie gelingt Arbeitsmarktintegration?
Welche Effekte hat Migration auf den deutschen Arbeitsmarkt? Kann sie dabei helfen, die Fachkräftelücke zu schließen? Und warum ist Deutschland vor allem bei hochqualifizierten Fachkräften unbeliebt? Hannah Illing, Postdoc bei ECONtribute an der Uni Bonn, forscht zum Arbeitsmarkt, insbesondere im Zusammenhang mit Geschlechtergerechtigkeit und Migration. In zwei Studien hat sie die Effekte von Migration auf den deutschen Arbeitsmarkt und die langfristige Integration der Fachkräfte analysiert. Wir sprechen darüber, wie sich Migration auf Löhne, Arbeitslosigkeit und Beschäftigung auswirkt, warum die Literatur dazu teilweise widersprüchlich ist und warum die Hürden auf dem Arbeitsmarkt für Migrant:innen über das ganze Berufsleben hinweg höher sind als für Deutsche. In dieser Folge geht es um Arbeit, Migration und Integration.

#48: Kommt jetzt der Bau-Turbo?
Warum wird noch immer zu wenig gebaut? Welche wirtschaftlichen Folgen hat der Wohnungsmangel? Und wie realistisch ist der von der neuen Bundesregierung angekündigte Bau-Turbo? Moritz Schularick, Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft, analysiert den deutschen Immobilienmarkt seit vielen Jahren. Wir sprechen darüber, warum die Ampelregierung ihre Wohnungsbauziele verfehlt hat, ob kurzfristig sinkende Immobilienpreise gegen Wohnungsmangel helfen und ob ein Bau-Turbo überhaupt so schnell umzusetzen ist. In dieser Folge geht es um Wohnen, Wucher und Wahlversprechen.

#47: Nebenjobs von Abgeordneten: Was bringt mehr Transparenz?
Was bewirken Transparenzregeln für das Nebeneinkommen von Bundestagsabgeordneten? Haben sie einen Einfluss auf ihr Verhalten? Und wie reagiert die Wählerschaft auf lukrative Nebenverdienste? Carina Neisser, Postdoc bei ECONtribute an der Uni Köln, forscht zu Finanzwissenschaften und angewandter Mikroökonometrie. In einer Studie hat sie die Effekte der 2005 eingeführten Transparenzrichtlinie für den Nebenverdienst von Bundestagsabgeordneten analysiert. Wir sprechen darüber, welche Nebenjobs die lukrativsten sind, warum sich vor allem Abgeordnete im konservativ-liberalen Spektrum nebenher etwas dazu verdienen, und ob sich überhaupt messen lässt, wie effektiv die Richtlinie war. In dieser Folge geht es um Kompetenz, Korruption und Kohle.

#46: Schaden Fake News der Wirtschaft?
Gefährden Fake News nicht nur die Demokratie, sondern schaden auch der Wirtschaft? Lässt sich das überhaupt messen? Und wieviel ist Menschen der Schutz vor Falschinformationen wert? Stefanie Huber, Professorin bei ECONtribute an der Uni Bonn, forscht unter anderem zu Finanzmärkten und dem Gender Gap in Führungspositionen. In verschiedenen Studien hat sie analysiert, wie sich Fake News wirtschaftlich auswirken. Wir sprechen darüber, warum viele Menschen ihre Fact-Checking-Fähigkeiten überschätzen, wie sich der Effekt von Fake News auf Produktivität und Arbeitslosigkeit messen lässt und ob Menschen dazu bereit sind, für den Schutz vor Falschinformationen zu bezahlen. In dieser Folge geht es um (falsche) Fakten, Unsicherheit und Selbstüberschätzung.

#45: Der Wirtschaftswahlkampf (2/2)
Warum ignorieren sämtliche Parteien die Zukunft des gesetzlichen Rentensystems? Was hat die Umstellung von HartzIV zum Bürgergeld ökonomisch gebracht? Und welche Wirtschaftsreformen sind wirklich realistisch? Das diskutieren Christian Bayer (Universität Bonn) und Felix Bierbrauer (Universität zu Köln) im zweiten Teil des Schwerpunkts zu den Bundestagswahlen. Wir sprechen darüber, warum der Arbeitsanreiz im heutigen Steuer- und Transfersystem gering ist, welches Renteneintrittsalter zeitgemäß wäre und welche Wirtschaftsreformen in der kommenden Legislaturperiode wahrscheinlich sind. Im zweiten Teil des Wahl-Spezials geht es um Arbeit, Altern und Anreize.

#44: Der Wirtschaftswahlkampf (1/2)
Kann eine neue Bundesregierung die Wirtschaft retten? Sollte die Schuldenbremse ausgesetzt werden? Und sind die angekündigten Steuerreformen realistisch oder nur übliche Wahlkampf-Rhetorik? Das diskutieren Christian Bayer (Universität Bonn) und Felix Bierbrauer (Universität zu Köln) in zwei Sonderfolgen zu den Bundestagswahlen. Wir sprechen darüber, welche Vorschläge der Parteien ökonomisch sinnvoll sind, wie sie finanziert werden sollen und warum Wahlversprechen gefährlich sein können. Im ersten Teil des Wahl-Spezials geht es um Schulden, Steuern und Reformen.

#43 KI: Hemmt die EU-Regulierung Innovation?
Hemmt das Regulieren von Künstlicher Intelligenz wirtschaftliches Potenzial in Europa? Wie verändert die Technologie das Recht? Und ist die KI-Verordnung in der Praxis überhaupt umsetzbar? Indra Spiecker gen. Döhmann leitet den Lehrstuhl für das Recht der Digitalisierung an der Universität zu Köln und forscht bei ECONtribute unter anderem zur rechtlichen Begleitung der Digitalisierung. Wir sprechen darüber, wie viel Regulierung KI braucht, was die KI-Verordnung der EU wirklich bringt und warum die Juristin ein Doppelleben führt. In dieser Folge geht es um KI, Kontrolle und (In)Konsequenzen.

#42: Gefährden die US-Wahlen die Weltwirtschaft?
Was bedeutet der Ausgang der US-Wahlen für die globale Wirtschaft? Droht ein eskalierender Handelskonflikt mit China? Und wie wirken sich die gegenseitigen Strafzölle bisher eigentlich auf die Wirtschaft aus? Felix Tintelnot, Professor an der Duke University in North Carolina, forscht zu internationalen Wirtschaftsbeziehungen und dem globalen Handel. Wir sprechen darüber, was Strafzölle eigentlich bewirken, wem sie im US-Chinesischen Handelskonflikt bisher mehr geschadet haben und welche Szenarien nach den Wahlen in den USA drohen. In dieser Folge geht es um Wahlen, Wägen und Waschmaschinen.

#41: Warum ist trotz niedriger Inflation alles noch so teuer?
Warum sind die Preise trotz niedriger Inflation noch immer so hoch? Was bedeutet die Zinssenkung der Europäische Zentralbank für die Wirtschaft? Und wie wirkt sich der Klimawandel langfristig auf die Inflation aus? Tom Zimmermann, Professor bei ECONtribute an der Universität zu Köln, forscht unter anderem zu Finanzmarktstabilität und Geldpolitik. Wir sprechen im Inflations-Update darüber, warum eine zwei Prozent hohe Inflation überhaupt als ideal betrachtet wird, welche langfristigen wirtschaftlichen Folgen Phasen hoher Inflation haben und wie aussagekräftig eigentlich der Preis für Olivenöl ist. In dieser Folge geht es um Klima, Renten und Oliven.

#40: Wie funktioniert der Aktienmarkt?
Wieso verhalten sich Menschen am Aktienmarkt so unterschiedlich? Wie entstehen eigentlich Blasen? Und wie viel Einfluss haben Privatanlegende überhaupt auf Aktienkurse? Johannes Wohlfart, Professor bei ECONtribute an der Uni Köln, analysiert in seiner Forschung unter anderem das Verhalten von Menschen am Aktienmarkt. In verschiedenen Studien hat er ein mentales Modell von Anlegenden entwickelt. Wir sprechen darüber, warum selbst Fondsmanager oft nicht rational handeln, welche Anlagestrategie laut Finanzforschung die erfolgversprechendste ist und ob bessere Finanzbildung Börsencrashs verhindern könnte. In dieser Folge geht es um Aktien, Akademiker und Blasen.

#39: Was treibt politische Meinungen?
Warum nehmen Menschen dieselben Fakten unterschiedlich wahr? Was bedeutet das für ihre politische Meinungsbildung? Und wie kann die Politik damit umgehen? Sonja Settele, Professorin bei ECONtribute an der Universität Köln, erforscht unter anderem wie Meinungen entstehen und menschliche Entscheidungen beeinflussen. Wir sprechen darüber, welche Rolle die Überzeugungen der Bevölkerung für wirtschaftspolitische Entscheidungen spielt, ob mehr Faktenwissen Polarisierung verhindert und wie gut Menschen eigentlich wirtschaftliche Fakten einschätzen können. In dieser Folge geht es um Politik, Polarisierung und Petitionen.

#38: Warum gibt es immer noch so wenig Frauen in MINT-Berufen?
Warum ist der Gender Gap in mathematisch-technischen Berufen heutzutage immer noch so groß? Was haben Schulleistungen damit zu tun? Und wie lässt sich die Lücke endlich schließen? Fani Lauermann, Professorin für empirische Bildungsforschung und Bildungspsychologie bei ECONtribute an der Universität Bonn, forscht zu Bildungs- und Berufsentscheidungen junger Menschen. Wir sprechen darüber, warum der Frauenanteil in MINT-Berufen in den vergangenen Jahrzehnten nur langsam wächst, ob genetische Faktoren dabei eine Rolle spielen und warum gerade Deutschland im Ländervergleich schlecht abschneidet. In dieser Folge geht es um Mathe, Mädchen und Motivation.

#37: Sollte die Schuldenbremse reformiert werden?
Ist die Schuldenbremse noch zeitgemäß? Verhindert sie wichtige Investitionen in Klimaschutz und Infrastruktur? Oder hilft sie dabei, die richtigen Prioritäten zu setzen? Das diskutieren Christian Bayer (Universität Bonn) und Felix Bierbrauer (Universität zu Köln) in der heutigen Folge. Wir sprechen darüber, welche Rolle Schulden für Staaten haben, warum die Schuldenbremse überhaupt eingeführt wurde und ob eine Reform ökonomisch sinnvoll wäre. In dieser Folge geht es um Schulden, Steuern und Staaten.

#36: Verteilt eine Aktienrente Vermögen gerechter?
Warum ist das Vermögen in Deutschland so ungleich verteilt wie fast nirgendwo sonst im Euroraum? Was hat das Rentensystem damit zu tun? Und kann eine Aktienrente die Ungleichheit bekämpfen? Christian Bayer, Professor für Makroökonomie bei ECONtribute an der Uni Bonn, forscht unter anderem zu Finanzkrisen, Fiskalpolitik und Ungleichheit. Wir sprechen darüber, was er sich unter einem "Vermögen für alle" vorstellt, was Deutschland in der Rentenpolitik versäumt hat und ob sich das überhaupt System noch rechtzeitig reformieren lässt, bevor die Babyboomer in Rente gehen. In dieser Folge geht es um Reichtum, Rente und Reformen.

#35: Wie meistern wir Krisen besser?
Hat die Wirtschaft die Corona-Pandemie gut überstanden? Warum gab es keinen Crash auf den Finanzmärkten? Und wie lernen wir als Gesellschaft, besser mit solchen Krisen umzugehen? Markus Brunnermeier, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Princeton University, analysiert internationale Finanzmärkte, das Entstehen von Preisblasen und die Rolle der Geldpolitik. Wir sprechen darüber, warum in den vergangenen Jahren eine Krise auf die nächste folgt, was die Politik aus den jüngsten Krisen gelernt hat und warum sich der Klimawandel von anderen Krisen unterscheidet. In dieser Folge geht es um Krisen, Crashs und Schilfrohr.

#34: Wäre der Brexit vermeidbar gewesen?
Wäre der Brexit vermeidbar gewesen? Wie konnte es überhaupt zum EU-Referendum kommen? Und droht uns eine Wiederholung der Geschichte? Thiemo Fetzer, Professor für Volkswirtschaftslehre bei ECONtribute an der Universität Bonn, beschäftigt sich in seiner Forschung damit, wie Krisen entstehen und welche wirtschaftlichen Konsequenzen sie haben. In den vergangenen Jahren hat er den Brexit wissenschaftlich begleitet. Wir sprechen darüber, wie viele Briten zu Protestwählern wurden, welche Rolle die strikte Sparpolitik der britischen Regierung dabei spielte und was wir in Deutschland aus dem Brexit lernen können. In dieser Folge geht es um Populismus, Protest und (Spar)Politik.

#33: Was kosten Naturkatastrophen Betroffene?
Wie viel kosten Naturkatastrophen einzelne Menschen langfristig? Was wird in offiziellen Statistiken nicht erfasst? Und wie sollten zielgerichtete Katastrophenhilfen aussehen? Hanna Schwank, Juniorprofessorin für Wirtschaftsgeschichte bei ECONtribute an der Universität Bonn, forscht zu Arbeitsmärkten und beschäftigt sich unter anderen damit, wie sich Naturkatastrophen wirtschaftlich auf das Leben einzelner Menschen auswirken. In einer Studie hat sie die langfristigen Effekte des San Francisco Fire 1906, eine der größten Naturkatastrophen in der US-amerikanischen Geschichte, analysiert. Wir sprechen darüber, wie Naturkatastrophen Menschen über Jahrzehnte hinweg wirtschaftlich beeinflussen, warum sie sich unter Umständen für nachfolgende Generationen wirtschaftlich sogar positiv auswirken und warum Hanna in ihren Daten nur Männer beobachten konnte. In dieser Folge geht es um Klima, Katastrophen und Kosten.

#Klima 4: Die Schmutzkosten
Was kostet uns Luftverschmutzung? Wie lassen sich die Krankheitskosten von Feinstaub überhaupt messen? Und wie viel Sinn ergeben die Schadstoff-Grenzwerte der EU mit Blick auf die Gesundheitskosten eigentlich? Julia Mink ist Umweltökonomin an der Uni Bonn und forscht unter anderem mit den gesundheitlichen Kosten von Luftverschmutzung. Wir sprechen darüber, wie sich die Kosten von Luftverschmutzung beziffern lassen, welche gesellschaftlichen Gruppen besonders betroffen sind und ob sich eine Reduktion der Schadstoffe nicht nur gesundheitlich, sondern auch finanziell lohnen würde. In dieser Folge geht es um Feinstaub, Krankheiten und Gesundheitskosten.

#Klima 3: Die Klimarechner
Was bringt mehr: Nachhaltig konsumieren oder investieren? Wie akkurat sind CO2-Rechner für den eigenen Klima-Fußabdruck? Und wie viel kann jeder Einzelne fürs Klima tun? Hendrik Hakenes, Professor bei ECONtribute an der Universität Bonn forscht, zu Finanzmärkten und beschäftigt sich unter anderen mit den ökonomischen Folgen des Klimawandels. Wir sprechen darüber, wie konventionelle CO2-Rechner den individuellen Fußabdruck berechnen, was sie dabei außer Acht lassen und wo jeder Einzelne ansetzen kann, um die eigene Klimabilanz zu verbessern. In dieser Folge geht es um Klima, Kosten und Konsum.

#Klima 2: Die Krisenpolitik
Wovon hängt es ab, ob Menschen Klimaschutzmaßnahmen unterstützen? Warum agiert die Politik trotz drängendem Klimawandel träge? Und warum sind wir auf Krisen generell so unvorbereitet? Michael Bechtel, Professor für Wirtschaftspolitik bei ECONtribute an der Universität zu Köln, forscht unter anderen dazu, wie Klimapolitik in der Bevölkerung wahrgenommen wird. Wir sprechen darüber, warum sich ein funktionierendes internationales Klimaabkommen auch aus innenpolitischer Sicht lohnen würde, warum Regierungen eher kurzfristig auf Krisen reagieren, statt zukünftige Krisen mit präventiven Maßnahmen zu verhindern und wie Klimaschutzmaßnahmen für mehr Zustimmung kommuniziert werden sollten. In dieser Folge geht es um Politik, Krisen und Kommunikation.

#Klima 1: Die Doppelkrise
Hemmt die Energiekrise den Kampf gegen den Klimawandel? Warum läuft die seit Jahrzehnten angestrebte Energiewende so schleppend? Und kann Deutschland die Klimaziele noch erreichen? Veronika Grimm, Professorin für Wirtschaftstheorie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Energieexpertin im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Wirtschaftsweise), forscht seit vielen Jahren zu zukunftsfähigen Energiemärkten und berät die Bundesregierung. Wir sprechen darüber, wie der Krieg in der Ukraine die Energiemärkte langfristig verändern wird, ob die verschärften Klimaziele überhaupt erreichbar sind und warum Wasserstoff dabei eine zentrale Schlüsselrolle zukommt. In dieser Folge geht es um Klima, Energie und Wasserstoff.

#Ukraine: Die Jahresbilanz
Was haben die Finanzsanktionen gegen Russland gebracht? Wie kommt Deutschland langfristig ohne russisches Gas zurecht? Und ist das Risiko einer globalen Hungersnot abgewendet? Forschende des Exzellenzclusters haben im Wirtschaftspodcast über das vergangene Jahr hinweg analysiert, wie sich der Ukrainekrieg ökonomisch auswirkt. Ein Jahr nach der russischen Invasion der Ukraine ziehen die Ökonomen Sascha Becker, Matin Qaim, Farzad Saidi, Moritz Schularick und Tom Zimmermann in einer Sonderfolge Bilanz. In dieser Folge geht es um Gas, Geld und Getreide.

#Ukraine Special: Day Zero?
One year full-scale Russian invasion in Ukraine – how did this affect both countries economically? In today’s special (English-language) episode, we discuss the economic consequences of the war with the Ukrainian economist Timofiy Mylovanov and the Russian economist Sergei Guriev. Sergei led the New Economic School in Moscow and was an external consultant of the Cremlin before he flew into exile in France in 2013, where he is now a professor at Science Po in Paris. Timofiy is the president of the Kyiv School of Economics, former minister of Economic Development, Trade and Agriculture in Ukraine and a consultant to Wolodymyr Selenskyj. We discuss why GDP is not a good measure of economic wellbeing in times of war and how one can even calculate the costs of war and have a look at the long-time economic perspective for Ukraine and Russia. This episode deals with costs of war, sanctions and rebuilding. Dieser Beitrag nimmt an Fast Forward Science 2022/23 teil, einem Wettbewerb für Wissenschaftskommunikation! Mehr Infos zum Wettbewerb gibt es hier: [fastforwardscience.de](http://www.fastforwardscience.de).

#FakeNews 4: Die Wahlbots
Dieser Beitrag nimmt an Fast Forward Science 2022/23 teil, einem Wettbewerb für Wissenschaftskommunikation! Mehr Infos zum Wettbewerb gibt es hier: [fastforwardscience.de](http://www.fastforwardscience.de). Dieser Beitrag nimmt an Fast Forward Science 2022/23 teil, einem Wettbewerb für Wissenschaftskommunikation! Mehr Infos zum Wettbewerb gibt es hier: [fastforwardscience.de](http://www.fastforwardscience.de). Gefährden Fake News unsere Demokratie? Wie viel Macht haben Bots im Wahlkampf? Und was können Politiker: innen gegen Desinformation im Online-Wahlkampf tun? Caja Thimm, Professorin für Medienwissenschaften an der Universität Bonn, forscht unter anderem zur politischen Kommunikation in sozialen Netzwerken. Wir sprechen darüber, welche politische Macht Fake News haben, wie sich rechte Gruppierungen Desinformation zunutze machen und ob Bots in naher Zukunft unsere Wahlen entscheiden. In dieser Folge geht es um Bots, Betrug und Bubbles.

#FakeNews 3: Die Gedächtnistrigger
Dieser Beitrag nimmt an Fast Forward Science 2022/23 teil, einem Wettbewerb für Wissenschaftskommunikation! Mehr Infos zum Wettbewerb gibt es hier: [fastforwardscience.de](http://www.fastforwardscience.de). Was beeinflusst, an welche Informationen wir uns erinnern, wenn wir Entscheidungen treffen? Warum bleiben Geschichten besser in Erinnerung als Zahlen? Und was hat das mit dem Erfolg von Fake News zu tun? Florian Zimmermann, Professor bei ECONtribute an der Universität Bonn, erforscht das menschliche Gedächtnis im Hinblick auf (ökonomische) Entscheidungen. In verschiedenen Studien hat er untersucht, warum sich welche Nachrichten unterschiedlich stark in unseren Köpfen verankern. Wir sprechen darüber, auf welcher Grundlage wir unsere Überzeugungen bilden, was man unter assoziativem Erinnern versteht und was das alles mit Ferienhäusern, Aktien und Sushi-Rollen zu tun hat. In dieser Folge geht es um unser Gedächtnis, Anekdoten und Zahlen.

# FakeNews 2: Die Faktenchecker
Dieser Beitrag nimmt an Fast Forward Science 2022/23 teil, einem Wettbewerb für Wissenschaftskommunikation! Mehr Infos zum Wettbewerb gibt es hier: [fastforwardscience.de](http://www.fastforwardscience.de). Wie können Plattformen effektiv gegen FakeNews vorgehen? Bringt Fact-Checking angesichts des riesigen täglichen Nachrichtenaufkommens überhaupt was? Und welche Rolle spielen Algorithmen und Künstliche Intelligenz beim Umlauf von Desinformation? Johannes Münster, Professor bei ECONtribute an der Universität zu Köln, forscht unter anderem zur Verbreitung von Nachrichten auf sozialen Netzwerken und dem Umgang mit FakeNews. Wir sprechen darüber, wie Nutzer:innen auf Fact-Checking reagieren, ob Schulungen zur Medienkompetenz wirksamer sind als reine Faktenchecks und wer eigentlich hinter unabhängigen Faktenchecks steht. In dieser Folge geht es um Facebook, Fakten und Fakes.

# FakeNews 1: Die Meinungsmacher
Dieser Beitrag nimmt an Fast Forward Science 2022/23 teil, einem Wettbewerb für Wissenschaftskommunikation! Mehr Infos zum Wettbewerb gibt es hier: [fastforwardscience.de](http://www.fastforwardscience.de). Wo liegt die Grenze zwischen populistischer Meinung, Verschwörungstheorie und FakeNews? Können Zuschauende Fakten und Meinungen immer klar trennen? Und wie wird sich der meinungsgetriebene Medienkonsum zukünftig entwickeln? Christopher Roth, Professor bei ECONtribute an der Universität zu Köln, hat in verschieden Studien den Medienkonsum von polarisierenden US-Meinungsshows und dessen Auswirkungen analysiert. Wir sprechen darüber, warum populistische Meinungsbeiträge das Entstehen von Fake News begünstigen kann, woran es liegt, dass immer mehr Menschen klassischen Nachrichten misstrauen und ob sich dies in naher Zukunft ändern lässt. In dieser Folge geht es um Meinungen, Polarisierung und (falsche) Fakten.

#Ukraine 6: Der Gashahn 2.0
Dieser Beitrag nimmt an Fast Forward Science 2022/23 teil, einem Wettbewerb für Wissenschaftskommunikation! Mehr Infos zum Wettbewerb gibt es hier: [fastforwardscience.de](http://www.fastforwardscience.de). Was hat sich in Deutschland in Sachen Gasversorgung seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine getan? Wie würde ein jetziger Gaslieferstopp die Wirtschaft treffen? Und mit welchen Maßnahmen gelingt es, ausreichend Gas einzusparen? Moritz Schularick, Professor bei ECONtribute an der Universität Bonn, hat in einer aktualisierten Schätzung untersucht, wie sich ein sofortiger Gaslieferstopp heute im Vergleich zum Frühjahr auswirken würde. Das Ergebnis: Panik sei fehl am Platz. Wir sprechen darüber, wie die Gas-Strategie der Bundesregierung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu bewerten ist und wie ein Gasliefertstopp die Wirtschaft zum jetzigen Zeitpunkt beeinträchtigen würde. In dieser Folge geht es um Gas, Anreize und Macht.

#Ukraine 5: Der Integrationsschlüssel
Dieser Beitrag nimmt an Fast Forward Science 2022/23 teil, einem Wettbewerb für Wissenschaftskommunikation! Mehr Infos zum Wettbewerb gibt es hier: [fastforwardscience.de](http://www.fastforwardscience.de). Welche wirtschaftlichen Folgen hat kriegsbedingte Migration? Wie gelingt erfolgreiche Integration? Und was können wir aus vergangenen Flüchtlingsbewegungen lernen? Sascha Becker, Wirtschaftshistoriker an den Universitäten Monash (Melbourne, Australien) und Warwick (GB), fordert Europa in einem aktuellen Artikel auf, Geflüchtete gemeinsam und unbürokratisch aufzunehmen und einen sofortigen Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Wir sprechen darüber, was erzwungene Migration von anderen Migrationsformen unterscheidet, wie sie sich auf die Arbeitsmärkte in den Zielländern auswirkt und was wir aus den Flüchtlingsbewegungen nach dem Zweiten Weltkrieg lernen können. In dieser Folge geht es um Krieg, Flucht und Integration.

#Arbeit 5: Der Verbrechensverlust
Dieser Beitrag nimmt an Fast Forward Science 2022/23 teil, einem Wettbewerb für Wissenschaftskommunikation! Mehr Infos zum Wettbewerb gibt es hier: [fastforwardscience.de](http://www.fastforwardscience.de). Wie viel kostet Kriminalität die Gesellschaft? Wie wirken sich Verbrechen langfristig auf die Karriere von Opfern aus? Und was hat Kriminalität eigentlich mit Wirtschaftsforschung zu tun? Anna Bindler, Professorin bei ECONtribute an der Universität zu Köln, forscht aus ökonomischer Sicht zu Kriminalität. In einer Studie hat sie analysiert, welche wirtschaftlichen Folgen Opfer von Verbrechen tragen. Wir sprechen darüber, wie sich Kosten von Kriminalität messen lassen, welche Arbeitsmarktfolgen Verbrechen für Oper im Schnitt haben und wie diese effektiv vermindert werden können. In dieser Folge geht es um Kriminalität, Kosten und Kausalität.

#Arbeit 4: Die Jobroboter
Dieser Beitrag nimmt an Fast Forward Science 2022/23 teil, einem Wettbewerb für Wissenschaftskommunikation! Mehr Infos zum Wettbewerb gibt es hier: [fastforwardscience.de](http://www.fastforwardscience.de). Vernichtet der technologische Fortschritt unsere Jobs? Treiben Digitalisierung und Automatisierung die Lohnschere weiter auseinander? Und wie wandeln sich unsere Tätigkeiten? Terry Gregory, Arbeitsmarktökonom beim Institute of Labor Economics (IZA) in Bonn, erforscht unter anderem, wie sich Digitalisierung und Automatisierung auf den Arbeitsmarkt auswirken. Wir sprechen darüber, wie man Digitalisierung eigentlich messen kann, welche Chancen und Risiken die digitale Transformation birgt und ob die Pandemie den technologischen Wandel tatsächlich beschleunigt hat. In dieser Folge geht es um digitale Transformation, Künstliche Intelligenz und Fortschritt.

#Ukraine 4: Die Inflationsspirale
Dieser Beitrag nimmt an Fast Forward Science 2022/23 teil, einem Wettbewerb für Wissenschaftskommunikation! Mehr Infos zum Wettbewerb gibt es hier: [fastforwardscience.de](http://www.fastforwardscience.de). Befördert der Krieg die Inflation? Stehen wir kurz vor einer neuen Eurokrise? Und was kann die Europäische Zentralbank tun, um das Preisniveau zu stabilisieren? Tom Zimmermann, Professor bei ECONtribute an der Universität zu Köln, forscht unter anderem zu Finanzmarktstabilität und Geldpolitik. Wir sprechen darüber, wie Inflation überhaupt entsteht und gemessen wird, wie sich die Teuerungsrate ohne den Ukraine-Krieg entwickelt hätte und warum die EZB in einem Dilemma steckt. In dieser Folge geht es um Preise, Geldpolitik und Zinsen.

#Ukraine 3: Die Kornkammer
Dieser Beitrag nimmt an Fast Forward Science 2022/23 teil, einem Wettbewerb für Wissenschaftskommunikation! Mehr Infos zum Wettbewerb gibt es hier: [fastforwardscience.de](http://www.fastforwardscience.de). Verursacht der russische Angriffskrieg eine globale Hungersnot? Was kann Europa in Sachen Getreidekonsum tun, um diese abzuwenden? Und wie verändert der Krieg die weltweite Lebensmittelversorgung langfristig? Matin Qaim, Professor für Ökonomischen und Technologischen Wandel an der Landwirtschaftlichen Fakultät der Uni Bonn und Direktor des Zentrums für Entwicklungsforschung, forscht unter anderem zur weltweiten Ernährungssicherung und nachhaltiger Landwirtschaft. Wir sprechen darüber, wie sich der kriegsbedingte Getreidemangel auf die weltweite Nahrungsversorgung auswirkt, welche Maßnahmen eine drohende Hungersnot bekämpfen können und welche Rolle Bioenergie dabei spielt. In dieser Folge geht es um Getreide, Hunger und Energie.

#Ukraine 2: Das SWIFT-System
Wie hart wird der Ausschluss aus dem internationalen SWIFT-System Russland langfristig treffen? Welche Bedeutung hat SWIFT für die Wirtschaft? Und können die westlichen Finanzsanktionen den Krieg frühzeitig beenden? Farzad Saidi, Professor bei ECONtribute an der Universität Bonn, forscht zu Finanzmarktstabilität, Geldpolitik und dem internationalen Bankenwesen. Wir sprechen darüber, warum Russland wirtschaftlich langfristig isoliert sein wird, welche Folgen die westlichen Finanzsanktionen haben und wie das SWIFT-System global zusammenhängt. In dieser Folge geht es um Geld, Globalisierung und Finanzmacht.

#Ukraine 1: Der Gashahn
Dieser Beitrag nimmt an Fast Forward Science 2022/23 teil, einem Wettbewerb für Wissenschaftskommunikation! Mehr Infos zum Wettbewerb gibt es hier: [fastforwardscience.de](http://www.fastforwardscience.de). Was passiert, wenn kein russisches Gas mehr fließt? Bricht Deutschlands Wirtschaft ein? Und warum zögert die deutsche Politik, einen Importstopp für russische Energie zu verhängen? Moritz Schularick, Professor bei ECONtribute an der Universität Bonn, hat in einer aktuellen Studie untersucht, welche wirtschaftlichen Folgen es für Deutschland hätte, wenn Russland den Gashahn zudreht oder die Bundesregierung ein Embargo umsetzt. Das Ergebnis: Der Wirtschaftseinbruch wäre deutlich, aber handhabbar. Wir sprechen darüber, wie das entstehende Gas-Defizit aufgefangen werden könnte, warum gerade Deutschland so abhängig von russischem Gas ist und was sich langfristig an der Energie-Infrastruktur ändern sollte. In dieser Folge geht es um Energie, Abhängigkeit und Sanktionen.

#Arbeit 3: Das Zukunftsmodell
Wie sehen die Arbeitsmodelle der Zukunft aus? Macht mehr Freiheit im Job produktiver? Und wie wird die Pandemie Arbeitsstrukturen langfrsitig beeinflussen? Matthias Kräkel, Professor bei ECONtribute an der Universität Bonn, hat in verschiedenen Studien analysiert, wie sich neue Arbeitsmodelle auf die Arbeitsleistung auswirken. Wir sprechen darüber, was Arbeitende motiviert, wer von höherer Flexibilität profitiert und warum mehr Selbstbestimmung unter Umständen zu geringeren Löhnen führen kann. In dieser Folge geht es um moderne Arbeitsmodelle, Selbstbestimmung und (niedrige) Löhne.

#Arbeit 2: Die Jobmanager
Ist die Wiedereingliederung von Arbeitssuchenden in den deutschen Arbeitsmarkt ineffizient? Warum ist die Langzeitarbeitslosigkeit in Deutschland vergleichsweise hoch? Und wie viel sollte man Arbeitssuchenden abverlangen? Amelie Schiprowski, Professorin bei ECONtribute an der Universität Bonn, hat in verschiedenen Studien analysiert, was die Dauer von Arbeitslosigkeit beeinflusst. Wir sprechen darüber, welche Rolle einzelne Betreuende beim Arbeitsamt spielen, warum mehr Auflagen für Arbeitssuchende nicht immer besser sind und wie sich der Zielkonflikt zwischen möglichst schneller und gleichzeitig nachhaltiger Wiedereingliederung lösen lässt. In dieser Folge geht es um Arbeitslosigkeit, Auflagen und das Arbeitsamt.

#Arbeit 1: Die Jobmaschinerie
Was macht den deutschen Arbeitsmarkt besonders? Wieso kommt er scheinbar unbeschadet durch Krisen? Und wie hätte sich die Arbeitslosigkeit ohne die Hartz-Reformen entwickelt? Moritz Kuhn, Professor bei ECONtribute an der Universität Bonn, hat in verschiedenen Studien die Besonderheiten des deutschen Arbeitsmarktes beleuchtet. Wir sprechen darüber, warum die Fluktuation in Deutschland im internationalen Vergleich so niedrig ist, was die Hartz IV Reformen damit zu tun haben und was das von der Ampelkoalition angekündigte Bürgergeld verändern wird. In dieser Folge geht es um den deutschen Arbeitsmarkt, Hartz IV und Kurzarbeit.
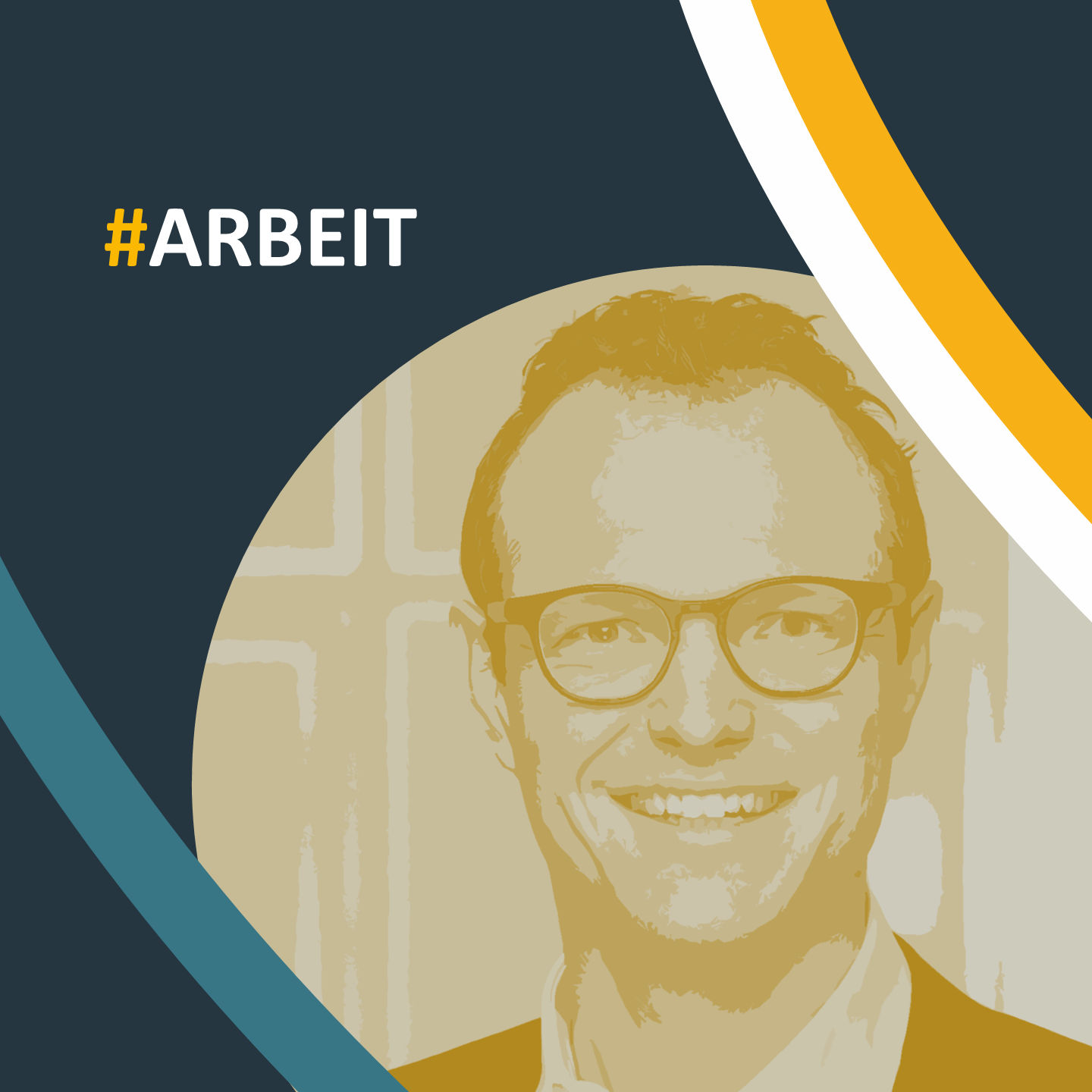
Bonusfolge: Der Bildungswandel
Hat die Pandemie den Wandel der universitären Bildung vorangetrieben? Was macht zukunfsgerichtete Bildung aus? Und vor welchen Hürden stehen Universitäten? Beatrix Busse, Professorin für Englische Sprachwissenschaft und Prorektorin für Lehre und Studium an der Universität zu Köln, setzt sich für eine ganzheitliche und zukunftsgerichtete Hochschulbildung ein. Unter anderem hat sie ein Positionspapier zur Zukunft der Lehrer:innenbildung verfasst. Sie fordert: Bildung muss agiler, digitaler und nachhaltiger werden. Wir sprechen darüber, wie dies in der Praxis gelingen kann, warum der Prozess in der Vergangenheit teilweise schleppend lief und was sich hinter einem Führerschein für digitale Kompetenzen verbirgt. In dieser Folge geht es um Universitäten, Digitalisierung und die Bildung der Zukunft.

#Bildung 4: Die Zeugnisjagd
Was motiviert junge Menschen, zu studieren? Warum brechen so viele Studierende ihr Studium ab? Und interessiert sie für den späteren Erfolg auf dem Arbeitsmarkt eigentlich nur das Abschlusszeugnis oder geht es ihnen tatsächlich um die vermittelten Inhalte? Laura Ehrmantraut, Doktorandin bei ECONtribute an der Universität Bonn, hat in einer aktuellen Studie gemeinsam mit ihren Kolleginnen analysiert, was Studierende antreibt. Das Ergebnis: Die überwiegende Mehrheit geht davon aus, dass am Ende einzig und alleine das Abschlusszeugnis über den Karriereerfolg und die damit einhergehenden Löhne entscheidet. Wir sprechen darüber, warum die Signalwirkung des Studiums so stark ist und was sich Studierende durch ihren Abschluss erhoffen. In dieser Folge geht es um Qualifikationsdruck, Studienabbrüche und Bildungsrenditen.

#Wahljahr 3: Die Klimafrage
Wieso schaffen wir es trotz eindringlicher Warnungen der Wissenschaft bisher nicht, den Klimawandel zu bekämpfen? Warum scheitern internationale Klimaabkommen? Und was kann Deutschland alleine überhaupt gegen den Klimawandel ausrichten? Axel Ockenfels, Professor bei ECONtribute an der Universität zu Köln, forscht seit Jahren zum internationalen Kooperationsproblem in Sachen Klima. Wir sprechen darüber, was in der deutschen Klimapolitik falsch läuft, warum es naiv wäre zu glauben, dass andere im Klimaschutz einfach mitziehen und wie ein internationaler CO2-Preis dieses Problem lösen kann. In dieser Folge geht es um den Klimawandel, (mangelnde) Kooperation und Symbolpolitik.

#Wahljahr 2: Die Wohnfrage
Spaltet der Immobilienboom die Gesellschaft? Wieso schießen die Immobilienpreise seit Jahren in die Höhe? Und wie wird Wohnen wieder bezahlbar? Moritz Schularick, Professor bei ECONtribute an der Universität Bonn, hat den Immobilienmarkt in Deutschland im vergangenen Jahrzehnt analysiert. Die Prognose: Auch 2030 wird der Wohnraum hierzulande knapp sein. Wir sprechen darüber, wie es zur angespannten Lage auf dem Immobilienmarkt kam, warum der Staat den Wohnungsbau so lange vernachlässigt hat und ob Mietpreisbremse & Co. langfristig für bezahlbaren Wohnraum sorgen können. In dieser Folge geht es um den Immobilienboom, Gentrifizierung und (un)bezahlbare Mieten.

#Wahljahr 1: Die Steuerfrage
Ist unser Steuersystem gerecht? Sollten Besserverdienende mehr bezahlen? Und wie realistisch sind Steuersenkungen nach der Pandemie? Felix Bierbrauer, Professor bei ECONtribute an der Universität zu Köln, hat gemeinsam mit seinen Kollegen mögliche Steuerreformen für unser Einkommenssteuersystem analysiert. Das Ergebnis: Unser System könnte durchaus effizienter sein. Wir sprechen darüber, wie sinnvoll ein höherer Spitzensteuersatz wäre, was sich hinter dem „Mittelstandsbauch“ verbirgt und wie realistisch Steuersenkungen nach der Pandemie sind. In dieser Folge geht es um den Staat, Steuern und Schulden.

#Bildung 3: Die Sortiermaschine
Funktioniert Integration in deutschen Schulen? Sollte das mehrgliedrige Schulsystem für mehr Bildungsgerechtigkeit abgeschafft werden? Und wie entstehen im Klassenzimmer soziale Netzwerke? Clemens Kroneberg, Professor bei ECONtribute an der Universität zu Köln, erforscht im Rahmen seines SOCIALBOND-Projekts, welche Faktoren die Integration von Kindern aus sozialen Minderheiten fördern oder hindern. Wir sprechen darüber, welche Rolle die ethnische Herkunft beim Knüpfen von Freundschaften spielt und was dazu beiträgt, dass sich Jugendliche mit Migrationshintergrund als Deutsche identifizieren. In dieser Folge geht es um soziale Netzwerke in der Schule, Integration und Identität.

#Bildung 2: Der Bildungsdschungel
Wie chancengerecht ist unser Schulsystem? Wie gelingt es, Kinder aus sozioökonomisch schwächeren Familien zu fördern? Und sind Gesamtschulen die Lösung für mehr Chancengleichheit? Pia Pinger, Professorin bei ECONtribute an der Universität zu Köln, hat gemeinsam mit ihren Kollegen erforscht, wie sich ein Mentoring-Programm für Grundschulkinder mit niedrigerem sozioökonomischem Status auf deren Entwicklung auswirkt. Das Ergebnis: Die Wahrscheinlichkeit, nach der Grundschule aufs Gymnasium zu wechseln steigt um elf Prozentpunkte. Wir sprechen darüber, wie Chancengerechtigkeit in Schulen erreicht werden kann und was das Dschungelbuch damit zu tun hat. In dieser Folge geht es um faire Chancen, Leistungsgerechtigkeit und Bildungsreformen.

#Bildung 1: Der Schul-Lockdown
Ist es Deutschlands Schulen gelungen, ein funktionierendes Konzept für Distanzunterreicht aufzubauen? Welche Perspektiven gibt es für Schüler:innen in den kommenden Monaten? Und driftet die Schere der Bildungsungleichheit durch die pandemiebedingten Schulschließungen weiter auseinander? Ludger Wößmann, Leiter des ifo Zentrums für Bildungsökonomik und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München, hat bereits den ersten Schul-Lockdown im Frühjahr 2020 mit einer Befragung von mehr als 1000 Eltern begleitet. Das ernüchternde Ergebnis: Die Lernzeit der Schüler:innen hat sich halbiert und gemeinsamer Online-Unterricht fand selten bis gar nicht statt. Wir sprechen darüber, ob sich die Lage während des zweiten Schul-Lockdowns 2021 gebessert hat und welche Folgen die Schulschließungen langfristig für Kinder und Jugendliche haben. In dieser Folge geht es um die Pandemieauswirkungen auf die Bildung, Politikversagen und Bildungsungleichheit.

#Gender 3: Die Frauenfonds
Werden Frauen bei der Finanzberatung abgezockt? Brauchen wir spezielle Finanzprodukte je nach Geschlecht? Und investieren Frauen und Männer eigentlich unterschiedlich? Christine Laudenbach, Finance-Professorin an der Universität Bonn, forscht zu finanziellen Entscheidungen in Haushalten und hat in ihrer aktuellen Studie die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Finanzberatung analysiert. Wir sprechen darüber, warum Frauen im Schnitt teurere Finanzprodukte empfohlen bekommen als Männer. In dieser Folge geht es um unterschiedliche Risikopräferenzen, rosa Geldanlagen und Vorurteile in der Finanzwelt.

#Gender 2: Die Babyfalle
Wollen Frauen nach der Geburt lieber zuhause bleiben? Drängt sie die Gesellschaft in eine Rolle? Oder ist das Ganze biologisch bedingt? Barbara Boelmann, Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität zu Köln, hat das Rückkehrverhalten von jungen Müttern in den Beruf deutschlandweit analysiert und gravierende Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland beleuchtet. Wir sprechen darüber, wie soziale Normen die Löhne nach einer Geburt langfristig beeinflussen. In dieser Folge geht es um traditionelle Rollenbilder, die Vereinbarkeit von Mutterschaft und Karriere und unterschätzte Folgen von Babypausen.

#Gender 1: Der Gendergap
Werden Frauen in der Wirtschaftsforschung diskriminiert? Wollen sie die Jobs in Top-Forschungsinstitutionen einfach nicht? Und wie bekommen wir mehr weibliche Wirtschaftsprofessorinnen? Guido Friebel, Leiter des Lehrstuhls für Personalwirtschaft an der Goethe Universität Frankfurt, hat den Frauenanteil in Wirtschaftsforschungsinstitutionen analysiert und große internationale Unterschiede festgestellt. Wir sprechen darüber, warum die Lage in Deutschland besonders prekär ist und wie sich das ändern kann. In dieser Folge geht es um Hürden in der akademischen Wirtschaftskarriere, Geschlechtergerechtigkeit und Frauenquoten.