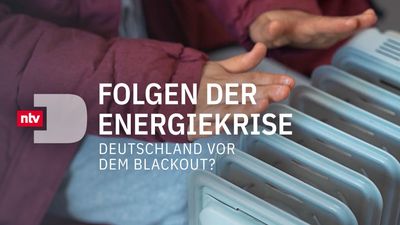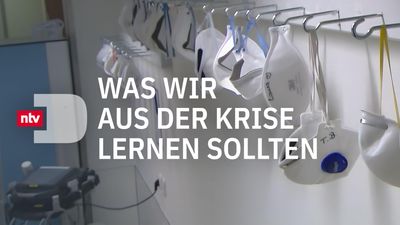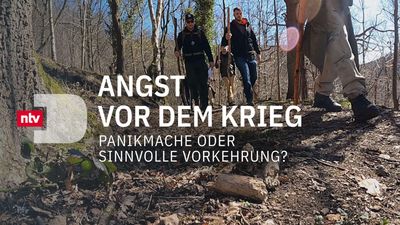Immer montags sprechen wir über das, was die Welt im Innersten zusammenhält: Geld, Macht, Gerechtigkeit. Warum kann ich mir kein Haus leisten? Wie wird eine Stadt klimaneutral? Kann ich Cannabis bald im Laden kaufen? Und muss die Wirtschaft wirklich ständig wachsen? Alle 14 Tage untersuchen Carla Neuhaus, Zacharias Zacharakis und Jens Tönnesmann ein wirtschaftliches Phänomen und fragen sich: Ist das eine Blase? Oder bleibt das? Immer mit einem Gast – und einem Tier. Falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos Die ZEIT: www.zeit.de/podcast-abo
Alle Folgen
Eine Ankündigung
In einigen Tagen werden wir das Archiv von "Ist das eine Blase?" und vielen weiteren Podcasts der ZEIT exklusiv für unsere Abonnenten zugänglich machen. Die drei aktuellsten Folgen bleiben kostenlos und frei verfügbar. Alle älteren Folgen können Sie künftig mit einem Digital- oder Podcastabo der ZEIT hören, unter www.zeit.de/wirtschaftspodcast, auf Apple Podcasts oder Spotify. Wenn Sie noch kein Abo haben, können Sie unter www.zeit.de/podcastabo ein kostenloses Probeabo bestellen. Nach der Probephase kostet es 4,99 Euro im Monat. Sie erhalten damit nicht nur Zugriff auf das komplette Podcastarchiv der Zeit, sondern auch auf regelmäßige Bonusfolgen von "OK, America?", "Das Politikteil", "Verbrechen" und weiteren Podcasts. Außerdem können Sie mit dem Abo unsere teils preisgekrönten Podcastserien wie "Irma. Das Kind aus Srebrenica" oder "Friedrich Merz: Sein langer Weg zur Macht" hören. Wenn Sie die ZEIT nicht nur hören, sondern auch lesen wollen, können Sie außerdem unter www.zeit.de/mehr-hoeren unser Digitalabo ebenfalls kostenlos für einen Monat testen. Wenn Sie bereits ein Abo haben, können Sie es direkt in Ihrer App mit Apple Podcasts oder Spotify verbinden und wie gewohnt weiterhören. Bei Fragen und Problemen schreiben Sie uns gerne an kontakt@zeit.de. [ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner finden Sie HIER. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts, Bonusfolgen und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Müssen wir jetzt alle zu Preppern werden?
Tausende Haushalte ohne Strom, für mehrere Tage, im tiefsten Winter: Der Brandanschlag auf die Stromversorgung in Berlin Anfang Januar hat gezeigt, wie schnell es zu Ausnahmesituationen kommen kann. Wie sind die Menschen in Deutschland auf solche Notfälle vorbereitet? Wie sieht vernünftige Vorsorge aus? Sollten wir alle zu Preppern werden – und was steckt eigentlich hinter dem Begriff? Oder ist das alles gerade etwas überbewertet? Darum geht es in der neuen Folge von "Ist das eine Blase?", dem Wirtschaftspodcast der ZEIT über Geld, Macht, Gerechtigkeit. Darin sprechen die Hosts Carla Neuhaus und Jens Tönnesmann über eine aktuelle Studie der TU Kaiserslautern-Landau (PDF), die zeigt, wie schlecht die Deutschen auf eine Katastrophe vorbereitet sind. Sei es, weil sie sich damit nicht beschäftigen wollen oder ihnen der Platz für Vorräte fehlt. Was Menschen dazu bringt, sich vorzubereiten, und welche Rolle dabei zum Beispiel das fehlende Vertrauen in den Staat spielt, auch das thematisiert diese Folge. Zu Gast ist der Kulturwissenschaftler Julian Genner, der sich in den vergangenen Jahren für sein Buch "Im Prepperkeller" intensiv mit der Prepperszene beschäftigt hat. Im Podcast berichtet er von seinen Besuchen bei Preppern und erklärt, warum Preppen kein Randphänomen mehr, sondern in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Genner erklärt auch, was Preppen von vernünftiger Vorsorge unterscheidet: Den Preppern gehe es eher egoistisch darum, "den Zusammenbruch der Gesellschaft" zu überleben, während in sinnvoller Vorsorge ein Solidaritätsgedanke stecke: Man bereitet sich vor, um im Krisenfall das System und die Einsatzkräfte zu entlasten. Kritisch sieht Genner allerdings, dass auch in der normalen Krisenvorsorge übersehen werde, wie wichtig soziale Kontakte und Beziehungen im Notfall seien. "Ich kann noch so viele Konservendosen und Survivalausrüstungen zu Hause haben", sagt Genner, mit einer Krise werde man kaum alleine fertig. "Man ist auf andere angewiesen." "Ist das eine Blase?" ist der Wirtschaftspodcast der ZEIT. Alle zwei Wochen montags diskutieren die Hosts Carla Neuhaus, Jens Tönnesmann und Zacharias Zacharakis über das, was die Welt im Innersten zusammenhält: Geld, Macht und Gerechtigkeit. [ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner finden Sie HIER. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts, Bonusfolgen und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Wann kommt die Bahn endlich wieder pünktlich?
Ihr Zug fährt ein auf Gleis acht statt zwölf. Heute leider ohne Bordbistro, dafür mit umgekehrter Wagenfolge und 120 Minuten Verspätung. Wer häufig mit der Deutschen Bahn unterwegs ist, kennt das. "Die Bahn ist zum Synonym eines dysfunktionalen Landes geworden", sagt selbst Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder. Jetzt aber soll es aufwärtsgehen. Wieder einmal, muss man sagen. Schließlich sind daran schon viele Minister und Bahnchefs gescheitert. Seit Herbst hat der Staatskonzern eine neue Chefin. Evelyn Palla hat versprochen, die Deutsche Bahn von Grund auf zu sanieren. Schon vor dem Wechsel an der Spitze aber hat das Unternehmen ein ambitioniertes Projekt gestartet. Es läuft die größte Erneuerung der Infrastruktur, von Schienen, Weichen, Stellwerken, in der Geschichte der Deutschen Bahn. Nur, wann bringt das auch eine Verbesserung für die Fahrgäste? Wann kommt die Bahn endlich wieder pünktlich? Darüber sprechen wir in der neuen Folge von "Ist das eine Blase?", dem ZEIT-Wirtschaftspodcast über Geld, Macht und Gerechtigkeit. Eingeladen haben die beiden Hosts Carla Neuhaus und Zacharias Zacharakis dieses Mal Jonas Schulze Pals, einen Kollegen aus dem ZEIT-Wirtschaftsressort, der sich so gut wie niemand anderes in der Redaktion mit der Deutschen Bahn auskennt. Er hat die neue Bahnchefin kürzlich zum Interview getroffen und sagt: "Mein Eindruck ist, dass die große Veränderung, die Evelyn Palla vorantreibt, zumindest hoffnungsvoll macht." Außerdem sei nun endlich das Geld vom Bund für die notwendigen Sanierungen vorhanden. Auch die Umbauten im Konzern, die Palla angestoßen habe, könnten bald Wirkung zeigen. "Ist das eine Blase?" ist der Wirtschaftspodcast der ZEIT. Alle zwei Wochen montags diskutieren die Hosts Carla Neuhaus, Jens Tönnesmann und Zacharias Zacharakis über das, was die Welt im Innersten zusammenhält: Geld, Macht und Gerechtigkeit. [ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner finden Sie HIER. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts, Bonusfolgen und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.

Kann man reich werden mit KI-Investments?
Milliardensummen fließen in KI-Startups, aber manche haben nicht mal ein Produkt. Der Investor Adrian Locher warnt: Da ist ganz viel Unsinn draußen unterwegs. [ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner finden Sie HIER [ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner finden Sie HIER. [ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf alle Dokupodcasts, Bonusfolgen und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.