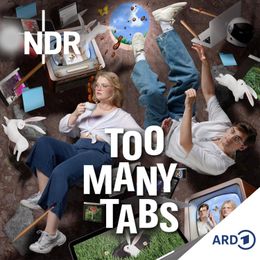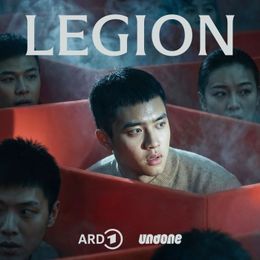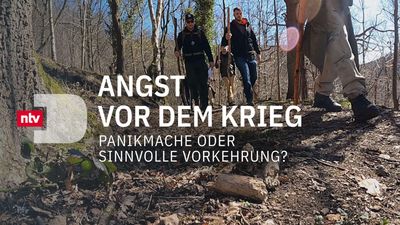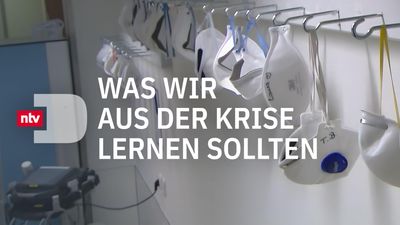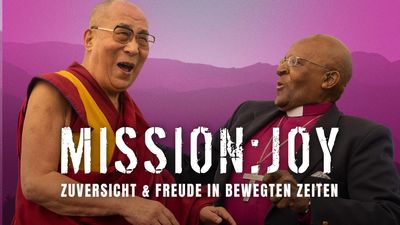Dokumentierte Vielfalt hören von Veranstaltungen der Katholischen Akademie in Bayern. Referate, Diskussionen und Gespräche zu Themen, die Kirche und Gesellschaft interessieren: Expertinnen und Experten haben das Wort.
Alle Folgen
Gespräch zum Thema 'Luctus et angor (Trauer & Angst)“: die Minus-Zeichen der Zeit deuten!'
„Gaudium et spes (Freude & Hoffnung)“, so heißt die Pastoralkonstitution, die unser Konzil vor exakt 60 Jahren erlassen hat: Was die Menschen von heute bewegt, wollte sich die Kirche zu eigen machen, endlich positiv auf die moderne Welt und ihren Fortschritt schauen und die Zeichen der Zeit im Licht des Evangeliums fruchtbar machen. Das zweite Begriffspaar, „luctus et angor (Trauer & Angst)“ hat es zwar nicht in den Titel des Textes geschafft, gehört aber als Rückseite zur Medaille dazu. Heute drückt es vielleicht sogar eher das aus, was Menschen empfinden, wenn sie auf die Welt von heute schauen: Unsere Lebensgrundlagen sind kaum noch zu retten. Die Völkergemeinschaft bricht wieder auseinander. Die Demokratie gerät unter Druck. Der Krieg ist zurück. Wie gehen wir als Christen damit um, dass die „Zeichen der Zeit“ heute überwiegend Minus-Zeichen sind? Verdrängen hilft da ebenso wenig, wie die Hoffnung einfach „thetisch“ zu behaupten. Welche tatsächlichen Anzeichen für Hoffnung lassen sich denn noch entdecken? Wie kann ich mich auch ohne konkrete Erfolgsaussichten zum Guten motivieren? Wie sind die Propheten oder andere Zeugen unserer Ur-Kunden mit Katastrophen klargekommen? Aber auch: Was brauchen meine Mitmenschen in dieser Lage von mir? Heute zu Gast: Sr. Dr. Katharina Ganz ist Franziskanerin und war zwölf Jahre lang Generaloberin ihrer Gemeinschaft. Sie hat Theologie und Sozialwesen studiert und promovierte über das pastorale Konzept ihrer Ordensgründerin Antonia Werr, in dem Verletzlichkeit (Vulnerabilität) die entscheidende Rolle spielt. Abt Dr. Johannes Eckert ist Benediktiner der Abtei Sankt Bonifaz in München und Andechs. Mit seiner reichen Vortrags- und Autorentätigkeit bereichert er die öffentliche Diskussion durch zeitgemäße Auslegungen biblischer Texte und frische Denkansätze zu Fragen des kirchlichen Lebens. Moderiert wird das Gespräch am 28.1.2026 von Akademiedirektor Dr. Achim Budde.

Gespräch zum Thema 'Ein russischer Aufruf gegen den Krieg in der Ukraine'
Ein russischer Aufruf gegen den Krieg in der Ukraine Akademiegespräch am Mittag mit Prof. Dr. Kristina Stoeckl und Dr. Johannes Oeldemann Mutig, fromm, riskant: Anfang Januar 2025 veröffentlichen ein paar Dutzend russische Geistliche und Laien anonym einen Aufruf gegen den Krieg in der Ukraine, der sie ihre Freiheit oder ihr Leben kosten könnte: Theologisch begründen sie, warum sich Patriarch Kyrill zu Unrecht auf die Bibel und die kirchliche Tradition beruft, um den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu legitimieren. Wir wollen zunächst die Aktion würdigen: Was steht in dem Text? Wie argumentiert er theologisch? Unter welchen Bedingungen mussten die Gleichgesinnten sich finden und arbeiten? Wie veröffentlichten sie ihre Botschaft und welche Risiken gingen sie damit ein? Wie organisiert und wie motiviert sich aktuell die Opposition? Manches Hintergrundwissen ist nötig, um die Situation zu bewerten: Wie wird in der orthodoxen Welt traditionell das Verhältnis von Kirche und Staat bestimmt? Und was hat die neue Lehre von der „Russischen Welt (Russkij mir)“ daraus gemacht? Schließlich interessieren uns die Perspektiven: Für die kirchliche Opposition unter Patriarch Kyrill. Für die Zivilgesellschaft unter Putin. Für den ökumenischen Dialog. Heute zu Gast: Prof. Dr. Kristina Stoeckl ist Religionssoziologin an der Freien Internationalen Universität für Soziale Studien (LUISS) in Rom und forscht intensiv über die Russische Orthodoxie und ihr Verhältnis zum Staat. Dr. Johannes Oeldemann ist Direktor am Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik, Schriftleiter der Zeitschrift „Catholica“ und profunder Kenner der Ostkirchen und ihrer Theologie insbesondere in Russland. Er hat den Aufruf ins Deutsche übersetzt. Moderiert wird das Online-Gespräch am 14.1.2026 von Akademiedirektor Dr. Achim Budde. Russischer Aufruf gegen den Krieg in der Ukraine von 2025: https://www.herder.de/stz/online/chri... Erklärung von 2022: https://publicorthodoxy.org/2022/03/1... Report von Sergej Chapnin: https://ocl.org/religious-communities... Newsletter-Anmeldung: https://kath-akademie-bayern.de/newsl...

Gespräch zum Thema 'Missbrauch aufdecken und erinnern: das Paderborner Mahnmal'
Wie kann das Monströse ins kulturelle Gedächtnis gehoben werden? So, dass es Betroffene nicht retraumatisiert, sondern aufatmen, Mut und Trost fassen lässt? So, dass die Kirche damit keine lästige Pflichtübung vollzieht, sondern ernsthaft bereut und sich auf einen unabgeschlossenen Prozess verpflichtet? So, dass es in die Gesellschaft hineinwirkt, die Tabuisierung überwindet und Passanten zur Auseinandersetzung drängt. So, dass es die verleugneten Geschichten erzählt und die brutale Wahrheit ins Gespräch bringt, ohne voyeuristisch zu werden? Das Erzbistum Paderborn gestaltet pünktlich zum Erscheinen des Missbrauchsgutachtens im Frühjahr 2026 die Brigidenkapelle im Hohen Dom zu einem Mahnmal um. Der Siegerentwurf dafür stammt von dem Münchner Künstler Christoph Brech, der hierzulande u.a. durch die Lungenflügelfenster in der Heilig-Kreuz-Kirche von sich reden machte, und der der Akademie durch Ausstellungen und die jährliche Weihnachtskarte eng verbunden ist. Das Projekt wird in engem Austausch mit dem Domkapitel, vertreten durch Generalvikar Mrgs. Dr. Michael Bredeck, und dem Betroffenenbeirat, vertreten durch seinen Vorsitzenden Reinhold Harnisch, durchgeführt. Alle drei lassen sich heute zum diesem vielschichtigen Prozess befragen. Was ist die Grundidee hinter dem Entwurf „Memory – Aufdecken und Erinnern“? Was sind seine einzelnen Elemente? Warum hat er sich durchgesetzt? Was hat der Hahn mit dem Missbrauch zu tun? Wieso ein Kinderspiel als Bezugsgröße? Was steht auf der Unterseite der Karten? Aber uns interessiert auch das methodische Vorgehen: Wie designt man einen Prozess, für den es keine Blaupause gibt? Wer hat die Ziele definiert? Wie wird ein Ausgleich gefunden, wo die Anliegen nicht deckungsgleich sind? Wann und wie wurden Betroffene einbezogen? Welche Grenzen sind gesetzt? Und was sagt eigentlich der Denkmalschutz? Mit Akademiedirektor Dr. Achim Budde diskutierten am 26.11.2025: Christoph Brech, Msgr. Dr. Michael Bredeck und Reinhold Harnisch.

Gespräch zum Thema 'Optionen der demokratischen Mehrheit'
Gehen den Demokraten im Kampf gegen die Demokratie-Verächter die Ideen aus? Und die Puste? An Vorschlägen und Rezepten mangelt es nicht. Aber sie haben alle ihre Haken. „Gut regieren“ wäre vielleicht das Wichtigste. Aber genau dies ist schwieriger geworden in einer grundständig veränderten Parteienlandschaft – und in Zeiten multipler Krisen. Und die vom rechten Rand geschürten Ressentiments ein bisschen zu bedienen, hat bislang auch nicht geholfen. „Argumentieren“ müsse man, und die Populisten inhaltlich stellen. Was aber, wenn diese sich der faktenbasierten Debatte entziehen, und stattdessen in ihrer immer größeren Blase konkurrenzfrei kommunizieren können? Auch „verbieten“ ist nicht trivial: Einmal, weil ein Verbotsverfahren scheitern könnte. Aber auch, weil ein Drittel oder Viertel der Wählerschaft ein Verbot „ihrer Partei“ als antidemokratischen Affront deuten dürfte. Sind die Verfassungsfeinde inzwischen „too big to ban“? Bleibt nur „entzaubern“? Also (mit-) regieren lassen und hoffen, dass die Anhänger bald sehr enttäuscht sein werden? Aber werden unsere demokratischen und rechtsstaatlichen Institutionen das schadlos überstehen? Für immer mehr Engagierte ist auch „resignieren“ inzwischen eine echte Option, um sich nicht bis zur Erschöpfung aufzureiben – sei es als Rückzug aus der Politik, als Auswanderung oder auch als Flucht ins Biedermeierlich-Private. Vor den drei Kommunal- und fünf Landtagswahlen des kommenden Jahres wollen wir darüber nachdenken, welche Strategie die demokratischen Kräfte verfolgen könnten, um – in allem Ringen um konträre politische Konzepte – doch gemeinsam die Vorzüge der Demokratie zu verkörpern. Zum Thema 'Optionen der demokratischen Mehrheit' diskutierten Prof. Dr. Ursula Münch und Marco Wanderwitz mit Akademiedirektor Dr. Achim Budde online am 12.11.2025.

Gespräch zum Thema 'Rennt die medizinische Innovation der Ethik davon?'
Rennt die medizinische Innovation der Ethik davon? - Akademiegespräch am Mittag mit Prof. Dr. Alena Buyx und Prof. Dr. Markus Lerch Der medizinische Fortschritt ist ein Segen. Aber er kann auch Angst und Bange machen: Weil man immer weniger davon verstehen kann. Weil es immer schneller geht. Und weil auf einem milliardenschweren Markt immer auch wirtschaftliche Interessen im Spiel sind, die mit denen der Patienten nicht deckungsgleich sind. In dieser Konstellation sind ethische Fragen vorprogrammiert. Aber bleibt im Wettlauf der Innovationen überhaupt Zeit zum Nachdenken? Wir wollen darüber reden mit Prof. Dr. Markus Lerch, der als Ärztlicher Direktor der Uniklinik der LMU und Innovationen forciert, und mit der wohl prominentesten Vertreterin der medizinischen Ethik in Deutschland, Prof. Dr. Alena Buyx. Wo eröffnen sich aktuell neue Therapiemöglichkeiten und welche Risiken sind damit verbunden? Ist in die Innovationsprozesse der großen Player eine „ethische Reflexionsschleife“ implementiert? Worauf ist zu achten, wenn Gesundheitsforschung und klinische Studien auch unternehmerische Potenziale wecken sollen? Werden neue Geschäftsmodelle, die Triebfedern des Fortschritts sind, durch Ethik ausgebremst? Welche Rolle spielen die Kirchen bei alledem? Das Gespräch mit Akademiedirektor Dr. Achim Budde fand am 29.10.2025 online statt.

Heinrich Bedford-Strohm: Laudatio auf Patriarch Bartholomäus I.
Patriarch Bartholomäus I. erhielt am 6. Juni 2025 den „Ökumenischen Preis der Katholischen Akademie“ und den „Abt-Emmanuel-Heufelder-Preis“. Die Katholische Akademie in Bayern und die Benediktinerabtei Niederaltaich haben vereinbart, im Jahr 2025 den Ökumenischen Patriarchen, Seine Heiligkeit Bartholomäus I. gleichzeitig mit dem Ökumenischen Preis der Akademie und dem Abt-Emmanuel-Heufelder-Preis der Abtei auszuzeichnen. Der Ökumenische Patriarch von Konstantinopel ist das Ehrenoberhaupt der Orthodoxen Kirchen weltweit, deren synodale Zusammenarbeit er koordiniert. Rechtlich unterstellt sind ihm neben seiner Ortskirche in der Türkei auch der Athos und die griechischen Diasporakirchen. Die Auszeichnungen wurden unter Anwesenheit des Preisträgers in einer Zeremonie in der Katholischen Akademie in Bayern verliehen. Der Laudator der Preisverleihung war der Vorsitzende des Zentralausschusses des „Ökumenischen Rates der Kirchen“ (ÖRK), Herr Landesbischof em. Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm. Kardinal Reinhard Marx trug traditionell das Schlusswort zu der Zeremonie bei. In der Preisbegründung heißt es u.a. „Bartholomäus I. zählt innerhalb der Orthodoxie zu den engagiertesten Verfechtern einer echten ökumenischen Zusammenarbeit. Antiwestliche oder antiökumenische Ressentiments sind ihm fremd. Eine solche Präsenz der Orthodoxie in der Welt-Ökumene bereichert auch die innerwestliche Ökumene“ sowie „Patriarch Bartholomäus pflegt beste Beziehungen zu Papst Franziskus, die in mehreren Begegnungen und gemeinsamen Verlautbarungen ihren Ausdruck fanden“. Er werde auch als der „grüne Patriarch“ bezeichnet, was eine weitere Parallele zu Papst Franziskus darstelle.

Patriarch Bartholomäus I.: Dankesrede bei der Verleihung des „Ökumenischen Preises 2025"
Patriarch Bartholomäus I. erhielt am 6. Juni 2025 den „Ökumenischen Preis der Katholischen Akademie“ und den „Abt-Emmanuel-Heufelder-Preis“. Die Katholische Akademie in Bayern und die Benediktinerabtei Niederaltaich haben vereinbart, im Jahr 2025 den Ökumenischen Patriarchen, Seine Heiligkeit Bartholomäus I. gleichzeitig mit dem Ökumenischen Preis der Akademie und dem Abt-Emmanuel-Heufelder-Preis der Abtei auszuzeichnen. Der Ökumenische Patriarch von Konstantinopel ist das Ehrenoberhaupt der Orthodoxen Kirchen weltweit, deren synodale Zusammenarbeit er koordiniert. Rechtlich unterstellt sind ihm neben seiner Ortskirche in der Türkei auch der Athos und die griechischen Diasporakirchen. Die Auszeichnungen wurden unter Anwesenheit des Preisträgers in einer Zeremonie in der Katholischen Akademie in Bayern verliehen. Der Laudator der Preisverleihung war der Vorsitzende des Zentralausschusses des „Ökumenischen Rates der Kirchen“ (ÖRK), Herr Landesbischof em. Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm. Kardinal Reinhard Marx trug traditionell das Schlusswort zu der Zeremonie bei. In der Preisbegründung heißt es u.a. „Bartholomäus I. zählt innerhalb der Orthodoxie zu den engagiertesten Verfechtern einer echten ökumenischen Zusammenarbeit. Antiwestliche oder antiökumenische Ressentiments sind ihm fremd. Eine solche Präsenz der Orthodoxie in der Welt-Ökumene bereichert auch die innerwestliche Ökumene“ sowie „Patriarch Bartholomäus pflegt beste Beziehungen zu Papst Franziskus, die in mehreren Begegnungen und gemeinsamen Verlautbarungen ihren Ausdruck fanden“. Er werde auch als der „grüne Patriarch“ bezeichnet, was eine weitere Parallele zu Papst Franziskus darstelle.

Gespräch zum Thema 'Kult & Welt – über die gesellschaftliche „Außenwirkung“ der Eucharistie'
Der christliche Kult will nach außen wirken. Er gehört in die Öffentlichkeit und entfaltet eine heilsame gesellschaftspolitische Ausstrahlung. Deshalb hat er Bedeutung für alle. Mit seinem Buch „KULT“ hat Kardinal Reinhard Marx eine beachtliche Resonanz ausgelöst und die öffentliche Debatte um die Kirche befeuert. Er sieht aktuelle Leitbegriffe wie Freiheit, Zusammenhalt, Menschenwürde, Frieden und Versöhnung fest im christlichen Gottesdienst verankert und benennt sehr konkrete sozialpolitische Implikationen mit echter Relevanz für das Leben aller Menschen: Ein so verstandener Kult ist politisch! Zugleich liefert Marx eine schonungslose Analyse der innerkirchlichen Hindernisse, die dieser Außenwirkung im Wege stehen: Fundamentalismus und Ablehnung der Moderne. Rückzug in die Blase. Mängel in der organisatorischen Gestalt der Kirche und in der Ästhetik ihrer Feiern. Zu enge Zulassungskriterien zum kirchlichen Amt. Zu wenig liturgische Bildung. Angst vor der inneren Vielfalt. Wir wollen im Gespräch zentrale Aspekte seiner Kernthese vertiefen und auch nachbohren, was für die Gestalt der Kirche und ihrer Liturgie konkret daraus folgt. Kardinal Reinhard Marx stellt sich online am 22.10.2025 eine Stunde lang den Fragen von Akademiedirektor Dr. Achim Budde und der Zuhörerschaft im Mittagsgespräch der Katholischen Akademie in Bayern.

Gespräch zum Thema 'KI-Chip im Hirn - Transhumanistische Träume für unser Beziehungsorgan'
Die Verschmelzung von Mensch und Maschine ist in der Medizin bereits in vollem Gang: Implantierte Computer-Chips überwinden Taubheit, Lähmung oder Parkinson, teils durch gedankliche Impulse. Entwickeln wir uns zu Cyborgs? Großes Aufsehen – von quasi-religiöser Hoffnung bis hin zu tiefsitzenden Ängsten – erregt die Vision, bereits in wenigen Jahren unser Gehirn durch KI-Chips mit dem Internet und dem Wissen der Welt zu verbinden. Das wirft große Fragen auf: Ist eine solche Entgrenzung des menschlichen Geistes wirklich vorstellbar und biologisch möglich? Bettet sie sich in das uns bekannte Verschmelzen mit Werkzeugen – mit dem Handy oder auch mit einer Geige – ein? Kann das Bewusstsein dann noch unterscheiden, ob sein verfügbares Wissen aus eigener Lernerfahrung oder aus dem Web stammt? Welche Chancen und welche Gefahren sind mit der Entwicklung verbunden? Welche Gerechtigkeitsfragen wirft sie auf? Wird durch den Brain-Booster für Reiche ein Teil der Menschheit noch weiter abgehängt? Oder sind die Gechipten dann nur noch Handlanger der KI? Für diese Klärungen haben wir Prof. Dr. Thomas Fuchs zu Gast, der wie kein anderer das Gehirn als ein dem ganzen Menschen zugeordnetes und für (Außen-) Beziehungen zuständiges Organ versteht. Auf dieser Basis bettet er die Erkenntnisse der Neurologie und auch die neuen medizinischen Möglichkeiten in ein ganzheitliches Bild des Menschen in seiner körperlichen Verfasstheit ein. Auch Prof. Dr. Georg Gasser aus Augsburg hat als Philosoph an der Theologischen Fakultät einen geeigneten Referenzrahmen, um die transhumanistischen Träume einer Bewertung aus christlicher Sicht zu unterziehen. Prof. Dr. Thomas Fuchs und Prof. Dr. Georg Gasser diskutierten online mit Akademiedirektor Dr. Achim Budde am 15.10.2025.

Markus Vogt: Ambivalenzen der Macht – Überlegungen aus sozialethischer Sicht
Romano Guardini veröffentlichte 1951 unter dem Titel „Die Macht – Versuch einer Wegweisung“ eine Denkschrift, die auffällig viele Bezüge zu unserer Gegenwart aufweist – in Europa und weltweit. Bisher für stabil gehaltene soziale Systeme scheinen plötzlich zu erodieren. Autokraten bemächtigen sich immer häufiger offener Zivilgesellschaften. Aber auch die Mächtigen fühlen sich zunehmend vereinnahmt von ihrer eigenen Machtfülle. „Die Familie verliert ihre gliedernde und ordnende Funktion“, resümiert Guardini, „die neuen Städte gleichen einander immer mehr, ob sie nun in Europa oder in China, in Nordamerika, Russland oder Südamerika entstehen.“ Von dieser Nivellierung ausgehend bildet sich ein neuer Typus Mensch heraus, „der aus dem Augenblick lebt, einen beängstigenden Charakter beliebiger Vertretbarkeit bekommt und dem Zugriff der Macht bereitsteht.“ Die Rückbesinnung auf die transzendente Dimension kann eine Wegweisung sein. Die Beziehung zu Gott öffnet dem Menschen einen Freiraum, der ihn vor dem Zugriff der Macht wappnen kann. Guardini bleibt in der Kritik an den Verhältnissen nicht stehen. Es geht ihm um die Aufgabe, die Macht so einzuordnen, dass der Mensch in ihrem Gebrauch als Mensch bestehen kann und nicht restlos Machtmechanismen ausgesetzt ist oder ihnen gar verfällt. Prof. Dr. Markus Vogt, Professor für Christliche Sozialethik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, referiert zu dem Thema Ambivalenzen der Macht – Überlegungen aus sozialethischer Sicht.

Michael Seewald: Menschlichkeit und Machtgefahr - Überlegungen zu Begriffen Romano Guardinis
Romano Guardini veröffentlichte 1951 unter dem Titel „Die Macht – Versuch einer Wegweisung“ eine Denkschrift, die auffällig viele Bezüge zu unserer Gegenwart aufweist – in Europa und weltweit. Bisher für stabil gehaltene soziale Systeme scheinen plötzlich zu erodieren. Autokraten bemächtigen sich immer häufiger offener Zivilgesellschaften. Aber auch die Mächtigen fühlen sich zunehmend vereinnahmt von ihrer eigenen Machtfülle. „Die Familie verliert ihre gliedernde und ordnende Funktion“, resümiert Guardini, „die neuen Städte gleichen einander immer mehr, ob sie nun in Europa oder in China, in Nordamerika, Russland oder Südamerika entstehen.“ Von dieser Nivellierung ausgehend bildet sich ein neuer Typus Mensch heraus, „der aus dem Augenblick lebt, einen beängstigenden Charakter beliebiger Vertretbarkeit bekommt und dem Zugriff der Macht bereitsteht.“ Die Rückbesinnung auf die transzendente Dimension kann eine Wegweisung sein. Die Beziehung zu Gott öffnet dem Menschen einen Freiraum, der ihn vor dem Zugriff der Macht wappnen kann. Guardini bleibt in der Kritik an den Verhältnissen nicht stehen. Es geht ihm um die Aufgabe, die Macht so einzuordnen, dass der Mensch in ihrem Gebrauch als Mensch bestehen kann und nicht restlos Machtmechanismen ausgesetzt ist oder ihnen gar verfällt. Prof. Dr. Michael Seewald, Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte an der Universität Münster, stellt seine Überlegungen zu zwei Begriffen Romano Guardinis vor.

Jean Greisch: Romano Guardinis Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Macht
Romano Guardini veröffentlichte 1951 unter dem Titel „Die Macht – Versuch einer Wegweisung“ eine Denkschrift, die auffällig viele Bezüge zu unserer Gegenwart aufweist – in Europa und weltweit. Bisher für stabil gehaltene soziale Systeme scheinen plötzlich zu erodieren. Autokraten bemächtigen sich immer häufiger offener Zivilgesellschaften. Aber auch die Mächtigen fühlen sich zunehmend vereinnahmt von ihrer eigenen Machtfülle. „Die Familie verliert ihre gliedernde und ordnende Funktion“, resümiert Guardini, „die neuen Städte gleichen einander immer mehr, ob sie nun in Europa oder in China, in Nordamerika, Russland oder Südamerika entstehen.“ Von dieser Nivellierung ausgehend bildet sich ein neuer Typus Mensch heraus, „der aus dem Augenblick lebt, einen beängstigenden Charakter beliebiger Vertretbarkeit bekommt und dem Zugriff der Macht bereitsteht.“ Die Rückbesinnung auf die transzendente Dimension kann eine Wegweisung sein. Die Beziehung zu Gott öffnet dem Menschen einen Freiraum, der ihn vor dem Zugriff der Macht wappnen kann. Guardini bleibt in der Kritik an den Verhältnissen nicht stehen. Es geht ihm um die Aufgabe, die Macht so einzuordnen, dass der Mensch in ihrem Gebrauch als Mensch bestehen kann und nicht restlos Machtmechanismen ausgesetzt ist oder ihnen gar verfällt. Prof. Dr. Jean Greisch, Professor em. für Philosophie und ehemaliger Inhaber der Guardini-Professur für Religionsphilosophie und Katholische Weltanschauung an der Humboldt-Universität zu Berlin, gilt als einer der besten Kenner Romano Guardinis. Prof. Dr. Jean Greisch referierte zum Thema 'Romano Guardinis Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Macht' bei der Guardini-Tagung 30.1.-1.2.2020.

Thomas M. Schmidt: Jürgen Habermas und die Religion
Am 14. Januar 2020 haben wir uns in der Katholischen Akademie in Bayern darum bemüht, das Denken von Jürgen Habermas zu ergründen. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie sich Glauben und Wissen zueinander verhalten. Die Akademie knüpfte damit an das berühmte Gespräch des Philosophen mit Kardinal Joseph Ratzinger in der Akademie an, als Habermas und der nachmalige Papst Benedikt XVI. das schwierige Verhältnis von Vernunft und Religion vor einem kleinen Kreis von Geladenen diskutierten. Der Habermas-Schüler Thomas M. Schmidt, Professor für Religionsphilosophie an der Goethe-Universität Frankfurt, den wir als Referenten gewinnen konnten, gilt als einer der besten Kenner des Habermas-Kosmos. Die Diskussion moderierte Dominik Fröhlich, Katholische Akademie in Bayern.

John Arnold: Der Erzbischof von Canterbury in der DDR
Für besonderes Engagement in der Ökumene der katholischen Kirche mit den Kirchen der Reformation wurde 2001 der „Ökumenische Preis der Katholischen Akademie“ an Stephen Sykes und John Arnold vergeben. Letzterer berichtete in seiner Ökumenepreis-Rede von einer weitgehend unbekannten Episode aus der Zeit der deutschen Teilung, dem Besuch des Erzbischofs von Canterbury, Michael Ramsey, in der DDR. Arnold begleitete 1974 den Erzbischof auf seiner Reise. Sein persönlicher Blick als Zeitzeuge dieses Ereignisses aus den siebziger Jahren im Osten Deutschlands ist gleichermaßen spannend wie berührend: John Arnold berichtet als Zeitzeuge von den Verhältnissen in der DDR und wie die anglikanischen Gäste aus dem Vereinigten Königreich damit umgingen. Dr. John Arnold, geb. 1933 in London, ist Träger des „Most Excellent Order of the British Empire“ OBE. Er studierte Französisch, Deutsch, Russisch und Theologie, wirkte nach einer wissenschaftlichen Tätigkeit als Dean of Rochester und Dean of Durham. Im Rahmen seiner diplomatischen Aufgaben begleitete er The Most Reverend and Right Honourable Michael Ramsey, Archbishop of Canterbury 1961 – 1974, bei seinem Besuch in der DDR.

Gespräch zum Thema 'Geld, Strukturen, Macht: das „Unternehmen Kirche“ im Umbau'
Zum Thema 'Geld, Strukturen, Macht: das „Unternehmen Kirche“ im Umbau' diskutierten online Thomas von Mitschke-Collande und Christian Gärtner am 8.10.2025 mit Akademiedirektor Dr. Achim Budde. Das reiche kirchliche Leben muss mit immer weniger Geld auskommen. Wo sparen? Nach welchen Kriterien? In welchen Strukturen? Und wer entscheidet? Für einen klugen Plan, muss ein tiefes Verständnis für Wesen und Mission der Kirche auf Professionalität im Umgang mit unternehmerischen Ressourcen treffen. Christian Gärtner, der neue Vorsitzende des Landeskomitees, bringt seinen beruflichen Blick als Volkswirt und Marktforscher mit in sein Ehrenamt als höchster Repräsentant der katholischen Laiinnen und Laien in Bayern. Er kennt Organisation und Verwaltung der Kirche von innen, und um kluger Entscheidungen willen ist er ein Freund echter Mitbestimmung. Dr. Thomas von Mitschke-Collande war als Unternehmensberater u.a. für Bistümer und die DBK tätig. 2012 machte er mit einer schonungslosen Analyse der kirchlichen Lage von sich reden, deren Befürchtungen sich seitdem teils bestätigten, teils aber auch von der Wirklichkeit noch übertroffen wurden. Bei diesem Mittagsgespräch soll der Frage nachgegangen werden, wie die Kirche trotz der unumgänglichen Einsparungen ihren Auftrag erfüllen und ein verlässlicher Partner für die Gläubigen sowie für die haupt- und ehrenamtlich Engagierten bleiben kann.

Gespräch zum Thema 'Biodiversität & Schöpfungsspiritualität'
„Biodiversität“ – klingt sperrig, entscheidet aber über Leben und Tod der Menschheit. „Schöpfungsspiritualität“ – klingt fromm, könnte aber helfen, die Kurve zu kriegen: wenn immer mehr Menschen die Verbundenheit aller Geschöpfe spüren und zu einem Leitmotiv ihres eigenen Lebensweges machen. Vier Pilgerwege durch artenreiche Naturlandschaften im Werdenfelser Land vermitteln erstaunliches Naturwissen und sind zugleich spiritueller Proviant für den eigenen geistig-geistlichen Weg. Konzipiert hat diese Routen Benjamin Schwarz, der Geschäftsführer des Katholischen Bildungswerks in Garmisch-Partenkirchen, das dort seit Jahren geführte Wanderungen erfolgreich anbietet. Er und der BR-Journalist Wolfgang Küpper, der sich im Ruhestand als 2. Vorsitzender des „KBW-GAP“ engagiert, sprachen am 24.9.2025 mit Direktor Dr. Achim Budde über theologische Grundlagen und praktische Erfahrungen, über Quellen der Hoffnung angesichts der drohenden Katastrophe, über Gesellschaft und Politik, über Gerechtigkeit und Bewusstseinsbildung, über Bildungsarbeit und das Genießen der Natur – und natürlich über das Wunder der Artenvielfalt, das einen um so mehr in Erstaunen versetzt, je mehr man darüber erfährt.

Gespräch zum Thema 'Die Dritte Gewalt in Gefahr'
Wo immer weltweit Demokratien ins Autokratische kippen, steht (neben der Bildung) die Justiz zuerst im Visier. Deshalb wurde unser Grundgesetz vor der Bundestagswahl noch einmal nachgerüstet, bevor die Zweidrittel-Mehrheit für solche Operationen verlorenging. Wird das reichen? Wo sind die Schwachstellen, an denen eine Demontage weiterhin ansetzen kann? Welche Strategien lassen sich aus den Erfahrungen in anderen Staaten ableiten? Was können wir als Kirchen und Christ:innen tun? Welche Instrumente zur Bekämpfung ihrer Feinde kann unsere „wehrhafte Demokratie“ einsetzen? Zu diesen Fragen ruft Dr. Achim Budde die Expertise von zwei Hochkarätern ab: Dr. Hans-Joachim Heßler ist Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs und des Oberlandesgerichts München. Als höchster Repräsentant der Dritten Staatsgewalt in Bayern träg er Verantwortung für den Rechtsstaat. Frau Prof. Dr. Angelika Nußberger ist Ordinaria für Verfassungsrecht, Völkerrecht und Rechtsvergleichung an der Universität Köln. Von 2011 bis 2020 war sie Richterin, von 2017 bis 2019 Vizepräsidentin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). Am 10.12.2024 erhielt sie den Romano-Guardini-Preis der Katholischen Akademie in Bayern.

Jürgen Bründl: Was heißt heute „Gott handelt“?
Mit der Veranstaltung „(Wie) handelt Gott?“ am 3. Dezember 2016 versuchte die Katholische Akademie Bayern den beiden im Titel verwobenen Fragen näherzukommen und Nachdenklichkeit zu erzielen. Denn zum christlichen Glauben gehört ja die feste Überzeugung, dass Gott nicht nur am Anfang der Welt als Schöpfer tätig war, sondern auch in der Welt handelt. Jedes Gebet, jeder Gottesdienst ist durchdrungen von der Annahme, dass sich Gott den Menschen zuwendet. Wer biblisch-christlich glaubt, ist überzeugt: Gott handelt in und an der Welt. Deckt sich diese gläubige Grundannahme mit der alltäglichen Erfahrung unseres Lebens? Denn unsere Erfahrung scheint allzu oft eine gegensätzliche zu sein - wir erleiden die Abwesenheit, das Schweigen Gottes. Wie kann man also ernsthaft von einem Handeln Gottes sprechen? Theologisch formuliert: Was hat „Offenbarung“ mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun? Prof. Dr. Jürgen Bründl ist Professor für Fundamentaltheologie und Dogmatik an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg.

Thomas Söding: Das Handeln Gottes in der Bibel - Strukturen und Kategorien
Mit der Veranstaltung „(Wie) handelt Gott?“ am 3. Dezember 2016 versuchte die Katholische Akademie Bayern den beiden im Titel verwobenen Fragen näherzukommen und Nachdenklichkeit zu erzielen. Denn zum christlichen Glauben gehört ja die feste Überzeugung, dass Gott nicht nur am Anfang der Welt als Schöpfer tätig war, sondern auch in der Welt handelt. Jedes Gebet, jeder Gottesdienst ist durchdrungen von der Annahme, dass sich Gott den Menschen zuwendet. Wer biblisch-christlich glaubt, ist überzeugt: Gott handelt in und an der Welt. Deckt sich diese gläubige Grundannahme mit der alltäglichen Erfahrung unseres Lebens? Denn unsere Erfahrung scheint allzu oft eine gegensätzliche zu sein - wir erleiden die Abwesenheit, das Schweigen Gottes. Wie kann man also ernsthaft von einem Handeln Gottes sprechen? Theologisch formuliert: Was hat „Offenbarung“ mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun? Prof. Dr. Thomas Söding ist Professor für neutestamentliche Exegese und Theologie an der Ruhr-Universität Bochum.

Udo Schnelle: Die Kreuzestheologie des Paulus
Paulus ist ein sperriger Autor (und auch eine sperrige Person...). Seine Briefe sind zumeist Gelegenheitsschreiben, anlassbezogen und somit tief verwurzelt in der Geschichte des frühen Christentums. Unsere Welt ist zwar anders geworden, aber die Probleme und Fragestellungen der frühchristlichen Gemeinden klingen häufig doch recht aktuell. Auf der anderen Seite erreicht die zweite Ebene seiner Briefe, nämlich die kreative und existentiell tief gehende Theologie, ein Abstraktionsniveau, das höchsten intellektuellen Ansprüchen genügt. Dadurch wird er allerdings nicht leichter verständlich. Bei den Biblischen Tagen, 21. bis 23. März 2016, zum ersten Korintherbrief referierte Prof. Dr. Udo Schnelle über die Kreuzestheologie des Paulus.

Hans-Georg Gradl: Stadt und Gemeinde von Korinth
Paulus ist ein sperriger Autor (und auch eine sperrige Person...). Seine Briefe sind zumeist Gelegenheitsschreiben, anlassbezogen und somit tief verwurzelt in der Geschichte des frühen Christentums. Unsere Welt ist zwar anders geworden, aber die Probleme und Fragestellungen der frühchristlichen Gemeinden klingen häufig doch recht aktuell. Auf der anderen Seite erreicht die zweite Ebene seiner Briefe, nämlich die kreative und existentiell tief gehende Theologie, ein Abstraktionsniveau, das höchsten intellektuellen Ansprüchen genügt. Dadurch wird er allerdings nicht leichter verständlich. Bei den Biblischen Tagen, 21. bis 23. März 2016, zum ersten Korintherbrief referierte Prof. Dr. Hans-Georg Gradl zum Thema 'Stadt und Gemeinde von Korinth'.

Marlis Gielen: Paulus – vier Spotlights auf eine vielschichtige Persönlichkeit
Paulus ist ein sperriger Autor (und auch eine sperrige Person...). Seine Briefe sind zumeist Gelegenheitsschreiben, anlassbezogen und somit tief verwurzelt in der Geschichte des frühen Christentums. Unsere Welt ist zwar anders geworden, aber die Probleme und Fragestellungen der frühchristlichen Gemeinden klingen häufig doch recht aktuell. Auf der anderen Seite erreicht die zweite Ebene seiner Briefe, nämlich die kreative und existentiell tief gehende Theologie, ein Abstraktionsniveau, das höchsten intellektuellen Ansprüchen genügt. Dadurch wird er allerdings nicht leichter verständlich. Bei den Biblischen Tagen, 21. bis 23. März 2016, zum ersten Korintherbrief referierte Prof. Dr. Marlis Gielen zum Thema: Paulus – vier Spotlights auf eine vielschichtige Persönlichkeit.

Reinhard Stauber: Wege durch Italien im 18. Jahrhundert
Die Reise nach Italien war in der Frühen Neuzeit wichtiger Bestandteil der Erziehung deutscher Adeliger. Sie sollte erworbenes Wissen demonstrieren, adelige Manieren verfeinern und politische Beziehungen stärken oder neu knüpfen. Und natürlich gehörte auch die Besichtigung bedeutender Stätten der Kunst und Kultur dazu. So brach auch Karl Albrecht, Sohn des bayerischen Kurfürsten Max II. Emanuel und nachmaliger Kaiser Karl VII., am 3. Dezember 1715 zu einer Reise auf, die ihn von München über Salzburg und Innsbruck, über Venedig und Loreto nach Rom und Neapel führen sollte. Dabei waren Papstaudienzen, Besuche bei Kardinälen und dem jeweiligen Stadtadel Höhepunkte dieses Unternehmens. Beim sechsten Karl Graf Spreti Symposium, das vom 30.6.-2.7.2016 in der Katholischen Akademie in Bayern abgehalten wurde, fanden Aspekte dieser Reise nähere Beleuchtung und wurden in einen größeren historischen Kontext gestellt. Die Reise nach Italien war in der Frühen Neuzeit wichtiger Bestandteil der Erziehung deutscher Adeliger. Sie sollte erworbenes Wissen demonstrieren, adelige Manieren verfeinern und politische Beziehungen stärken oder neu knüpfen. Und natürlich gehörte auch die Besichtigung bedeutender Stätten der Kunst und Kultur dazu. So brach auch Karl Albrecht, Sohn des bayerischen Kurfürsten Max II. Emanuel und nachmaliger Kaiser Karl VII., am 3. Dezember 1715 zu einer Reise auf, die ihn von München über Salzburg und Innsbruck, über Venedig und Loreto nach Rom und Neapel führen sollte. Dabei waren Papstaudienzen, Besuche bei Kardinälen und dem jeweiligen Stadtadel Höhepunkte dieses Unternehmens. Das sechste Karl Graf Spreti Symposium wird Aspekte dieser Reise näher beleuchten und in einen größeren historischen Kontext stellen. Zum Thema "Amphitheater oder Papstmesse? Wege durch Italien im 18. Jahrhundert" referiert Prof. Dr. Reinhard Stauber, Professor für Neuere und Österreichische Geschichte, Universität Klagenfurt.

Carola Finkel: Barocke Tanzkultur im Kontext von Karl Albrechts Italienreise
Die Reise nach Italien war in der Frühen Neuzeit wichtiger Bestandteil der Erziehung deutscher Adeliger. Sie sollte erworbenes Wissen demonstrieren, adelige Manieren verfeinern und politische Beziehungen stärken oder neu knüpfen. Und natürlich gehörte auch die Besichtigung bedeutender Stätten der Kunst und Kultur dazu. So brach auch Karl Albrecht, Sohn des bayerischen Kurfürsten Max II. Emanuel und nachmaliger Kaiser Karl VII., am 3. Dezember 1715 zu einer Reise auf, die ihn von München über Salzburg und Innsbruck, über Venedig und Loreto nach Rom und Neapel führen sollte. Dabei waren Papstaudienzen, Besuche bei Kardinälen und dem jeweiligen Stadtadel Höhepunkte dieses Unternehmens. Beim sechsten Karl Graf Spreti Symposium, das vom 30.6.-2.7.2016 in der Katholischen Akademie in Bayern abgehalten wurde, fanden Aspekte dieser Reise nähere Beleuchtung und wurden in einen größeren historischen Kontext gestellt. Unter dem Titel: "'gegen abend aber vor Seiner Durchlaucht in dem palast ein adel voller bal gehalten worden - Barocke Tanzkultur im Kontext von Karl Albrechts Italienreise" referiert Dr. Carola Finkel, Dozentin für Musikwissenschaft an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main.

Andrea Zedler: Musik und Politik während Karl Albrechts Aufenthalt in Venedig
Die Reise nach Italien war in der Frühen Neuzeit wichtiger Bestandteil der Erziehung deutscher Adeliger. Sie sollte erworbenes Wissen demonstrieren, adelige Manieren verfeinern und politische Beziehungen stärken oder neu knüpfen. Und natürlich gehörte auch die Besichtigung bedeutender Stätten der Kunst und Kultur dazu. So brach auch Karl Albrecht, Sohn des bayerischen Kurfürsten Max II. Emanuel und nachmaliger Kaiser Karl VII., am 3. Dezember 1715 zu einer Reise auf, die ihn von München über Salzburg und Innsbruck, über Venedig und Loreto nach Rom und Neapel führen sollte. Dabei waren Papstaudienzen, Besuche bei Kardinälen und dem jeweiligen Stadtadel Höhepunkte dieses Unternehmens. Zum Thema: "Nach dem Krieg ist vor dem Krieg: Musik und Politik während Karl Albrechts Aufenthalt in Venedig" referiert Mag. Andrea Zedler M.A., Wiss. Mitarbeiterin am Lehrstuhl für bayerische Landesgeschichte, Universität Regensburg, beim sechsten Karl Graf Spreti Symposium, 30.6.-2.7.2016, in der Katholischen Akademie in Bayern.

Jörg Zedler: Konfliktlinien während Karl Albrechts Aufenthalt in Rom 1716
Die Reise nach Italien war in der Frühen Neuzeit wichtiger Bestandteil der Erziehung deutscher Adeliger. Sie sollte erworbenes Wissen demonstrieren, adelige Manieren verfeinern und politische Beziehungen stärken oder neu knüpfen. Und natürlich gehörte auch die Besichtigung bedeutender Stätten der Kunst und Kultur dazu. So brach auch Karl Albrecht, Sohn des bayerischen Kurfürsten Max II. Emanuel und nachmaliger Kaiser Karl VII., am 3. Dezember 1715 zu einer Reise auf, die ihn von München über Salzburg und Innsbruck, über Venedig und Loreto nach Rom und Neapel führen sollte. Dabei waren Papstaudienzen, Besuche bei Kardinälen und dem jeweiligen Stadtadel Höhepunkte dieses Unternehmens. Beim sechsten Karl Graf Spreti Symposium, das vom 30.6.-2.7.2016 in der Katholischen Akademie in Bayern abgehalten wurde, fanden Aspekte dieser Reise nähere Beleuchtung und wurden in einen größeren historischen Kontext gestellt. Zum Thema "Zeremoniell und politisches Kalkül: Konfliktlinien während Karl Albrechts Aufenthalt in Rom 1716" referierte Jörg Zedler, der zu diesem Zeitpunkt als Wiss. Assistent am Lehrstuhl für bayerische Landesgeschichte an der Universität Regensburg tätig war. Gegenwärtig ist Prof. Dr. Jörg Zedler Vertreter der Professur für Neuere und Neueste Geschichte, LMU München.

Armin Nassehi: Die Zukunft der Gesellschaft
Rund 150 Menschen nahmen an den Philosophischen Tagen 2016 der Katholischen Akademie Bayern statt. Das Thema der drei Tage vom 6. bis zum 8. Oktober war nichts weniger als die "Zukunft". Versehen mit dem Untertitel "Welchen Fragen stellt sich die Philosophie?" ging die Veranstaltung unter Leitung von Prof. Dr. Dr. Winfried Löffler, Professor am Institut für Christliche Philosophie der Universität Innsbruck, das weitgespannte Thema an. Das geschah zu Beginn unter anderem mit Hilfe von Experten verschiedener Wissenschaftsgebiete, die der Philosophie helfend zur Seite standen. Am Freitagvormittag sprachen der Astrophysiker Josef M.Gaßner über die wohl sehr zerstörerische Zukunft des Kosmos und der Klimaforscher Ottmar Edenhofer über die Zukunft der Menschen auf der Erde, die immerhin noch möglich ist. Nachmittags referierte der Soziologe Armin Nassehi über die Gesellschaft, deren Zukunft sehr unterschiedlich sein kann. Am Abend sahen die Teilnehmer dann die Zukunft leibhaftig: Die Technische Universität München hatte in ihr "Robotor-Laboratorium" in der Barer Straße eingeladen und die Ingenieure dort zeigten die Prototypen zukünftiger Roboter-Generationen. Am Samstag dann berichtete die Historikerin Elke Seefried über die Vergangenheit, die Geschichte der Zukunftsforschung seit 1945. Und den Abschluss bildete schließlich der Blick auf die Zukunft schlechthin: die Ewigkeit. Thomas Schärtl-Trendel, Philosoph und Theologe, stellte die Frage, ob Gott denn auf uns zukomme? Prof. Dr. Armin Nassehi referierte über das Thema "Die Zukunft der Gesellschaft" bei den Philosophischen Tagen, 6. - 8.10.2016, in der Katholischen Akademie in Bayern.

Gespräch zum Thema 'Transformation der Landnutzung - Zukunftsverantwortung für Gesellschaft, Politik & Land-Wirtschaft'
Dr. Achim Budde, Ely Eibisch, Prof. Dr. Anna Henkel, Dr. Jörg Lüer, Prof. em. Dr. Peter Strohschneider, Prof. Dr. Dr. Johannes Wallacher diskutieren über Zukunftsverantwortung für Gesellschaft, Politik und Landwirtschaft. Die Landnutzung hat sich weltweit, aber auch bei uns in den vergangenen Jahrzehnten schneller und einschneidender verändert als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Dies führt zu zunehmenden Nutzungskonkurrenzen um knappe Böden, was die Landwirtschaft national und international vor gewaltige Herausforderungen stellt: Sie soll einer wachsenden Bevölkerung gesunde Lebensmittel liefern, den Klimawandel eindämmen, zur Energiewende beitragen, Biodiversität schützen und zugleich wirtschaftlich tragfähig bleiben, eine Herkulesaufgabe, die nur im Zusammenwirken der gesamten Gesellschaft gelöst werden kann. Unser Podiumsgespräch brachte Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Praxis und Verbänden zusammen, um unterschiedliche Sichtweisen und Perspektiven einzubeziehen. Sie führten eine fundierte und zugleich lösungsorientierte Diskussion, die sowohl für Entscheidungsträger als auch für Landwirte und interessierte Bürgerinnen und Bürger wertvolle Erkenntnisse lieferte. Die Katholische Akademie in Bayern ist eine selbstständige kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts. Die bayerischen Bischöfe haben die Akademie 1957 als unabhängige Denkwerkstatt gegründet und finanzieren sie bis heute, ohne auf ihre Arbeit Einfluss zu nehmen. Mit ihrer Satzung erhielt sie den Auftrag, „die Beziehungen zwischen Kirche und Welt zu klären und zu fördern“. Unser Themenspektrum umfasst Religion und Politik, Naturwissenschaft und Technik, Geschichte und Philosophie, Kunst und Kultur.

Gespräch zum Thema 'Auswirkungen der Zoll- und Wirtschaftspolitik unter Donald Trump'
Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit im Januar 2025 verfolgt Präsident Donald Trump eine radikale Neuausrichtung der US-Zoll- und Wirtschaftspolitik. Unter dem Motto „America First“ wurden z.T. drastische Importzölle eingeführt, die zu wachsenden Spannungen mit den Handelspartnern (insb. China) führten. Während Trump betont, dass seine Politik die US-Industrie schützen und Arbeitsplätze sichern soll, zeigen die bisherigen Entwicklungen vor allem eine Verunsicherung bei Unternehmen und an den Börsen. Die langfristigen Folgen dieser protektionistischen Ausrichtung bleiben abzuwarten, doch die bisherigen Indikatoren deuten auf negative Konsequenzen für die US-Wirtschaft (das US-BSP schrumpfte im ersten Quartal 2025 um 0,3 %, und die Verbraucherpreise stiegen spürbar an) und die Weltwirtschaft hin. Professor Goldschmidt wird die Zoll- und Wirtschaftspolitik Trumps aus volkswirtschaftlicher Sicht einordnen und die nationalen und globalen Konsequenzen analysieren. mit: Dr. Martin Dabrowski, Prof. Dr. Nils Goldschmidt

Gespräch zum Thema 'Rohstoffe für die Energiewende - Lieferketten, Abhängigkeiten und Verantwortung'
Ohne Rohstoffe ist unser modernes Leben nicht denkbar, ohne Rohstoffe gäbe es keine Technik. In einem Smartphone stecken 60 verschiedene Metalle. Batterien, ein zentraler Baustein der Energiewende, benötigen Lithium und Kobalt. Auf welche weiteren Rohstoffe ist die deutsche Industrie angewiesen? Welche Mengen werden benötigt und wo kommen diese her? Ist unsere Rohstoffversorgung auch langfristig gesichert – und zu welchem Preis, mit welchen Abhängigkeiten? Welche sozialen und ökologischen Probleme ergeben sich entlang der Lieferkette der Rohstoffe? Gemeinsam mit Fachleuten aus Wissenschaft und Wirtschaft und auch mit Ihnen diskutieren wir diese Fragen am Beispiel der für die Energiewende erforderlichen Rohstoffe wie Kupfer und Lithium. Wir werfen einen Blick auf den globalen Rohstoffhandel und die Lieferketten. Welche Rolle spielt der Import mineralischer Rohstoffe? Natürlich wollen wir sicherstellen, dass der Import sozial und ökologisch verantwortbar ist – selbst, wenn die Rohstoffe aus weit entfernten Ländern kommen, meist aus Regionen außerhalb Europas. Wie können neue und nachhaltige Wege unserer Rohstoffversorgung aussehen? Welchen Beitrag leisten heimische Lagerstätten? Und welche Rolle spielen Sekundärrohstoffe aus Abfällen und Schrott? Können Recycling und die Kreislaufwirtschaft einen zentralen Beitrag zur Deckung des steigenden Rohstoffbedarfs leisten? mit: Dr. Achim Budde, Prof. Dr. Jens Gutzmer, Luise Müller-Hofstede Moderation: Dr. Martin Dabrowski

Gespräch zum Thema 'Gibt es überhaupt ein gerechtes Wahlrecht? Von Tücken und Tricks beim Ankreuzen'
Gerechte Wahlen, deren Ergebnisse den Volkswillen abbilden, sind eine fundamentale Herausforderung für das Funktionieren einer Demokratie. Doch das Wahlrecht steht immer wieder in der Kritik. Politischer Streit darüber, dass es nicht gerecht sei, ist an der Tagesordnung. Aber! Gibt es überhaupt ein gerechtes Wahlrecht oder gibt es nur weniger ungerechte? Im Mittagsgespräch gehen wir besonders folgenden Fragen nach: Welches sind die besonders kritischen Punkte zum Beispiel im US-Wahlrecht? Welche Kritik gibt es am neuen deutschen Wahlrecht? Wie sollte sich das deutsche Wahlrecht ändern, um weniger ungerecht zu sein? Welche vorsätzlichen Manipulationen zeigten und zeigen sich in anderen Demokratien? Wie kann man das Wahlrecht vor Manipulation schützen? Unser Gesprächspartner am 16.7.2025 ist Prof. Dr. Michael Zöller, Professor em. für Politische Soziologie an der Universität Bayreuth. Der Soziologe forscht seit Jahren zum Thema Wahlrecht und ist seit Jahrzehnten ein sehr guter Kenner der US-Verhältnisse. Gerade dort ist die Problematik des Wahlrechts ja besonders virulent. Das Gespräch führt Akademiedirektor Dr. Achim Budde.

Gespräch zum Thema 'KI in den Medien'
In vielen Redaktionen hat die künstliche Intelligenz schon lange Einzug gehalten. Was aber bedeutet das für Redakteurinnen und Redakteure sowie Verlage oder Sender? Große Umstellungen, Vereinfachung, Arbeitsverdichtung, Stellenabbau, Ökonomisierung? Und was für die Nutzer? Wem und was können sie noch glauben? Wird das Vertrauen in die Medien dadurch geschwächt? Was sind die Chancen, Risiken und Herausforderungen beim Einsatz von KI in den Medien? Und hat der Einsatz von Künstlicher Intelligenz nicht auch Auswirkungen weit über die Medien hinaus? Ethische und politische Implikationen für die Gesellschaft? Diesen und weiteren Fragen widmen sich die Gesellschaft der Katholischen Publizistinnen und Publizisten (GKP) sowie die Katholische Akademie in Bayern beim gemeinsamen Symposion mit dem Titel "Zwischen Innovation und Ethik. KI in den Medien". Expertinnen und Experten werden am 12. November 2024 einen Tag lang die praktischen und ethischen Auswirkungen der Veränderungen auf Beruf und Gesellschaft analysieren. Eingeladen sind neben Journalistinnen und Journalisten alle anderen in Medienberufen tätigen Menschen und Interessierte, die gerne wissen wollen, wie in Zukunft Nachrichten entstehen. Prof. Dr. Hannah Schmid-Petri ist Inhaberin des Lehrstuhls für Wissenschaftskommunikation an der Universität Passau. Christine Ulrich, Medienethikerin und Redakteurin bei epd. Moderation: Joachim Frank, Chefkorrespondent und Mitglied der Chefredaktion beim Kölner Stadt-Anzeiger, Vorsitzender der GKP, der Gesellschaft Katholischer Publizistinnen und Publizisten Deutschlands. Die GKP ist Kooperationspartner der Katholischen Akademie in Bayern bei dieser Veranstaltung.

Gespräch zum Thema 'Themen und Sprache - Die Reaktion der Medien auf die Krisen der Welt'
Krisenberichterstattung dominiert die Nachrichten in praktisch allen Medien. Kriege, politische Fehlschläge, Verbrechen werden sofort gemeldet und kommentiert, auch wenn die Fakten noch nicht klar sind. Wenn sich nach ein paar Tagen oder auch nur Stunden herausstellt, dass alles doch nicht so war, sind die Emotionen geweckt und die nachträglichen sachlichen Klarstellungen verpuffen. „Positive“ Nachrichten, Berichte über erfolgreiches Handeln können sich da kaum noch Geltung verschaffen. Auch die Sprache in den Medien ist oft einseitig aufgeheizt: legale Demonstrationen werden schnell zu „Aufruhr“. Legitime politische Diskussionen sind sofort „Streit“, werden komplexe Probleme nicht sofort aus dem Weg geräumt, herrscht „Chaos“. Trägt diese Wortwahl noch zur Verschärfung von Krisen bei? Die Reaktion der Medien auf die Ereignisse in einer als krisenhaft empfundenen Welt sollen bei unserem Gespräch am Mittag des 9.7.2025 mit der Medienethikerin Claudia Paganini zur Sprache kommen. Die Medienethikerin ist Privatdozentin am Institut für Christliche Philosophie der Universität Innsbruck und hatte neben Lehrtätigkeiten in Kroatien, Griechenland und Italien auch die Vertretungsprofessur für Medienethik an der Hochschule für Philosophie in München inne. Moderation: Dr. Robert Walser.

Christine Ulrich: KI und ihre Folgen - Ethische Aspekte des KI-Einsatzes in den Medien
Christine Ulrich, Medienethikerin und Redakteurin bei epd, spricht in diesem Video über ethische Aspekte des KI-Einsatzes in den Medien. Immer dort, so die Journalistin, wo es in Berichten um Persönlichkeitsschutz und Menschenwürde geht, ist die Ethik gefragt. Und Christine Ulrich fragt: "Was ist denn noch journalistische Arbeit, wenn wir KI einsetzen." Expertinnen und Experten analysierten am 12. November 2024 die praktischen und ethischen Auswirkungen der Veränderungen auf Beruf und Gesellschaft. Eingeladen wurden sie von der Gesellschaft der Katholischen Publizistinnen und Publizisten (GKP) sowie die Katholische Akademie in Bayern zum gemeinsamen Symposion mit dem Titel "Zwischen Innovation und Ethik. KI in den Medien."

Hannah Schmid-Petri: Wenn Algorithmen Botschaften verfassen – potentielle Auswirkungen auf Vertrauen und Desinformation
Prof. Dr. Hannah Schmid-Petri, Inhaberin des Lehrstuhls für Wissenschaftskommunikation an der Universität Passau, spricht in diesem Video über potentielle Auswirkungen auf Vertrauen und Desinformation durch den Einsatz von KI in den Medien. Expertinnen und Experten analysierten am 12. November 2024 die praktischen und ethischen Auswirkungen der Veränderungen auf Beruf und Gesellschaft. Eingeladen wurden sie von der Gesellschaft der Katholischen Publizistinnen und Publizisten (GKP) sowie die Katholische Akademie in Bayern zum gemeinsamen Symposion mit dem Titel "Zwischen Innovation und Ethik. KI in den Medien." Prof. Dr. Hannah Schmid-Petri referierte zum Thema 'Wenn Algorithmen Botschaften verfassen – potentielle Auswirkungen auf Vertrauen und Desinformation' am 12.11.2024 in der Katholischen Akademie in Bayern. Hannah Schmid-Petri: Potentielle Auswirkungen des KI-Einsatzes auf das Vertrauen in die Medien

Gespräch zum Thema 'Habemus papam! Ecclesia, quo vadis?', Folge 5
Fünfte Folge unseres Mittagsgesprächs in der Reihe "Habemus papam! Ecclesia, quo vadis". Die neue Veranstaltungsreihe der Katholischen Akademie in Bayern "Digitales Mittagsgespräch – Mittwochs um 12" wird moderiert von Akademiedirektor Dr. Achim Budde. Nach und nach werde sich in den kommenden Wochen und Monaten durch Äußerungen und Handlungen, Gesten und Signale klären, in welche Richtung Papst Leo die Kirche steuern werde, so Achim Budde. Die Akademie will diesen Klärungsprozess mit den eingeladenen Expertinnen und Experten im Mittagsgespräch zu klären helfen. In unserem fünften Gespräch haben wir mit Sr. Dr. Katharina Ganz OSF, Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen, eine profilierte Stimme, die sich aktiv für die Gleichberechtigung von Frauen in der katholischen Kirche und für die Zulassung von Frauen zum Weiheamt einsetzt – und das neue Pontifikat auf diese Themen hin abklopfen wird. P. Felix Meckl OSA, Prokurator und Wallfahrtskurat des Augustinerkonvents Maria Eich in Planegg bei München und Mitbruder von Leo XIV., hat den neuen Papst bei verschiedenen Gelegenheiten kennengelernt und wird Einblicke in die Persönlichkeit des neuen Pontifex geben.

Gespräch zum Thema '1700 Jahre Nizäa - Christologische Perspektiven'
In diesem Jahr steht ein besonderes Jubiläum an: 325, vor 1700 Jahren, fand das Erste Ökumenische Konzil in Nizäa statt. Damals trafen sich, auf Einladung von Kaiser Konstantin, Bischöfe aus aller Welt, um wichtige Glaubensfragen zu diskutieren. Es ging um ein gemeinsames Osterdatum der verschiedenen christlichen Richtungen oder, am wichtigsten, um die Gottheit von Jesus Christus. Über das Konzil, seine bis heute reichenden Auswirkungen und speziell die christologischen Aspekte sprechen P. Dr. Andreas Batlogg SJ, der vor kurzem dazu das Buch “Jesus glauben” veröffentlich hat, sowie Prof. Dr. Hans-Georg Gradl, Neutestamentler an der Universität Trier, der an der Katholischen Akademie bei den Biblischen Tagen 2026 (30. März bis 1. April) das Thema “Jesus (Christus)” aufgreifen wird. Die neue Veranstaltungsreihe der Katholischen Akademie in Bayern "Digitales Mittagsgespräch – Mittwochs um 12" wird moderiert von Akademiedirektor Dr. Achim Budde.

Gespräch zum Thema 'Habemus papam! Ecclesia, quo vadis?', Folge 4
Vierte Folge unseres Mittagsgesprächs in der Reihe "Habemus papam! Ecclesia, quo vadis". Die neue Veranstaltungsreihe der Katholischen Akademie in Bayern "Digitales Mittagsgespräch – Mittwochs um 12" wird moderiert von Akademiedirektor Dr. Achim Budde. Nach und nach werde sich in den kommenden Wochen und Monaten durch Äußerungen und Handlungen, Gesten und Signale klären, in welche Richtung Papst Leo die Kirche steuern werde, so Achim Budde. Die Akademie will diesen Klärungsprozess mit den eingeladenen Expertinnen und Experten im Mittagsgespräch zu klären helfen. In unserem vierten Gespräch werden Dr. h.c. mult. Annette Schavan, ehem. Bundesbildungsministerin und von 2014 bis 2018 deutsche Botschafterin am Hl. Stuhl, und Stefan von Kempis, Leiter der deutschsprachigen Abteilung bei Vatican News, ihre römisch geprägte Sicht der Situation darstellen.

Gespräch zum Thema 'Habemus papam! Ecclesia, quo vadis?', Folge 3
Es geht um viel. Der neue Pontifex trägt große Verantwortung. Seine Entscheidungen und der Kurs, den er einschlägt, haben Auswirkungen auf den ganzen Erdkreis: Die Menschheit sieht sich vielfachen Krisen ausgesetzt. Die Weltkirche ringt zwischen Einheit und Vielfalt um Zusammenhalt. In Deutschland sehnen sich viele Gläubige nach einer Vertiefung der Aufbrüche, die Franziskus angestoßen hat … Nach und nach wird sich in den kommenden Wochen und Monaten durch erste Äußerungen und Handlungen, Gesten und Signale klären, in welche Richtung Papst Leo die Kirche steuern wird und was wir von diesem Pontifikat zu erwarten haben. In unserem dritten Gespräch wird Prof. Dr. Thomas Söding von der Universität Bochum, der nicht nur Neutestamentler ist, sondern auch Vizepräsident des ZdK und Präsidiumsmitglied des Synodalen Wegs, seine Einschätzung über die Zukunft des von Papst Franziskus bereits angestoßenen Wegs der Synodalität unter Leo XIV. geben.

Gespräch zum Thema 'Habemus papam! Ecclesia, quo vadis?', Folge 2
Es geht um viel. Der neue Pontifex trägt große Verantwortung. Seine Entscheidungen und der Kurs, den er einschlägt, haben Auswirkungen auf den ganzen Erdkreis: Die Menschheit sieht sich vielfachen Krisen ausgesetzt. Die Weltkirche ringt zwischen Einheit und Vielfalt um Zusammenhalt. In Deutschland sehnen sich viele Gläubige nach einer Vertiefung der Aufbrüche, die Franziskus angestoßen hat … Nach und nach wird sich in den kommenden Wochen und Monaten durch erste Äußerungen und Handlungen, Gesten und Signale klären, in welche Richtung Papst Leo die Kirche steuern wird und was wir von diesem Pontifikat zu erwarten haben. In unserem zweiten Gespräch haben wir mit Frau Prof. Dr. Johanna Rahner von der Universität Tübingen eine Expertin für Dogmatik, Dogmengeschichte und Ökumenische Theologie zu Gast, die aus fachwissenschaftlicher theologischer Perspektive einen Blick auf das neue Pontifikat werfen wird. Mit Prof. Dr. Stefanos Athanasiou, Lehrstuhlinhaber für Systematische Theologie an der Fakultät für Orthodoxe Theologie der LMU München, kommt ein orthodoxer Experte zu Wort, der die ökumenische Ausrichtung zur Orthodoxie beleuchten wird.

Gespräch zum Thema 'Habemus papam! Ecclesia, quo vadis?', Folge 1
Gespräch zum Thema 'Habemus papam! Ecclesia, quo vadis?', Folge 1 - mit P. Dr. Andreas R. Batlogg SJ und Bischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm. Die neue Veranstaltungsreihe der Katholischen Akademie in Bayern "Digitales Mittagsgespräch – Mittwochs um 12:00 Uhr" wird moderiert von Akademiedirektor Dr. Achim Budde. Thema am 14. Mai 2025: Unsere Kirche hat einen neuen Papst. Es geht um viel. Der neue Pontifex trägt große Verantwortung. Seine Entscheidungen und der Kurs, den er einschlägt, haben Auswirkungen auf den ganzen Erdkreis: Die Menschheit sieht sich vielfachen Krisen ausgesetzt. Die Weltkirche ringt zwischen Einheit und Vielfalt um Zusammenhalt. In Deutschland sehnen sich viele Gläubige nach einer Vertiefung der Aufbrüche, die Franziskus angestoßen hat … Nach und nach wird sich in den kommenden Wochen und Monaten durch erste Äußerungen und Handlungen, Gesten und Signale klären, in welche Richtung Papst Leo die Kirche steuern wird und was wir von diesem Pontifikat zu erwarten haben.

Reinhard Heckel: Biocomputing - DNA in der Informationsverarbeitung
DNA kann zur Codierung, Speicherung, Übertragung und Verarbeitung von Informationen benutzt werden. DNA ist interessant für die Informationsverarbeitung, da Informationen auf sehr kleinem Raum effizient und langlebig gespeichert werden können. Sie ist damit eine potenzielle Alternative für Aufgaben die heute von traditionellen Informationsverarbeiteten Systemen verwendet werden können. Diese Art der Speicherung bietet das Potenzial, Daten über Hunderte von Jahren hinweg ohne Qualitätsverlust zu bewahren, was herkömmliche Speichermedien wie Festplatten oder USB-Sticks nicht leisten können. Diese Eigenschaft macht DNA zu einem vielversprechenden Medium für die Langzeitarchivierung von Informationen. In der Veranstaltung gibt Professor Heckel einen Überblick über den Forschungsstand im Bereich der DNA in der Informationstechnologie und einen Ausblick auf zukünftige Nutzungsmöglichkeiten. Prof. Dr. Reinhard Heckel, Professur für Maschinelles Lernen, TUM School of Computation, Garching bei München, referierte am 27.11.2024 zum Thema 'Biocomputing - DNA in der Informationsverarbeitung'.

Gespräch zum Thema 'Der ökologische Fußabdruck der Digitalisierung'
Der „ökologische Fußabdruck der Digitalisierung“ bezeichnet die Umweltauswirkungen, die durch die Nutzung digitaler Technologien entstehen. Dazu gehören der Energieverbrauch von Rechenzentren, die Produktion und Entsorgung von elektronischen Geräten sowie der Datenverkehr im Internet. Jede Aktivität im digitalen Raum, sei es das Versenden einer E-Mail, eine Suchanfrage, das Streamen eines Videos oder das Nutzen von Cloud-Diensten, trägt zum ökologischen Fußabdruck bei. Wieviel Energie brauchen digitale Anwendungen, wie wirkt sich die verstärkte Nutzung von KI aus, und kann Digitalisierung auch Strom einsparen? Diese und weitere Fragen diskutiert eine neue Ausgabe unseres “Digitalen Salons” mit Prof. Dr. Dieter Kranzlmüller, Prof. Dr. Markus Vogt und Johanna Wende. Moderation: Dr. Anna Frey. Das Gespräch fand am 26.11.2024 in der Katholischen Akademie in Bayern statt.

Anna Marmodoro: What’s Ancient about Ancient Philosophy
Die Philosophin Anna Marmodoro lud am 25.2.2025 im Rahmen des Philosophischen Meisterkurses, der bereits zum neunten Mal in Zusammenarbeit zwischen der Katholischen Akademie in Bayern und der Münchner Hochschule für Philosophie angeboten wurde, zu einem neuen Kennenlernen der Philosophie der Antike ein. „History of Philosophy: Just Say No!“ So expressed himself Gil Harman, at Princeton in the late 1980s. Do philosophers today still think the same? And for what reasons? In this talk, I engage with the multifaced debate on the topic that continues today, examining positions and arguments. I conclude with a positive proposal for why studying and researching ancient philosophy today can make us better philosophers if our concerns are with today’s world, but also better scholars if our interests lie with historical ideas. „History of Philosophy: Yes, please!“ (Anna Marmodoro)

Friedrich Wilhelm Graf im Theologischen Terzett
Das Gespräch über Werke von Aleida und Jan Assmann, Jan Loffeld und Anselm Schubert fand am 27. November 2024 in der Katholischen Akademie in Bayern statt. Friedrich Wilhelm Graf, emeritierter Professor für Systematische Theologie an der Evang.-Theol. Fakultät der LMU München, war am 27. November 2024 zu Gast beim Theologischen Terzett. Er und die Gastgeber Annette Schavan sowie Jan-Heiner Tück stellten drei interessante Bücher mit religiösem Inhalt vor und diskutierten darüber. Besprochen wurden "Gemeinsinn" von Aleida und Jan Assmann, Jan Loffelds "Wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt" und von Anselm Schubert: "Christus (m/w/d)". Die Katholische Akademie in Bayern ist eine selbstständige kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts. Die bayerischen Bischöfe haben die Akademie 1957 als unabhängige Denkwerkstatt gegründet und finanzieren sie bis heute, ohne auf ihre Arbeit Einfluss zu nehmen. Mit ihrer Satzung erhielt sie den Auftrag, „die Beziehungen zwischen Kirche und Welt zu klären und zu fördern“. Unser Themenspektrum umfasst Religion und Politik, Naturwissenschaft und Technik, Geschichte und Philosophie, Kunst und Kultur.

Dagmar Gottschall: Was Meister Eckhart in seinen deutschen Predigten über ‘Kirche’ sagt
Prof. Dr. Dagmar Gottschall, Professorin für Mediävistische Germanistik, Università del Salento, Lecce, referierte am 16.3.2024 in der Katholischen Akademie in Bayern zu dem Thema: Was Meister Eckhart in seinen deutschen Predigten über ‘Kirche’ sagt Meister Eckhart scheint auf den ersten Blick dazu nicht viel zu sagen. Aber, wenn man seine Äußerungen in den deutschen Predigten zugrunde legt und die Predigten auch als solche genauer liest, ergibt sich doch einiges, auch Überraschendes, zum Beispiel zum Bau der Kirche, zu architektonischen und im übertragenen Sinn zu spirituellen Räumen, in denen er agiert. Dass es der große Prediger, Theologe, Philosoph, Mystiker, Lehrer und Ordensorganisator mit seiner Kirche nicht leicht hatte, zeigen der Prozess, der gegen ihn geführt wurde, und die Verurteilung einzelner Sätze seiner Lehre als häretisch nach seinem Tod im Jahr 1328. Wir werden uns fragen, in welchem Verhältnis er zu seiner Kirche, zu seinem Dominikanerorden und dem Mönchtum allgemein stand, was er selbst über Kirche dachte und welche Rolle Kirche als Institution oder Raum, Papsttum, Priesterschaft und Laien, aber auch die kirchliche Dogmatik für ihn und in seiner Zeit spielten. Im Zentrum stehen dabei auch Fragen nach dem Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinschaft oder der Rolle von Institutionen und deren Vermittlungscharakter einerseits wie der möglichen unmittelbaren Gottesbegegnung jedes einzelnen Menschen andererseits. Und natürlich ist die Situation im frühen 14. Jahrhundert auch ein ferner Spiegel für die heutige. Die Jahrestagung der Meister-Eckhart-Gesellschaft zum 20. Jubiläum ihrer Gründung im Jahr 2004, zum siebten Mal schon in Zusammenarbeit mit der Katholischen Akademie in Bayern, ist offen für alle Interessierten.

Dietmar Mieth: Theologie statt Kirche?
Prof. em. Dr. Dietmar Mieth, Professor für Theologische Ethik am Lehrstuhl für Theologische Ethik / Sozialethik der Eberhard Karls Universität, Tübingen, Fellow und Mitglied der Meister-Eckhart-Forschungsstelle am Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien der Universität Erfurt referierte am 16.3.2024 in der Katholischen Akademie in Bayern zu dem Thema: Theologie statt Kirche? Warum Kirche bei Meister Eckhart präsent ist, aber nicht zum Thema wird Erst mit den Konfessionen wurde Kirche zum kontroversen Thema. Dennoch kann man Differenzen über „Kirche“ erschließen, zum Beispiel zwischen Thomas von Aquin und Meister Eckhart. Eckhart spricht primär von der Menschwerdung Gottes in ihrer Bedeutung für alle Menschen. Er stellt bestehende Strukturen implizit in Frage. Die Kirche gehört nicht in die „Zeit der Ernte“ (vgl. Mt 13,30). Das hat zum Beispiel Auswirkungen auf die theologische Begründung der Inquisition. Dass es der große Prediger, Theologe, Philosoph, Mystiker, Lehrer und Ordensorganisator mit seiner Kirche nicht leicht hatte, zeigen der Prozess, der gegen ihn geführt wurde, und die Verurteilung einzelner Sätze seiner Lehre als häretisch nach seinem Tod im Jahr 1328. Wir werden uns fragen, in welchem Verhältnis er zu seiner Kirche, zu seinem Dominikanerorden und dem Mönchtum allgemein stand, was er selbst über Kirche dachte und welche Rolle Kirche als Institution oder Raum, Papsttum, Priesterschaft und Laien, aber auch die kirchliche Dogmatik für ihn und in seiner Zeit spielten. Im Zentrum stehen dabei auch Fragen nach dem Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinschaft oder der Rolle von Institutionen und deren Vermittlungscharakter einerseits wie der möglichen unmittelbaren Gottesbegegnung jedes einzelnen Menschen andererseits. Und natürlich ist die Situation im frühen 14. Jahrhundert auch ein ferner Spiegel für die heutige. Die Jahrestagung der Meister-Eckhart-Gesellschaft zum 20. Jubiläum ihrer Gründung im Jahr 2004, zum siebten Mal schon in Zusammenarbeit mit der Katholischen Akademie in Bayern, ist offen für alle Interessierten.

Manfred Gerwing: „Freund, zieh höher hinauf“ (Lk 14,10)
Prof. em. Dr. Manfred Gerwing, Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte an der Theologischen Fakultät der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, referierte am 16.3.2024 in der Katholischen Akademie in Bayern zu dem Thema: „Freund, zieh höher hinauf“ (Lk 14,10). Zum kritischen Gottes- und Glaubensverständnis Meister Eckharts Manche Leute wollen Gott mit jenen Augen ansehen, mit denen sie eine Kuh ansehen, wie Meister Eckhart in einer deutschen Predigt (16B) bitter bemerkt. Er kritisiert damit das erschreckend niedrige Glaubensbewusstsein in der Kirche. Um es zu erhöhen, muss Gott selbst vor den Blick kommen, was wiederum nur möglich ist, wenn die Plätze getauscht werden: Freund, zieh höher hinauf! (Lk 14,10) Dass es der große Prediger, Theologe, Philosoph, Mystiker, Lehrer und Ordensorganisator mit seiner Kirche nicht leicht hatte, zeigen der Prozess, der gegen ihn geführt wurde, und die Verurteilung einzelner Sätze seiner Lehre als häretisch nach seinem Tod im Jahr 1328. Wir werden uns fragen, in welchem Verhältnis er zu seiner Kirche, zu seinem Dominikanerorden und dem Mönchtum allgemein stand, was er selbst über Kirche dachte und welche Rolle Kirche als Institution oder Raum, Papsttum, Priesterschaft und Laien, aber auch die kirchliche Dogmatik für ihn und in seiner Zeit spielten. Im Zentrum stehen dabei auch Fragen nach dem Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinschaft oder der Rolle von Institutionen und deren Vermittlungscharakter einerseits wie der möglichen unmittelbaren Gottesbegegnung jedes einzelnen Menschen andererseits. Und natürlich ist die Situation im frühen 14. Jahrhundert auch ein ferner Spiegel für die heutige. Die Jahrestagung der Meister-Eckhart-Gesellschaft zum 20. Jubiläum ihrer Gründung im Jahr 2004, zum siebten Mal schon in Zusammenarbeit mit der Katholischen Akademie in Bayern, ist offen für alle Interessierten.

Martina Roesner: Zur Sakramentalität des Überindividuellen in Meister Eckharts Mystik
Prof.in Dr. Martina Roesner, Professorin für Philosophie und Philosophiegeschichte, Theologische Hochschule Chur, referierte am 17.3.2024 in der Katholischen Akademie in Bayern zu dem Thema: Jenseits von Konrad und Heinrich. Zur Sakramentalität des Überindividuellen in Meister Eckharts Mystik Meister Eckharts Mystik gilt gemeinhin als eine Form der Spiritualität, in der die sonst üblichen Formen kirchlicher Heilsvermittlung keine Rolle spielen. Dennoch betont Eckhart immer wieder, dass die von ihm thematisierte Einheit mit Gott „ohne Mittel“ gerade nicht auf der Ebene der Individualität als solcher verwirklicht werden kann. Der Vortrag will der Frage nachgehen, inwiefern die mit dem Begriff der „Gelassenheit“ verbundene Überschreitung des individuellen Eigenseins gleichsam das eckhartsche Äquivalent zu jener theologischen Wirklichkeit ist, die sonst im Kontext der Sakramentenlehre und Ekklesiologie behandelt wird. Dass es der große Prediger, Theologe, Philosoph, Mystiker, Lehrer und Ordensorganisator mit seiner Kirche nicht leicht hatte, zeigen der Prozess, der gegen ihn geführt wurde, und die Verurteilung einzelner Sätze seiner Lehre als häretisch nach seinem Tod im Jahr 1328. Wir werden uns fragen, in welchem Verhältnis er zu seiner Kirche, zu seinem Dominikanerorden und dem Mönchtum allgemein stand, was er selbst über Kirche dachte und welche Rolle Kirche als Institution oder Raum, Papsttum, Priesterschaft und Laien, aber auch die kirchliche Dogmatik für ihn und in seiner Zeit spielten. Im Zentrum stehen dabei auch Fragen nach dem Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinschaft oder der Rolle von Institutionen und deren Vermittlungscharakter einerseits wie der möglichen unmittelbaren Gottesbegegnung jedes einzelnen Menschen andererseits. Und natürlich ist die Situation im frühen 14. Jahrhundert auch ein ferner Spiegel für die heutige. Die Jahrestagung der Meister-Eckhart-Gesellschaft zum 20. Jubiläum ihrer Gründung im Jahr 2004, zum siebten Mal schon in Zusammenarbeit mit der Katholischen Akademie in Bayern, ist offen für alle Interessierten.

Markus Vinzent: Gott hat nie mehr als ein einziges Wort gesprochen
Prof. em. Dr. Markus Vinzent, Vizepräsident der Meister-Eckhart-Gesellschaft, ehemaliger Professor für Historische Theologie am King‘s College in London, Fellow und Leiter der Meister-Eckhart-Forschungsstelle am Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien der Universität Erfurt, referierte am 16.3.2024 in der Katholischen Akademie in Bayern zu dem Thema: Gott hat nie mehr als ein einziges Wort gesprochen: Vater, Sohn, Geist, Kreaturen – wo ist die Kirche? (Pfeiffer Nr. 17) Eine ebenfalls nahezu unbekannt gebliebene Predigt, die bisher nicht kritisch ediert wurde, ist die Predigt Nr. 17 Franz Pfeiffers. Sie behandelt, gerade zu Beginn, etliche Aspekte, die mit Blick auf Eckharts Auffassung von Kirche zentral sind, und hat deshalb eine ausführliche Analyse verdient. Dass es der große Prediger, Theologe, Philosoph, Mystiker, Lehrer und Ordensorganisator mit seiner Kirche nicht leicht hatte, zeigen der Prozess, der gegen ihn geführt wurde, und die Verurteilung einzelner Sätze seiner Lehre als häretisch nach seinem Tod im Jahr 1328. Wir werden uns fragen, in welchem Verhältnis er zu seiner Kirche, zu seinem Dominikanerorden und dem Mönchtum allgemein stand, was er selbst über Kirche dachte und welche Rolle Kirche als Institution oder Raum, Papsttum, Priesterschaft und Laien, aber auch die kirchliche Dogmatik für ihn und in seiner Zeit spielten. Im Zentrum stehen dabei auch Fragen nach dem Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinschaft oder der Rolle von Institutionen und deren Vermittlungscharakter einerseits wie der möglichen unmittelbaren Gottesbegegnung jedes einzelnen Menschen andererseits. Und natürlich ist die Situation im frühen 14. Jahrhundert auch ein ferner Spiegel für die heutige. Die Jahrestagung der Meister-Eckhart-Gesellschaft zum 20. Jubiläum ihrer Gründung im Jahr 2004, zum siebten Mal schon in Zusammenarbeit mit der Katholischen Akademie in Bayern, ist offen für alle Interessierten.

Mauritius Wilde: Meister Eckhart und das Mönchtum
P. Dr. Mauritius Wilde OSB, Prior der Primatialabtei Sant’ Anselmo in Rom, referierte am 16.3.2024 in der Katholischen Akademie in Bayern zu dem Thema: Meister Eckhart und das Mönchtum Meister Eckhart war kein Mönch. Seine Adressaten jedoch finden sich im monastischen Kontext. Auch die Art seines Theologisierens könnte man als kontemplativ beschreiben. Mit dem Konzept der „Abgeschiedenheit“ trifft er ein monastisches Prinzip, das auch für Menschen außerhalb des Klosters relevant war und ist. Dass es der große Prediger, Theologe, Philosoph, Mystiker, Lehrer und Ordensorganisator mit seiner Kirche nicht leicht hatte, zeigen der Prozess, der gegen ihn geführt wurde, und die Verurteilung einzelner Sätze seiner Lehre als häretisch nach seinem Tod im Jahr 1328. Wir werden uns fragen, in welchem Verhältnis er zu seiner Kirche, zu seinem Dominikanerorden und dem Mönchtum allgemein stand, was er selbst über Kirche dachte und welche Rolle Kirche als Institution oder Raum, Papsttum, Priesterschaft und Laien, aber auch die kirchliche Dogmatik für ihn und in seiner Zeit spielten. Im Zentrum stehen dabei auch Fragen nach dem Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinschaft oder der Rolle von Institutionen und deren Vermittlungscharakter einerseits wie der möglichen unmittelbaren Gottesbegegnung jedes einzelnen Menschen andererseits. Und natürlich ist die Situation im frühen 14. Jahrhundert auch ein ferner Spiegel für die heutige. Die Jahrestagung der Meister-Eckhart-Gesellschaft zum 20. Jubiläum ihrer Gründung im Jahr 2004, zum siebten Mal schon in Zusammenarbeit mit der Katholischen Akademie in Bayern, ist offen für alle Interessierten.

Gespräch zum Thema 'Suizidalität im Kontext der Bundeswehr'
Oberstarzt Dr. med. Gerd Willmund, Klinischer Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychotraumatologie, referierte in der Katholischen Akademie in Bayern zum Thema "Suizidalität in den Streitkräften". Prof. Dr. Ulrich Hegerl hat seit Juni 2019 die Johann Christian Senckenberg Distinguished Professorship mit Sitz in der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Universitätsklinikums Frankfurt inne, bereits seit 2008 den Vorsitz der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Sein Referat drehte sich um das Thema "Volkskrankheit Depression". Das Gespräch zum Thema 'Suizidalität im Kontext der Bundeswehr' fand am 8.10.2024 in der Katholischen Akademie in Bayern statt.

Maximilian Fichtner: Neue Batterietypen für das postfossile Zeitalter
In Kooperation mit dem Deutschen Museum in der Reihe Wissenschaft für jedermann stellte Professor Maximilian Fichtner von der Helmholtz-Gesellschaft grundlegend neue Batterietypen vor. Der Direktor des Helmholzt-Instituts für Elektrochemische Energiespeicherung (HIU) und Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm sieht in dieser nachhaltigen und kosteneffizienten Technologie die Grundlage für Energiespeicher der Zukunft im postfossilen Zeitalters. Beim Vortrag am 5. Februar 2025 legte Maximilian Fichtner dar, dass der Ersatz fossiler Brennstoffe durch erneuerbare Energien und damit die gesamte Energiewende in Deutschland und weltweit nur gelingen kann, wenn die Speichertechnologien immer weiter verbessert werden. Dies gilt im großen Stil für Energiespeicher, die die natürlichen Schwankungen von Windkraft und Solarenergie ausgleichen, um eine flächendeckende und permanente Versorgung mit klimaneutralen Energien zu sichern. Lithium-Ionen-Batterien sind im Moment der am weitesten verbreitete Batterietyp in den unterschiedlichsten Einsatzgebieten. Die steigende Nachfrage nach Lithium-Batterien führt jedoch zu Problemen bei der Beschaffung von Rohstoffen und Komponenten. Daher ist es notwendig, alternative Zellkonzepte zu entwickeln, die auf Rohstoffen basieren, die besser verfügbar sind und eine sichere, nachhaltige und kosteneffiziente Versorgung mit Hochleistungsbatterien gewährleisten.

Gespräch zum Thema 'Staatsfinanzen und Generationengerechtigkeit'
Im Rahmen eines Vortrags- und Diskussionsabends am 25. November 2024 unter dem Titel "Wer zahlt die Zeche? Über Staatsfinanzen und Generationengerechtigkeit" setzte sich die Katholische Akademie in Bayern interdisziplinär mit dem Thema Staatsverschuldung auseinander. Als das Bundesverfassungsgericht Ende 2023 entschied, dass ungenutzte Gelder aus dem Corona-Sondervermögen nicht in den Klima- und Transformationsfonds verschoben werden dürfen, fehlte der Bundesregierung ein Betrag in Milliardenhöhe (u.a. für Klimaschutzprojekte). Rege wurde über eine Kompensation der Mittel diskutiert: Wo könnte gespart werden? Sollten Steuern erhöht werden? Wie will man weiter mit der Schuldenbremse verfahren? In diese Debatte mischte sich eine weit in die Zukunft reichende Frage: Sollen große Projekte und Investitionen durch neue, sogar massive Schulden finanziert werden? Davon betroffen wären besonders die kommenden Generationen, die von langfristigen Investitionen profitieren, aber auch eine größere finanzielle Hypothek übernehmen würden. Über dieses aktuelle Thema referieren und diskutieren der Ökonom Nils Goldschmidt und der Philosoph Christian Neuhäuser. Moderation: Studienleiterin Katharina Löffler.

Podiumsdiskussion zum Thema 'Herausforderung Klimafinanzierung - Klimaschutz sucht Geldgeber'
Der klimagerechte Umbau der Wirtschaft und die Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels kosten viel Geld. Offen ist, wer die Investitionen in klimafreundliche Technologien, erneuerbare Energien, nachhaltige Infrastruktur und Anpassungsmaßnahmen weltweit finanzieren soll. Wie komplex und vielschichtig die Suche nach Geldgebern für Klimaschutzprojekte ist, zeigte das von der Katholischen Akademie in Bayern in Kooperation mit der Münchener Rück Stiftung durchgeführte Dialogforum im Rahmen des Münchner Klimaherbst 2024. Bei der Suche nach Geldgebern für den Klimaschutz stellt sich immer auch die Frage nach Fairness und Gerechtigkeit. Johannes Wallacher, Professor für Sozialwissenschaften und Wirtschaftsethik sowie Präsident der Hochschule für Philosophie München, kann dem ethisch nicht unproblematischen Prinzip der historischen Schuld wenig abgewinnen. Denn: „Weder ist die heutige Generation für frühere Emissionen verantwortlich, noch wussten frühere Generationen, was sie anrichten.“ Stattdessen plädiert er dafür, sich an der Klimaschutzkapazität einzelner Länder zu orientieren, die oft stark mit kumulierten CO2-Emissionen korreliert. Für David Ryfisch, Leiter der Abteilung Internationale Klimapolitik bei Germanwatch e.V., müssen Schäden und Verluste, etwa durch Extremwetterereignisse, den Anstieg des Meeresspiegels oder die Häufung von Dürren stärker in den Fokus rücken. „Verschiedene Studien zur fairen Lastenverteilung zwischen den Staaten kommen zu dem Ergebnis, dass die Hauptverantwortung noch bei den Industrieländern liegt. Mit der Zeit wird sich dieses Bild verschieben und auch Länder wie die Golfstaaten, Russland oder China werden Verantwortung übernehmen müssen“, sagte der Experte. Der jüngst etablierte Fonds für Verluste und Schäden sei ein wichtiger Fortschritt, auch wenn die Mittel von 700 Millionen US-Dollar bei weitem nicht ausreichten. „Wir müssen Wege finden, hier in neue Dimensionen vorzustoßen“, forderte er. Was kann der öffentliche Sektor beitragen, um mehr privates Kapital zu mobilisieren? „Der Staat muss bereit sein, mehr Risiken zu übernehmen. Er könnte Förderbanken mit Bürgschaften ausstatten, damit sie auch riskantere Projekte finanzieren“, erklärte Florian Egli, Professor für Public Policy for the Green Transition an der Technischen Universität München. Gerade im Bereich Klimaschutz ließe sich privates Kapital gut einsetzen, in den Bereichen Schäden oder Klimaanpassung funktioniere es weniger. Am schwierigsten seien Projekte zu finanzieren, die keine marktfähigen Produkte hervorbringen, wie die Speicherung von CO2 oder Investitionen in Biodiversität. Grüne Energien hingegen bräuchten keine staatlichen Garantien, da sich solche Investitionen über den Stromverkauf amortisieren. Wird die anstehende Klimakonferenz COP 29 im November Lösungen bringen? „Ich hoffe, dass alle in Baku vertretenen Länder zu einem tragfähigen Beschluss zur Klimafinanzierung kommen“, hofft Henn. Deutschland habe sich in der internationalen Gemeinschaft viel Vertrauen erarbeitet und könne als Brückenbauer fungieren. Klimafinanzierung ist also nicht nur eine ökologische, sondern auch eine soziale und ökonomische Herausforderung. Man darf gespannt sein, wie entschlossen die Klimakonferenz in Baku dieses Thema angehen wird. Nötig sind eine Neudefinition der globalen Prioritäten und eine Umverteilung der Ressourcen im Sinne einer nachhaltigen Zukunft für alle. Die Podiumsdiskussion fand am 14.10.2024 in der Katholischen Akademie in Bayern statt.

Katharina Weigand: Einst populär, heute umstritten - Bismarck- und Kriegerdenkmäler
Bei den Denkmälern, die bei dieser Veranstaltung im Mittelpunkt stehen, handelt es sich nicht um Objekte des Denkmalschutzes, also nicht um erhaltenswerte Kirchen, Schlösser oder Bauernhäuser, sondern vielmehr um neu geschaffene Monumente, die – vorrangig in den Städten – auf Sockel gehoben wurden, um an Vergangenes zu erinnern. Dabei ist es durchaus erstaunlich, welche starke Beachtung Denkmäler noch immer – in unserer digitalen Welt – erfahren. Erfunden im geschichtsbegeisterten 19. Jahrhundert, sollten sie einerseits dazu beitragen, das allgemeine Geschichtsbewusstsein zu fördern, andererseits waren sie aber auch häufig Instrumente zur Beeinflussung der damals aktuellen Politik. Heute können Denkmäler auf zwei Arten in den Mittelpunkt des Interesses geraten. So entschließen sich nach wie vor gesellschaftlich relevante Gruppen, neue, weitere Denkmäler in Angriff zu nehmen. Dies ist vor allem in Berlin zu beobachten, wo in absehbarer Zeit wohl für alle einzelnen Opfergruppen der nationalsozialistischen Herrschaft ein eigenes Denkmal bzw. Mahnmal errichtet sein wird. Aber auch längst bestehende Denkmäler geraten mitunter in den Blick der Öffentlichkeit: Während die meisten der die Städte möblierenden Monumente eine Art Dornröschenschlaf halten, sind im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung nun vor allem jene Personendenkmäler massiv umstritten, die in einem engeren oder weiteren Zusammenhang mit dem Kolonialismus stehen. Dr. Katharina Weigand referierte zum Thema "Einst populär, heute umstritten - Bismarck- und Kriegerdenkmäler?" am 5.7.2021 in der Katholischen Akademie in Bayern.

Katharina Weigand: An Vergangenes erinnern? Bemerkungen zur Genese und Wirksamkeit von Denkmälern
Bei den Denkmälern, die bei dieser Veranstaltung im Mittelpunkt stehen, handelt es sich nicht um Objekte des Denkmalschutzes, also nicht um erhaltenswerte Kirchen, Schlösser oder Bauernhäuser, sondern vielmehr um neu geschaffene Monumente, die – vorrangig in den Städten – auf Sockel gehoben wurden, um an Vergangenes zu erinnern. Dabei ist es durchaus erstaunlich, welche starke Beachtung Denkmäler noch immer – in unserer digitalen Welt – erfahren. Erfunden im geschichtsbegeisterten 19. Jahrhundert, sollten sie einerseits dazu beitragen, das allgemeine Geschichtsbewusstsein zu fördern, andererseits waren sie aber auch häufig Instrumente zur Beeinflussung der damals aktuellen Politik. Heute können Denkmäler auf zwei Arten in den Mittelpunkt des Interesses geraten. So entschließen sich nach wie vor gesellschaftlich relevante Gruppen, neue, weitere Denkmäler in Angriff zu nehmen. Dies ist vor allem in Berlin zu beobachten, wo in absehbarer Zeit wohl für alle einzelnen Opfergruppen der nationalsozialistischen Herrschaft ein eigenes Denkmal bzw. Mahnmal errichtet sein wird. Aber auch längst bestehende Denkmäler geraten mitunter in den Blick der Öffentlichkeit: Während die meisten der die Städte möblierenden Monumente eine Art Dornröschenschlaf halten, sind im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung nun vor allem jene Personendenkmäler massiv umstritten, die in einem engeren oder weiteren Zusammenhang mit dem Kolonialismus stehen. Dr. Katharina Weigand referierte zum Thema "An Vergangenes erinnern?" am 5.7.2021 in der Katholischen Akademie in Bayern.

Gespräch zum Thema 'Mutationen und Menschenleben'
"Mutationen und Menschenleben" - Zwei Medizinerinnen von Rang und Namen befassen sich in der gut halbstündigen Diskussion mit den Auswirkungen der neuen Varianten des Corona-Virus und der Lage Schwerkranker und Sterbender in den Kliniken. Prof. Dr. Ulrike Protzer, Virologin an der TU München und eine der wichtigsten Beraterinnen der bayerischen Staatsregierung, diskutiert mit Prof. Dr. Claudia Bausewein, Palliativmedizinerin an der LMU München und Präsidentin der deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Das Gespräch zum Thema 'Mutationen und Menschenleben' führten Prof. Dr. Ulrike Protzer und Prof. Dr. Claudia Bausewein am 18.3.2021 in der Katholischen Akademie in Bayern.

Gespräch zum Thema 'Goethe und der Koran'
Wie kein anderer deutscher Dichter hat sich Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) mit Orient und Islam beschäftigt. Das reicht vom frühen Mahomet-Fragment (1772/73) bis zum späten Gedicht-Zyklus West-östlicher Divan (1819). In dessen Einleitung wird die Aufmerksamkeit auf den Orient gelenkt, „woher so manches Große, Schöne und Gute seit Jahrtausenden zu uns gelangte“. Goethe kannte den Koran, er hat ihn exzerpiert und kommentiert. Seine Schreib-Übungen im Arabischen sind überliefert. Diese Seite des Dichters wurde lang ignoriert, erst in den letzten Jahrzehnten hat sich die Literaturwissenschaft für sie interessiert. Dass nun auch Theologie und Religionswissenschaft nachziehen können, dafür hat heuer der Tübinger Professor Karl-Josef Kuschel mit seinem gewichtigen und schön aufgemachten Werk Goethe und der Koran gesorgt. Neben der Dokumentation aller einschlägigen Texte ordnet er sie auch ein und betont etwa die interreligiöse oder besser religionsverbindende Dimension Goethes. So könne man die Ergebung in den Willen Gottes durchaus als Gemeinsamkeit der monotheistischen Weltreligionen sehen. Oder mit Goethes Worten: „Wenn Islam Gott ergeben heißt, im Islam leben und sterben wir alle.“ Und doch eignet sich Goethe nicht für eine vorschnelle und billige Vereinnahmung. Seine Interkulturalität, die nicht nur auf Toleranz, sondern auch auf Wertschätzung abzielt, könnte durchaus als Modell für ein auf Kenntnissen und nicht auf Vorurteilen beruhendes Gespräch mit dem Islam dienen. Darum freuen wir uns, dass auch Professor Ahmad Milad Karimi, der in Münster islamische Philosophie lehrt und selbst den Koran übersetzt hat, zu einem Dialog der Gelehrten nach München kommt. Prof. Dr. Ahmad Milad Karimi diskutierte mit Prof. Dr. Karl-Josef Kuschel am 21.9.2021 in der Katholischen Akademie in Bayern.

Gespräch zum Thema 'Perspektiven für Europa nach der Bundestagswahl'
Zum Thema 'Perspektiven für Europa nach der Bundestagswahl' diskutierten am 11.10.2021 im Vortragssaal der Katholischen Akademie in Bayern auf dem Podium und mit den Stipendiatinnen und Stipendiaten im Auditorium: Prof. Dr. Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin, Direktorin der Akademie für Politische Bildung Tutzing, Dr. Stefan Leifert, Journalist, langjähriger Korrespondent im ZDF-Studio Brüssel, Leiter des Landesstudios Bayern. Als Moderatoren fungierten: Valerie zu Rhein, Stipendiatin der Bayerischen EliteAkademie, und Dominik Schwab, Stipendiat der Bayerischen EliteAkademie.

Jan Assmann: Der Mann Mose und Gottes Gesetz
Am Anfang der Rechtstradition steht das Königsrecht: Die göttlich legitimierte Stellung des Königs legitimiert zugleich seine Gesetze. Mit der Geschichte des jüdischen Volkes wird diese Praxis jedoch in Frage gestellt. Die in den Büchern Mose enthaltenen Gesetze sind nämlich explizit als Gottesrecht legitimiert, wodurch dem orientalischen Sakralkönigtum die Grundlage entzogen wird. Eine völlige Umwertung aller Werte unternimmt schließlich das Christentum, das beide Rechtsformen gleichermaßen kritisiert: „Durch das Gesetz wird niemand gerecht“ (Gal 2,16). Wie ist diese Kritik aber zu verstehen? Und mit welchem Recht wird sie laut? Diese Gemengelage bildet das Fundament unserer Jubiläumstagung 'Alles was Recht ist', mit der unsere Kooperation mit dem Katholischen Bibelwerk ihre Fortsetzung findet. Anlässlich der 100. Ausgabe von Welt und Umwelt der Bibel wollen wir mit unseren Gästen über das Phänomen der Gesetzgebung reflektieren und dabei die Geltungsfrage in den Mittelpunkt rücken. Unser Blick ist dabei übrigens auch auf „unsere Zeit“ gerichtet: Mit welchem Recht entscheiden wir täglich darüber, was sein soll? Und welche Probleme ergeben sich daraus für demokratisch legitimierte Ordnungen und Prozesse? Prof. Dr. Jan Assmann ist Professor emeritus für Ägyptologie an der Universität Heidelberg. Er referierte bei der Tagung "Alles was Recht ist. Legitimation und Gesetzgebung in Religion und Gesellschaft" am 1./2.10.2021 in der Katholischen Akademie in Bayern zu dem Thema 'Der Mann Mose und Gottes Gesetz'.

Hans-Georg Gradl: Kein Jota soll vergehen?! Das Gesetz im Urchristentum
Am Anfang der Rechtstradition steht das Königsrecht: Die göttlich legitimierte Stellung des Königs legitimiert zugleich seine Gesetze. Mit der Geschichte des jüdischen Volkes wird diese Praxis jedoch in Frage gestellt. Die in den Büchern Mose enthaltenen Gesetze sind nämlich explizit als Gottesrecht legitimiert, wodurch dem orientalischen Sakralkönigtum die Grundlage entzogen wird. Eine völlige Umwertung aller Werte unternimmt schließlich das Christentum, das beide Rechtsformen gleichermaßen kritisiert: „Durch das Gesetz wird niemand gerecht“ (Gal 2,16). Wie ist diese Kritik aber zu verstehen? Und mit welchem Recht wird sie laut? Diese Gemengelage bildet das Fundament unserer Jubiläumstagung 'Alles was Recht ist', mit der unsere Kooperation mit dem Katholischen Bibelwerk ihre Fortsetzung findet. Anlässlich der 100. Ausgabe von Welt und Umwelt der Bibel wollen wir mit unseren Gästen über das Phänomen der Gesetzgebung reflektieren und dabei die Geltungsfrage in den Mittelpunkt rücken. Unser Blick ist dabei übrigens auch auf „unsere Zeit“ gerichtet: Mit welchem Recht entscheiden wir täglich darüber, was sein soll? Und welche Probleme ergeben sich daraus für demokratisch legitimierte Ordnungen und Prozesse? Prof. Dr. Hans-Georg Gradl ist Professor für Exegese des Neuen Testaments an der Theologischen Fakultät Trier. Er referierte bei der Tagung "Alles was Recht ist. Legitimation und Gesetzgebung in Religion und Gesellschaft" am 1./2.10.2021 in der Katholischen Akademie in Bayern zu dem Thema 'Kein Jota soll vergehen?! Das Gesetz im Urchristentum'.

Gespräch zur Eröffnung der Hans Maier-Bibliothek
Exakt 67 Mal referierte Prof. Dr. Hans Maier in der Katholischen Akademie in Bayern. Er ist damit der Wissenschaftler, Politiker, Intellektuelle und engagierte Katholik, der mit Abstand am häufigsten in unserem Haus am Rednerpult stand. Ab sofort ist die Verbindung zwischen dem ehemaligen bayerischen Kultusminister und ZdK-Präsidenten zur Akademie noch enger. Denn Hans Maier stiftete ihr einen Gutteil seiner Privatbibliothek, die in Zukunft in Schloss Suresnes eingerichtet ist und benutzt werden kann. Bei der Eröffnungsfeier der Hans-Maier-Bibliothek am 15. Juli 2021 fand Akademiedirektor Dr. Achim Budde dann auch die entsprechenden Lobesworte für den 90-Jährigen. Hans Maier sei einer der besten Freunde und engagiertesten Förderer der Akademie, es sei eine Ehre, seine mehr als 1700 Bücher aus vielen Wissensgebieten im Schloss zu beherbergen. Mit einem „Vergelt’s Gott“, schloss Achim Budde seine Begrüßung. Zur Begegnung mit Hans Maier anlässlich der Eröffnung der professionell eingerichteten Bibliothek waren Mitglieder der Akademie-Gremien sowie enge Weggefährten von Professor Maier gekommen. Das Gespräch von Akademiedirektor Achim Budde mit Hans Maier fand bei der Eröffnungsfeier der Hans-Maier-Bibliothek am 15.7.2021 in der Katholischen Akademie in Bayern statt.

Barbara Zehnpfennig: Die Legitimation des Bösen? Hitlers „Mein Kampf“
Am Anfang der Rechtstradition steht das Königsrecht: Die göttlich legitimierte Stellung des Königs legitimiert zugleich seine Gesetze. Mit der Geschichte des jüdischen Volkes wird diese Praxis jedoch in Frage gestellt. Die in den Büchern Mose enthaltenen Gesetze sind nämlich explizit als Gottesrecht legitimiert, wodurch dem orientalischen Sakralkönigtum die Grundlage entzogen wird. Eine völlige Umwertung aller Werte unternimmt schließlich das Christentum, das beide Rechtsformen gleichermaßen kritisiert: „Durch das Gesetz wird niemand gerecht“ (Gal 2,16). Wie ist diese Kritik aber zu verstehen? Und mit welchem Recht wird sie laut? Diese Gemengelage bildet das Fundament unserer Jubiläumstagung 'Alles was Recht ist', mit der unsere Kooperation mit dem Katholischen Bibelwerk ihre Fortsetzung findet. Anlässlich der 100. Ausgabe von Welt und Umwelt der Bibel wollen wir mit unseren Gästen über das Phänomen der Gesetzgebung reflektieren und dabei die Geltungsfrage in den Mittelpunkt rücken. Unser Blick ist dabei übrigens auch auf „unsere Zeit“ gerichtet: Mit welchem Recht entscheiden wir täglich darüber, was sein soll? Und welche Probleme ergeben sich daraus für demokratisch legitimierte Ordnungen und Prozesse? An diesem Punkt setzt unser Abendvortrag einen weiteren Akzent — gewinnen diese Fragen doch vor dem Horizont unseres Jahrhunderts erst ihren vollen Sinn: Wie legitimiert sich das radikal Böse in der Welt? Und worauf rekurriert der Widerstand gegen geltendes (Un-)Recht? An Hitlers „Mein Kampf“ und der Gruppe Weiße Rose wollen wir es lernen. Prof. Dr. Barbara Zehnpfennig ist Professorin für Politische Theorie und Ideengeschichte an der Universität Passau. Sie referierte bei der Tagung "Alles was Recht ist. Legitimation und Gesetzgebung in Religion und Gesellschaft" am 1./2.10.2021 in der Katholischen Akademie in Bayern zu dem Thema 'Die Legitimation des Bösen? Hitlers „Mein Kampf“'.

Johannes Willms: Was kann uns Napoleon 200 Jahre nach seinem Tod noch bedeuten?
Der französische Schriftsteller, Politiker und Diplomat François-René de Chateaubriand (1768-1848) bemerkte in seinen Mémoires d’outre tombe über Napoleon: „Nach dem Despotismus seiner Person werden wir noch den Despotismus seiner Erinnerung erleiden müssen. Dieser Despotismus ist noch viel dominierender. Auch wenn wir gegen Napoleon kämpften, solange er auf dem Thron saß, so gibt es eine universelle Zustimmung zu den Eisen, in die er uns als Toter geschlagen hat.“ Diese Vorhersage hat sich nur zu sehr bewahrheitet, denn jede Nation hat ihr eigenes Bild von Napoleon. Das gilt auch für die Deutschen, die sich von ihm eine in unterschiedlichen politischen Farben gemalte Vorstellung machten, die endgültig von den Nazis verhunzt wurde, die eine „Wesensgleiche“ zwischen Napoleon und Hitler feststellten. Napoleon habe, so wird gerne gesagt, der Moderne in Europa zum Durchbruch verholfen. Als Beweis dafür wird auf den Code Civil verwiesen oder auch auf die von ihm veranlasste „Flurbereinigung“ in der buntscheckigen deutschen Staatenwelt des alten Reichs. Dagegen spricht, dass Napoleon unfähig war, stabile und legitime staatliche Verhältnisse aufzubauen. Frankreich hat mit dem Erbe dieses Unvermögens bis heute seine Last. Welche Bedeutung könnte Napoleon heute also haben? Vielleicht ist seine Geschichte so etwas wie die Ilias der Neuzeit, ein Epos von Größe und Scheitern, das immer wieder den sich wandelnden Umständen der jeweiligen Gegenwart entsprechend neu erzählt und gedeutet wird. Dr. Johannes Willms ist Historiker und Journalist. Er referierte zum Thema "Was kann uns Napoleon 200 Jahre nach seinem Tod noch bedeuten?" am 5.5.2021 in der Katholischen Akademie in Bayern.

Armin Nassehi: Wie verändert Corona unsere Gesellschaft?
Prof. Dr. Armin Nassehi, einer der bekanntesten deutschen Soziologen, analysiert im Video-Gespräch „Wie verändert Corona unsere Gesellschaft?“ die Auswirkungen der Pandemie auf eine Reihe von Bereichen. Studienleiter Johannes Schießl befragte den an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität lehrenden Soziologen zu verschiedenen gesellschaftlichen Aspekten wie der Gerechtigkeit. Armin Nassehi, der auch zahlreiche Politiker berät, gab zudem Auskunft zur Rolle der Medien in der Pandemie. Weiterhin kam die Situation der Wissenschaft und bei den Studierenden zum Tragen; abgerundet wurde das etwa 45-minütige Interview durch die Themenbereiche Kultur und Kirche. Prof. Dr. Armin Nassehi referierte zum Thema "Wie verändert Corona unsere Gesellschaft?" am 14.6.2021 in der Katholischen Akademie in Bayern.

Gespräch zum Thema 'Vernunft und Offenbarung'
Es ist eine alte Streifrage in der Geschichte unseres Denkens: Wie soll die Vernunft mit Wahrheitsansprüchen umgehen, die sich auf Offenbarung berufen? Und wie verhält sich der Glaube, der sich einem Offenbarungsgeschehen verdankt, zur Vernunft, die lediglich sich selbst verpflichtet ist? Über diese Frage diskutieren die katholische Theologin Dr. Sarah Rosenhauer aus Frankfurt und der Philosoph Dr. Thomas Oehl aus München. Mit einem durchaus überraschenden Ergebnis: Vernunft könnte durch Offenbarung nicht nur gestützt und ergänzt werden, sondern selbst Offenbarung sein! Kann das einleuchten? Überzeugen Sie sich selbst! Das Gespräch zum Thema 'Vernunft und Offenbarung' fand am 15.2.2021 in der Katholischen Akademie in Bayern statt.

Thomas Oehl: Philosophie als Offenbarung
Es ist eine alte Streifrage in der Geschichte unseres Denkens: Wie soll die Vernunft mit Wahrheitsansprüchen umgehen, die sich auf Offenbarung berufen? Und wie verhält sich der Glaube, der sich einem Offenbarungsgeschehen verdankt, zur Vernunft, die lediglich sich selbst verpflichtet ist? Zusammen mit der katholischen Theologin Dr. Sarah Rosenhauer aus Frankfurt und dem Philosophen Dr. Thomas Oehl aus München klären wir, was unter „Vernunft“ und „Offenbarung“ eigentlich genau zu verstehen ist. Und wir prüfen, wie sich diese beiden Größen aufeinander beziehen lassen. Dr. Thomas Oehl referierte zum Thema 'Philosophie als Offenbarung' am 15.2.2021 in der Katholischen Akademie in Bayern.

Sarah Rosenhauer: Geliebte Freiheit - Zum Verhältnis von Offenbarung und Autonomie
Es ist eine alte Streifrage in der Geschichte unseres Denkens: Wie soll die Vernunft mit Wahrheitsansprüchen umgehen, die sich auf Offenbarung berufen? Und wie verhält sich der Glaube, der sich einem Offenbarungsgeschehen verdankt, zur Vernunft, die lediglich sich selbst verpflichtet ist? Zusammen mit der katholischen Theologin Dr. Sarah Rosenhauer aus Frankfurt und dem Philosophen Dr. Thomas Oehl aus München klären wir, was unter „Vernunft“ und „Offenbarung“ eigentlich genau zu verstehen ist. Und wir prüfen, wie sich diese beiden Größen aufeinander beziehen lassen. Dr. Sarah Rosenhauer referierte zum Thema 'Geliebte Freiheit - Zum Verhältnis von Offenbarung und Autonomie' am 15.2.2021 in der Katholischen Akademie in Bayern.

Theologisches Terzett mit Annette Schavan, Jan-Heiner Tück und Felicitas Hoppe
Felicitas Hoppe (*1960) lebt als Schriftstellerin in Berlin und Leuk. Seit 1996 veröffentlicht sie Erzählungen, Romane, Kinderbücher und Feuilletons; sie ist auch als Übersetzerin tätig. Hoppe ist reisend und vortragend rund um die Welt unterwegs. Sie ist Trägerin des Georg-Büchner-Preises und Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Zuletzt erhielt sie ein Ehrendoktorat der Leuphana Universität Lüneburg. Am 8. September erscheint ihr neuer Roman „Die Nibelungen. Ein deutscher Stummfilm“. Die im Terzett besprochenen Bücher werden von den drei Diskutanten des Abends vorgeschlagen und im Vorhinein gelesen: Andrea Riccardi: Das Herz wiederfinden. Beten mit dem Wort Gottes Simone Weil: Schwerkraft und Gnade Erik Varden: Heimweh nach Herrlichkeit. Das Theologische Terzett mit Annette Schavan, Jan-Heiner Tück und Felicitas Hoppe fand am 13.9.2021 in der Katholischen Akademie in Bayern statt.

Gespräch zum Thema '150 Jahre Unfehlbarkeit'
Mit dem Ersten Vatikanischen Konzil hat sich die Kirche von Rom auf einen Sonderweg begeben, indem sie zweierlei zum Dogma erhob: 1. Alle Hirten und Gläubigen weltweit sind dem Bischof von Rom zu hierarchischer Unterordnung und Gehorsam verpflichtet – und zwar sowohl in Fragen des Glaubens und der Sitten als auch disziplinarisch (DH 3060). 2. Der Bischof von Rom besitzt Unfehlbarkeit, wenn er „ex cathedra“ spricht. Seine Definitionen sind dann aus sich selbst heraus, nicht aufgrund des Konsenses der Kirche „unreformierbar“ (DH 3074). Seit 1870 muss jeder Katholik das glauben. Und hat auch das Zweite Vatikanische Konzil diese Ekklesiologie durch Kategorien wie „Communio“, „Synodalität“ oder „Volk Gottes“ ergänzt, so bleibt sie doch ungeschmälert in Kraft. Dieses Jubiläum fordert die Theologie heraus. Einmal in ökumenischer Hinsicht; denn keine andere Konfession wird sich diesem Anspruch jemals unterwerfen. Aber auch intern verstummt nicht jene Kritik, die schon damals zu erbittertem Widerstand und zu einer Kirchenspaltung geführt hatte: Ist, gemessen an der Botschaft Jesu, die absolutistische Wahlmonarchie wirklich die Rechtsform, in der sich Autorität, Macht und Entscheidungsbefugnis in der Kirche legitimieren sollten? Andere halten jeden Versuch, die päpstliche Vollmacht zu relativieren, für nicht mehr katholisch – und haben dabei die seit 150 Jahren geltende Lehre auf ihrer Seite. Wir wollen über diese Fragen ins Gespräch kommen: Wie ist es zur Dogmatisierung der Herrschaft gekommen? Wie hat sie sich seitdem entwickelt? Sind jegliche Ideen, die Macht in der Kirche zu teilen, von vornherein zum Scheitern verurteilt? Und selbst wenn Kirche und Papst es wollten: Kämen wir aus der Nummer überhaupt wieder heraus? Oder ist die Lehre tatsächlich, wie sie selbst es nennt, „irreformabilis“? Das Gespräch zum Thema '150 Jahre Unfehlbarkeit' fand am 20.5.2021 in der Katholischen Akademie in Bayern statt.

Franz Xaver Bischof: Primat und Unfehlbarkeit auf dem Ersten Vatikanischen Konzil
Mit dem Ersten Vatikanischen Konzil hat sich die Kirche von Rom auf einen Sonderweg begeben, indem sie zweierlei zum Dogma erhob: 1. Alle Hirten und Gläubigen weltweit sind dem Bischof von Rom zu hierarchischer Unterordnung und Gehorsam verpflichtet – und zwar sowohl in Fragen des Glaubens und der Sitten als auch disziplinarisch (DH 3060). 2. Der Bischof von Rom besitzt Unfehlbarkeit, wenn er „ex cathedra“ spricht. Seine Definitionen sind dann aus sich selbst heraus, nicht aufgrund des Konsenses der Kirche „unreformierbar“ (DH 3074). Seit 1870 muss jeder Katholik das glauben. Und hat auch das Zweite Vatikanische Konzil diese Ekklesiologie durch Kategorien wie „Communio“, „Synodalität“ oder „Volk Gottes“ ergänzt, so bleibt sie doch ungeschmälert in Kraft. Dieses Jubiläum fordert die Theologie heraus. Einmal in ökumenischer Hinsicht; denn keine andere Konfession wird sich diesem Anspruch jemals unterwerfen. Aber auch intern verstummt nicht jene Kritik, die schon damals zu erbittertem Widerstand und zu einer Kirchenspaltung geführt hatte: Ist, gemessen an der Botschaft Jesu, die absolutistische Wahlmonarchie wirklich die Rechtsform, in der sich Autorität, Macht und Entscheidungsbefugnis in der Kirche legitimieren sollten? Andere halten jeden Versuch, die päpstliche Vollmacht zu relativieren, für nicht mehr katholisch – und haben dabei die seit 150 Jahren geltende Lehre auf ihrer Seite. Wir wollen über diese Fragen ins Gespräch kommen: Wie ist es zur Dogmatisierung der Herrschaft gekommen? Wie hat sie sich seitdem entwickelt? Sind jegliche Ideen, die Macht in der Kirche zu teilen, von vornherein zum Scheitern verurteilt? Und selbst wenn Kirche und Papst es wollten: Kämen wir aus der Nummer überhaupt wieder heraus? Oder ist die Lehre tatsächlich, wie sie selbst es nennt, „irreformabilis“? Prof. Dr. Franz Xaver Bischof ist Professor für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit an der LMU München. Sein Referat am 20.5.2021 in der Katholischen Akademie in Bayern trägt den Titel: Dogmatisierung des päpstlichen Absolutismus. Primat und Unfehlbarkeit auf dem Ersten Vatikanischen Konzil.

Thomas Schüller: Endpunkt und Absicherung des Papstes als absolutistischer Wahlmonarch
Mit dem Ersten Vatikanischen Konzil hat sich die Kirche von Rom auf einen Sonderweg begeben, indem sie zweierlei zum Dogma erhob: 1. Alle Hirten und Gläubigen weltweit sind dem Bischof von Rom zu hierarchischer Unterordnung und Gehorsam verpflichtet – und zwar sowohl in Fragen des Glaubens und der Sitten als auch disziplinarisch (DH 3060). 2. Der Bischof von Rom besitzt Unfehlbarkeit, wenn er „ex cathedra“ spricht. Seine Definitionen sind dann aus sich selbst heraus, nicht aufgrund des Konsenses der Kirche „unreformierbar“ (DH 3074). Seit 1870 muss jeder Katholik das glauben. Und hat auch das Zweite Vatikanische Konzil diese Ekklesiologie durch Kategorien wie „Communio“, „Synodalität“ oder „Volk Gottes“ ergänzt, so bleibt sie doch ungeschmälert in Kraft. Dieses Jubiläum fordert die Theologie heraus. Einmal in ökumenischer Hinsicht; denn keine andere Konfession wird sich diesem Anspruch jemals unterwerfen. Aber auch intern verstummt nicht jene Kritik, die schon damals zu erbittertem Widerstand und zu einer Kirchenspaltung geführt hatte: Ist, gemessen an der Botschaft Jesu, die absolutistische Wahlmonarchie wirklich die Rechtsform, in der sich Autorität, Macht und Entscheidungsbefugnis in der Kirche legitimieren sollten? Andere halten jeden Versuch, die päpstliche Vollmacht zu relativieren, für nicht mehr katholisch – und haben dabei die seit 150 Jahren geltende Lehre auf ihrer Seite. Wir wollen über diese Fragen ins Gespräch kommen: Wie ist es zur Dogmatisierung der Herrschaft gekommen? Wie hat sie sich seitdem entwickelt? Sind jegliche Ideen, die Macht in der Kirche zu teilen, von vornherein zum Scheitern verurteilt? Und selbst wenn Kirche und Papst es wollten: Kämen wir aus der Nummer überhaupt wieder heraus? Oder ist die Lehre tatsächlich, wie sie selbst es nennt, „irreformabilis“? Prof. Dr. Thomas Schüller ist Professor für Kirchenrecht an der Universität Münster. Sein Referat am 20.5.2021 in der Katholischen Akademie in Bayern trug den Titel: Der Codex von 1983 als vorläufiger Endpunkt und Absicherung des Papstes als Absolutistischer Wahlmonarch – von kirchenrechtlichen Sackgassen und Reformbedarfen.

Gespräch zum Thema 'Wozu Verzicht?'
In der Tradition der philosophischen und theologischen Ethik sowie der Praxis der Weltreligionen spielen verschiedene Formen des Verzichts eine erhebliche Rolle. Diesen Befund mag man nun begrüßen oder nicht - auf unsere Gegenwart lässt er sich jedenfalls nicht eins zu eins übertragen. Denn obwohl auch säkulare Zeitgenossen noch vor oder an christlichen oder jüdischen Feiertagen spenden oder fasten - Muslime tun gar beides im Monat Ramadan -, so ist das Stichwort des Verzichts (ebenso wie die Umfeldausdrücke der Askese und des Fastens) aus der öffentlichen Diskussion so gut wie verschwunden. Zusammen mit dem Philosophen Prof. Dr. Otfried Höffe aus Tübingen und dem Moraltheologen Dr. Werner Veith aus München möchten wir dieser Tatsache aktiv entgegenwirken und die Logik des Verzichts neu ins Bewusstsein heben. Dabei werden wir jedoch keiner lebensfernen Utopie das Wort reden, sondern die Sachgründe zu erörtern suchen, die für eine Wiederentdeckung und Wiederbelebung des Verzichts sowie der ihm zugeordneten Tugend der Besonnenheit sprechen. Allein die zahlreichen Probleme der Gegenwart fordern uns auf, den traditionellen Diskussionsrahmen einer personalen Ethik auf eine soziale und politische Ethik hin zu erweitern. Denn: „Will die moderne Zivilisation menschenwürdig überleben, benötigt sie ein erhebliches Maß sowohl an persönlichen als auch an einer wirtschaftlich- und gesellschaftspolitischen, nicht zuletzt an einer global wirksamen Besonnenheit“ (Otfried Höffe). Wozu Verzicht? Ein Gespräch zwischen Prof. Dr. Otfried Höffe, emeritierter Professor für Ethik, Politische Philosophie und Philosophie an den Universitäten Fribourg (Schweiz) und Tübingen, und Dr. Werner Veith, Akademischer Oberrat am Lehrstuhl für Christliche Sozialethik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der LMU München, in der Katholischen Akademie in Bayern am 10.11.2021.

Achim Budde im Gespräch mit Moshe Zimmermann zum Thema 'Kann Israel Sicherheit und Frieden finden?'
Israels Gesellschaft ist zerrissen. Das geht oftmals unter, wenn die aktuelle Regierung mit dem ganzen Staat oder gar mit dem Judentum in eins gesetzt wird. Das Trauma des 7. Oktober teilen alle. Aber ob das militärische Vorgehen in Gaza Israel sicherer macht, darüber gehen auch innerhalb Israels die Meinungen weit auseinander. Im Gespräch mit Akademiedirektor Dr. Achim Budde, vertieft Professor Moshe Zimmermann, einer der renommiertesten Historiker des Landes, seine Analysen zur innenpolitischen Situation in Israel, die zur heutigen Lage und ihrer Aussichtslosigkeit geführt hat. Die Katholische Akademie in Bayern ist eine selbstständige kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts. Die bayerischen Bischöfe haben die Akademie 1957 als unabhängige Denkwerkstatt gegründet und finanzieren sie bis heute, ohne auf ihre Arbeit Einfluss zu nehmen. Mit ihrer Satzung erhielt sie den Auftrag, „die Beziehungen zwischen Kirche und Welt zu klären und zu fördern“. Unser Themenspektrum umfasst Religion und Politik, Naturwissenschaft und Technik, Geschichte und Philosophie, Kunst und Kultur. Das Gespräch mit Prof. Dr. Moshe Zimmermann zum Thema 'Kann Israel Sicherheit und Frieden finden?' fand am 24.6.2024 in der Katholischen Akademie in Bayern statt.

Moshe Zimmermann: Religiöse Strömungen in der israelischen Gesellschaft
Die Ansichten in Israel über den Nahostkonflikt sind sehr geteilt. Besonders, ob das militärische Vorgehen in Gaza als Antwort auf den Hamas-Terror am 7. Oktober 2023 den Staat Israel und seine Bürger sicherer macht, ist im Land sehr umstritten. Das geht oftmals unter, wenn die aktuelle Regierung mit dem ganzen Staat oder gar mit dem Judentum in eins gesetzt wird. Professor Moshe Zimmermann, einer der renommiertesten Historiker des Landes, analysiert die Entwicklung, die zur heutigen Lage und ihrer Aussichtslosigkeit geführt hat. Er legt dabei sein besonderes Augenmerk auf die veränderte Rolle der Religion: Welchen Stellenwert hatte für die überwiegend säkulare Einwanderungsbewegung ihre jüdische Religiosität? Welche Strömungen verbanden dann eine religiös-orthodoxe Identität mit politischem Nationalismus? Wie veränderten der Sechs-Tage-Krieg und später die auch religiös motivierte Besiedelung der Westbank das gesellschaftliche Gefüge? Welche Gruppen dominieren heute den Diskurs und die Politik? Und mit welchen demographischen und demoskopischen Umwälzungen sehen sich die Anhänger einer liberalen Demokratie aktuell konfrontiert? Prof. Dr. Moshe Zimmermann referierte zum Thema 'Religiöse Strömungen in der israelischen Gesellschaft' am 24.6.2024 in der Katholischen Akademie in Bayern.

Marcus H. Rosenmüller und Theresa Schopper diskutieren über das Thema 'Demokratie braucht Bildung'
Marcus H. Rosenmüller und Theresa Schopper diskutierten am 13.9.2024 im Rahmen des gemeinsamen Forums des Landeskomitees der Katholiken in Bayern und der Katholischen Akademie in Bayern über das Thema „Demokratie braucht Bildung“ und ihre Haltung zu Religion, Demokratie und Bildung.

Podiumsdiskussion mit Harald Lesch und Wilhelm Vossenkuhl zum Thema 'Geist - Natur - Künstliche Intelligenz'
In der Aufklärung galt, dass die Wissenschaften (technischen) Fortschritt ermöglichen und die menschliche Freiheit fördern. Heute kennen wir die Kehrseite dieses Prozesses: die Gefährdung von Natur und Umwelt, was wiederum die Freiheit einschränkt. Harald Lesch und Wilhelm Vossenkuhl diskutierten am 25.7.2024 darüber, wie gerade die KI z.B. Kommunikation und medizinische Diagnostik prägt. Kann sie die durch den technischen Fortschritt bedingten Schäden minimieren, oder schränkt sie die Mündigkeit des Menschen ein. Haben wir also ein neues Dilemma? Mit einem Feuerwerk von Fragen wurden Harald Lesch und Wilhelm Vossenkuhl nach ihrer Diskussion zum Thema KI konfrontiert. Ihre Antworten bei der Veranstaltung "Geist und Natur im Zeitalter von KI" waren klug, die Statements spritzig. Die Katholische Akademie in Bayern ist eine selbstständige kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts. Die bayerischen Bischöfe haben die Akademie 1957 als unabhängige Denkwerkstatt gegründet und finanzieren sie bis heute, ohne auf ihre Arbeit Einfluss zu nehmen. Mit ihrer Satzung erhielt sie den Auftrag, „die Beziehungen zwischen Kirche und Welt zu klären und zu fördern“. Unser Themenspektrum umfasst Religion und Politik, Naturwissenschaft und Technik, Geschichte und Philosophie, Kunst und Kultur.

Hans-Georg Gradl: Ein Buch mit sieben Siegeln - Die Johannesapokalypse
Die Johannesapokalypse entführt ihre Leserinnen und Leser in eine eigene Welt. Das Einstiegsreferat fragt nach dem Autor, den Adressaten und dem zeitgeschichtlichen Hintergrund, aber auch nach hilfreichen Leseschlüsseln für ein sachgerechtes Verständnis der Apokalypse. Die Johannesapokalypse ist schön und schauerlich zugleich. Sie erzählt von Glanz und Gräuel. Monster tauchen aus dem Meer auf, und Heere rüsten sich zum Krieg. Es sind fremd anmutende Bilder. Wer die Johannesapokalypse liest, braucht Leseschlüssel, denn sie umfasst mehr als logisch argumentierende, abstrakt-vernünftige Theologie. Die Schrift des Sehers Johannes wird nicht nur mit dem Kopf verstanden. Sie regt die Sinne an. Dementsprechend vielfältig sind die gewählten Zugänge bei den Biblischen Tagen: Biblisch-exegetische Vorträge wechseln sich ab mit musikalischen, kunsthistorischen und filmischen Beiträgen. Herzliche Einladung zu einer Begegnung mit dem wohl rätselvollsten und schaurigsten, aber zugleich auch schönsten Buch des gesamten Neuen Testaments. Prof. Dr. Hans-Georg Gradl referierte zum Thema "Ein Buch mit sieben Siegeln - Eine Einführung in die Johannesapokalypse" am 25.3.2024 in der Katholischen Akademie in Bayern. Er ist Professor für Exegese des Neuen Testaments an der Theologischen Fakultät Trier.

Podium zum Thema 'Harris vs. Trump - Die US-Wahlen als Richtungsentscheidung'
Demokratische Partei hat auf ihrem Parteitag im August Kamala Harris als ihre Präsidentschaftskandidatin nominiert, nachdem Joe Biden auf die erneute Kandidatur verzichtet hat. Auf der anderen Seite hat die Republikanische Partei Donald Trump erneut als ihren Kandidaten aufgestellt. Trump, der von 2017 bis 2021 als 45. Präsident der Vereinigten Staaten amtierte, will seine Basis mit dem Versprechen mobilisieren, die „America First“- Agenda weiterzuführen. Diese Wahl verspricht eine spannende und sehr polarisierende Auseinandersetzung zu werden, da die beiden politischen Lager in den USA tief gespalten sind. Die Stimmung im Land wirkt angespannt und unsicher. Da die USA eine weltweite Wirtschafts- und Militärmacht sind, ist der Ausgang der Wahl für Europa und die ganze Welt von Bedeutung. Die zentralen Fragen, die die USA sowohl innen- als auch außenpolitisch betreffen, sind: Bleiben die USA ein Land für Einwanderer, Offenheit und Demokratie, oder erfolgt eine neue Phase von Abschottung, Nationalismus und Falschaussagen? Die unterschiedlichen politischen Visionen der Kandidaten bzw. der beiden Parteien werden tiefgreifende Auswirkungen auf die globale Politik und Wirtschaft haben. In der Diskussion zwischen USA-Expertinnen und -Experten wurden Einschätzungen und Prognosen zum Ausgang der Wahl und zu deren Auswirkungen vorgenommen. Dabei ging es vor allem um die Bereiche Politik, Sicherheit und Verteidigung sowie Wirtschaft. Gleichzeitig wurden die Bedeutung und die Konsequenzen der Wahlentscheidung für die USA, für Europa und global diskutiert. In der Abschlussfrage wurden alle Podiumsgäste gebeten, eine persönliche Einschätzung zum Ausgang der US-Wahl am 5. November 2024 abzugeben: einig waren sich alle drei, dass die Wahl sehr knapp ausgehen wird und bis zum Wahltag noch viel passieren kann, was das Wahlergebnis nachhaltig beeinflussen könnte. Kamala Harris habe aber durchaus realistische Chancen, als Siegerin aus den Wahlen hervorzugehen und damit erste Präsidentin der USA zu werden. Auf dem Podium am 9.10.2024 in der Katholischen Akademie in Bayern: Dr. Benedikt Franke, Lotta Straube, Elmar Theveßen, Prof. Dr. Britta Waldschmidt-Nelson.

Gespräch zum Thema 'Demokratie in der Krise?'
Ist die Demokratie in der Krise? Dieser Frage gehen in diesem Video Prof. Dr. Michael Hochgeschwender, Professor für Nordamerikanische Kulturgeschichte, Empirische Kulturforschung und Kulturanthropologie an der LMU München, und Prof. Dr. Magnus Brechtken, stellvertretender Direktor am Institut für Zeitgeschichte in München, im Gespräch nach. Die Moderation des Gesprächs hat als Gastgeberin der Reihe "Akademie aktuell" Prof. Dr. Marita Krauss, Inhaberin des Lehrstuhls für Europäische Regionalgeschichte an der Universität Augsburg. Das Gespräch zum Thema 'Demokratie in der Krise?' fand am 1.2.2021 in der Katholischen Akademie in Bayern statt.

Manfred Spitzer: Einsamkeit in schwierigen Zeiten
Einsamkeit ist eine Grunderfahrung menschlicher Existenz. Als solche ist sie uns zwar vertraut, weist bei näherem Hinsehen jedoch paradoxe Züge auf: Auf der einen Seite befällt sie den Menschen und verursacht dadurch Leid, Krankheit und Tod; auf der anderen Seite wird sie vom Menschen gewählt, um daraus Inspiration und Lebenskraft zu schöpfen. Was hat das zu bedeuten? Und wie geht das zusammen? Gemeinsam mit der Philosophin Prof. Dr. Annemarie Pieper (Basel) und dem Neurowissenschaftler und Psychiater Prof. Dr. Manfred Spitzer (Ulm) wollen wir uns von diesen beiden Richtungen her dem Phänomen der Einsamkeit nähern. Im Zentrum wird dabei die Frage stehen, ob und – wenn ja – inwiefern Gelingen und Misslingen menschlichen Lebens von unserem Umgang mit der Einsamkeit abhängen. Oder anders gefragt: Gibt es Wege aus der Einsamkeit? Und einen richtigen Zugang zu ihr? Oder hängen beide Pfade gar miteinander zusammen? Aufklärung tut also not. Denn Einsamkeit kann jeden befallen – ganz egal, ob Alt oder Jung, Mann oder Frau, Arm oder Reich. Und dass die Vereinzelung des Menschen auch unsere Gesellschaft bedrohen kann, zeigen nicht zuletzt die Folgen der Corona-Pandemie. Prof. Dr. Manfred Spitzer referierte zum Thema "Einsamkeit in schwierigen Zeiten" am 28.6.2021.

Annemarie Pieper: Einsames Glück
Einsamkeit ist eine Grunderfahrung menschlicher Existenz. Als solche ist sie uns zwar vertraut, weist bei näherem Hinsehen jedoch paradoxe Züge auf: Auf der einen Seite befällt sie den Menschen und verursacht dadurch Leid, Krankheit und Tod; auf der anderen Seite wird sie vom Menschen gewählt, um daraus Inspiration und Lebenskraft zu schöpfen. Was hat das zu bedeuten? Und wie geht das zusammen? Gemeinsam mit der Philosophin Prof. Dr. Annemarie Pieper (Basel) und dem Neurowissenschaftler und Psychiater Prof. Dr. Manfred Spitzer (Ulm) wollen wir uns von diesen beiden Richtungen her dem Phänomen der Einsamkeit nähern. Im Zentrum wird dabei die Frage stehen, ob und – wenn ja – inwiefern Gelingen und Misslingen menschlichen Lebens von unserem Umgang mit der Einsamkeit abhängen. Oder anders gefragt: Gibt es Wege aus der Einsamkeit? Und einen richtigen Zugang zu ihr? Oder hängen beide Pfade gar miteinander zusammen? Aufklärung tut also not. Denn Einsamkeit kann jeden befallen – ganz egal, ob Alt oder Jung, Mann oder Frau, Arm oder Reich. Und dass die Vereinzelung des Menschen auch unsere Gesellschaft bedrohen kann, zeigen nicht zuletzt die Folgen der Corona-Pandemie. Prof. Dr. Annemarie Pieper referierte zum Thema "Einsames Glück" am 28.6.2021.

Hans-Georg Gradl: Die Apostelgeschichte
Die Apostelgeschichte hat es in sich. Wer sie liest, begibt sich auf eine so spannende wie spektakuläre, so tröstende wie aufwühlende Lese-Reise. Der Weg führt von Jerusalem nach Rom, herab von zinnenbekränzten Stadtmauern über das sturmgepeitschte Meer, heraus aus mehrstöckigen Kerkern und durch die öde Wildnis. Mit viel erzählerischem Charme beschreibt die Apostelgeschichte das Wachsen und Werden der jungen Kirche. Doch die Verkündigung der ersten Christen findet nicht nur begeisterte Annahme; sie stößt auf ebenso heftigen Widerstand. Zauberer und Handwerker fürchten um ihr Auskommen. Religiöse Instanzen sehen sich in ihrem Einfluss bedroht. Statthalter interessiert weniger die Botschaft als der Profit. Immer wieder steht das Christentum vor Gericht. Die Anfangszeit war eine von mannigfaltigen Krisen bestimmte Epoche. Nicht zuletzt deshalb ist die Apostelgeschichte noch heute so aktuell. Letztlich erzählt sie von einer nie endenden Geschichte und Aufgabe. Damals wie heute geht es doch um die Verkündigung des Evangeliums inmitten unterschiedlichster Kulturen und Kalküle, Regionen und Religionen. Die diesjährigen Biblischen Tage laden zu einer Reise in die bewegte und bewegende Welt des frühen Christentums ein. Kundige Reisebegleiterinnen und -begleiter stehen bereit. Die Route gibt der zweite Teil des lukanischen Doppelwerks vor. Der Weg führt aus der Vergangenheit in die Gegenwart, aus der heiligen Aura der Anfangszeit zu den alltäglichen Aufgaben der Jetztzeit und geradewegs auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu. Prof. Dr. Hans-Georg Gradl, Professor für Exegese des Neuen Testaments an der Theologischen Fakultät Trier, führte am 30.3.2021 in der Katholischen Akademie in Bayern in die Apostelgeschichte ein.

Theologisches Terzett mit Annette Schavan, Jan-Heiner Tück und Andreas R. Batlogg
Zum Theologischen Terzett mit Buchlektüre und -diskussion laden wieder Annette Schavan und Jan-Heiner Tück ein. Diesmal zu Gast: Andreas R. Batlogg SJ (*1962). Er studierte von 1981 bis 1985 Philosophie und Theologie an der Universität Innsbruck und trat 1985 in den Jesuitenorden ein. 1993 erhielt er in Wien die Priesterweihe und wurde 2000 zum Dr. theol. promoviert. Von 2000 bis 2009 war er Redaktionsmitglied der Zeitschrift „Stimmen der Zeit“, von 2009 bis 2017 deren Herausgeber und Chefredakteur. Seit 2014 ist Andreas R. Batlogg Seelsorger an St. Michael München; außerdem hält er Vorträge und publiziert Artikel und Bücher; seine neueste Publikation trägt den Titel „Jesus begegnen: suchen – finden – bekennen“ (2021). Die im Terzett besprochenen Bücher werden von den drei Diskutanten des Abends vorgeschlagen und im Vorhinein gelesen. Andreas Batlogg stellt vor: „geist-bewegt. Synodale Wege in den Spuren Jesu gehen“ von Margit Eckholt. Jan-Heiner Tück schlägt „Ins Innere hinaus. Von den Engeln und Mächten“ von Christian Lehnert vor. Und Annette Schavan stellt „Erneuerung aus dem Ursprung. Theologie, Christologie, Eucharistie“ von Walter Kardinal Kasper vor. Zur Begrüßung und Einleitung spricht Astrid Schilling, Studienleiterin der Katholischen Akademie in Bayern. Annette Schavan, Jan-Heiner Tück und Andreas R. Batlogg SJ diskutierten am 22.3.2022 beim Theologischen Terzett in der Katholischen Akademie in Bayern.

Theologisches Terzett mit Annette Schavan, Jan-Heiner Tück und Ulrich Greiner
Zum Theologischen Terzett mit Buchlektüre und -diskussion luden wieder Annette Schavan und Jan-Heiner Tück ein. Diesmal zu Gast: Ulrich Greiner, 1945 geboren, war Feuilleton-Chef der „Zeit“ und verantwortlicher Redakteur des Ressorts Literatur und ist nun Autor der „Zeit“. Als Gastprofessor lehrte er in Hamburg, Essen, Göttingen und St. Louis. Er ist Mitglied des PEN und war Präsident der Freien Akademie der Künste in Hamburg. Seine jüngsten Buchveröffentlichungen sind „Das Leben und die Dinge: Alphabetischer Roman“ (2015), „Heimatlos – Bekenntnisse eines Konservativen“ (2017) und „Dienstboten – Von den Butlern bis zu den Engeln“ (2022). 2015 wurde er mit dem Tractatus-Preis für philosophische Essayistik ausgezeichnet. Die im Terzett besprochenen Bücher wurden von den drei Diskutanten des Abends vorgeschlagen und im Vorhinein gelesen. Es sind dies: Tomáš Halík Der Nachmittag des Christentums. Eine Zeitansage Jon Fosse Ich ist ein anderer Hans Joas Warum Kirche? Selbstoptimierung oder Glaubensgemeinschaft. Annette Schavan, Jan-Heiner Tück und Ulrich Greiner diskutierten am 13.9.2022 beim Theologischen Terzett in der Katholischen Akademie in Bayern.

Gespräch zum Thema 'Technik gegen Hunger?'
Weltweit hungern über 800 Millionen Menschen. Zwei Milliarden leiden zudem unter „verborgenem Hunger“ – sie nehmen genug Kalorien zu sich, aber unzureichend Vitamine und Spurenelemente. Die Antwort auf die Frage nach den richtigen Strategien für eine globale Sicherung der Ernährungsmöglichkeiten umfasst neben Aspekten der Verteilung, klimabedingter Änderungen von Anbaustrategien und des Transfers von Know-How auch technologische Innovationen. Dabei beschränken sich neue Technologien nicht auf den Einsatz in konventionellen Großbetrieben: auch der ökologische Landbau bis hin zu Kleinbauern in entlegenen Regionen dieser Welt können davon profitieren. An diesem Abend sollen verschiedene Ansätze zur Sicherung der Welternährung vorgestellt und anhand von Beispielen diskutiert werden. Impulse und Podium: - Dr. Sabine Gerber-Hirt, Kuratorin, Deutsches Museum - Dominik Heinrich, Director of Innovation beim World Food Programme (WFP) - Dr. Eberhard Nacke, Director Corporate Product Strategy, CLAAS KGaA mbH Moderation: Prof. Dr. Bernhard Bleyer, Professor für Theologische Ethik, Universität Passau. Das Gespräch 'Technik gegen Hunger?' wurde am 24.5.2022 von den Kooperationspartnern Deutsches Museum, acatech und der Katholischen Akademie in Bayern veranstaltet.

Rüdiger Safranski über E.T.A. Hoffmann
Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann (1776–1822) war ein Spätentwickler, obwohl er schon früh als musikalisches Wunderkind galt. Bereits als junger Bursche hatte er zwei stattliche Romane in der Schublade liegen, und das „A“ in E. T. A. steht ganz unbescheiden für Wolfgang Amadeus Mozart. Sein literarisches Debüt gibt er mit 33 Jahren - Ritter Gluck heißt die Erzählung, die an einen toten Komponisten erinnern soll. Beglückt und geplagt von Anspruchsphantasien wählt Hoffmann aber zunächst einen Brotberuf beim preußischen Staat, der ihn wegen seiner Streiche immer tiefer ins annektierte Polen verbannt. Als Musikdirektor in Bamberg scheitert er anschließend kläglich, stattdessen wird er Kapellmeister im belagerten Dresden. In Berlin avanciert er schließlich zum erfolgreichen Schriftsteller und einflussreichen Juristen, bis er sich verwundert die Augen reibt: Und das soll es gewesen sein? Auch 200 Jahre nach seinem Tod lädt E. T. A. Hoffmann zum Wundern und Staunen ein. So wählt sich unsere diesjährige Sommernacht der Künste Rüdiger Safranski zum Bündnispartner, der mit seiner neu aufgelegten Biographie dem Geheimnis des „entfesselten Romantikers“ (Safranski) auf die Schliche zu kommen glaubt. Prof. Dr. Rüdiger Safranski referierte zum 200. Todestag von E.T.A. Hoffmann am 30.6.2022 in der Katholischen Akademie in Bayern.

Eva Orthmann: Wissenschaft und Bildung zur Blütezeit des Islam
Mit dem Missionsbefehl am Ende des Matthäus-Evangeliums erteilt der auferstandene Jesus seinen Jüngern den Auftrag, zu den Völkern der Erde zu gehen und diese den Glauben zu lehren. Dadurch steht das Christentum von Anfang an unter einer methodischen Spannung, denn einerseits lässt die „Lehre“ das Christentum zur Bildungsreligion werden, andererseits sprengt der „Glaube“ die Exklusivität einer Religion der Gebildeten. So erzählt die Entwicklung des Christentums stets auch die Geschichte des Umgangs mit der Spannung zwischen Glauben und Wissen: die Geschichte der religiösen Bildung. Mit unserer diesjährigen Kooperationsveranstaltung mit Welt und Umwelt der Bibel wollen wir diese Geschichte nacherzählen und nachvollziehen. Über drei Tage verteilt nehmen wir dabei aber nicht nur das heranwachsende junge Christentum in den Blick, sondern bahnen uns von der arabischen Gelehrtentradition der Jahrtausendwende über das Mittelalter Meister Eckharts einen Weg mitten ins Herz der europäischen Aufklärung, wo sich der Streit um die rechte Vereinbarkeit von Wissen und Glauben am Phänomen der Kunst neu entzündet. Prof. Dr. Eva Orthmann ist Professorin für Islamwissenschaft und Iranistik an der Georg-August-Universität Göttingen. Sie referierte zum Thema 'Wissenschaft und Bildung zur Blütezeit des Islam' im Rahmen der Veranstaltung „Was ist religiöse Bildung?“, 20.10. - 22.10.2022, in der Katholischen Akademie in Bayern.

Dirk Heißerer: Thomas Mann über religiöse Bildung
Mit dem Missionsbefehl am Ende des Matthäus-Evangeliums erteilt der auferstandene Jesus seinen Jüngern den Auftrag, zu den Völkern der Erde zu gehen und diese den Glauben zu lehren. Dadurch steht das Christentum von Anfang an unter einer methodischen Spannung, denn einerseits lässt die „Lehre“ das Christentum zur Bildungsreligion werden, andererseits sprengt der „Glaube“ die Exklusivität einer Religion der Gebildeten. So erzählt die Entwicklung des Christentums stets auch die Geschichte des Umgangs mit der Spannung zwischen Glauben und Wissen: die Geschichte der religiösen Bildung. Mit unserer diesjährigen Kooperationsveranstaltung mit Welt und Umwelt der Bibel wollen wir diese Geschichte nacherzählen und nachvollziehen. Über drei Tage verteilt nehmen wir dabei aber nicht nur das heranwachsende junge Christentum in den Blick, sondern bahnen uns von der arabischen Gelehrtentradition der Jahrtausendwende über das Mittelalter Meister Eckharts einen Weg mitten ins Herz der europäischen Aufklärung, wo sich der Streit um die rechte Vereinbarkeit von Wissen und Glauben am Phänomen der Kunst neu entzündet. Doch wie verhält sich dazu etwa der Künstler Thomas Mann, der religiöse Bildung mit ironischer Distanz verknüpft? Und wie steht es um uns selbst? Haben wir wir heute verlernt, den Glauben zu lehren? Unsere Tagung will die Antwort geben. Dr. Dirk Heißerer ist Vorsitzender des Thomas Mann Forums München e. V. Der vollständige Titel seines Vortrags lautet: „Was ist das?“ oder von „Gottes Gemütsart“ – Religiöse Bildung in den Romanen Thomas Manns. Er referierte zum Thema 'Thomas Mann über religiöse Bildung' im Rahmen der Veranstaltung „Was ist religiöse Bildung?“, 20.10. - 22.10.2022, in der Katholischen Akademie in Bayern.

Podiumsdiskussion zum Thema 'Pilgern tut gut'
Der Podcast dokumentiert die Podiumsdiskussion "Pilgern tut gut" und gibt einige Statements von Pilgerinnen und Pilgern wieder. Die Jahrestagung der Deutschen St. Jakobus-Gesellschaft dreht sich um die immanente und dynamische Verbindung von Pilgern mit Heil und Heilung. Die immer aktuelle Frage, warum Pilgern guttut, steht dahinter. Unterschiedliche Zugänge zu diesen zentralen Aspekten des Pilgerns sollen hier vorgestellt und gemeinsam diskutiert werden: Von der Philosophie über Theologie, Medizin und Psychologie bis zur Geschichte. Dabei spielen die kulturhistorischen Vorträge eine verbindende Rolle. Hier geht es um Pilgerliturgie und Wunderberichte, Heilungserfahrungen und Ablässe, Heilige Jahre, heilige Orte und geistiges Pilgern. Bei der Veranstaltung im Kloster Benediktbeuern (23.-26.9.2021) waren die Diskutanten auf dem Podium: Dr. Sabrina Han, Köln, Michael Kaminski, München, Prof. Dr. Wilhelm Schmid, Berlin, Wolfgang M. Schneller, Oberdischingen, Sabrina Späth M.A., Nürnberg. Die Moderation übernahm Barbara Massion.

Markus May: 250 Jahre Novalis
Am 2. Mai 2022 jährte sich der Geburtstag des Dichters Novalis zum 250. Mal. Seine Hymnen an die Nacht und Geistlichen Lieder markieren nicht nur einen Höhepunkt religiöser Dichtung der Frühromantik, sie sind auch Ausdruck einer Sehnsucht nach Erfüllung in der Transzendenz. Literaturwissenschaftler Prof. Dr. Markus May und Lyrikerin Nora Gomringer versuchen, dem Geheimnis Friedrich von Hardenbergs auf die Schliche zu kommen. Prof. Dr. Markus May referierte am 2.5.2022 in der Katholischen Akademie in Bayern.

Herfried Münkler: Der Wandel der Weltordnung und die Folgen für Europa
Der russische Angriff auf die Ukraine hat die vor allem in Deutschland erhoffte regelbasierte, wertegestützte und normgetriebene Weltordnung in weite Ferne gerückt. Von einem institutionalisierten Vertrauen, das durch wechselseitige wirtschaftliche Abhängigkeit gestützt wurde, haben wir uns in ein generalisiertes Misstrauen hineinbewegt, das durch verstärkte Aufwendungen für militärische Fähigkeiten getragen ist. Aber der 24. Februar dieses Jahres ist nicht das einzige Ereignis, das die Vorstellungen von einer friedlichen Weltordnung beschädigt hat. Die Bilder vom Flughafen in Kabul beim Rückzug der westlichen Streitkräfte stehen für die Absage an die Bereitschaft des Westens, seinen Vorstellungen von Menschenrechten globale Geltung zu verschaffen. Der Westen hat die afghanischen Frauen ihrem Schicksal überlassen. Er zieht sich in seine eigene Hemisphäre zurück, während sich China überwiegend mit wirtschaftlicher Macht und Russland mit militärischer Gewalt neue Einflusssphären verschaffen. Die Weltordnung, die im Entstehen begriffen ist, wird eine der großen Mächte mitsamt ihrer Einflusssphären und Peripherien sein. Was aber heißt das für die EU und Europa? Dieser zentralen Fragestellung wollen wir uns am Abend des 12. Septembers widmen. Der Berliner Politikwissenschaftler Prof. Dr. Herfried Münkler wird uns dabei aber nicht nur die vielschichtigen Hintergründe zur aktuellen Lage erläutern, sondern auch die großen Herausforderungen benennen, vor welchen Europa und damit wir alle gemeinsam stehen. Denn die Bewertung der weltpolitischen Lage berührt auch die Frage, wie wir in Zukunft eigentlich leben wollen. Oder sollten wir besser fragen: Wie wir noch leben können? Prof. Dr. Herfried Münkler ist Prof. em. für Theorie der Politik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Der Titel seines Vortrags lautet: "Nach dem Ukrainekrieg: Der Wandel der Weltordnung und die Folgen für Europa". Er sprach am 12.9.2022 in der Katholischen Akademie in Bayern.

Gespräch zum Thema 'Die sozial-ökologische Transformation - als Chance für Wirtschaft und Unternehmen begreifen'
Kontrovers aber konstruktiv diskutierten Vertreter:innen aus Wirtschaft, Gewerkschaft und Wissenschaft am 14. Mai 2024 die sozial-ökologische Transformation. Auf Einladung der Katholischen Akademie und der Deutschen Kommission Justitia et Pax ging es um die Fragen, wie Wirtschaft und Unternehmen die unvermeidlichen Änderungen als Chance begreifen, wie Wohlstand erhalten oder sogar vermehrt werden kann oder ob nicht doch auch Verzicht nötig ist. Die sozial-ökologische Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft zielt auf ein gutes Zusammenleben aller Menschen in der Gegenwart und Zukunft unter Wahrung der planetarischen Grenzen ab. Der „Umbau des Schiffes auf hoher See“ (Otto Neurath) ist dabei keine unerreichbare Aufgabe, sondern eine realistische Zukunftsoption. Die Transformation hin zu einer CO2-neutralen Wirtschaft lässt dabei keinen Haushalt und kein Unternehmen in Deutschland unberührt. Wie kann diese sozial-ökologische Transformation gelingen? Die mit der Transformation verbundenen Herausforderungen und Chancen für die Wirtschaft und für Unternehmen wurden auch mit den Teilnehmer:innen im Rahmen des Podiumsgesprächs „Die sozial-ökologische Transformation – als Chance für Wirtschaft und Unternehmen begreifen!“ reflektiert und diskutiert. Die Veranstaltung eröffnete die ab jetzt jährlich stattfindende Reihe „Forum for Future and Transformation“. Dabei werden unterschiedliche Dimensionen der sozial-ökologischen Transformation mit Vertreter:innen aus der Wirtschaft analysiert und diskutiert werden. Das Gespräch zum Thema 'Die sozial-ökologische Transformation - als Chance für Wirtschaft und Unternehmen begreifen' fand am 14.5.2024 in der Katholischen Akademie in Bayern statt. Nach der Begrüßung durch Dr. Martin Dabrowski, Studienleiter, Katholische Akademie in Bayern, und der Einführung durch Dr. Jörg Lüer, Deutsche Kommission Justitia et Pax, diskutierten auf dem Podium: - Dr. Thomas M. Fischer, Allfoye Managementberatung GmbH - Dr. Marcel Pietsch, PNZ-Produkte GmbH – Manufaktur für ökologischen Holzschutz und natürliche Wandfarben - Bernhard Stiedl, Deutscher Gewerkschaftsbund Bayern - Dr. Sonja Stuchtey, The Landbanking Group – for the Value in Nature - Prof. Dr. Dr. Johannes Wallacher, Professor für Sozialwissenschaften und Wirtschaftsethik, Hochschule für Philosophie München Moderation: Anja Keber, Wirtschaftsredakteurin, Bayerischer Rundfunk. Die Katholische Akademie in Bayern ist eine selbstständige kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts. Die bayerischen Bischöfe haben die Akademie 1957 als unabhängige Denkwerkstatt gegründet und finanzieren sie bis heute, ohne auf ihre Arbeit Einfluss zu nehmen. Mit ihrer Satzung erhielt sie den Auftrag, „die Beziehungen zwischen Kirche und Welt zu klären und zu fördern“. Unser Themenspektrum umfasst Religion und Politik, Naturwissenschaft und Technik, Geschichte und Philosophie, Kunst und Kultur.

Herfried Münkler und Jean Asselborn diskutieren die neue multipolare Weltordnung
In ihren Referaten analysierten der bekannte Politikwissenschaftler Herfried Münkler und der ehemalige luxemburgische Außenminister und Vollblut-Europäer Jean Asselborn, welche Risiken die sich dramatisch veränderte Weltlage - besonders, aber nicht nur für die EU - mit sich bringt. Auf dem Podium am 10.4.2024 in der Katholischen Akademie in Bayern diskutierten sie im Rahmen dieses Beitrags das Thema mit dem Publikum; Moderation: Martin Dabrowski, Studienleiter bei der Katholischen Akademie in Bayern.

Herfried Münkler zur neuen multipolaren Weltordnung
Über Jahrzehnte war die Welt während des Kalten Krieges von zwei Machtblöcken und gegensätzlichen politisch-wirtschaftlichen Systemen geprägt und damit bipolar strukturiert. Spätestens seit den russischen Überfällen auf die Ukraine ist klar, dass die bisherige Weltordnung an ihr Ende gekommen ist. Aktuell hat sich ein System regionaler Einflusszonen herausgebildet, das im Wesentlichen von fünf Machtzentren dominiert wird: den USA, der Europäischen Union, Russland, China und Indien. In seinem Referat am 10.4.2024 in der Katholischen Akademie in Bayern analysiert der bekannte Politikwissenschaftler, welche Risiken die sich dramatisch veränderte Weltlage - besonders, aber nicht nur für die EU - mit sich bringt.

Jean Asselborn zur neuen multipolaren Weltordnung
Über Jahrzehnte war die Welt während des Kalten Krieges von zwei Machtblöcken und gegensätzlichen politisch-wirtschaftlichen Systemen geprägt und damit bipolar strukturiert. Spätestens seit den russischen Überfällen auf die Ukraine ist klar, dass die bisherige Weltordnung an ihr Ende gekommen ist. Aktuell hat sich ein System regionaler Einflusszonen herausgebildet, das im Wesentlichen von fünf Machtzentren dominiert wird: den USA, der Europäischen Union, Russland, China und Indien. In seinem Referat am 10.4.2024 in der Katholischen Akademie in Bayern analysiert der ehemalige luxemburgische Außenminister und Vollblut-Europäer, welche Risiken die sich dramatisch veränderte Weltlage - besonders, aber nicht nur für die EU - mit sich bringt.

Theologisches Terzett mit Annette Schavan, Jan-Heiner Tück und Hans Joas
Der Religionssoziologe Hans Joas war zu Gast bei Annette Schavan und Jan-Heiner Tück. Beim Theologischen Terzett am 9. April 2024 besprachen sie drei spannende Bücher zu Philosophie, Religion und Glauben: Otfried Höffe, Die hohe Kunst des Verzichts. Kleine Philosophie der Selbstbeschränkung Sebastian Kleinschmidt, Kleine Theologie des Als ob Carl Schmitt, Römischer Katholizismus und politische Form. Die Katholische Akademie in Bayern ist eine selbstständige kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts. Die bayerischen Bischöfe haben die Akademie 1957 als unabhängige Denkwerkstatt gegründet und finanzieren sie bis heute, ohne auf ihre Arbeit Einfluss zu nehmen. Mit ihrer Satzung erhielt sie den Auftrag, „die Beziehungen zwischen Kirche und Welt zu klären und zu fördern“. Unser Themenspektrum umfasst Religion und Politik, Naturwissenschaft und Technik, Geschichte und Philosophie, Kunst und Kultur.

Gespräch der Soziologen Heinz Bude und Armin Nassehi zum Thema 'Was hält unsere Gesellschaft zusammen?'
In einem Gesprächsabend entwickelten die beiden Soziologen Heinz Bude und Armin Nassehi ein politisches Panorama, das nicht sehr hoffnungsvoll ist. Gesellschaften, so eine These, werden nicht von Werten zusammengehalten sondern von ihren Problemen. Deren gibt es viele! Wir schlittern von einer Krise in die nächste zu schlittern: Corona-Pandemie, Klima-Katastrophe, Kriege an den Rändern Europas und ihre Folgen strapazieren auch das Zusammenleben hierzulande. Der Ton des gesellschaftlichen Diskurses wird ruppiger, gerade wenn es um das Thema Migration geht. Rechte Parteien erstarken, Demokratie und Rechtsstaat wirken auf einmal verletzlich. Sehen und hören Sie, was die beiden Experten raten, um die Gesellschaft zu retten. Das Gespräch der Soziologen Heinz Bude und Armin Nassehi zum Thema 'Was hält unsere Gesellschaft zusammen?' fand am 8.5.2024 in der Katholischen Akademie in Bayern statt.

Klaus Naumann: Der Verlauf des Ersten Weltkriegs von 1914 bis 1918
„Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ – so hat bekanntlich der US-amerikanische Historiker und Diplomat George F. Kennan den Ersten Weltkrieg bezeichnet. In vielerlei Hinsicht markiert er eine einschneidende Zäsur der deutschen und europäischen Geschichte. Im August 1914 – mitten in einer Epoche des unbedingten Fortschrittsglaubens – entzündete er sich. Die machtpolitischen Gegensätze der hochgerüsteten europäischen Großmächte entluden sich mit ungeahnter Wucht, blutige Materialschlachten bis dahin nicht gekannten Ausmaßes und zermürbende Stellungskriege wurden Sinnbilder des Großen Krieges. Tiefgreifende Erschütterungen aller bisherigen Lebenswirklichkeiten waren die Folgen: Die machtpolitische Dominanz Europas endete, und die europäische Landkarte wurde grundlegend verändert. Drei Kaiserreiche verschwanden, neue Staaten entstanden, und aus revolutionären Umstürzen gingen neue Regierungssysteme hervor. Wie hatten am Vorabend des Krieges die politischen Konstellationen in Europa ausgesehen? Welche Haltung nahmen die Katholiken und ihre Kirche ein, die sich im noch nicht lange zurückliegenden Kulturkampf deutlich gegen das preußisch dominierte Kaiserreich profiliert hatten? Und wie ist ein Verständnis dessen möglich, was durch den Ersten Weltkrieg angerichtet wurde, in dem die Ordnungen, Normen, Werte und Erfahrungen der alten Zeit vor 1914 aus den Fugen gerieten und schlagartig zerbrachen? Fragen und Erinnerungen, die 100 Jahre später überraschend aktuell anstehen. General a. D. Klaus Naumann, ehemaliger Chef des Nato-Militärausschusses und zuvor Generalinspekteur der Bundeswehr, zeichnete einen sehr genauen Verlauf des Krieges von 1914 bis 1918. Besonders stellte er heraus, dass mannigfaltige Chancen für einen Friedensschluss nicht genutzt worden seien. Parallelen zu heute wollte Klaus Naumann im Gegensatz zu vielen anderen Analysten allerdings nicht sehen. Er referierte am 17.03.2014 in der Katholischen Akademie in Bayern.

Otfried Höffe: Verzicht - (k)eine Utopie
In der Tradition der philosophischen und theologischen Ethik sowie der Praxis der Weltreligionen spielen verschiedene Formen des Verzichts eine erhebliche Rolle. Diesen Befund mag man nun begrüßen oder nicht - auf unsere Gegenwart lässt er sich jedenfalls nicht eins zu eins übertragen. Denn obwohl auch säkulare Zeitgenossen noch vor oder an christlichen oder jüdischen Feiertagen spenden oder fasten - Muslime tun gar beides im Monat Ramadan -, so ist das Stichwort des Verzichts (ebenso wie die Umfeldausdrücke der Askese und des Fastens) aus der öffentlichen Diskussion so gut wie verschwunden. Zusammen mit dem Philosophen Prof. Dr. Otfried Höffe aus Tübingen und dem Moraltheologen Dr. Werner Veith aus München möchten wir dieser Tatsache aktiv entgegenwirken und die Logik des Verzichts neu ins Bewusstsein heben. Dabei werden wir jedoch keiner lebensfernen Utopie das Wort reden, sondern die Sachgründe zu erörtern suchen, die für eine Wiederentdeckung und Wiederbelebung des Verzichts sowie der ihm zugeordneten Tugend der Besonnenheit sprechen. Allein die zahlreichen Probleme der Gegenwart - denken wir beispielsweise an die Impfstoffverteilung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie oder an die Bedrohung der globalen Ressourcenknappheit - fordern uns auf, den traditionellen Diskussionsrahmen einer personalen Ethik auf eine soziale und politische Ethik hin zu erweitern. Denn: „Will die moderne Zivilisation menschenwürdig überleben, benötigt sie ein erhebliches Maß sowohl an persönlichen als auch an einer wirtschaftlich- und gesellschaftspolitischen, nicht zuletzt an einer global wirksamen Besonnenheit“ (Otfried Höffe). Prof. Dr. Otfried Höffe ist emeritierter Professor für Ethik, Politische Philosophie und Philosophie an den Universitäten Fribourg (Schweiz) und Tübingen. Er sprach am 10.11.2021 in der Katholischen Akademie in Bayern.