
InFact - Der HZI-Podcast. Wissenschaft, die ansteckt.
Wie lösen Bakterien und Viren Krankheiten aus? Wie wehrt sich unser Immunsystem dagegen? Und was müssen Wirkstoffe können, um gefährliche Infektionen zu bekämpfen? Am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung – kurz HZI - wird nach Antworten auf diese Fragen gesucht. Wie diese Forschung funktioniert, wie die Ergebnisse in der Medizin genutzt werden und wer die Menschen sind, die hier forschen. Das hört ihr hier: Bei InFact - dem Podcast des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung.
Alle Folgen
New drugs enabled by artificial intelligence
At first glance, biology and computer science seem like opposites. In reality, however, computer science is something like a highly organized manager for modern biology: wherever enormous amounts of data are generated from research, progress is hardly possible without digital methods. Bioinformatician Prof. Andreas Keller therefore relies on artificial intelligence. He heads the Clinical Bioinformatics research group at the Helmholtz Institute for Pharmaceutical Research Saarland, or HIPS for short – an institute founded in 2009 by the Helmholtz Centre for Infection Research and Saarland University. In this episode of InFact, host Julia Demann talks to him about how AI can help us understand how beneficial and harmful bacteria communicate with each other in our bodies, how to predict when infections will cause long-term effects, and how this can be used to develop new drugs against dangerous pathogens.

Neue Medikamente dank künstlicher Intelligenz
Biologie und Informatik wirken auf den ersten Blick wie Gegensätze. In Wahrheit aber ist die Informatik für die moderne Biologie so etwas wie eine hochorganisierte Managerin: Überall dort, wo enorme Datenmengen aus der Forschung entstehen, wird ohne digitale Methoden kaum noch ein Fortschritt möglich. Bioinformatiker Prof. Andreas Keller setzt deshalb auf künstliche Intelligenz. Er leitet die Forschungsgruppe Klinische Bioinformatik am Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland, kurz HIPS – einem Institut, das 2009 vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung und der Universität des Saarlandes gegründet wurde. In dieser Folge von InFact spricht Host Julia Demann mit ihm darüber, wie KI helfen kann zu verstehen, wie nützliche und schädliche Bakterien in unserem Körper miteinander kommunizieren, wie sich vorhersagen lässt, wann Infektionen Spätfolgen auslösen – und wie man damit neue Medikamente gegen gefährliche Erreger entwickeln kann.

Phages – “bacteria eaters” against dangerous infections
In this episode of “InFact”, host Julia Demann talks to Jun. Prof. Jens Hör about a fascinating tool in the fight against resistant germs: Phages - viruses that specifically attack bacteria but are harmless to humans. Phages act like tiny, specialized hunters: They attach themselves to bacteria, inject their genetic material, and reprogram the cells so that they only produce phage genetic material – until they eventually burst and release new phages. In theory, this is a promising alternative to antibiotics, but in practice it poses a major challenge. This is because bacteria also develop their own defense strategies. At the Helmholtz Institute for RNA-based Infection Research (HIRI) in Würzburg, Jens Hör and his research group are investigating the role played by RNA phages in particular, how they differ from DNA phages – and what still needs to be done before phage therapies can be used nationwide in Germany.

Phagen - „Bakterienfresser“ gegen gefährliche Infektionen
In dieser Folge von „InFact“ spricht Host Julia Demann mit Jun.-Prof. Jens Hör über ein faszinierendes Werkzeug im Kampf gegen resistente Keime: Phagen – Viren, die gezielt Bakterien angreifen, für uns Menschen jedoch ungefährlich sind. Phagen wirken wie winzige, spezialisierte Jäger: Sie docken an Bakterien an, schleusen ihr Erbgut ein und programmieren die Zellen so um, dass diese nur noch Phagenerbgut produzieren – bis sie schließlich platzen und neue Phagen freisetzen. In der Theorie eine vielversprechende Alternative zu Antibiotika, in der Praxis jedoch eine große Herausforderung. Denn auch Bakterien entwickeln eigene Abwehrstrategien. Am Helmholtz-Institut für RNA-basierte Infektionsforschung (HIRI) in Würzburg untersucht Jens Hör mit seiner Forschungsgruppe, welche Rolle vor allem RNA-Phagen spielen, wie sie sich von DNA-Phagen unterscheiden – und was noch geschehen muss, damit Phagen-Therapien in Deutschland flächendeckend eingesetzt werden können.

One Health: Healthy environment - healthy animals - healthy people
In this episode of InFact, host Julia Demann talks to Prof. Dr. Fabian Leendertz about how zoonoses, or diseases that jump from animals to humans, develop, and why protecting the environment is central to this process. Leendertz explains how habitat loss, climate change, and globalization create new transmission routes for pathogens, and he discusses why humans, animals, and nature must be considered together. At the Helmholtz Institute for One Health (HIOH), Leendertz and his team research how to identify infection risks early on, using data from African jungle regions and Mecklenburg-Western Pomerania. Their work focuses on the One Health approach, which links health research, ecology, and prevention to better prepare for future pandemics.

One Health: Gesunde Umwelt - gesunde Tiere - gesunde Menschen
In dieser Folge von „InFact“ spricht Host Julia Demann mit Prof. Dr. Fabian Leendertz darüber, wie Krankheiten entstehen, die vom Tier auf den Menschen überspringen – sogenannte Zoonosen – und warum der Schutz der Umwelt dabei eine zentrale Rolle spielt. Leendertz erklärt, wie Lebensraumverlust, Klimawandel und Globalisierung neue Übertragungswege für Krankheitserreger schaffen, und warum Mensch, Tier und Natur nur gemeinsam gedacht werden können. Am Helmholtz-Institut für One Health (HIOH) erforschen er und sein Team, wie sich Infektionsrisiken frühzeitig erkennen lassen – mit Daten aus afrikanischen Dschungelregionen ebenso wie aus Mecklenburg-Vorpommern. Im Mittelpunkt steht der One-Health-Ansatz: ein Konzept, das Gesundheitsforschung, Ökologie und Prävention miteinander vernetzt, um besser auf zukünftige Pandemien vorbereitet zu sein.

Autoimmunerkrankungen: Wenn dein Körper zum Feind wird
In dieser Folge von „InFact“ spricht Host Julia Demann mit Dr. Dr. Theresa Graalmann darüber, warum unser Immunsystem manchmal den falschen Gegner wählt und wie die Forschung am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) Menschen mit Autoimmunerkrankungen neue Hoffnung gibt. Theresa Graalmann erklärt, wie Rheuma, Lupus oder vaskuläre Entzündungen entstehen, welche Organe besonders leiden und welche Rolle Infektionen, Ernährung und Suchtstoffe wie Nikotin als Auslöser oder Verstärker spielen. Vor allem aber zeigt sie, wie eng Ärzt:innen und Wissenschaftler:innen am HZI und seinem Partnerinstitut TWINCORE zusammenarbeiten. Patientendaten und modernste Zellanalysen fließen hier direkt in die Entwicklung neuer Therapieansätze ein, so dass Laborerkenntnisse schneller am Krankenbett ankommen.

Autoimmune diseases: When your body becomes the enemy
In this episode of "InFact", host Julia Demann talks to Dr. Dr. Theresa Graalmann about why our immune system sometimes chooses the wrong enemy: Its own body. They also discuss how research at the Helmholtz Centre for Infection Research (HZI) is giving new hope to people with autoimmune diseases. Theresa Graalmann talks about how rheumatism, lupus, and vascular inflammation develop. She also talks about which organs are most affected and the role that infections, diet, and addictive substances like nicotine play in causing or worsening these conditions. Most importantly, it shows how closely medical doctors and scientists work together at the HZI and its partner institute TWINCORE. The development of new treatments is based on patient data and cutting-edge cell analyses. This means that laboratory findings reach the patient's bedside more quickly.

Mini-Organe, große Wirkung: Wie Organoide die Infektionsforschung revolutionieren
In dieser Folge von HZI InFact spricht Dr. Kristin Metzdorf, stellvertretende Leiterin der Abteilung "Innovative Organoid-Forschung" am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI), über ein zukunftsweisendes Werkzeug der biomedizinischen Forschung: Organoide. Diese winzigen, organähnlichen Zellstrukturen werden aus Stammzellen gezüchtet – und eröffnen völlig neue Möglichkeiten, um Infektionskrankheiten auf menschlichem Gewebe zu untersuchen. Was genau sind Organoide? Wie werden sie im Labor hergestellt? Und warum könnten sie in Zukunft Tierversuche ersetzen und zur Entwicklung neuer Therapien beitragen? Themen der Folge: • Was Organoide eigentlich sind – und warum sie nicht einfach nur „Mini-Organe“ sind • Wie ein Roboter namens Molly hilft, Zellkulturen vollautomatisch herzustellen • Warum Organoide ideal für die Erforschung von Viren und Bakterien geeignet sind • Wie sich Infektionsverläufe realitätsnah im Labor nachstellen lassen • Welche Rolle sie in der personalisierten Medizin der Zukunft spielen • Warum Organoide helfen können, Tierversuche zu reduzieren Exklusive Einblicke: Dr. Metzdorf berichtet, wie ihre Abteilung in kürzester Zeit eine automatisierte Organoid-Plattform aufgebaut hat – und warum internationale Kooperationen eine entscheidende Rolle für den Erfolg spielen. Außerdem erklärt sie, weshalb Organoide besonders geeignet sind, um komplexe Infektionsprozesse wie bei SARS-CoV-2 oder Tuberkulose besser zu verstehen – und wie sie selbst von der Neurobiologie zur Infektionsforschung gekommen ist. Begriffserklärungen: Organoid: Eine dreidimensionale Zellstruktur, die im Labor aus Stammzellen gezüchtet wird und Eigenschaften eines bestimmten menschlichen Organs imitiert – z. B. Darm, Herz oder Gehirn. Pluripotente Stammzellen: Zellen, die sich noch in fast jeden Zelltyp des menschlichen Körpers entwickeln können. S3-Labor: Ein Hochsicherheitslabor für den Umgang mit gefährlichen Krankheitserregern wie SARS-CoV-2 oder Mykobakterien. #Podcast #Organoide #Infektionsforschung #Stammzellen #Biomedizin #Mikrobiologie #HZIInfact #Wissenschaft #ZukunftMedizin #MollyDerRoboter

Mini organs, big impact: How organoids are revolutionizing infection research
In this episode of HZI InFact, Dr Kristin Metzdorf, Deputy Head of the Department "Innovative Organoid Research" at the Helmholtz Centre for Infection Research (HZI), talks about a pioneering tool in biomedical research: organoids. These tiny, organ-like cell structures are grown from stem cells - and open up completely new possibilities for studying infectious diseases in human tissue. What exactly are organoids? How are they made in the lab? And why could they replace animal testing in the future and contribute to the development of new therapies? Topics of the episode: • What organoids are - and why they're not just 'mini-organs' • How a robot called Molly is helping to fully automate the production of cell cultures • Why organoids are ideal for studying viruses and bacteria • How infection processes can be realistically simulated in the lab • What role they will play in the personalized medicine of the future • Why organoids can help reduce animal testing Exclusive insights: Dr Metzdorf talks about how her department has built up an automated organoid platform in a very short time - and why international collaboration is crucial to its success. She also explains why organoids are particularly well suited to understanding complex infection processes such as SARS-CoV-2 or tuberculosis - and how she herself is inspired by neurobiology.

Influenza, long COVID & co: What impact do infections have on our brain and how can we protect ourselves
In this episode of HZI InFact, Prof. Martin Korte, head of the research group "Neuroinflammation and Neurodegeneration" at the Helmholtz Centre for Infection Research (HZI), discusses the links between infections, the immune system, and the brain. How do viruses and bacteria affect our cognitive abilities? What role do they play in neurodegenerative diseases like Alzheimer’s and dementia? And how can we protect our brain in the long term? Episode Topics: • Why some infections cause neurological long-term effects • How viruses and bacteria can indirectly attack our brain • The role of the blood-brain barrier in infections • Why the immune system affects the brain longer than other organs • How vaccinations can help prevent neurodegenerative processes • What measures keep the brain fit and healthy Exclusive Insights: Prof. Korte explains why the brain needs months to recover after an infection, even if the illness is over, and why older individuals are particularly at risk. He also shares practical tips on how everyone can actively protect their brain from infections and aging processes – from physical activity and healthy nutrition to lifelong learning. Glossary: Blood-Brain Barrier: A protective barrier between the bloodstream and the brain that shields the nervous system from harmful substances – but is not completely impenetrable. Microglial Cells: Specialized immune cells in the brain responsible for its protection and regeneration, but also involved in inflammatory responses. Sickness Behavior: A biological phenomenon that causes fatigue, lack of motivation, and social withdrawal during illness – an evolutionary defense mechanism of the body. #Podcast #Science #Neurology #LongCovid #InfectionResearch #BrainHealth #Alzheimer #Dementia #Immunology #HZIInfact

Grippe, Long COVID & Co: Wie Infektionen unser Gehirn beeinflussen und wie wir uns schützen können
In dieser Folge von HZI InFact spricht Prof. Martin Korte, Leiter der Arbeitsgruppe "Neuroinflammation und Neurodegeneration" am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI), über die Zusammenhänge zwischen Infektionen, dem Immunsystem und dem Gehirn. Wie beeinflussen Viren und Bakterien unser Denkvermögen? Welche Rolle spielen sie bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer und Demenz? Und wie können wir unser Gehirn langfristig schützen? Themen der Folge: • Warum einige Infektionen neurologische Langzeitfolgen haben • Wie Viren und Bakterien unser Gehirn indirekt angreifen können • Welche Rolle die Blut-Hirn-Schranke für Infektionen spielt • Warum das Immunsystem unser Gehirn länger beschäftigt als andere Organe • Wie Impfungen helfen können, neurodegenerativen Prozessen vorzubeugen • Welche Maßnahmen das Gehirn fit und gesund halten Exklusive Einblicke: Prof. Korte erklärt, warum das Gehirn auch nach einer überstandenen Infektion noch Monate benötigt, um sich zu regenerieren, und warum gerade ältere Menschen besonders betroffen sind. Außerdem gibt er praktische Tipps, wie jeder sein Gehirn aktiv vor Infektionen und Alterungsprozessen schützen kann – von Bewegung über gesunde Ernährung bis hin zu lebenslangem Lernen. Begriffserklärungen: Blut-Hirn-Schranke: Eine Barriere zwischen Blutkreislauf und Gehirn, die das Nervensystem vor schädlichen Stoffen schützt – aber nicht undurchdringlich ist. Mikrogliazellen: Spezialisierte Immunzellen des Gehirns, die für dessen Schutz und Regeneration verantwortlich sind, aber auch an Entzündungsreaktionen beteiligt sein können. Sickness Behavior: Ein biologisches Phänomen, das während einer Krankheit zu Müdigkeit, Antriebslosigkeit und sozialem Rückzug führt – eine evolutionäre Schutzreaktion des Körpers. #Podcast #Wissenschaft #Neurologie #LongCovid #Infektionsforschung #Hirngesundheit #Alzheimer #Demenz #Immunologie #HZIInfact

Wie sich Viren verbreiten - Mpox, Transmissionsimmunologie und globale Gesundheit
Im Mai 2022 sorgten Schlagzeilen für Unruhe: Eine mysteriöse, tödliche Krankheit breitete sich in Zentralafrika aus. War das der Beginn einer neuen Pandemie? Heute wissen wir: Es handelte sich um Mpox (ehemals Affenpocken), eine Viruserkrankung, die 2024 erneut zur gesundheitlichen Notlage erklärt wurde. In dieser Folge von HZI InFact spricht Dr. Julia Port, Leiterin der Forschungsgruppe „Transmissionsimmunologie“ am Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung (HZI), über die Übertragungswege von Viren und die Rolle des Immunsystems. Ihre Forschung verbindet Immunologie und Virusökologie mit globaler Gesundheit. Themen der Folge: • Warum die WHO erneut eine Gesundheitsnotlage wegen Mpox ausgerufen hat • Wie sich Mpox über verschiedene Übertragungswege verbreitet • Welche Rolle die Immunabwehr bei der Virusausbreitung spielt • Welche Berufe und Personengruppen besonders gefährdet sind • Welche Schutzmaßnahmen gegen zoonotische Viren wirklich helfen • Wie innovative Forschung helfen kann, zukünftige Pandemien besser zu verstehen Exklusive Einblicke Dr. Port erklärt, wie sie neue Tiermodelle zur Virusübertragung entwickelt, warum Schleimhäute eine entscheidende Rolle spielen und was wir aus der Mpox-Pandemie für andere Viren wie Influenza lernen können. Außerdem gibt sie Tipps für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und spricht über die Herausforderung, Forschung und Wissenschaftskommunikation zu verbinden. Jetzt reinhören und mehr über die Wissenschaft hinter Pandemien und Virusübertragungen erfahren. Begriffserklärungen: Klade: Eine Klade bezeichnet in der Biologie eine geschlossene Abstammungsgemeinschaft, die den letzten gemeinsamen Vorfahren und alle seine Nachfahren enthält. Preprint: Preprints sind Vorabversionen oder Manuskriptfassungen von wissenschaftlichen Publikationen, die der Fachwelt und der Öffentlichkeit in der Regel zur Verfügung gestellt werden, bevor sie wissenschaftlich begutachtet wurden. Diese Form der Veröffentlichung dient vor allem dem beschleunigten Austausch von Forschungsergebnissen. Preprints werden frei zugänglich auf Preprint-Servern veröffentlicht. #Podcast #Wissenschaft #Virologie #Mpox #Virusübertragung #Infektionsforschung #Zoonosen #Pandemieprävention #Immunologie #Helmholtz #HZIInfact

How Viruses Spread – Mpox, Transmission Immunology, and Global Health
In May 2022, alarming headlines emerged: A mysterious and deadly disease was spreading in Central Africa. Was this the beginning of a new pandemic? Today, we know that it was Mpox (formerly known as monkeypox), a viral disease that has once again been declared a public health emergency in 2024. In this episode of HZI InFact, Dr. Julia Port, head of the Research Group “Laboratory of Transmission Immunology” at the Helmholtz Centre for Infection Research (HZI), discusses virus transmission and the role of the immune system. Her research bridges immunology, viral ecology, and global health. Topics covered in this episode: • Why the WHO has once again declared a health emergency due to Mpox • How Mpox spreads through different transmission routes • The role of the immune system in viral transmission • Which professions and groups are particularly at risk • Which protective measures are truly effective against zoonotic viruses • How innovative research can help us better understand future pandemics Exclusive insights Dr. Port explains how she is developing new animal models for virus transmission, why mucous membranes play a crucial role, and what we can learn from the Mpox outbreak for other viruses such as influenza. She also shares advice for young scientists and discusses the challenge of bridging research and science communication. Tune in now to learn more about the science behind pandemics and viral transmission. Explanation of terms: Clade: In biology, a clade refers to a closed community of descent that contains the last common ancestor and all of its descendants. Preprint: Preprints are preliminary versions or manuscript versions of scientific publications that are usually made available to experts and the public before they have been scientifically reviewed. This form of publication is primarily used to accelerate the exchange of research results. Preprints are published freely accessible on preprint servers. #Podcast #Science #Virology #Mpox #VirusTransmission #InfectionResearch #Zoonoses #PandemicPrevention #Immunology #Helmholtz #HZIInfact

Krankenhauskeime – mit besserer Diagnostik zur schnellen Behandlung
Ein Krankenhaus ist der Ort, den viele Menschen nicht gerne aufsuchen, aber dankbar sind, wenn sie ihn brauchen. Es ist der Ort, an dem oft der Geruch von Desinfektionsmitteln in der Luft liegt. „Klinisch sauber“ wird es genannt. Doch gerade hier begegnet uns auch der Begriff „Krankenhauskeim“ – eine unheilvolle Erinnerung daran, dass ein Ort der Heilung gleichzeitig zur Gefahr für die Gesundheit werden kann. Krankheitsverursachende Keime, die so widerstandsfähig sind, dass oft nur noch wenige Medikamente gegen sie wirken. Die Rede ist von multiresistenten Bakterien. Doch wie entstehen diese gefährlichen Krankenhauskeime? Und vor allem: Wie kann man mit ihnen umgehen? Dies erforscht Prof. Susanne Häußler mit ihrer Arbeitsgruppe Molekulare Bakteriologie am HZI und Twincore in Hannover. In dieser Folge erfahrt ihr, wie Bakterien Strategien entwickeln, um multiresistent zu werden, wie Wissenschaftler diese Problematik untersuchen und was wir alle tun können, um uns sowie gefährdete Patienten vor diesen Keimen zu schützen.

Hospital-acquired infections – better diagnostics for rapid treatment
A Hospital. A place where you generally don't like to go, but are glad that it's there when you need it. A place that smells of disinfectant. It's called ‘clinically clean’. And then the inappropriate-sounding aliteration ‘hospital germ’. A place where you are supposed to get well becomes a threat to your health from pathogens that are often so persistent that there are hardly any effective drugs against them. Multi-resistant bacteria. How can that be? And above all: how can we deal with it? Prof Susanne Häußler and her Molecular Bacteriology research group at the HZI and the Twincore in Hanover are investigating this. In this episode, we talk about the clever strategies bacteria use to become multi-resistant hospital germs, how ways of dealing with them are being researched and what we can all do to protect ourselves and vulnerable patients from them.

Die neue Life-Science-Biologie
"Mit der Veranstaltung "Sounds und Science – Musik und Infektionen" tragen wir die Wissenschaft des HZI aus dem Elfenbeinturm und verknüpfen sie mit Musik, um komplexe wissenschaftliche Themen einem breiten Publikum zugänglich zu machen", erklärt Prof. Josef Penninger, Wissenschaftlicher Geschäftsführer des HZI und Initiator der Idee, die Wiener Musiker nach Braunschweig zu holen. „Kunst und Wissenschaft teilen die Prinzipien von Kreativität und Originalität. Dieses Format bietet eine einzigartige Möglichkeit, wissenschaftliche Erkenntnisse sowohl emotional als auch intellektuell zu vermitteln. Es hat sich bereits in Wien und Vancouver bewährt und bietet dem Publikum ein tiefgehendes und bewegendes Erlebnis, das Forschung und Musik vereint“, so Penninger weiter. „Unser besonderer Dank gilt dem Förderverein des HZI, der die Verwirklichung dieses außergewöhnlichen Projekts möglich gemacht hat.“ MODERATION 1. Andreas Pietschmann (Schauspieler und Sprecher) STREICHQUARTETT: 2. Rainer Honeck (Violine) 3. Rémy Ballot (Violine) 4. Hans Peter Ochsenhofer (Viola) 5. Manfred Hecking (Kontrabass) WISSENSCHAFTLER:INNEN: 6. Prof. Kathrin de la Rosa 7. Prof. Melanie Brinkmann 8. Prof. Thomas Pietschmann 9. Prof. Josef Penninger 10. Prof. Martin Korte Mehr zum Thema Forschung am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung findet ihr im Netz unter: https://www.helmholtz-hzi.de/de/ Arbeiten und Forschen am HZI: https://www.helmholtz-hzi.de/de/karriere/ Wer mehr zum Thema Keime, Antibiotikaresistenzen oder Erkrankungen, die durch Viren und Bakterien verursacht werden lernen will, der kann sich in unserem Wissensportal informieren: https://www.helmholtz-hzi.de/wissen/wissensportal/
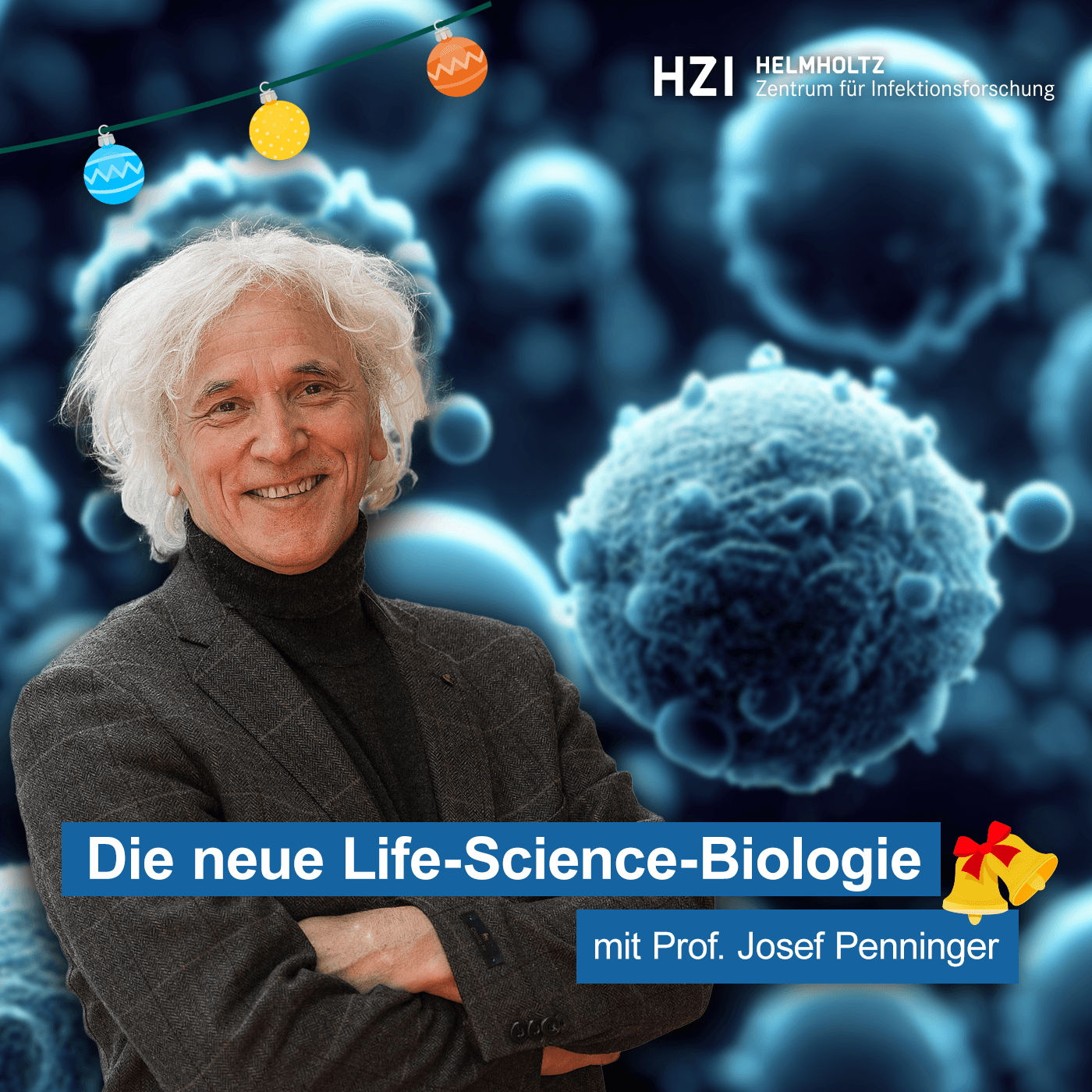
Brahms, Strauss und das gesunde Altern
"Mit der Veranstaltung "Sounds und Science – Musik und Infektionen" tragen wir die Wissenschaft des HZI aus dem Elfenbeinturm und verknüpfen sie mit Musik, um komplexe wissenschaftliche Themen einem breiten Publikum zugänglich zu machen", erklärt Prof. Josef Penninger, Wissenschaftlicher Geschäftsführer des HZI und Initiator der Idee, die Wiener Musiker nach Braunschweig zu holen. „Kunst und Wissenschaft teilen die Prinzipien von Kreativität und Originalität. Dieses Format bietet eine einzigartige Möglichkeit, wissenschaftliche Erkenntnisse sowohl emotional als auch intellektuell zu vermitteln. Es hat sich bereits in Wien und Vancouver bewährt und bietet dem Publikum ein tiefgehendes und bewegendes Erlebnis, das Forschung und Musik vereint“, so Penninger weiter. „Unser besonderer Dank gilt dem Förderverein des HZI, der die Verwirklichung dieses außergewöhnlichen Projekts möglich gemacht hat.“ MODERATION 1. Andreas Pietschmann (Schauspieler und Sprecher) STREICHQUARTETT: 2. Rainer Honeck (Violine) 3. Rémy Ballot (Violine) 4. Hans Peter Ochsenhofer (Viola) 5. Manfred Hecking (Kontrabass) WISSENSCHAFTLER:INNEN: 6. Prof. Kathrin de la Rosa 7. Prof. Melanie Brinkmann 8. Prof. Thomas Pietschmann 9. Prof. Josef Penninger 10. Prof. Martin Korte Mehr zum Thema Forschung am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung findet ihr im Netz unter: https://www.helmholtz-hzi.de/de/ Arbeiten und Forschen am HZI: https://www.helmholtz-hzi.de/de/karriere/ Wer mehr zum Thema Keime, Antibiotikaresistenzen oder Erkrankungen, die durch Viren und Bakterien verursacht werden lernen will, der kann sich in unserem Wissensportal informieren: https://www.helmholtz-hzi.de/wissen/wissensportal/
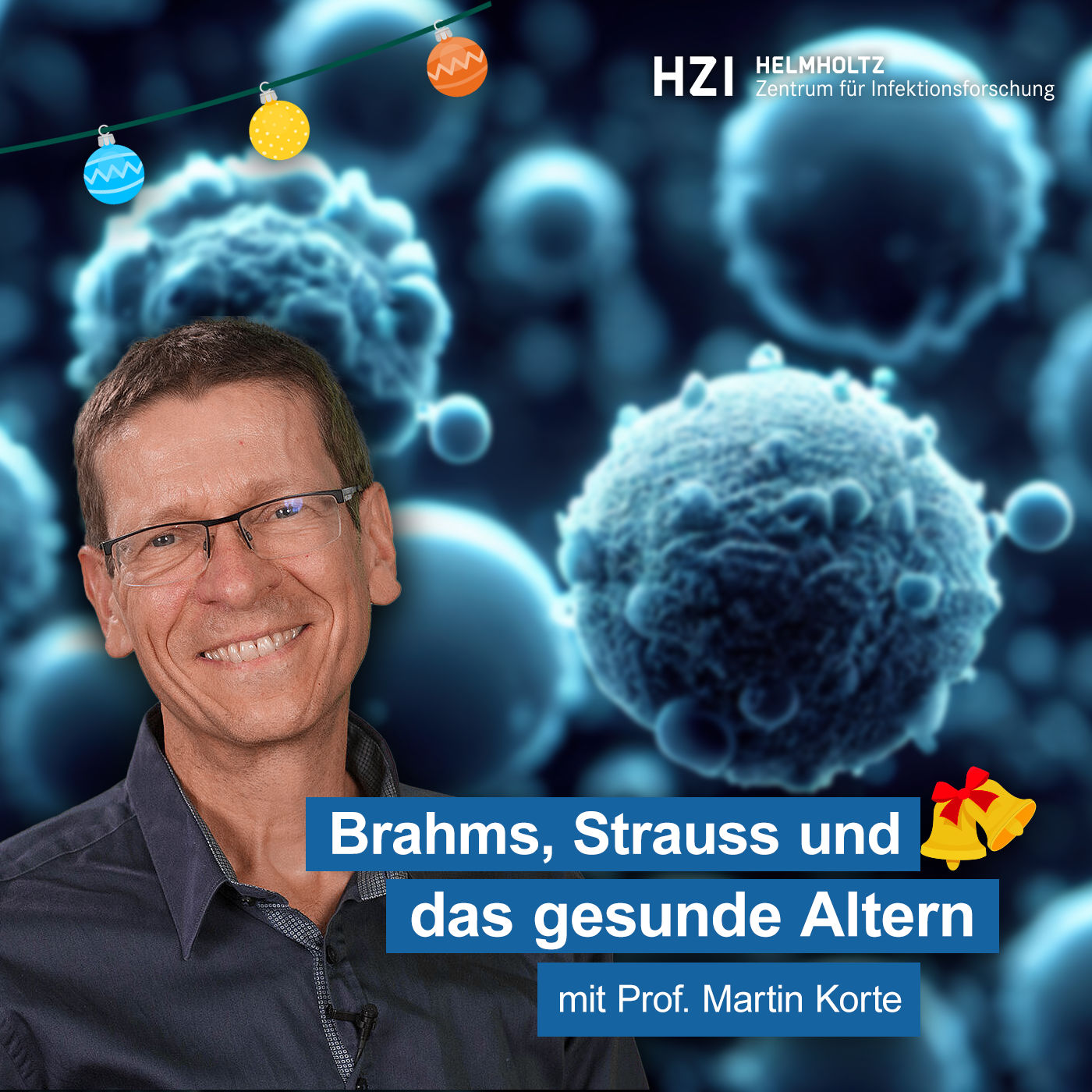
Beethoven und Hepatitis B: Eine Medizinische Spurensuche
"Mit der Veranstaltung "Sounds und Science – Musik und Infektionen" tragen wir die Wissenschaft des HZI aus dem Elfenbeinturm und verknüpfen sie mit Musik, um komplexe wissenschaftliche Themen einem breiten Publikum zugänglich zu machen", erklärt Prof. Josef Penninger, Wissenschaftlicher Geschäftsführer des HZI und Initiator der Idee, die Wiener Musiker nach Braunschweig zu holen. „Kunst und Wissenschaft teilen die Prinzipien von Kreativität und Originalität. Dieses Format bietet eine einzigartige Möglichkeit, wissenschaftliche Erkenntnisse sowohl emotional als auch intellektuell zu vermitteln. Es hat sich bereits in Wien und Vancouver bewährt und bietet dem Publikum ein tiefgehendes und bewegendes Erlebnis, das Forschung und Musik vereint“, so Penninger weiter. „Unser besonderer Dank gilt dem Förderverein des HZI, der die Verwirklichung dieses außergewöhnlichen Projekts möglich gemacht hat.“ MODERATION 1. Andreas Pietschmann (Schauspieler und Sprecher) STREICHQUARTETT: 2. Rainer Honeck (Violine) 3. Rémy Ballot (Violine) 4. Hans Peter Ochsenhofer (Viola) 5. Manfred Hecking (Kontrabass) WISSENSCHAFTLER:INNEN: 6. Prof. Kathrin de la Rosa 7. Prof. Melanie Brinkmann 8. Prof. Thomas Pietschmann 9. Prof. Josef Penninger 10. Prof. Martin Korte Mehr zum Thema Forschung am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung findet ihr im Netz unter: https://www.helmholtz-hzi.de/de/ Arbeiten und Forschen am HZI: https://www.helmholtz-hzi.de/de/karriere/ Wer mehr zum Thema Keime, Antibiotikaresistenzen oder Erkrankungen, die durch Viren und Bakterien verursacht werden lernen will, der kann sich in unserem Wissensportal informieren: https://www.helmholtz-hzi.de/wissen/wissensportal/
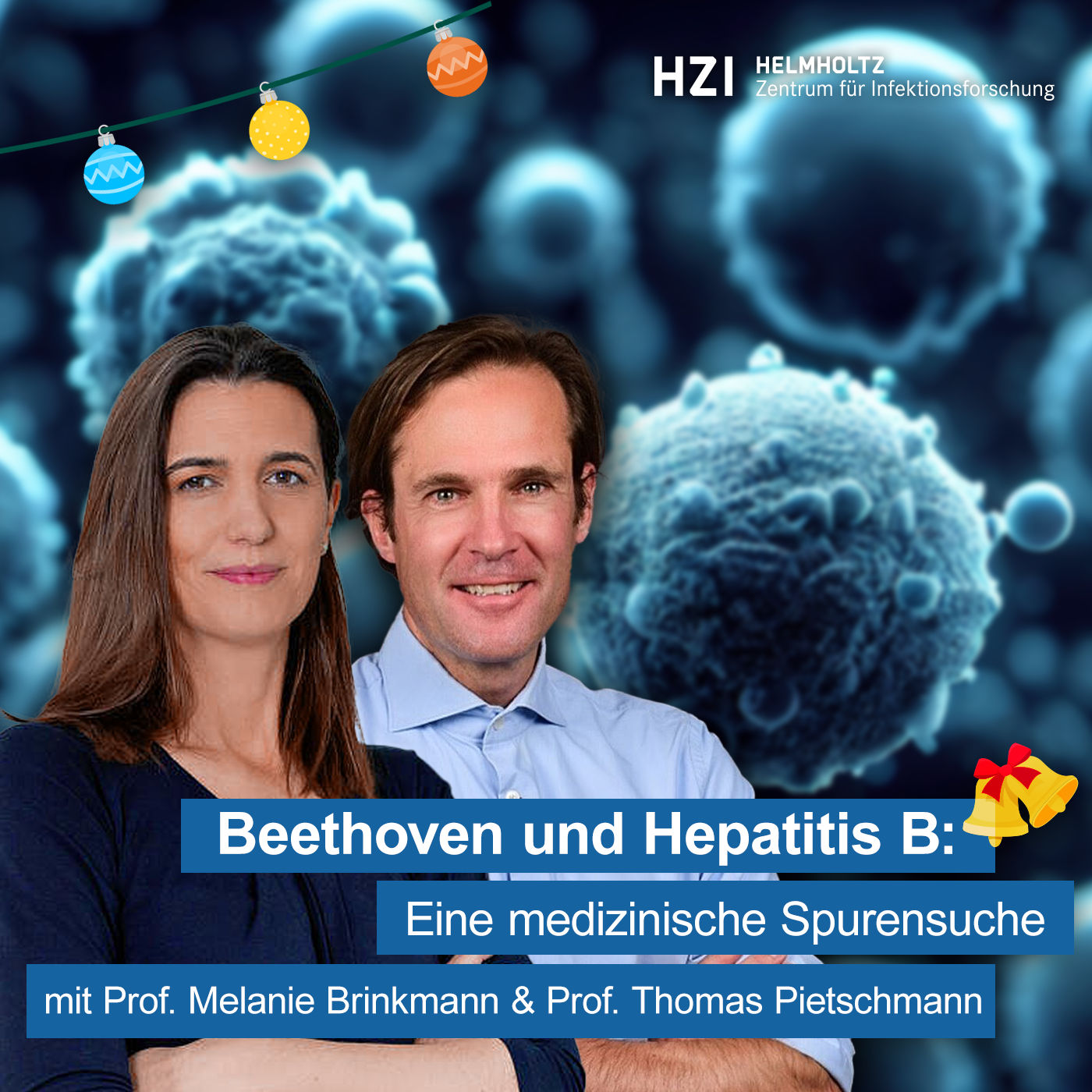
Schubert, Mozart und das Mysterium des Immunsystems
"Mit der Veranstaltung "Sounds und Science – Musik und Infektionen" tragen wir die Wissenschaft des HZI aus dem Elfenbeinturm und verknüpfen sie mit Musik, um komplexe wissenschaftliche Themen einem breiten Publikum zugänglich zu machen", erklärt Prof. Josef Penninger, Wissenschaftlicher Geschäftsführer des HZI und Initiator der Idee, die Wiener Musiker nach Braunschweig zu holen. „Kunst und Wissenschaft teilen die Prinzipien von Kreativität und Originalität. Dieses Format bietet eine einzigartige Möglichkeit, wissenschaftliche Erkenntnisse sowohl emotional als auch intellektuell zu vermitteln. Es hat sich bereits in Wien und Vancouver bewährt und bietet dem Publikum ein tiefgehendes und bewegendes Erlebnis, das Forschung und Musik vereint“, so Penninger weiter. „Unser besonderer Dank gilt dem Förderverein des HZI, der die Verwirklichung dieses außergewöhnlichen Projekts möglich gemacht hat.“ MODERATION 1. Andreas Pietschmann (Schauspieler und Sprecher) STREICHQUARTETT: 2. Rainer Honeck (Violine) 3. Rémy Ballot (Violine) 4. Hans Peter Ochsenhofer (Viola) 5. Manfred Hecking (Kontrabass) WISSENSCHAFTLER:INNEN: 6. Prof. Kathrin de la Rosa 7. Prof. Melanie Brinkmann 8. Prof. Thomas Pietschmann 9. Prof. Josef Penninger 10. Prof. Martin Korte Mehr zum Thema Forschung am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung findet ihr im Netz unter: https://www.helmholtz-hzi.de/de/ Arbeiten und Forschen am HZI: https://www.helmholtz-hzi.de/de/karriere/ Wer mehr zum Thema Keime, Antibiotikaresistenzen oder Erkrankungen, die durch Viren und Bakterien verursacht werden lernen will, der kann sich in unserem Wissensportal informieren: https://www.helmholtz-hzi.de/wissen/wissensportal/

Our immune system in the fight against diseases
Oh, but the opponent is getting dangerously close to goal. Now it's time for the defence to show what it's made of. Exciting duel here. And... Ah, that was really close. Great performance here. Really.... Phew. The defence of the football team (maybe Braunschweig too?) just managed to prevent a goal. And thus helped the team to victory. Points. Money. Maybe a championship title? We may not get a championship title or money, but it does feel like a victory when our immune system successfully fights off a pathogen. It does this every day. Often without us realising it. But sometimes we do notice it. For example, in the form of cold symptoms, swollen lymph nodes, thick tonsils, fever or a red, swollen area. Then our body's own defence system, our immune system, is working at full speed. And this is only the case with harmless pathogens. Some pathogens are not so harmless. And some people's defences don't work so well either. Then it's a matter of life and death. Our body is constantly exposed to new challenges - environmental changes and new pathogens. Our immune system can receive help against some of these - in the form of vaccinations or other medicines that can support our immune system in the fight against certain pathogens. However, there is still no help against some pathogens. Depending on WHO gets WHICH pathogen, it's a game of chance. Prof Kathrin de la Rosa wants to be one step ahead of the pathogens. She wants to be able to improve individual defence mechanisms in people whose immune system cannot cope with the pathogen on its own. And she is copying tricks from nature. Since 2024, she has headed the ‘Personalised Immunotherapy’ research group at the Centre for Individualised Infection Medicine - a joint institution of Hannover Medical School and the HZI.

Auswärtssieg: Unser Immunsystem im Wettkampf gegen Krankheiten
Oh da kommt der Gegner aber gefährlich nah Richtung Tor. Jetzt gilt’s: die Abwehr muss zeigen, was sie drauf hat. Spannender Zweikampf hier. Und…Ah das war aber gerade wirklich knapp. Tolle Leistung hier. Echt…. Puh. Da hat die Abwehr der Fußballmannschaft (vllt. auch von Braunschweig?) gerade noch so ein Tor verhindert. Und damit der Mannschaft zum Sieg verholfen. Punkte. Geld. Vielleicht ein Meistertitel? Nen Meistertitel oder Geld bekommen wir zwar nicht, aber wie ein Sieg ist es schon, wenn unser Immunsystem sich erfolgreich gegen einen Krankheitserreger wert. Das tut es tagtäglich. Oft ohne dass wir das merken. Manchmal merken wir es aber auch. Z. B. an Erkältungssymptomen, geschwollenen Lymphknoten, dicken Mandeln, Fieber oder einer roten, geschwollenen Stelle. Dann arbeitet unsere körpereigene Abwehr, unser Immunsystem auf Hochtouren. Und das ist nur bei harmlosen Erregern der Fall. Manche Erreger sind nicht so harmlos. Und bei manchen Menschen funktioniert die Abwehr auch nicht so gut. Dann geht es um Leben und Tod. Unser Körper ist immer wieder neuen Herausforderungen ausgesetzt –Umweltveränderungen und neuen Krankheitserregern. Gegen manche kann unser Immunsystem Hilfe bekommen – in Form von Impfungen oder anderen Medikamenten, die unser Immunsystem im Kampf gegen bestimmte Erreger unterstützen können. Gegen manche Erreger gibt’s aber noch keine Hilfe. Je nachdem WER WELCHEN Erreger abbekommt, ist es ein Glücksspiel. Prof. Kathrin de la Rosa möchte den Erregern einen Schritt voraus sein. Abwehrmechanismen individuell bei Menschen verbessern können, deren Immunsystem alleine nicht mit dem Erreger klarkommt. Und dabei guckt sie sich Tricks in der Natur ab. Sie leitet seit 2024 die Forschungsgruppe „Personalisierte Immuntherapie“ am Zentrum für Individualisierte Infektionsmedizin – einer gemeinsamen Einrichtung der Medizinischen Hochschule Hannover und dem HZI.

Pathogen Evolution
A virus that is transmitted from birds to cattle on another continent. Then: the first human was infected with this virus. How did that happen? The virus has evolved. Adapted. To a different host. And the evolution continues. Suddenly, people are no longer infecting animals, but: each other? It sounds like an apocalyptic scenario, but we have all experienced how real this scenario can suddenly become. And a few years later, life is back to normal. Just with one more virus that can make us ill. This can and will happen again and again, but in order for us to be prepared and NOT have an apocalypse, we need to know as much as possible about which viruses are on the move and how they are changing. And this is what Professor Sébastien Calvignac-Spencer is doing at the Helmholtz Institute for One Health in Greifswald. He not only looks at the pathogens, but also at how changes in the environment and nature - including those caused by us - influence how pathogens have developed in the past. Sébastien Calvignac-Spencer heads the ‘Evolution of Pathogens’ working group and uses genetic changes to retrospectively analyse what could have caused this change. This allows valuable conclusions to be drawn about how today's pathogens could develop. I will now be talking to Sébastien Calvignac-Spencer about how predictions can be made from this and what they are.

Evolution von Krankheitserregern
Erst noch weit weg: Ein Virus, das auf einem anderen Kontinent von Vögeln auf Rinder übertragen wird. Dann: der erste Mensch hat sich mit diesem Virus infiziert. Wie konnte das passieren? Das Virus hat sich entwickelt. Angepasst. An einen anderen Wirt. Und die Entwicklung geht weiter. Plötzlich stecken sich bald Menschen nicht mehr an Tieren an, sondern: sich gegenseitig?. Es klingt wie ein apokalyptisches Szenario, aber wir haben alle erlebt, wie real dieses Szenario auf einmal werden kann. Und ein paar Jahre später ist das Leben wieder normal. Nur mit einem Virus mehr, dass uns krank machen kann. Das kann und wird immer wieder passieren, aber damit wir darauf vorbereitet sind und KEINE Apokalypse bekommen, müssen wir so gut wie möglich Bescheid wissen, welche Viren unterwegs sind und wie sie sich verändern. Und das macht Professor Sébastien Calvignac-Spencer am Helmholtz-Institut für One Health in Greifswald. Hier wird nicht nur auf die Krankheitserreger geguckt, sondern auch wie Veränderungen der Umwelt, der Natur – auch von uns hervorgerufen – beeinflussen, wie sich Krankheitserreger in der Vergangenheit entwickelt haben. Sébastien Calvignac-Spencer leitet die Arbeitsgruppe „Evolution von Krankheitserregern“ und untersucht anhand genetischer Veränderungen Rrückwirkend, was diese Veränderung verursacht haben könnte. Daraus lassen sich nämlich wertvolle Schlüsse ziehen, wie sich heutige Krankheitserreger weiterentwickeln könnten. Wie man daraus Vorhersagen treffen kann und welche das sind – darüber spreche ich unter anderem jetzt mit Sébastien Calvignac-Spencer.

Unser Mikrobiom und wie es uns gesund erhält
Verdauungsprobleme nehmen zu – mittlerweile ist jede 2.bis 3. erwachsene Person betroffen. Und die hängen DIREKT mit unserer modernen Lebensweise zusammen: Was uns das Leben leichter macht, macht unseren Körper kaputt: Fast Food, sitzen im Job – im Auto – auf der Couch, die Notwendigkeit, sich zu bewegen, nimmt immer mehr ab. Alles kann man sich nach Hause liefern lassen – selbst den Wocheneinkauf. Und wenn dann doch mal etwas zwickt und zwackt: Ja dann müssen wir vielleicht doch mal unseren Hintern zum Arzt bewegen. Und da gibt’s dann oft: Medikamente, z. B. Antibiotika. Und all das schadet unseren winzig kleinen Mitbewohnern. Denn wir sind ja nicht allein in unserem Körper: Die riesige Mikroorganismen WG in unserem Darm hält uns gesund. Und wenn da der Haussegen schief hängt, werden wir krank. Und nicht nur so ein bisschen: Für krankhaftes Übergewicht, Diabetes, entzündliche Darmerkrankungen und sogar Depressionen oder Krebs könnten Störungen unseres Mikrobioms der Auslöser sein. Das weiß Dr. Lisa Osbelt-Block. Sie forscht an HZI in der Forschungsgruppe „Mikrobielle Immunregulation“ unter der Leitung von Prof. Till Strowig und ist fasziniert von unseren kleinen Mitbewohnern. Wir sprechen heute darüber, wie unser Mikrobiom unseren Körper gesund hält und was passiert, wenn es nicht in Ordnung ist. Außerdem über die aktuelle Forschung zum Mikrobiom und darüber wie man die Erkenntnisse bei der Behandlung von Krankheiten nutzen kann. Und: heute gibt’s auch ein bisschen Service: nämlich was jeder und jede von uns selbst tun kann oder lassen sollte, um unser Mikrobiom fit und damit uns gesund zu halten.

Our microbiome and how it keeps us healthy
Digestive problems are on the rise - every 2nd to 3rd adult is now affected. And they are DIRECTLY linked to our modern way of life: What makes life easier for us is ruining our bodies: fast food, sitting at work - in the car - on the couch, the need to exercise is decreasing more and more. You can have everything delivered to your home - even the weekly shop. And if something does pinch and tweak, then perhaps we need to take our bums to the doctor. And then there's often: medication, e.g. antibiotics. And all of this harms our tiny little flatmates. After all, we are not alone in our bodies: the huge community of microorganisms in our gut keeps us healthy. And when things go wrong, we get sick. And not just a little: Disorders of our microbiome could be the trigger for morbid obesity, diabetes, inflammatory bowel diseases and even depression or cancer. Dr Lisa Osbelt-Block knows this. She conducts research at the HZI in the ‘Microbial Immune Regulation’ research group headed by Prof Till Strowig and is fascinated by our little fellow inhabitants. Today we are talking about how our microbiome keeps our body healthy and what happens when it is not in order. We also talk about current research into the microbiome and how the findings can be used to treat diseases. And: today there's also a bit of service: namely what each and every one of us can or should not do to keep our microbiome fit and thus ourselves healthy. Transparency notice: The podcast contains AI-generated audio material.

Vaccines against viruses - protection against diseases
Depending on where you are travelling, different viruses are on the move, some of which can cause life-threatening illnesses. Either through contaminated water or food or through insects that can transmit them when bitten. They can spread all over the world due to climate change, travelling and global transport chains. We have all experienced what this can mean in recent years. What can help: Vaccines and other medicines that help our immune system to fight off these pathogens. Finding them is not so easy. For Professor Thomas Pietschmann, head of the Institute of Experimental Virology at TWINCORE and spokesperson for the "Infection Research" research programme at the HZI, this means: challenge accepted! The conversation is about viruses, how important vaccines are, how difficult the search for them is and how important interdisciplinarity is here. Transparency notice: The podcast contains AI-generated audio material.

Impfstoffe gegen Viren – Schutz vor Erkrankungen
Je nachdem, wohin man reist, sind unterschiedliche Viren unterwegs, die zum Teil lebensbedrohliche Erkrankungen auslösen können. Entweder durch verunreinigtes Wasser oder Lebensmittel oder durch Insekten, die sie bei einem Stich übertragen können. Durch den Klimawandel, durch das Reisen und globale Transportketten können sie sich in der ganzen Welt verbreiten. Was das bedeuten kann, haben wir alle in den letzten Jahren schon mal erlebt. Was dagegen hilft: Impfstoffe und andere Medikamente, die unserem Immunsystem helfen, diese Erreger abzuwehren. Die zu finden, ist gar nicht so leicht. Für Professor Thomas Pietschmann, dem Leiter des Instituts für experimentelle Virologie am TWINCORE und Sprecher des Forschungsprogramms „Infektionsforschung“ am HZI heißt das: Challenge accepted! Im Gespräch geht es um Viren, darüber, wie wichtig Impfstoffe sind und wie schwierig die Suche danach ist und wie wichtig hier Interdisziplinarität ist.

Anti-infektive Naturstoffe
Die Abteilung „Antiinfectiva aus Microbiota“ von Prof. Christine Beemelmanns fokussiert sich auf die Identifizierung und funktionelle Analyse von neuartigen anti-infektiven Naturstoffen aus mikrobiellen Gemeinschaften. Ko-Kultivierungsstudien sowie zellbasierte Assays in Kombination mit chemisch-analytischen und molekularbiologischen Methoden werden zur Evaluierung neuer mikrobieller Naturstoff-Produzenten verwendet. Zur Strukturaufklärung der sekretierten Naturstoffe wendet die Gruppe etablierte und innovative metabolomische, aktivitäts- und genomgeleitete Methoden an. Basierend auf den isolierten Naturstoffen erfolgt die funktionale Analyse und Evaluierung ihres Wirkspektrums. Die Abteilung hat ihren Sitz am Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS) in Saarbrücken, einem Standort des HZI in Kooperation mit der Universität des Saarlandes. Die Verbreitung von Antibiotika-resistenten humanpathogenen Bakterien ist eine zunehmende Bedrohung für die menschliche Gesundheit. Daher sind die Entwicklung neuer Anti-Infektiva sowie ein verbessertes Verständnis ihrer Funktion und Wirkungsweise dringend notwendig. Eine vielversprechende Quelle für neue Wirkstoffe sind Mikroorganismen. Mikrobielle Gemeinschaften (Mikrobiota / Mikrobiom) setzen sich aus einer Vielzahl verschiedener Bakterien, Pilze und Vertreter ein- und wenigzelliger Eukaryoten sowie Viren, zusammen. Diese Gemeinschaften befinden sich unter anderem auf menschlichen, tierischen und pflanzlichen Gewebeoberflächen, wo sie essenzielle Funktionen für den Wirt einnehmen können. Die Zusammensetzung der Mikrobiota korreliert in vielen Fällen mit ihrer Lokalisation und damit ihrer Funktion. Mikroorganismen regulieren und manipulieren ihr Zusammenleben durch die Aussendung von bioaktiven Naturstoffen. Mikrobielle Naturstoffe können antibiotisch wirken, um die Produzenten zu schützen, können aber auch als zelluläres Signal wirken, als Morphogen für den Wirtsorganismus oder als Nährstoff verstoffwechselt werden. Die chemischen Strukturen vieler dieser Naturstoffe sind jedoch unbekannt, und damit sind ihre natürliche Funktion sowie ihr Einfluss auf die Mikrobiota und mögliche Anwendungspotenziale bis heute nur sehr wenig erschlossen. Da Naturstoffe wichtige Funktionen in mikrobiellen Interaktionen spielen, ist ihre Produktion eng mit der Zusammensetzung der Mikrobiota verknüpft. Die Beemelmanns-Gruppe analysiert repräsentative mikrobielle Gemeinschaften, um diesen chemischen Raum zu erschließen.

Anti-infective natural substances
The department "Anti-infectives from Microbiota" of Prof Christine Beemelmanns focuses on the identification and functional analysis of novel anti-infective natural products from microbial communities. Co-cultivation studies and cell-based assays in combination with chemical-analytical and molecular biological methods are used to evaluate new microbial natural product producers. The group uses established and innovative metabolomic, activity- and genome-guided methods to elucidate the structure of the secreted natural products. Based on the isolated natural products, the functional analysis and evaluation of their spectrum of activity is carried out. The department is based at the Helmholtz Institute for Pharmaceutical Research Saarland (HIPS) in Saarbrücken, a site of the HZI in co-operation with Saarland University. The spread of antibiotic-resistant human pathogenic bacteria is an increasing threat to human health. The development of new anti-infectives and a better understanding of their function and mode of action are therefore urgently needed. Microorganisms are a promising source of new active substances. Microbial communities (microbiota / microbiome) are made up of a large number of different bacteria, fungi and representatives of unicellular and few-celled eukaryotes as well as viruses. These communities are found on human, animal and plant tissue surfaces, among others, where they can fulfil essential functions for the host. In many cases, the composition of the microbiota correlates with its localisation and thus its function. Microorganisms regulate and manipulate their coexistence by emitting bioactive natural substances. Microbial natural products can have an antibiotic effect to protect the producers, but can also act as a cellular signal, as a morphogen for the host organism or be metabolised as a nutrient. However, the chemical structures of many of these natural substances are unknown, which means that their natural function, their influence on the microbiota and their potential applications are still poorly understood. As natural products play important roles in microbial interactions, their production is closely linked to the composition of the microbiota. The Beemelmanns group analyses representative microbial communities to explore this chemical space. Transparency notice: The podcast contains AI-generated audio material.

Pandemic Resilience – The next pandemic is coming
Do you remember the winter of 2022? The paediatric intensive care units were full of babies and small children who could barely breathe. This was because the measures taken to combat the coronavirus pandemic in the two previous winters meant that many children had not yet had their first RSV infection. As a result, there were many children who were suddenly ill and therefore more than usual who were seriously ill. The respiratory syncytial virus is particularly bad for babies under 3 months of age. This is because it can lead to severe pneumonia - and sometimes life-long consequential damage remains. An example of how quickly pathogens can spread. And this is precisely the area of expertise of Dr Berit Lange - the (acting) head of the Department of Epidemiology and head of the Clinical Epidemiology research group here at the HZI.

Pandemic Resilience – Nach der Pandemie ist vor der Pandemie
Erinnert ihr euch noch an den Winter 2022? Die Kinder-Intensivstationen waren voll von Babies und kleinen Kindern, die kaum Luft bekamen. Denn durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in den zwei Wintern davor, hatten viele Kinder noch nicht ihre erste RSV-Infektion durchgemacht. Deshalb gab es viele Kinder, die auf einmal krank waren und damit auch mehr als sonst, die schwer krank waren. Für Säuglinge unter 3 Monaten ist das Respiratorische Synzytialvirus besonders schlimm. Denn es kann zu schweren Lungenentzündungen führen – und manchmal bleiben lebenslange Folgeschäden. Ein Beispiel dafür, wie schnell sich Erreger ausbreiten können. Und genau das ist das Spezialgebiet von Dr. Berit Lange – der (kommissarischen) Leiterin der Abteilung Epidemiologie und Leiterin der Forschungsgruppe klinische Epidemiologie hier am HZI.

New antibiotics - The fight against resistance
Multi-resistant bacteria live on the skin of some of us. When we are young, healthy and fit, there is o reason to worry. But it can happen to all of us that we suddenly become sick, our immune system is weakened or we are seriously injured and must go into hospital. When multi-resistant bacteria invade our bodies, it can be life-threatening. And the problem is getting worse. Mark Brönstrup is a professor of chemical biology at the HZI and is researching substances to combat antibiotic resistance.

Neue Antibiotika und Wirkstoffe – Der Kampf gegen die Resistenzen
Multiresistente Keime leben bei manchen von uns auf der Haut. Wenn wir jung, gesund und fit sind: Kein Grund zur Sorge. Aber uns allen kann es passieren, dass wir plötzlich krank werden, unser Immunsystem geschwächt ist oder wir uns schwer verletzen und ins Krankenhaus müssen. Wenn dann so multiresistente Bakterien in unseren Körper eindringen, droht Lebensgefahr. Denn über normale Antibiotika lachen die nur müde. Und dieses Problem wird immer größer. Deshalb müssen wir Mittel und Wege finden, bei denen Bakterien das Lachen vergeht! So ähnlich hat sich das auch Mark Brönstrup gedacht. Er ist Professor für chemische Biologie und forscht am HZI an Stoffen, um Antibiotika-Resistenzen zu begegnen.

Our teachers: What is there to learn from microbes and bacteria.
How do bacteria and viruses cause diseases? How does our immune system defend itself against them? And what must active substances be able to do to fight dangerous infections? The Helmholtz Centre for Infection Research - HZI for short - is looking for answers to these questions. How this research works, how the results are used in medicine and who the people are who do the research here. You can listen to it here: At InFact - the podcast of the Helmholtz Centre for Infection Research.

Unsere Lehrer - Viren und Bakterien
Stellt euch mal vor, ihr guckt durchs Mikroskop und seht ein Bakterium etwas auf eine Tafel kritzeln…Es dreht sich um und guckt euch an. Wie in der Schule früher: Die Lehrerin schreibt ne hochkomplexe, verwirrende mathematische Formel an die Tafel – und ihr sollt sie jetzt lösen. Mist! Hättet ihr doch mal in der letzten Stunde besser aufgepasst. Na? Welche Erinnerungen weckt das in euch? Bakterien und Viren brauchen keine Tafel, damit wir uns schlecht fühlen. Dass wir eher Negatives mit ihnen verknüpfen, liegt vielleicht daran, dass wir sie in der Regel erst bemerken, wenn sie uns Probleme machen. Dabei geht’s uns ohne sie auch nicht gut. Sie gehören einfach zu unserem Leben dazu, auch wenn wir sie mit bloßem Auge nicht sehen können. Und – auch ohne Tafel können sie uns ne ganze Menge beibringen: wie sie funktionieren, wie sie auf uns wirken, was wir GEGEN sie, aber auch MIT ihnen tun können. Wie man von Bakterien und Viren am besten lernt, das weiß Josef Penninger, der österreichische Professor für Genetik und Molekularbiologie. Mit der Begeisterung eines kleinen Jungen hat der Top-Forscher mit Leib und Seele – auch nach etlichen Preisen, Ehrungen und weltweiten, jahrzehntelangen Erfahrungen in Spitzenpositionen - noch Visionen: Nämlich: Die Infektionsforschung neu erfinden. Und wo? In Braunschweig. Am Helmholzzentrum für Infektionsforschung – kurz: HZI, einem der wichtigsten außeruniversitären Forschungszentren im Deutschlands – und vielleicht bald der Welt? Mit Josef Penninger spreche ich heute – darüber, was sich in der Infektionsforschung verändern muss, um gegen neue gesundheitliche Herausforderungen gewappnet zu sein, die der Klimawandel, die Globalisierung und auch der medizinische Fortschritt mit sich bringen. Außerdem sprechen wir über Professor Penningers neuen Job! Nämlich die Leitung des HZI, über völlig neue Wege, die er mit dem HZI gehen will und: darüber, ob man als wissenschaftlicher Leiter eines Forschungszentrums eigentlich noch sowas wie Hobbies haben kann.




































